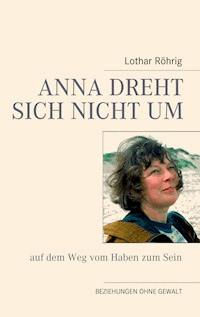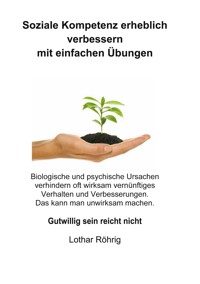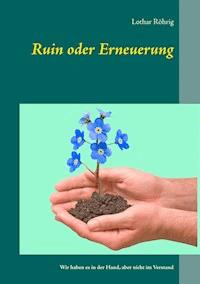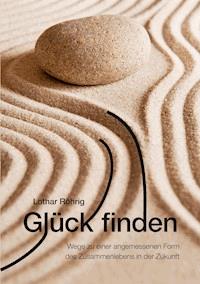
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie bleiben wir frei und unabhängig, obwohl wir in einer Gemeinschaft leben und Rücksicht nehmen müssen? Wie können wir dieses Zusammenleben, unsere Beziehungen, unsere Familien- und Arbeitsverhältnisse so gestalten, dass wir uns damit wohlfühlen? Was tun wir, wenn der Alltag die Schritte in Richtung mehr Wohlergehen immer wieder schluckt, behindert und aufzehrt? Jeder, der auf der Suche nach persönlichem Glück ist, stellt sich diese Fragen. In diesem Buch werden sie beantwortet. Lothar Röhrig zeigt Wege auf, die Schritt für Schritt zu mehr Zufriedenheit führen, und verschweigt dabei nicht, wie viel Disziplin dafür vonnöten ist. Seine Ausführungen zeigen, wie wichtig es ist, seine Umgebung wirklich zu sehen und kennenzulernen und wie sich durch dieses »Sehen« ungeahnte Chancen auftun.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lothar Röhrig, 1946 in Hamm geboren, machte eine Lehre als Buchdrucker, studierte Verwaltungsrecht und später Psychologie. 1996 promovierte er an der Universität Essen. Er absolvierte zahlreiche Ausbildungen, unter anderem in den Bereichen Verhaltenstraining, Konflikt- und Problemmanagement, Stressbewältigung, Supervision Er arbeitete unter anderem als Psychologielehrer, Trainer, QMA, QMB, Supervisor, Dozent, Mediator, Coach und Therapeut. Seit 1994 war er als Qualitätsmanager bei der Polizei Nordrhein-Westfalen tätig. Zurzeit arbeitet er als Berater, Therapeut, Mediator und Konfliktmanager.
Inhalt
Vorwort
Teil 1
Anna.
Expertengespräch
Teil 2
Was können wir von Theorien erwarten?
Was ist eine Gruppe und warum sollte ich das wissen?
Wie groß kann eine funktionierende Gruppe sein?
Welche Energien, welche Dynamik gibt es in Gruppen?
Probleme entstehen durch Führung
Teil 3
Wie funktioniert das alles?
Soziale Strukturen sind hierarchisch aufgebaut
Teil 4
Was veranlasst Menschen, sich primitiv zu verhalten?
Psychischer Druck durch Führung
Persönliche regressionsbegünstigende Merkmale
Regressionsverstärkung durch die Gruppe
Psychischer Druck als Folge momentaner Ereignisse
Teil 5
Was kann ich tun? Lösungsmöglichkeiten?
Wege auf verschiedenen Ebenen
Der fruchtbringende Moment für persönliches Wachstum
Führung im neuen Licht.
Zukunftsaussichten und Lösungsmöglichkeiten
Vorwort
Man kann nur das »sehen«, was man kennt. Das gilt nicht nur für Dinge, die gegenständlich sind und wahrgenommen werden, sondern auch für zunächst Unsichtbares wie Gefühle, Stimmungen, Betriebsklima. Erst wenn wir damit Erfahrungen gemacht haben, sehen und erkennen wir es an vielen kleinen Indizien und Äußerungsformen. Man kann deshalb nur das wahrnehmen, wiedererkennen und bewusst zur Kenntnis nehmen und vor allem bearbeiten, was wir »kennengelernt« haben. Zusätzlich gibt es nach diesem Schritt des Kennenlernens dann auch die Möglichkeit eines Vergleichs. Wer nie eine erfüllende und wirklich harmonische Beziehung »kennengelernt« hat, kann das auch nicht mit anderen eigenen oder fremden Beziehungen vergleichen. Ihm fehlt das entscheidende »Bild«. Das Gleiche gilt auch für gesellschaftliche Bilder. Wie könnte eine menschengerechte Gesellschaft ohne unnötige Gewalt aussehen? Zur Verfügung stehen nur die Erfahrungen, die in unserem Leben vorgekommen und zur »Kenntnis« genommen worden sind. Ausgeschlossen sind damit möglicherweise viele »bessere« Möglichkeiten, nur weil wir sie nicht kennen oder noch nicht kennengelernt haben.
Es gibt viele Ratgeber, die uns zeigen wollen, was wir noch nicht »kennen« oder bisher »übersehen« haben. Insofern leisten sie etwas Sinnvolles. Zum Beispiel: Wie werde ich glücklicher? Wie vermeide ich Stress? Wie kommuniziere ich wirksamer? Häufig jedoch wird der durchaus mögliche Erfolg nicht so realisiert, wie der Leser und der Autor sich das gedacht hatten. Mühe und Disziplin sind nämlich für einen Erfolg neben dem »Sehen und Erkennen« zusätzlich erforderlich. Erst wenn man etwas tut, ausprobiert und ändert, kann eine Veränderung eintreten. Leider reicht das häufig auch noch nicht aus. Die ersehnten kleinen Schritte und Erfolge werden vom Alltag geschluckt, behindert und wieder aufgezehrt. Schnell ist wieder alles, wie es vorher war. Das spricht deutlich dafür, dass die Alltagsbedingungen berücksichtigt werden sollten. Leider sind die aber extrem unterschiedlich und selbst wenn sie gleich oder ähnlich sein sollten, werden sie sehr individuell wahrgenommen und deshalb doch wieder irgendwie unterschiedlich sein. Eine unübersichtliche Vielzahl von Wirkzusammenhängen übt einen Einfluss aus. Allgemeine Ratschläge tun sich damit naturgemäß sehr schwer. Sie können solche Fragen deshalb nicht alle beantworten.
Was soll nun dieses Buch?
Zunächst sind auch hier viele Ratschläge und Verbesserungsvorschläge enthalten. Die haben ihren eigenen Nutzen. Es soll aber unbedingt Zusätzliches liefern.
Wie hängen Einzelheiten zusammen?
Folgt es Regeln und Gesetzen? Welchen?
Welche Verbindungen gibt es zu gesellschaftlichem Verhalten? Wie wirkt es auf mein persönliches Wohlfühlen? Welche Auswirkung hat das auf meine Beziehungen, meine Familie und meine Karriere? Was kann ich tun, wenn es Widerstände und Hindernisse gibt?
Solche Fragen werden in diesem Buch beantwortet und mit jedem »Sehen« und »Kennenlernen« werden Sie als Leser weitere Schritte und Wege für eine menschlichere Zukunft erkennen. Sie sehen und verstehen die Dinge um Sie herum besser, für Sie und andere werden völlig neue Wege möglich. Ungeahnte Chancen tauchen plötzlich auf und können genutzt werden. Eine menschengerechtere Gesellschaft wird möglich. Es geht darum:
Wie bleibt der Mensch frei und unabhängig, obwohl er in der Gemeinschaft leben und Rücksicht nehmen muss? Wie muss dieses Zusammenleben persönlich, wirtschaftlich, politisch ausgeprägt sein, um damit zufrieden und glücklich sein zu können? Welche Möglichkeiten gibt es hier und heute, so etwas umzusetzen?
Das muss ausreichend beantwortet sein, um Wachstum zu ermöglichen und um persönlich weiterzukommen. Wenn Sie es wollen, werden sich Ihre Beziehungen verbessern und die Voraussetzungen für ein menschlicheres Zusammenleben für sie erkenn- und erreichbar sein.
Wenn Sie schon Vieles gelesen haben, wird sich hier dieser Versuch trotzdem lohnen, weil er Neues enthält, was so noch nicht beschrieben wurde und einen guten Weg in die Zukunft zeigt. Wenn Sie auf Inhalte stoßen, die Sie kennen, können Sie diese überschlagen. Zusätzlich schlage ich vor, lesen Sie auch die Passagen, die für Sie theoretisch und möglicherweise deshalb weniger ansprechend sein könnten, sie haben eine Bedeutung für das »Gesamtbild« und das Verstehen. Der Nutzen stellt sich möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt ein. Sollte Ihnen der Inhalt zu kompliziert sein, so schlage ich vor, immer nur einen begrenzten Teil zu lesen und danach eine Pause von mindestens einem Tag einzuhalten. Ein Gesamtverständnis wird sich einstellen.
Viel Erfolg!
Teil 1
Anna
Die Natur hatte es gut gemeint. Die kleine Anna war gesund und für ihr Alter sehr aufgeweckt und intelligent. Sie hatte ein einnehmendes Wesen und war nach den herrschenden Ansichten ziemlich hübsch. Nachbarn und Freunde sparten nicht mit Lob und zustimmenden Bemerkungen. Die Eltern hatten allen Grund zufrieden zu sein. Sie mochten ihre Kleine und hatten viel Freude mit ihr, aber so völlig zufrieden waren sie nicht. »Sie hört schlecht«, meinten die Großeltern. In der Tat hatte Anna eine geschickte Art, Dinge zu überhören oder abzulenken und vor allem nicht zu folgen. Vorschläge zur Gestaltung der freien Zeit kamen bei ihr nicht an. Sie wollte alles selbst entscheiden. Lernspiele waren nach einmaligem Gebrauch uninteressant. Auch mit verlockenden Belohnungen war sie meist nicht zu beeindrucken. Den Eltern ging es wie vielen anderen in unserem Kulturkreis. Eigentlich waren sie stolz und irgendwie auch mehr oder weniger zufrieden, aber das eine oder andere hätte schon besser oder anders sein können. Im Vergleich mit anderen war das schon in Ordnung. Aber wer hat schon (in allen Betrachtungsrichtungen) genau die Kinder, die er haben will? Die Eltern fühlten sich stark mit ihrem Kind verbunden und liebten es innig. Das hielt sie aber nicht davon ab, die eine oder andere Verhaltensweise zu beklagen und sich Veränderungen zu wünschen. Es verging, wenn man es genau nimmt, beinahe kein Tag ohne irgendeine Ermahnung oder einen Appell, einen Versuch, etwas positiv zu verändern. »Erziehung muss ja schließlich auch sein!« Viele Dinge weiß ein Kind ja auch noch nicht. So war die Botschaft an Anna häufig:
»Tue dies nicht! Unterlasse jenes!« und irgendwie auch: »Du bist so nicht okay.« Anna bekam insgesamt gesehen sehr viel Aufmerksamkeit, Zuwendung und viele Angebote, es gab Lernspiele, einfache Musikinstrumente und vieles, was fördern konnte. Der Vater kaufte zum Beispiel einmal einen großen Lastkraftwagen mit Anhänger, der beinahe genau so groß war wie Anna. Er war selbst extrem begeistert von dem Spielzeug. Versuchte einige Male mit ihr zu spielen und Freude daran zu gewinnen. Früher, zu seiner Kinderzeit, hatte es so etwas Tolles nicht gegeben. So etwas hätte er früher auch gern besessen. Anna aber war gleichmäßig lieb und wenig interessiert. Ein anderes Mal wurde ein Cat-Car gekauft. Der Vater musste sogar den Sitzabstand extra verkürzen, weil Anna noch zu »kurz« war. Mit einer Bohrmaschine mussten einige Löcher neu gebohrt werden. Anna ließ sich nicht von der väterlichen Begeisterung anstecken. Ihr war das alles nicht so wichtig. Andererseits beschäftigte sie sich mit vielen Dingen ohne jede Anleitung. Sie malte und bastelte und war eigentlich sehr zufrieden. Dinge des täglichen Gebrauchs wurden zu allen möglichen Fantasieobjekten umfunktioniert. Zusammengeknüllte Stoffstücke wurden Tiere, Haushaltsgegenstände Autos oder Puppenwagen. Die merkwürdigsten Dinge mussten Vater oder Mutter sein. Modernes Spielzeug, insbesondere solches mit Batterien, wurde zunächst neugierig erkundet, aber schon bald mit Gleichgültigkeit und Desinteresse betrachtet. Vater hatte es schon aufgegeben, »geschlechtsneutrales« Spielzeug anzuschleppen, das funktionierte nicht. An Stelle des Spielzeugs kamen neue Angebote: Musikschule und andere Förderbereiche. Zwänge, wie dieser regelmäßige Besuch einer Musikschule, waren gar nichts für Anna. Anfänglich stand zwar eine neugierige Lust, aber schon die ersten Ermahnungen zu üben und die einengende Planung der nächsten Schulbesuche vermiesten ihr die Freude derart, dass auch das Instrument, eine bis dahin liebevoll behandelte Flöte, uninteressant wurde. Das alles verunsicherte die Mutter sehr und löste das ein oder andere Mal auch Ärger aus. Dem Vater war das mittlerweile egal, was den Konflikt belastender machte.
„Lass sie doch, Hauptsache sie beschäftigt sich. Ist doch alles in der Ordnung“. Anna schaffte es wie immer, sich viele Stunden allein zu beschäftigen. Mit anderen zu spielen war ihr auch eine große Freude, aber danach musste sie wieder allein sein. Die Mutter kam das ein und andere Mal ins Grübeln, stellte sich und auch anderen so manche Frage zu diesem Thema, ohne jedoch eine vernünftige Antwort zu bekommen. Die Angesprochenen waren allerdings auch nicht ernsthaft interessiert.
„Sei doch froh!“, sagten die meisten, »Meine nerven entsetzlich. « Sie war aber nicht froh. Sie machte sich Sorgen, vielleicht auch nur deshalb, weil das ihr erstes Kind war. Da ist bei den meisten Eltern alles viel wichtiger und deutlicher. Anna bekam natürlich das alles nicht mit. Sie spielte und war zufrieden. Zeitweilig vergaß es die Mutter, dem Vater war das sowieso nur weibliche Überempfindlichkeit. Sie wuchs und gedieh prächtig. Nur die Phasen des Alleinseins und die Zeiten, die sie mit anderen verbrachte, wurden intensiver und verlängerten sich. Es konnte durchaus sein, dass sie zwei Tage keinen Kontakt haben wollte, um dann mit Freude und vollem Genuss wieder mit anderen zu spielen und das tat sie durchaus für eine längere Zeit. Danach kam in der Regel jedoch wieder eine Zeit des Alleinseins. So wurde sie älter und die Mutter spürte die Besonderheit gar nicht mehr so deutlich. So richtig schlimm war es ja auch nicht, nur komisch. In der Schule lief alles zum Besten. Trotzdem appellierte sie zwischendurch immer noch halbherzig und total vergebens: »Anna, geh doch mal raus. « »Komm doch in den Garten, du bist ja ganz blass!« »Was macht eigentlich Ute?«
Aber Anna ruhte in sich und wusste anscheinend genau, wann sie allein sein wollte und wann sie mit Anderen Kontakt brauchte. Trotzdem machte sich die Mutter Sorgen um die Gesundheit. »War das normal?« Einmal verlor die Mutter nach vergeblichen Versuchen die Geduld und trieb ihre Tochter mit lautem Schimpfen nach draußen zu den anderen Kindern. »Du gehst jetzt nach draußen an die frische Luft, geh jetzt spielen. « Irritiert von dem ungewohnten Ausbruch der Mutter ging Anna verunsichert durch den Garten auf die Straße und blieb dort stehen. In einiger Entfernung spielten die anderen Kinder. Anna stand mit leicht gesenktem Kopf und wartete. Sie wartete und rührte sich nicht von der Stelle. Sie war nicht trotzig oder wütend, eher traurig und unsicher. Die Mutter, die das durch das Fenster beobachtete, wurde beim zweiten Blick ungeduldig und wollte etwas Aufmunterndes rufen, wartete aber dann doch noch. Bei den folgenden Kontrollblicken durch das Fenster bekam sie immer deutlicher ein schlechtes Gefühl. Die kleine Gestalt stand da mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern, bei genauem Hinsehen ein Anblick zum Herzerweichen. Sie öffnete schließlich das Fenster und rief: »Anna, komm wieder rein! « Anna kam und beschäftigte sich sofort mit besserer Stimmung in ihrem Zimmer. Der Mutter blieb nur ein hoffnungsloses Kopfschütteln. Zwischendurch kam so etwas wie Neid oder eine sehr unbestimmte Verärgerung bei der Mutter durch. Warum konnte Anna das so ohne Wenn und Aber machen? Wie konnte sie sich auf ihre Bedürfnisse konzentrieren und sich auch durchsetzen, ohne ein Problem damit zu haben? Sie als reife, erwachsene Mutter konnte ihre Bedürfnisse so nicht durchsetzen wegen der vielen Verpflichtungen, die Anna ja noch nicht hatte und vielleicht auch aus anderen Gründen. War Anna nicht ein wenig rücksichtslos und egozentrisch? War sie gleichgültig gegenüber den Sorgen der anderen oder der eigenen Mutter? Liebte sie sie nicht genug? Irgendwie ungerecht war es schon, oder nicht? Antworten gab es nicht. Für den Vater war das alles weibliche Überempfindlichkeit. So ging es, bis Anna sieben Jahre wurde. Plötzlich wollte sie wissen, ob sie anders war als andere, die alle viel mehr unternahmen. Das brachte die Mutter in arge Verlegenheit. Mehr stammelnd als argumentierend relativierte sie und fand alles ganz in der Ordnung, beschwichtigte Annas Bedenken. Natürlich könne man das eine oder andere anders sehen oder auch machen, aber so wichtig solle man es auch nicht nehmen. Anna hörte sich alles an. Aber wie auch schon früher ließ sie sich nicht beirren. Sie wollte es genauer wissen. Sie unternahm mehr und war tagelang auf anstrengendste Art mit anderen beschäftigt. Zufrieden aber machte sie das nicht. Nach kurzer Zeit des näheren Kontaktes spürte sie deutlich den Wunsch, wieder für sich zu sein. Das hatte nichts mit den anderen zu tun, nichts mit deren Fehlern oder deren Besonderheiten. Irgendwie war es einfach so. War sie längere Zeit allein, spürte sie ein langsam stärker werdendes Verlangen nach anderen. Die Mutter zählte zu ihrem eigenen Entsetzen für diese Bedürfnisse nicht. War sie mit ihr zusammen, so kamen die Bedürfnisse genauso, vielleicht ein wenig schwächer. War sie aber in der Gesellschaft anderer und ging es auch hoch her, so reichte schon die erste Gelegenheit des Luftholens, der Besinnung, um zu empfinden, dass Distanz und Alleinsein besser sein könnten. War sie normal? Ihre Freundinnen lachten über solchen Unsinn. Sie hatten solche Probleme nicht. Auch waren sie viel lustiger und sorgloser. Es war schon sehr auffällig. Annas Tagebuch verstand sie da besser. Hier ging sie der Frage nach, wie und warum sie nur so seltsam war, warum alles schwerer war als bei anderen, warum der Kontakt mit der Mutter zwar gut tat, aber in diesem Zusammenhang nicht zählte. Hier half nur das Zusammensein mit Gleichaltrigen. Aber Antworten keimten nicht. Diese Fragen und das bewusstere Wahrnehmen verlängerten die Zeiten des Alleinseins, ohne jedoch eine Antwort zu produzieren. Sie spürte so etwas wie einen Makel, ein Zeichen auf ihrer Stirn. Ihre Mutter erinnerte sie leider oft daran, wenn sie gerade von diesem vermeintlichen Problem ein wenig Abstand gewonnen hatte. Dennoch hatte sie insgesamt gesehen das Gefühl, dass alles in der Ordnung war. Doch richtig sicher konnte sie nicht sein, denn die Botschaft der anderen, insbesondere der Mutter, war:
»Du bist nicht okay, ändere dich!« Genau so hörte sich das natürlich nicht an. Es war viel versöhnlicher und verbindlicher, zum Beispiel: »Komm doch mal aus deinem Zimmer, lass uns mal zusammen einkaufen gehen. « Sie spürte aber deutlich, dass gemeint war: »So ist es nicht richtig. « Die Häufigkeit solcher Botschaften und ähnlicher Themen machten ein Überhören oder Unberücksichtigt lassen unmöglich. Ihr war schon klar, dass sie anders sein sollte, normaler. Aber was war normal?
Sie hatte sich Fragen gestellt, gelesen, nachgedacht. Jetzt spürte sie, woher ihre tiefen Zweifel kamen. Es war der Gegensatz zwischen Nähe und Distanz. Sie spürte auch, dass es allen Menschen so geht. Sind sie allein, möchten sie mit anderen zusammen sein. Sind sie jedoch mit anderen zusammen, womöglich sehr eng und nah, so wünschen sie sich wieder mehr Distanz und nur für sich zu sein. War das ein normaler Vorgang? Trotz ihres Alters sah sie die Dinge erstaunlich klar, ohne jedoch die Hintergründe oder irgendwelche Antworten zu erkennen. Warum wurde sie aber so häufig darauf angesprochen? Warum bewegte sie das Problem und andere verstanden nicht einmal, wovon sie redete? Für sie war das sogar lächerlich. Auch versuchte sie zu glauben, dass es ein Gesetz gibt, das ungefähr so lauten müsste: Je mehr Nähe entsteht, desto stärker ist das Bedürfnis nach Distanz. Je größer die Distanz ist, umso mehr Energie wird mobilisiert, diese zu verringern. Sie fand viele Beweise und Indizien für die Richtigkeit der Thesen. Nur stellte es sie nicht so zufrieden, wie sie eigentlich erhoffte hatte. Irgendetwas fehlte. Sie bedauerte besonders, dass die Regeln und Gesetze sehr technisch und nüchtern waren und nicht sehr viel mit der Vielfältigkeit ihres Erlebens, mit ihren Freundinnen und mit der Intensität ihrer Gefühle zu tun hatten.
Annas zweiter Lebenskonflikt
Eines Tages war ihr Tagebuch plötzlich nicht mehr so geduldig, wie sie es kannte. Sie ertappt sich dabei, es dumm und unreif zu finden, in ein kleines Buch zu schreiben und zu glauben, dass sie an einen Vertrauten schrieb, der sogar antworten konnte. Denn so war es früher durchaus. Sie hatte sehr nahe und intensive Gefühle zu dem Geschriebenen und vor allem zu den vielen Bildern, die dabei auftauchten. Die nun einsetzende Leere, das Fehlen dieser Lebensgefühle machte sie noch einsamer. Es verlängerte die Zeit, die sie für sich vorsah, denn Einsamkeit war es ja eigentlich nicht. War es Unsicherheit? Im Laufe der nächsten Monate nahm sie die Bedürfnisse der beiden unterschiedlichen Richtungen immer klarer und intensiver wahr. Mit einer eindringlichen Deutlichkeit wurde ihr immer bewusster, wie oberflächlich Menschen in Gesellschaft sein konnten, wie leer und unecht ihr Zusammensein häufig war. Sie redeten und argumentierten, ohne sich wirklich zuzuhören. Jeder erzählte seine Dinge, seine Geschichte und nach einem Luftholen der andere, ohne auf das Gesagte einzugehen. Machen sie nur ein Geräusch? Sie beobachtete sich jetzt häufiger, wie sie auch in Gesellschaft etwas abseits stand und beobachtete. Viel klarer als früher war jetzt, dass Menschen zwar zusammen, aber dennoch gleichzeitig getrennt und unbeachtet sein konnten. Sie sprachen sich zwar an, gingen aber komischerweise meist nicht aufeinander ein. Jeder erzählt etwas von und über sich, ohne den anderen wirklich zu sehen oder auf ihn und sein Gesagtes einzugehen. Berichtete beispielsweise jemand etwas von seiner schwierigen Schwiegermutter, so konnte er ziemlich sicher sein, dass der Zuhörer bei der ersten sich bietenden Gelegenheit nicht darauf einging, sondern von seiner ebenso schwierigen Schwiegermutter erzählte: »Genau wie meine, die macht immer Folgendes…« Der enttäuschte Sender wartete dann in der Regel bis zum nächsten Luftholen und sagte dann vielleicht: »Ja, ja, meine macht aber…«
Diese Art der Unterhaltung kam so häufig vor, dass sie auch hier an eine Gesetzmäßigkeit glaubte. Diese war ihr zutiefst zuwider. Wenn ihr selbst so etwas passierte und das war auch bei ihren besten Freundinnen nicht selten, fühlte sie sich nicht nur nicht ernst genommen, sondern auch irgendwie verraten. Ärger und manchmal auch Ratlosigkeit traten auf. Was sollte das alles? Was sollte man tun? Wie konnte man das ändern? Gespräche mit einigen Vertrauten, die sie suchte, brachten ebenfalls nichts: »Das ist doch völlig normal. Das machen doch alle so. « Andere verstanden überhaupt nicht, was sie bedrückte, trösteten oder machten sich lustig über ihre Sorgen. Das kannte sie ja schon. Anna hatte wieder einmal Probleme. Das so wichtige Zusammensein wurde dadurch seiner letzten Wirkung beraubt. Alles war dann nur noch oberflächlich, hohl und unbedeutend. Geräusche waren es, ohne Bedeutung, wie ein laufendes Radio, aber kein Austausch unter Menschen. Es fehlte die Nähe, die sie zwischendurch so dringend benötigte. Und damit kam immer mehr Einsamkeit. Im Zusammensein mit anderen konnte sie sie noch ertragen, aber sie wurde doch so stark, dass eine Reaktion erforderlich wurde. Sie fing an, ohne es zu merken, die Bekannten und Veranstaltungen zu sortierten. Welche Freundin war ihr nahe oder ging auf sie ein, und welche war oberflächlich? Welche Einladung sollte sie annehmen, welche ausschlagen? Wen sollte sie selbst einladen, und wie sollte sie sich dann verhalten? Komischerweise gehörte ihre Mutter nicht zu den Aussortierten, obwohl sie auch meist nicht zuhörte und überwiegend mit ihren eigenen Problemen beschäftigt war. Wenn sie zusammen waren, trat trotz ähnlich schlechter Kommunikationsqualität ein solch negatives Abwehrgefühl nicht auf wie bei den anderen Menschen. Bei denen lichtete sich die Zahl. Die Zeit des Zusammenseins mit den Verbliebenen und Näheren nahm zu, mit den anderen ab. Mit einigen Menschen gab es gar keine Verbindung mehr. Sie merkte deutlich, dass ihr das alles viel besser bekam als früher. Aber es machte sie weiter unsicher. Die alte Unsicherheit blieb, sie bekam zusätzliche Nahrung.
Andere sahen das so nicht, viele Konventionen waren anders. Man lud andere ein, wenn man selbst eingeladen wurde. Man lud nicht ein, wenn der andere zuhören konnte und Interesse hatte. Geschenke wurden in ähnlichem Wert gekauft, wie man sie selbst bekommen hatte. Manchmal, dachte sie verbittert, würde es reichen, eine bestimmte Geldsumme wandern zu lassen, da ja jeder den gleichen Wert zurückbekam. Was sollte dieser Unsinn? Noch dazu wurden Dinge verschenkt, die mit den Bedürfnissen des Beschenkten wenig oder gar nichts zu tun hatten. Die meisten wussten einfach zu wenig von den Wünschen und Vorlieben, um sinnvolle Geschenke kaufen zu können. Es war keine böse Absicht, sondern eher Unwissenheit und Desinteresse. Sie beobachtete dieses Phänomen und erkannte zunächst, dass auch die meisten Menschen relativ wenig von ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen berichteten. Dann durften sie sich auch nicht wundern. Wenn sie es dann doch einmal taten, dann in einer verdeckten und versteckten Art. In keinem Fall kam Klartext. Andererseits hörten sie aber auch nicht zu, wenn jemand einmal etwas aus seinem Erleben und von seinen Bedürfnissen berichtete. Schnell waren sie wieder bei sich und ihren eigenen Geschichten und erzählten darüber. Es lohnt sich offensichtlich nicht, über eigene Bedürfnisse und Gefühle zu sprechen. Das war aus allem Gehörten die einzige logische Erkenntnis, die täglich an alle Menschen gesendet wurde. »Es lohnt nicht, über eigene Gefühle zu sprechen!«
Vergaß man einmal oder mehrmals jemand zu einem Geburtstag einzuladen, so konnte man ziemlich sicher sein, dass man auch von seiner Einladungsliste verschwand. Das alles traf auf erschreckend viele Menschen zu. Da Anna sehr genau überlegte, wen sie einlud und auch nur wenige auswählte, traf das auch für sie zu. Sie wurde zu einem Teil ausgegrenzt. Bei ihrer engsten Freundin Nadine war das Gott sei Dank anders. Die konnte zuhören, mit ihr traurig sein oder sich freuen. Auch Einladungen und Geschenke waren unkompliziert, unabhängig von den Vorgeschichten, und passten meistens genau. Immer war es so, dass sie genau merkte, dass Nadine sich viele Gedanken gemacht hatte und dass sie ihr wichtig war. Das war ein schönes Gefühl, das sie dringend benötigte und in Abwesenheit herbeisehnte. Gleiches versuchte sie auch zu verursachen. Sie verbrachte viel Zeit mit der Überlegung, welche Geschenke passen könnten. Anna war manchmal schon viele Tage vor einem Ereignis damit beschäftigt, etwas genau Passendes zu finden und das war manchmal wirklich schwer. Dabei fühlte sie sich trotzdem wohl und verspürte eine gewisse Befriedigung und Gefühlstiefe. War sie dann wieder längere Zeit allein, überkam sie immer noch das Bedürfnis nach Kontakt. Doch jetzt war ihr klar, dass eine besondere Qualität gemeint war. Nicht nur einfach Menschen, Gerede, Geräusche, sondern das Gefühl von Nähe, Sicherheit, Verständnis und Geborgenheit. Fehlte es, so herrschte so etwas wie Alleinsein, Unsicherheit und eine Spur von richtiger Einsamkeit. Die fühlten sie auch dann, wenn sie unter Menschen war. Mittlerweile wusste sie sich zu helfen. Sie ging ans Telefon und sprach mit den »Nahen«, schrieb ihnen lange, gefühlvolle Briefe, oder sie suchte sie unkompliziert sofort auf. Die Betroffenen reagierten ähnlich und fanden das gut. Mit einem kleinen Kreis von Menschen funktionierte das sehr konfliktfrei und angenehm. Darüber war sie ziemlich zufrieden und sehr dankbar. Komischerweise übertrug sich das auch auf andere Lebensbereiche wie Schule, Nachbarschaft und Sportverein. Es war, als habe sie mehr Kraft. Sie wusste jetzt, worauf es ihr ankam. Andere Menschen merkten das. Sie war bestimmter. In ihrer Gegenwart fühlten die meisten Menschen sich wohl, es war klar und einfach, man konnte es gut haben. Das alte Problem relativierte sich, es kamen jetzt Phasen, die sie als harmonisch und intensiv erlebte. Alles wurde weniger dramatisch und ging in viel geringerem Maße unter die Haut. Auch mit ihrer Mutter hatte sie ein viel besseres Verhältnis. Diese hatte jetzt nur noch Probleme mit der hohen Telefonrechnung. Sie wurde vom Vater energisch unterstützt, der meinte, man könne ja schließlich auch kurze Gespräche führen. Abgesehen von diesen ärgerlichen Diskussionen kam Anna jetzt mit dem Dilemma von Nähe oder Distanz gut klar. Für ihr relativ geringes Alter hatte sie zu diesem Zeitpunkt schon einige besondere Erfahrungen gemacht. Sie hatte einiges lernen müssen, was viele andere in ihrem Alter nicht kennenlernen mussten.
Doch da kam die Pubertät für sie ziemlich unvorbereitet. Die gewonnene Klarheit verschwand über Nacht. Plötzlich genügte es ihr, mit ihrer Clique zusammen zu sein und völlige Belanglosigkeiten auszutauschen. Sie verstand sich selbst nicht mehr. Banales und völlig Oberflächliches, vor allem von und über andere, verursachte zunächst bei den anderen Mitgliedern, dann auch bei ihr, echte Freude und gemeinsames Gelächter. Zu diesem positiven Erleben trugen alle nach ihren Möglichkeiten bei. Es wurde viel gelacht und mit den ungeeignetsten Themen Stimmung gemacht. Ohne aufmerksames Zuhören und anstrengende Gedanken über die Gefühle und Bedürfnisse der andern spürte sie eine unbekannte starke Verbundenheit zu den anderen Gleichaltrigen. Die war einfach da. Warum das plötzlich so war, war ihr nicht klar. Dass es ihr gut tat, das wusste sie sicher. War es ein Rückfall? Eine Rückentwicklung? Egal, sie verstand gar nicht mehr, was sie früher mit so tiefen Gefühlen bewegt hatte. Und so suchte sie, wann immer sie konnte, die Gegenwart der Clique. Andere Dinge wurden unwichtiger. Die Leistungen in der Schule, natürlich auch die Zensuren, ließen nach. Einige aus der Clique waren sogar gefährdet. Auch die Bedeutung der elterlichen Meinung nahm stark ab, wie ihr an verschiedenen Beispielen selbst klar wurde. Ihre Freundin Nadine traf sie seltener. Natürlich war das dann immer noch schön und harmonisch, aber doch anders, nicht mehr so fundamental wichtig und aufwühlend, irgendwie leichter. Die Clique selbst lebte von gemeinsamen Themen und mittlerweile auch von einem eigenen Vokabular, das nur die Eingeweihten verstanden. Nur wenn sich einer nicht an die bekannten Verhaltensregeln hielt, wurde es bitter. Den traf dann der Unmut und die Anfänge von Feindseligkeit von allen anderen. Dabei konnte die Gruppe schon ganz schön gemein sein. Und sie machte sogar mit! Nichtdazugehörende waren häufig irritiert, was bei der Gruppe Heiterkeit, Witze und starke Zusammengehörigkeitsgefühle auslöste. Das Verbindende wurde auch in ähnlicher Kleidung und fast identischen Frisuren deutlich. Sah man einige Cliquenmitglieder von hinten, war es häufig nicht möglich, sie zu unterscheiden, zu ähnlich war das Outfit. In dieser Zeit hatte sie eine Form des Zusammenlebens gefunden, die sie bei all den Nachteilen in der Schule und der Familie befriedigte. Wenn sie zurückschaute, verstand sie überhaupt nicht mehr, mit welchem Leid und tiefen Gefühlen sie das frühere Zusammenleben betrachtet hatte.
Acht Monate später war sie unsterblich in einen älteren Jungen verliebt. Schlagartig war die Clique ohne jede Bedeutung. Nur Klaus, Klaus, Klaus, der war wichtig. Die andern konnten da nicht mitreden. Alles war wieder da, tiefe Verzweiflung, wenn Klaus wenig Zeit oder Interesse hatte und ebenso tiefe Zufriedenheit, wenn er sich um sie kümmerte. Sie war von diesen beiden Richtungen wieder ziemlich abhängig. Ihr wurde klar, dass das sehr viel Ähnlichkeit mit den früheren Problemen hatte. Der einzige Unterschied bestand darin, dass es jetzt nicht mehr die anderen Menschen, die wenigen »Nahen« waren, wie sie es damals nannte. Jetzt war es nur Klaus, nur ein einziger Mensch. Das bedeutete noch größere Abhängigkeit und machte alles viel gefährlicher. Sein Verhalten war es, was ausschlaggebend war. Gut zuhören konnte auch er nicht. Das war aber auch nicht annähernd so schlimm, wie sie es früher bei anderen bewertet hatte. Sie tat alles, um das in die richtige Bahn zu bringen und mit ihm zusammen zu sein. Klaus musste sich auf jeden Fall um sie kümmern! Das tat er aber nicht oft genug. Eigene Interessen im Sportverein und mit seinen Freunden störten die schönen Erlebnisse. Es dauerte nicht lange, da betrachtete sie seine Freunde, den Sport und ähnliches mit unangenehmen, dann mit feindseligen Gefühlen. Eifersucht, Wut und Ärger waren das Ergebnis. Es half auch nichts, alles als normal zu betrachten. Anderen ging es nicht anders. In dem Maße, wie ihr klar wurde, dass sie es nicht ändern konnte, stellten sich Trauer und Kraftlosigkeit ein. Nur wenn sie mit ihm zusammen war, war alles toll und leicht. Immer häufiger ertappte sie sich dabei, dass sie schon im Zusammensein mit Klaus Angst verspürte, dass es bald wieder anders sein würde. Klaus ging das ständige Wechselbad gehörig auf die Nerven. Die vielen Bemerkungen und Hinweise reizten ihn mittlerweile sehr. Die kleinste Andeutung und er ging hoch. Es gab dann meist Streit. Auf Forderungen reagierte er vermehrt mit dem Gegenteil. »Ich werde doch nicht meine Freunde aufgeben.« »Was ist so schlimm daran, wenn ich mal Fußball spielen gehe?« Eine solche »einsame« Nähe wollte er nicht. Es war von Luftabschnüren und Beziehungsgefängnis die Rede. Die Familie litt ähnlich intensiv unter den Problemen. »Du darfst auch nicht wie eine Klette sein, lass ihm doch mehr Freiheit. Das muss sich erst einspielen.«, diese gut gemeinten Vorschläge mit viel Lebenserfahrung brachten sie jedes Mal so in Wut, dass sie Dinge sagte, zu denen sie zuvor nicht fähig gewesen wäre und die sie anschließend sofort bereute. Nach weiteren vier Wochen war die Beziehung zu Ende. Die Clique bestand auch nicht mehr. Zurück ging nicht. Wiederaufleben war nicht möglich. Mit noch größerer Deutlichkeit kam das alte Problem zurück. Wie sollte ein Zusammenleben funktionieren? Welche Art des Zusammenlebens gab es und welche war für Menschen die richtige? »Wiederkehr des Gleichen«, dachte sie. Mittlerweile hatte sie aber bei aller Trauer so viel Kraft, Klarheit und praktische Lebenserfahrung, dass sie begann, dieses Gebiet systematisch zu bearbeiten. Gott sei Dank bestand die Beziehung zu Nadine noch, die mittlerweile ähnliche Erfahrungen gemacht hatte. Sie redeten und weinten zusammen, waren sich gegenseitig eine solide Stütze. Dabei gab es kurze Momente, in denen sie eine tiefe Harmonie und Nähe verspürte. Die waren so tief, dass sie nicht wusste, ob sie lachen oder weinen oder nur genießen sollte. Dankbarkeit war da. Festhalten wollte sie, festhalten, aber das ging nicht. Es waren immer nur wenige Minuten. Sie fasste den Entschluss: »Mit diesen Fragen werde ich mich näher beschäftigen und für mich einen geeigneten Weg finden. Diese Harmonie und Nähe will ich häufiger oder immer haben.«
Der dritte Konflikt
Dieser Vorsatz überlebte natürlich nicht in der Stärke, wie er gefasst worden war. Er fristete ein schwaches, latentes Dasein. Außerdem waren die halbherzigen Versuche, die es durchaus gab, wenig erfolgreich. Harmonie, Nähe, Tiefe, wie sie es wollte, das gab es im Alltag nicht. Es blieb eine von Misstrauen getränkte Suche, obwohl ihre allgemeine Stimmung nicht schlecht war. Die Menschen waren gern mit ihr zusammen, sie war angenehm, aber häufig ernst. Manchmal kam es wieder vor, dass die alten Probleme, die alten Gegensätze sich meldeten und ins Bewusstsein vordrangen. Das kam insbesondere dann vor, wenn sie Schwierigkeiten in ihren Beziehungen hatte. Dann kamen die alten Bilder zurück und brachten sich in Erinnerung und mit ihnen ähnlich starke Gefühle wie damals. Nur war es jetzt nicht mehr so allumfassend tief, nicht mehr so bedrohlich, keine existenzielle Frage mehr, nur noch eine zusätzliche Belastung des Alltags. Sie hatte gelernt, dass mit einiger Mühe Auswege zu finden waren und auch Lösungen sich auftaten, wenn sie sich ernstlich damit auseinandersetzte, zumindest sah sie solche, mit denen der Alltag weiterging. Mittlerweile hatte sie Sozialwissenschaften studiert und arbeitete in einem Schulungs- und Beratungszentrum. Ihr Lebenspartner Hans, mit dem sie das Leben und eine Wohnung teilte, war ein junger, aber schon sehr erfolgreicher Rechtsanwalt. Sie sprachen viel über ihre Arbeit und verstanden sich gut. Sie waren sehr verschieden. Er war nüchtern, hatte für alles Erklärungen, Gefühle traten wenig nach außen. Sie fühlte und zweifelte! Ihn amüsierte das. Für ihn war alles viel klarer und Grübeln ziemlich unnötig. Sie liebte diesen großen Unterschied. Manchmal dachte sie: »Nur wir zwei zusammen in unserer Unterschiedlichkeit sind eine funktionierende Einheit, so sind wir realistisch und geschützt.« Das machte es leicht für sie. Anna achtete sehr genau darauf, dass sie beide einigermaßen gleichmäßig zu ihren Rechten und Bedürfnissen kamen. Sie hatte vom Leben schon als schmerzhaften Lehrsatz entgegennehmen müssen, dass Einseitigkeit, Aufopferung und Altruismus nicht überdauern können. Sie hörte exzellent zu. Ihr Mann merkte das und bemühte sich, es ihr gleichzutun. Sie konnte auch andere Menschen intensiv zulassen. Mittlerweile hatte sie auf diesem Gebiet sehr viel dazugelernt. Manchmal dachte sie, wenn sie an die früheren Zeiten mit der kleinen Anna dachte: »Damals hätte ich mir nicht im Entferntesten vorstellen können, welche Kompetenzen man noch beim Zuhören dazulernen kann.« Dabei war ihr ebenfalls völlig klar geworden, dass es nicht die Kompetenz und das entsprechende Wissen allein waren, was wirkliche Qualitätsverbesserung brachte. Es waren bestimmte Einstellungen zu Mitmenschen erforderlich, um weiterzukommen. Menschenbilder von Achtung und Wertschätzung, hervorgerufen von der Beachtung des Personengleichheitswertes, der Berücksichtigung von Integrität und Individualität des Einzelnen, brachten wirkliche Verbesserungen. Schöne, vermutlich auch richtige Sätze waren das. Der normale Alltag sah deutlich anders aus. Manche günstige Gelegenheit nutzte sie, um diese Lebenserfahrung wenigstens jüngeren Kolleginnen weiterzugeben. Aber beinahe jedes Mal merkte sie, dass die Kolleginnen das nicht annehmen konnten und hörten: »Ändere dich, lerne mehr!« oder »Du bist so nicht okay.« Sie kannte das ja aus ihrer eigenen Geschichte und bekam dann jedes Mal einen gehörigen Schrecken. Das wollte sie auf keinen Fall. »Aber zeige einmal jemandem etwas, der nichts sucht!« Dann erinnerte sie sich meist daran, dass sie immerhin ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse mittlerweile kompetent und sozial annehmbar vortragen konnte und dass solche Abwehrreaktionen nur bei »gut gemeinten« Ratschlägen vorkamen. Sie hatte es eigentlich klar. Ihr Lehrer an der Uni hatte das damals überdeutlich mit Slogans übermittelt und dafür gesorgt, dass sie nicht vergaß »Ratschläge sind auch nur Schläge.« Gut gemeint ist meist nur das Gegenteil von gut. Auch war ihr klar, dass das mit dem individuellen Selbstwertsystem des Empfängers und dem des Senders zu tun hatte. Man möchte gut sein und geliebt werden, aber der andere lässt es nicht zu, obwohl er auch gut sein will und es ebenso nicht zugelassen wird. So isst jeder das Brot des anderen und keiner wird so richtig satt. So etwas tritt auch bei Arbeitsgruppen zu Tage. In der Gruppe, die sie leitete, war das deutlich spürbar. Alle waren darauf bedacht, dass sie genau mitbekam, dass der Einzelne gute Arbeit leistete und auch so gesehen und wertgeschätzt werden wollte. Es gab Wettbewerb untereinander. Obwohl alle sich genaugenommen als Konkurrenten um Lob und Anerkennung betrachteten, durfte sie keinen bevorzugen. Kam das trotzdem einmal vor, weil zum Beispiel eine gute Arbeit eine gute Rückmeldung von ihr auslöste, war Freude und der eifersüchtige Ärger darüber unübersehbar. Alle gleich zu behandeln, das hatte sie schon ausprobiert, war ebenfalls nicht fruchtbringend. Dann hatten die meisten das Gefühl, sie könnten sich anstrengen, wie sie wollten, es würde nicht beachtet. Dafür hatte sie bisher keine vernünftige Lösung gefunden, es ging offensichtlich beides nicht. Trotz der Zweifel und Schwierigkeiten hatten ihre Feinfühligkeit und Kompetenz dazu geführt, dass sie geachtet, teilweise auch bewundert und als Konkurrenz gefürchtet wurde. Lustig und locker war sie nicht, aber sehr angenehm. Meist war sie in Gedanken, ernst und immer ziemlich stark beteiligt. Sie hatte längst begriffen, dass das eine Art war, die Kräfte benötigte und sehr anstrengend und belastend sein konnte. Sie ertappte sich häufiger dabei, wie sie die Mitarbeiter neidisch beobachtete, die ohne viel Tiefgang das Leben so nahmen, wie es kam, über jede Situation sich lustig machen konnten und insgesamt wenig angestrengt und erschöpft waren. Sie tröstete sich dann immer mit den selbst gemachten Erfahrungen, dass gerade diese Personen in eigenen Lebenskrisen extrem getroffen und meist völlig hilflos waren, wenn sie überhaupt zuließen und wahrnahmen. Aber eine kleine Flamme oder Sehnsucht nach mehr Leichtigkeit und Erfüllung war vorhanden und meldete sich regelmäßig. Bei den Vorgesetzten hatte sie einen sehr guten Ruf. Aufträge wurden gründlich und mit viel Sinn für Zusammenhänge erledigt. War irgendetwas wichtig oder ernst, dann konnte sie damit rechnen, dass sie dieses Projekt übertragen bekam. Das machte sie stolz und glücklich. In dieses schöne und angenehme Gefühl und Ergebnis mischte sich aber regelmäßig auch ein Gefühl des ausgenutzt Werdens, eine leise Stimme, die relativierte und anmahnte. Objektiv gesehen stimmte es sogar. Häufig übernahm sie Arbeiten von anderen, weil sie nicht schnell oder gut genug erledigt wurden. Einige Mitstreiter hatten schon längst erkannt, dass sie, wenn sie sich nur umständlich oder langsam verhielten, um die Arbeit herumkamen. Anna machte dann alles lieber selbst. Sie zwang sich, mehr zu delegieren und genaue Arbeitsgebiete mit strengen Qualitätszielen zu vereinbaren. Das führte relativ kurzfristig dazu, dass sie noch erfolgreicher und angesehener wurde. Jedoch in ihrer Arbeitsgruppe gab es deswegen gleichzeitig Irritationen. Die sonst einfühlsame Vorgesetzte war plötzlich für die Zeit der Zielvereinbarungsgespräche sehr viel direktiver und bestimmender, um anschließend wieder verständnisvoll und annehmend zu sein. Das war für die meisten ein Bruch im alten Führungsstil, der verunsicherte und für viel Gesprächsstoff sorgte. »Langsam tickt sie aus«, meinten einige. Es wurde unterstellt, dass sie das alles nur von oben erzwungen mache. Trotzdem wuchs die Forderung nach individueller Anerkennung und nach Differenzierung zwischen guten und weniger guten Mitarbeitern, obwohl das bisher geringere Bedeutung hatte und bislang irgendwie vermieden wurde. Das von allen geschätzte Gleichheitsgefühl schmolz dahin. Forderung nach anderer Beurteilung, nach Zensuren und entsprechender Behandlung wurden vorgetragen. Jetzt plötzlich kam es auch vor, dass einige die Gelegenheiten nutzten, um über andere schlecht zu sprechen und über jeden Geeigneten herzuziehen. Auch nahm die Bereitschaft, gemeinsam zu arbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen, deutlich ab. Das machte sie ziemlich unzufrieden und ratlos. Sie merkte immer deutlicher und genauer, dass sie sich zudem noch alleingelassen fühlte. Von wem? Wieso? Man arbeitete eigentlich gern mit ihr zusammen, achtete und bewunderte sie, liebte sie aber nicht, wie sie es gerne gehabt hätte. Neben ihr war nicht viel Platz. Das war ihr ziemlich klar, sie erhielt Achtung statt Liebe. Bei der geringsten Möglichkeit, sich selbstständig zu verhalten, sich abzunabeln, einen eigenen Weg zu gehen, galt ihr Rat und sie als Mensch nicht mehr viel. Eigentlich war das ziemlich unvernünftig und unsinnig. Die Mitarbeiter machten lieber etwas selbstständig halb richtig, als sie für eine gute Lösung zu beteiligen. Sie stand dann jedes Mal fassungslos vor dem Geschehen und ärgerte sich über die unnötig unzureichenden Ergebnisse. War Delegation und Zielvereinbarung doch nicht das Richtige? Sie verstand es nicht. War es dumm oder unreif? Wie auch immer die Antwort ausfiel, es war krass und traf sie tief, vor allem, weil es sie hilflos machte. Andere Motive waren offensichtlich plötzlich viel wichtiger als Zusammenarbeit und Gemeinsamkeit. Schlimm war, dass es sich in den Jahren immer auf die gleiche Art wiederholte. »Gut, dankbar musste keiner sein, mich lieben auch nicht, aber … Ja, aber was?«
Mit der Zeit wurden ihre Reaktionen darauf langsam blasser und weniger stark, taten auch weniger so weh. Sie konnte es auch nicht ändern. Die Tatsachen aber blieben, sie ließen ein Gefühl des Unvollständigen zurück, des Mangelhaften. Insgesamt gesehen hinterließen sie im Laufe der Zeit eine Art Narbe. Davon hatte sie jetzt schon einige. Narben haben eine dickere, unempfindlichere Oberfläche. Nahm sie deshalb weniger wahr, bekam sie einiges nicht mehr mit? Das durfte nicht sein! Sie fing an, die Narben wieder genau wahrzunehmen, sie empfindlicher zu machen und neben den Narben zu fühlen. Das funktionierte einigermaßen, aber verursachte neue Schwierigkeiten. Es beantwortete keine Fragen und löste nichts. Alles blieb erfolgreich und gut, aber nur relativ zufriedenstellend. Ihr Mann fand ihre Gefühle übertrieben, unrealistisch und hielt alles für weibliche Überempfindlichkeit. Sie aber verspürte eine Sehnsucht, die anfänglich keinen Namen hatte. Trotzdem war sie vorhanden und stark. Beim Zulassen und intensivem Fühlen wurde die Sehnsucht nach dem Unbekannten immer deutlich und stark. Im normalen Alltag bemerkte sie meist nichts davon, nur wenn sie allein war und nachdachte und plante. Schließlich war das ein normaler Teil ihres Verständnisses von Lebensqualität. Änderung war nicht in Sicht, der Wunsch blieb. Deshalb fehlte etwas, das sah sie nun völlig klar. Nur was? Sprach sie mit ihrem Mann darüber, so wurde er schnell ungehalten, verstand vermutlich wirklich nicht, worum es ging. »Du machst alles so gut und hast so viel Erfolg, jetzt sei doch mal zufrieden und gib Ruhe!« Ließ sie nicht locker, wie meistens, so kam er häufig an einen Punkt, an dem er glaubte, er habe auch Schuld. Er empfand dann, er könne ihr nicht das Leben bieten, das sie benötigte. Das tat ihm und dann beiden weh. Sie stritten sich zum Schluss über irgendeinen unwichtigen Punkt. Die Erkenntnis, dass das alles nur ein Beweis ihrer Liebe und tiefen Beziehung war, half nichts. Dieser vermutlich richtige Gedanke brachte nicht weiter, nicht einmal ihn, den nüchternen, rational denkenden Juristen. Es ging beiden an die Nerven und machte zusätzlich noch hilflos. Sie fingen an, diese Themen zu vermeiden. Hilflosigkeit aber konnte sie gar nicht ertragen. Was war zu tun? Wie sollte es weiter gehen?
Es kam der Tag, der ihr Leben veränderte. Er kam unvorhersehbar, wie häufig im Leben. Nichts Großes geschah, die Welt blieb nicht stehen. Unbemerkt traf sie eine Erkenntnis, die ihrer Sehnsucht endlich einen Namen gab. Und das kam so: Sie hatte sich, wie viele Male zuvor zu einem Fortbildungsseminar angemeldet. Mehrere Tage sollten in einem guten Hotel mit dem Thema Kommunikation verbracht werden. Eigentlich wollte sie nur mit gutem Beispiel vorangehen. Ihre Mitarbeiter sollten, von ihrem Modell angeregt, sich auch zu solchen Fortbildungen melden. Obwohl es in der Abteilung regelmäßig zu Unstimmigkeiten und Streit kam, hatte sie nicht zu Unrecht das Gefühl, dass andere Firmenangehörige kommunikative Inhalte viel dringender bearbeiten sollten als sie. Außerdem galt sie als gute Gesprächspartnerin mit außergewöhnlicher Zuhörkompetenz. Trotzdem meldete sie sich sofort und begab sich pflichtbewusst zum Seminar. Die ungefähr gleich alten Teilnehmer waren mit ihr sieben Frauen und nur drei Männer. Schnell wurde ihr klar, dass sie den anderen vieles voraus hatte. Sie kannte sich in diesem Thema schon sehr gut aus. So war es klar, dass sie die meisten Inhalte schon kannte und der Seminarleiter sich überwiegend mit den anderen Teilnehmern beschäftigte. Sie war geduldig, zurückhaltend und verspürte eine gewisse Überlegenheit, die sie einerseits genoss, aber sich dafür auch in geringem Maße schämte. Häufig wurde sie bei schwierigen Rollenspielen hinzugezogen und konnte erfolgreich ihre Kompetenz vorführen. Schon am zweiten Tag war sie von allen geachtet und umworben. Das kannte sie ja schon. Es war hier auch nicht anders als auf ihrer Arbeitsstelle. Sie spürte aber jede Minute mehr, dass sie das hier nicht wollte. Sie wollte etwas Neues lernen, nicht nur den anderen helfen. Sie wollte wachsen und sich weiterentwickeln und so ging das nicht. Sie war jetzt auch mal an der Reihe. Es konnte doch nicht immer nur um die anderen gehen. Der Seminarleiter verstand ihr Anliegen, konnte ihr aber nicht helfen, die Schwächeren benötigten seine ganze Aufmerksamkeit. Er bemühte sich sehr, beteiligte sie häufig, sah sie regelmäßig an und wartete auf ein Nicken, auf Zustimmung. Doch die Inhalte verblassten weiter und ihre Motivation sank. Und noch etwas Unangenehmes kam hinzu. Bei praktischen Inhalten und Rollenspielen versuchten die Teilnehmer einen guten Eindruck bei den anderen Gruppenmitgliedern zu erreichen. Sie taten alles, um sich nicht zu blamieren, sondern andere zu beeindrucken. Das war nicht echt, das war aufgesetzt und mit Masken verdeckt. So kam es, dass auch nicht wirklich Neues erprobt wurde. Altes wurde aufgewärmt. Nichts konnte in Ruhe reifen und wachsen. Das gefiel ihr gar nicht. Sie war für echte und ehrliche Wachstumsschritte bereit, wartete förmlich darauf. Die waren aber zurzeit hier nicht möglich und für sie schon gar nicht. Nicht ganz ernst und nicht mit letzter Konsequenz dachte sie schon daran, das Seminar abzubrechen. Dann kam eine Wendung.
Beinahe gleichzeitig fingen zwei der Männer einen Kleinkrieg an. Führungsansprüche in der Gruppe wurden angemeldet, Lösungen, auch die des Leiters, in Zweifel gezogen. Es wurde vermehrt diskutiert. Selbstdarstellung, Angriffe und Verunglimpfung raubten den Rest der Zeit. Mit anderen Worten, es wurden vielfältige Rangordnungskämpfe ausgetragen. Es war genau so, wie in vielen Gruppen in ihrer Firma. Mit erwachtem Interesse beobachtete sie jetzt das Geschehen und wartete darauf, dass sie jemand angriff, denn nicht alle mochten sie wirklich gut leiden. Seltsamerweise kam das nicht vor, obwohl sich jetzt auch die anderen mehr oder weniger an den Kämpfen beteiligten. Selbst eine zuvor sehr vorsichtig und bescheiden wirkende Frau beteiligte sich jetzt auf einmal in einer nicht vermuteten Stärke und Aggressivität. Es ging hoch her, höher als die Stunden zuvor. Die Inhalte traten in ihrer Bedeutung sehr stark zurück. Der Leiter, ein sehr feinfühliger und warmherziger Typ, versuchte erfolglos zu vermitteln und umzusteuern. Als das nach mehreren Versuchen immer noch nicht funktionierte, intervenierte er mit weiteren Sachinhalten. Schließlich wandte er sich an die wenigen, die unbeteiligt wirkten. Alles blieb ohne Erfolg. Es wurde weiter gekämpft. Koalitionen bildeten sich. Fronten standen sich gegenüber. Sie sah alles mit großem Interesse. Es war wie auf einer Bühne, total spannend, viel klarer und offensichtlicher als normalerweise in der Arbeitswelt. Dort war das alles an der Tagesordnung, nur viel versteckter und so verfeinert, dass man es nicht so einfach sah. Es steckte in Protokollen, in Bemerkungen, in Geschichten und Witzen über Personen, in Lügen und Halbwahrheiten. Wie satt hatte sie das alles. Aber es war ja wohl normal, wie man hier sehen konnte. Es erstaunte sie, wie viel Kraft darin steckte, wie viel Energie dafür frei gemacht wurde. Kraft die man sinnvoller für Anderes nutzen könnte. Nach einer Mittagpause sorgte der Leiter für die nötige Aufmerksamkeit und machte klar, dass das Seminar so nicht weitergehen konnte. Er würde sich ab jetzt nicht mehr regelnd einmischen, sie wären ja schließlich alle gut ausgebildet und erwachsen. Einige staunten. Es entstand eine ziemliche Aufregung mit Anklagen und Reden, es wurde unterstellt, aufgebauscht und heruntergespielt. Unnatürliche Gesprächspausen traten auf, die kaum zu ertragen waren. Eine greifbare Feindseligkeit schwebte zwischen den Teilnehmern. Wutausbrüche wechselten sich mit Appellen und Hilflosigkeitseingeständnissen ab. Alles wurde unerträglich und peinlich. Der Seminarleiter wurde hasserfüllt angesehen und erfolglos angegriffen. Er schwieg. Einige wollten das Seminar verlassen und nach Hause fahren, zögerten aber noch aus ungeklärten Motiven. Die Spannung war auf einem Höhepunkt angekommen. Wie bei einem Theaterstück brach plötzlich alles zusammen und verkehrte sich ins Gegenteil. Ohne jede Ankündigung und erkennbare Ursache waren sich urplötzlich alle einig und baten sichtlich erleichtert den Leiter, doch wieder zu leiten. Der zögerte und nannte schärfere Bedingungen für die Zukunft, die alle auffällig schnell akzeptierten. »Was für kleine Opportunisten!«, bewertete sie das Geschehen und die Akteure, um sich aber auch gleichzeitig zu ermahnen: »Du wolltest doch die Menschen annehmen, wie sie sind und nicht ständig bewerten und urteilen.«
Es folgte eine Aufarbeitung der Geschehnisse auf einer Meta-Ebene. Lustiger weise bemühte der Leiter das Bild eines kleinen Engels, namens Meta, welches ständig über uns fliegt und uns beobachtet. Was denkt wohl dieser kleine Engel über uns? Denkt er: »Was tun die da?« In erstaunlich kurzer Zeit waren alle Erlebnisse erinnert, analysiert und die Strukturen des Kampfes und die eingenommenen Rollen für jeden klar. Nur zarter Protest kam bei zu starker Be- oder besser Verurteilung auf. Geschickt fügte der Leiter unbekanntes Wissen über Gruppenstrukturen und Rangordnungen ein und sorgte für einige Aha-Momente. Aber auch Zweifel und Kopfschütteln kamen vor. Am wenigsten wurde die Theorie akzeptiert, dass wir Menschen uns grundsätzlich nicht anders verhalten als bestimmte Tierarten, dass wir animalisches Verhalten zeigen. Der Leiter erklärte ausführlich, dass solche sozialen Regeln mit Rangkämpfen bei den Primaten, aber auch bei den Haushühnern in Form von Hackordnungen vorkommen und ganz bestimmten Gesetzen folgen. Nichts anderes war zuvor geschehen, das konnte keiner leugnen. Die Erkenntnis, dass wir uns nicht viel anders verhalten als Haushühner, war ein großer Brocken, den nicht alle schlucken konnten. Beinahe wäre es wieder losgegangen. Erst das geschickte Einlenken des Leiters, dass ja keiner sich so verhalten müsse, dass wir Menschen sehr wohl in der Lage seien, uns auf »angemessenere« Art zu verhalten, machte so viel Hoffnung, dass der große Bissen hinuntergewürgt wurde. Man sprach noch eine gewisse Zeit über das Wie. »Was ist denn die angemessene soziale Form für Menschen?« Es reifte zunächst nur ein Gruppenmotto, die neue Regel, es wenigstens ohne Rangordnung zu versuchen, ohne Kämpfe und besser als andere sein zu wollen. Es sollte keine Seminarbesten geben, keine Zensuren und entsprechende Beurteilungen. Jeder sollte nach seinen Möglichkeiten in größtmöglicher Freiheit und bestem Nutzen handeln dürfen. Die anderen hatten ab sofort nur noch die Rolle des Helfers, nicht des Richters oder Beurteilers, schon gar nicht mehr die des Besserwissers. Die folgenden Stunden waren geprägt von erstaunlich schnell wachsender Harmonie und Nähe. Es war, als gäbe es etwas nachzuholen. Auch in den Pausen und am Abend intensivierten sich die Gespräche und Beziehungen. Innerhalb des Seminars berichteten plötzlich einige von sehr persönlichen Problemen, von Schwächen und Ängsten und waren froh und erleichtert, dass nichts passierte. Das steckte an. Mit tiefer Betroffenheit und Dankbarkeit erlebten sie, dass sie so sein durften, wie sie waren. Plötzlich gab es so etwas wie Angst- und Blamagefreiheit. Man durfte schwach oder unvollkommen sein, musste nicht mehr so sein, wie andere einen haben wollten, man musste keine Rolle spielen. Keiner wollte der Beste sein. Rollenspiele wurden echt und persönlich. Es war, als wenn ein Damm brechen würde, beinahe alle machten davon Gebrauch. Dennoch waren alle noch vorsichtig und auf der Hut und sehr ernst bei ihrer Sache. Die gegenseitige Achtung wuchs und war von nun unausgesprochene Verhaltensregel. Sie wuchs sogar, obwohl einiges falsch gemacht wurde und vorübergehende Unfähigkeit auftrat. Sie dachte einige Male, dass es vermutlich genau dieses Zulassen von Unvollkommenem und von kleinen Fehlern Sympathie auslösen würde. Verglich sie das mit ihrer Arbeitsphilosophie, keine Fehler machen, immer perfekt sein, immer das Beste geben, keine Kompromisse machen, so nährte sich in ihr der Verdacht, dass sie vielleicht genau deshalb nicht so geliebt würde, wie sie sich das wünschte. Aber sollte sie deshalb Fehler machen? Sie sah da keinen vernünftigen Weg.
In der verbliebenen Zeit konnte in der Gruppe noch vieles zugelassen, erprobt und gelernt werden. Am Seminarende verabschiedeten sich alle wie nahe Verwandte, wie gute Freunde, versprachen sich das eine und andere und gingen auseinander. Anna war verwirrt. Damit hatte sie nicht gerechnet, das hatte sie nicht erwartet, das hatte sie von sich selbst auch nicht gedacht. Sie hatte sich bei eigentlich fremden Menschen fallen lassen, war für einige Zeit sie selbst, brauchte nicht auf der Hut, nicht immer und jederzeit gut und perfekt zu sein, konnte ohne Angst Dinge an sich zeigen, von denen sie eine schlechte Meinung hatte. Das war unendlich wohltuend. Das Gleiche konnte sie auch bei den anderen wahrnehmen, ohne jede Regung der Konkurrenz, der Bewertung. Es berührte sie in einer nicht gekannten Intensität. Wie war das möglich? Eins war klar, dieses Gefühl war schön, leicht und trotzdem tiefgehend und erfüllend. Frei sein! Warum war das nicht früher schon einmal passiert? Warum war das nicht zwischen ihrem Mann und ihr vorhanden, wo sie sich doch wirklich liebten und gut kannten? Warum passierten zwischen ihnen beiden auch Machtkämpfe? Bei diesen fremden Seminarteilnehmern geht es, warum bei ihrem Liebsten nicht? »Liebst du vielleicht nicht wirklich, oder liebt er dich nicht?« Dieser Gedanke erschreckte sie sehr. Sofort war die alte Angst wieder da. Die alten Rollen tauchten wieder auf, die Rolle des Partners, der Geliebten, des guten Kameraden. Das schöne Gefühl war mit nur einem einzigen Gedanken aufgelöst und verschwunden. Das durfte nicht sein. Sie wollte es zurück. Es kam aber nicht zurück, nur die Theorie darüber blieb. Wissen über das alles war jetzt vorhanden, aber keine Empfindung. Sie spürte aber eine sichere, starke Sehnsucht danach. Die tat sogar weh. Und plötzlich war ihr klar: Das war es, diese angstfreie Harmonie in der Gruppe, zwischen Menschen. Das war es, was sie die vielen Jahre herbeigesehnt hatte, ohne es genau zu wissen. Jetzt war es klar. Aber was war mit den vielen Rollen, die sie bisher spielen musste? Die gute Mitarbeiterin, die fehlerlose Kollegin, die aufmerksame Nachbarin, die dankbare Tochter? War sie real die Summe all dieser Rollen? Steckte sie in einer mehr als in anderen? Oder, steckte sie, was noch viel entsetzlicher wäre, in keiner? Unruhe und Angst ergriff sie. War sie in einem Versteck und spielte außerhalb nur Rollen? Dann war es kein Versteck, sondern eher ein Gefängnis. War sie so schrecklich, dass sie nach außen nicht sie selbst sein durfte, Rollen spielen, sich sogar verstecken musste? Warum nur machte sie das alles, wenn es ihr nicht gut tat? Warum verhielt sie sich nicht einfach anders? Nach vielem Grübeln innerhalb der nächsten Tage hatte sie es heraus gespürt. Es war Angst, einfach nur Angst! Die Angst war, nicht begehrenswert genug zu sein, nicht genug beachtet und geliebt zu werden. War sie so schwach und bedürftig? Vermutlich ja. Sie erinnerte sich an ihre Kindheit, an die kleine Anna, die häufig hören musste, dass sie so nicht in Ordnung ist. Mehrmals war sie versucht, ihren Eltern, insbesondere ihrer Mutter, die volle Schuld für dieses Dilemma zuzuschieben. Was sollte aus einem Kind schon werden, das ständig hört, von den Eltern, den Nachbarn, im Kindergarten, in der Schule, es ist so nicht richtig? Das wird doch gezwungen, sich zu verstellen und Rollen zu spielen, zu lügen und zu betrügen und sich zurückzuziehen. Sie spürte genau, dass es diese echten Zuwendungen, diese interaktiven Streicheleinheiten und ehrlichen Blicke waren, die sie wie eine unverzichtbare Nahrung benötigte. Bekam sie davon nicht genug, setzte schlagartig Angst und Rollenspiel ein, Unehrlichkeit und Täuschung. »Hohes Gericht, bedenken Sie die schuldausschließenden Hintergründe. Es ist doch so etwas wie Notstand, Notwehr oder Mundraub, von Kindheit an eingeübt. Es ist kein Verbrechen, nur eine Schwäche, die alle haben, auch Sie. Man wird krank, wenn man nicht genug geliebt wird, nicht genug bekommt, wenn es nicht funktioniert.« Häufig ertappte sie sich jetzt dabei, wie sie solche Verteidigungsreden entwarf. Für wen, war ihr anfänglich nicht klar. Später sagte sie sich: »Natürlich irgendwie für dich, sonst würdest du sie ja auch anderen vortragen.« Dennoch blieb eine verzweifelte Unruhe. Sie war fortan schon ziemlich ungeduldig und ein wenig zwanghaft auf der Suche nach solchen echten harmonischen und angstfreien Erlebnissen. Aber sie fand sie nicht. Das konnte doch nicht sein. Im Gegenteil, jetzt mit den neuen Erkenntnissen überhäuften sie die kleinen versteckten und großen brutalen Beispiele von Kämpfen auf der Arbeitsstelle, bei Kunden und viel schlimmer in ihrem Privatleben. Vielleicht waren es in der Menge gar nicht mehr geworden. Nur jetzt sah sie sie leider auch noch überdeutlich. Ihre Beziehung zu ihrem Mann litt ebenfalls darunter. Der kleinste Streit und sie zweifelte an allem. Meist weinte sie dann hemmungslos, was auch neu war. Früher kamen ihr auch Tränen, aber nur selten und einzeln, jetzt aber brach es aus ihr heraus. »Man kann nur das sehen, was man kennt«, dachte sie. Sie kannte und sah es in einer Menge und Intensität, die ihr Leben und ihren Gefühlshaushalt stark belasteten. Wo war der Ausweg? Gab es ihn?
Müssen wir doch so leben wie die Haushühner oder Primaten? Sie wollte das nicht, das war klar. Wie sollte es gehen? Ohne ein klares Ziel vor Augen veränderte sie sich trotzdem. Sie war vorsichtiger, abwartender, viel mehr bereit, auf die Gefühlslage anderer einzugehen und Rücksicht zu nehmen. Das fiel auch anderen auf. Sie war jetzt viel weniger dominant und direktiv. Andere nutzten die plötzlich vorhandene Gelegenheit und Lücke. Sie setzten sich in einer nicht gekannten Unverfrorenheit über sie hinweg und meldeten eigene Führung an. Selbst Menschen, von denen sie das niemals gedacht hätte, verhielten sich so. Sie erkannte, dass selbst die tief geglaubten Beziehungen davon nicht verschont blieben. Auch diese Menschen nutzten die sich bietenden Lücken. Das alles traf sie hart, aber überraschte sie nicht. Ihr war klar, dass ein Teil ihres bisherigen Weltbildes zerbrochen war, ohne dass etwas Neues die Lücken geschlossen hatte. Das machte sie erstaunlicherweise mehr froh als ängstlich. Das war gut so. Ein Zurück gab es wieder einmal nicht. Ihr Vorgesetzter fragte zunächst, was los sei, dann machte er Vorwürfe und beklagte sich schließlich deutlich. Würde ihre Karriere stagnieren? Möglicherweise konnte das kommen. Aber das Leben hatte ihr schon die Lehre mit auf den Weg gegeben, dass in diesem Bereich so schnell nicht gehandelt und verändert wird. Es bleibt noch genug Zeit zum Suchen und Finden.
Annas Lösungswege zu mehr Glück
Jahre waren vergangen. Ihre Karriere hatte keinen Knick bekommen, wie einige gedacht hatten. Sie war weitergekommen, und sie leitete jetzt die gesamte Fortbildungsabteilung. Ihre Meinung, ihr Wissen, ihre unbestrittene Kompetenz und Erfahrung wurden geachtet und berücksichtigt. Manchmal geschah das bis in unsinnige Bereiche. Es kam nämlich durchaus vor, dass sie etwas leicht und noch ungeprüft und ungenau sagte. Wie man das manchmal so macht. Kollegen bezogen sich später äußerst genau und oft auch wörtlich darauf. Sie waren überzeugt von der Tiefsinnigkeit des Gesagten. Das passierte selbst dann, wenn es offensichtlich fehlerhaft war. Das war ihr dann immer sehr unangenehm und setzte sie unter den speziellen Druck, ausschließlich nur Wohlüberlegtes zu sagen und nicht mit einiger Leichtigkeit auch Unüberlegtes zu äußern. Damit ging viel von ihrer begehrten und für sie sehr wertvollen Leichtigkeit und Freiheit verloren. Immer kontrolliert zu sein, das schaffte sie nicht, das wollte sie nicht und wenn sie es schaffte, dann nur unter sehr großen Mühen. Häufig fragte sie sich: »Warum können die anderen nicht in gleichem Maße mitdenken, warum können wir nicht alle in einer Richtung an einem Seil ziehen?«