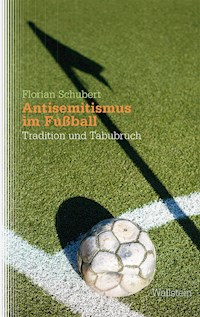
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Studien zu Ressentiments in Geschichte und Gegenwart
- Sprache: Deutsch
Die beliebteste Sportart in Deutschland - ein Ort für Antisemitismus und Diskriminierung. Fußball wird von Millionen von Menschen in Deutschland gespielt, von noch mehr Fans im Stadion oder am Bildschirm verfolgt. Fußball ist ein kulturelles Ereignis - und gleichzeitig ein Bereich, in dem Diskriminierung und besonders Antisemitismus noch immer gegenwärtig sind, so der Autor Florian Schubert. Mit antisemitischen Stereotypen werden seit jeher gegnerische Spieler, Fans und auch Schiedsrichter diskreditiert, unabhängig davon, ob es sich um Juden handelt oder nicht. Florian Schubert eruiert, in welcher Form und in welchen Kontexten Antisemitismus im Fußball seit den 1980er Jahren in der BRD und in der DDR auftaucht und wie er fußballintern bewertet wird. Er untersucht die Funktion antisemitischen Verhaltens bei Fans, Spielern und Vereinsverantwortlichen - von Nationalmannschaft und DFB bis hin zu regionalen Vereinen. Am Ende steht die Frage, ob das Stadion in Bezug auf diskriminierendes Verhalten eine Sonderstellung einnimmt oder als Brennglas gesellschaftlicher Phänomene gesehen werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 818
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STUDIEN ZU RESSENTIMENTS IN GESCHICHTE UND GEGENWART
Herausgegeben vom
Zentrum für Antisemitismusforschung
Band 3
Florian Schubert
AntisemitismusimFußball
Tradition und Tabubruch
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung
der Hans Böckler Stiftung,
der Stiftung Irene Bollag-Herzheimer
und der Stiftung Zeitlehren
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2019
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf
Umschlagfoto: Gunnar Geertz
Lithografie: SchwabScantechnik, Göttingen
Zugl.: Berlin, Technische Universität, Diss., 2017, unter dem Titel »Antisemitismus im Fußball: Manifestation und Legitimation eines Tabubruchs«.
ISBN (Print) 978-3-8353-3420-5
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4332-0
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-4333-7
Inhalt
1. Einleitung
2. Fußball und Gesellschaft
2.1 Katharsis
2.2 Identitätsbildung und Vergemeinschaftung
2.3 Fußall als Ort für männliche Vergemeinschaftung
3. Antisemitismus in Deutschland: Forschungsstand
3.1 Definition von Antisemitismus
3.2 Kommunikationslatenz
3.3 Antisemitische Differenzkonstruktion
3.4 Intendierter – nicht intendierter Antisemitismus
3.5 Abwertung
3.6 Antisemitische Kommunikation unter Jugendlichen
4. Antisemitismus im Fußball: Forschungsstand
5. Methoden
5.1 Qualitative Sozialforschung
5.2 Transkription und Auswertung
6. Antisemitismus im Fußball: Historischer Überblick
6.1 Fußball und Antisemitismus in den 1980er Jahren in der Bundesrepublik
6.2 Antisemitismus im Fußball der DDR in den 1980er Jahren
6.3 Antisemitismus im Fußball der Bundesrepublik in den 1990er Jahren
6.4 Exkurs: Fanzines
6.5 Antisemitismus im Fußball der 2000er Jahre
6.6 Exkurs: Forendiskussion
7. Neonazis und Antisemitismus im Fußball
7.1 Fußballfans im Fokus von Neonazis
7.2 Weniger stark wahrnehmbar, nicht mehr präsent?
8. Ausdrucksformen von Antisemitismus im Fußball
8.1 Verbal artikulierter Antisemitismus
8.2 Visuell vermittelter Antisemitismus
8.3 Antisemitismus in Verbindung mit diskriminierenden Äußerungen
8.4 Antisemitismus gegen den politischen Gegner
8.5 Unterschiedliches Verhalten an verschiedenen Orten
8.6 Der antisemitische Bezug zum Nationalsozialismus
8.7 Der Verrat als antisemitische Konnotation im Fußball
9. Jüdische Vereine und Spieler in Deutschland
9.1 Jüdisch-israelische Spieler in den Bundesligen
9.2 Makkabi
9.3 Veränderungen im Antisemitismus gegen Makkabi
9.4 Spiele gegen Teams aus Israel
10. Umgang mit Antisemitismus im Fußball
10.1 Die Verbände
10.2 Der unterschiedliche Umgang von Vereinen mit Antisemitismus
10.3 Die Rolle der Schiedsrichter_innen
10.4 Polizei und Ordner
10.5 Fanprojekte
10.6 Umgang von Fans mit Antisemitismus
11. Legitimierung von Antisemitismus im Fußball
11.1 Antisemitismus als Tabubruch
11.2 Antisemitismus aus Vereins-Tradition
11.3 Antimoderne und struktureller Antisemitismus in Fußballfankulturen?
11.4 Alkoholkonsum als Begründung für antisemitisches Verhalten
11.5 Soziale Abgrenzung
12. Fazit
13. Literatur- und Quellenverzeichnis
13.1 Literatur
13.2 Internetdokumente
13.3 Satzungen / Verordnungen
13.4 Pressemitteilungen
13.5 Radiobeiträge
13.6 Videos
13.7 Archivgut
13.8 Selbsterhobenes Interviewmaterial
13.9 Periodika
Dank
Anmerkungen
1. Einleitung
Fußball ist ein gesellschaftliches und kulturelles Ereignis, ein Sport, der von Millionen Menschen in Deutschland gespielt und jedes Wochenende von noch mehr im Stadion oder am Bildschirm verfolgt wird. Das Stadion verkörpert für viele Menschen einen Ort, an dem sie ihren spontanen Gefühlserlebnissen freien Lauf lassen können.[1] Fußball dient aber auch der Produktion und der Inszenierung von Männlichkeit.[2] Im Stadion entstehen, in Abgrenzung zu gegnerischen Fangruppen,[3] für kurze Zeit (männliche) Vergemeinschaftungen[4] und identitätsstiftende Sinn- und Wertegemeinschaften.[5] Kennzeichen des modernen Fußballs ist eine Fan- und Kommunikationskultur der Provokation, Beschimpfung und Herabsetzung der zum Feind erklärten gegnerischen Fans.[6] Fans und Fangruppen grenzen sich systematisch, manifest oder latent, durch Abwertung und Diskriminierung von anderen, als fremd oder anders empfundenen Gruppen ab. Hier werden – bewusst und unbewusst – gesellschaftlich gesetzte Grenzen übertreten. Das Stadion nimmt somit eine Sonderstellung ein, denn hier scheint, in der Wahrnehmung der Fans, noch das erlaubt und möglich zu sein, was in der Gesellschaft nicht mehr akzeptiert, sondern sanktioniert würde.[7] Fußball ist ein Ort, an dem antimodernes Denken konserviert wird.[8] Dies zeigt sich in den hier präsentierten verschiedenen Diskriminierungsformen, besonders im Antisemitismus. Dass Zuschauer_innen beim Fußball ihren manifest oder latent vorhandenen rassistischen, sexistischen, nationalistischen und antisemitischen Haltungen und Überzeugungen freien Lauf lassen, diese Überzeugungen zum Bestandteil kommunikativer Aushandlungsprozesse machen und dies in ihren peergroups toleriert wird, ist ein von den Medien, Beobachter_innen, Wissenschaftler_innen und Fußballfans selbst häufig konstatiertes und kritisiertes Phänomen.[9]
Antisemitisch konnotierten Schmähungen fällt in der Fan- und Kommunikationskultur dabei eine besondere Rolle zu. Antisemitische Stereotype gelten im Fußball als eine der ältesten gebräuchlichen Formen, um gegnerische Spieler, Schiedsrichter, Mannschaften oder Fans zu diskreditieren, zu diskriminieren und zu beschimpfen.[10] Es werden dabei sowohl nichtjüdische Personen oder Gruppen als Juden beschimpft und über die Kategorie »Jude« abgewertet als auch Juden antisemitisch diskriminiert. David Jünger verweist in diesem Zusammenhang auf die historischen Kontinuitäten. So hätte sich das Bild vom Sportler in Deutschland von der Kaiserzeit bis zum Ende des Nationalsozialismus am Amateursportler orientiert. Sport wurde als Möglichkeit zur Charakterfestigung verstanden, die der Gemeinschaft dienen sollte, nicht zum bloßen Selbstzweck. Dieses Verständnis grenzte sich von einem modernen Sportverständnis ab, in dem es dem Westen ein materialistisches Verhältnis zum Sport vorwarf und unterstellte, der Sport solle helfen, die Bevölkerung gegen die Feinde Deutschlands fit zu machen. »Die Feinde Deutschlands waren in dieser Diktion neben verschiedenen Nationen vor allem der antinationale Kosmopolitismus, der raffende Kapitalismus: die Juden.« Der professionelle Sport widersprach damit dem Bild von einer Volksgemeinschaft, da er das individuelle Profitstreben über die Gemeinschaft stellte.[11] »Entsprechend […] war auch der Diskurs über den Berufssport antisemitisch konnotiert.«[12] Nach 1945 wurde die antisemitisch personifizierte Verknüpfung von Antiprofessionalismus und Kommerzialisierungskritik mit Juden tabuisiert.[13] Antisemitismus im Fußball war damit aber nicht verschwunden.
Die vorliegende Studie untersucht antisemitisch konnotierte Handlungen und Schmähungen, wie sie im Umfeld von Fußballspielen auftreten, und beschreibt, wo und wie Antisemitismus im Fußball auftaucht und wie antisemitisches Verhalten hier bewertet und eingeordnet wird. Das Phänomen und Themenfeld Antisemitismus und dessen Funktion im Fußballumfeld ist bisher keiner systematischen wissenschaftlichen Analyse unterzogen worden. Ziel der Untersuchung ist es, einen differenzierten Blick auf die antisemitischen Verhaltensweisen von Fußballfans, aber auch auf die von Spielern und Vereinsverantwortlichen, zu entwickeln.
Die Analyse von Antisemitismus im Fußballumfeld wird von der Beobachtung flankiert, dass antisemitische Einstellungen innerhalb der deutschen Bevölkerung nach wie vor verbreitet sind.[14] Neuere Studien, unter anderem Wilhelm Heitmeyers »Deutsche Zustände«, die »Mitte-Studien« der Friedrich-Ebert-Stiftung sowie der Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, gehen davon aus, dass bis zu 20 Prozent der Bevölkerung antisemitisch eingestellt sind.[15] Lars Rensmann verwies Mitte der 2000er Jahre sogar darauf, dass Antisemitismus bei den heranwachsenden Generationen erstmals wieder ansteige.[16] Und der Expertenkreis Antisemitismus fasste 2011 zusammen, dass es zwar in den Jahren 2004 bis 2006 einen deutlichen Rückgang antisemitischer Einstellungen gegeben habe, seit 2007 /2008 aber »wiederum ein Anstieg zu beobachten [ist], der allerdings bisher nicht das Niveau von 2002 erreicht hat«.[17]
Wenn heute in Wissenschaft und Medien über Antisemitismus gesprochen wird, steht oft die Frage im Vordergrund, ob Antisemitismus – zumindest unter Jugendlichen – zunehme, weil beispielsweise die Sensibilität in den jungen Generationen gegenüber dem Holocaust schwinden würde, und zusätzlich die damit zusammenhängende Frage, welches Wissen über den Holocaust bei jungen Menschen generell vorhanden ist.[18] Der Antisemitismus in der Alltagskommunikation von Jugendlichen ist jedoch, darauf weist Barbara Schäuble hin, kaum erforscht.[19] In noch größerem Maße trifft dies auf die antisemitische Kommunikation und das antisemitische Verhalten von Fußballfans, gleich welchen Alters, zu. Wenn überhaupt, hat sich die Forschung mit gewalttätigem Verhalten von Fußballfans auseinandergesetzt und hier vor allem rechte und neonazistische Verhaltensweisen thematisiert.[20] Insgesamt kann aber auch für diesen Bereich festgehalten werden, dass es kaum wissenschaftlich abgesicherte Daten über die Verbreitung von diskriminierenden und rechten oder neonazistischen Vorfällen und Verhaltensweisen gibt.[21] Auf der Grundlage des vorhandenen Datenmaterials wird in der Forschung einerseits vermutet, es gebe seit einigen Jahren einen Rückgang rassistischer und xenophober Vorfälle in den Stadien der Bundesliga,[22] andererseits wird aber auch darauf hingewiesen, dass sich die Formen der Diskriminierungen und die Orte ihrer Verlautbarungen verschoben haben: Weg von rassistischen Diskriminierungen, hin zu anderen, gesellschaftlich tolerierteren Diskriminierungsformen wie Homophobie und Sexismus, bei gleichzeitiger Verlagerung der nicht mehr akzeptierten Diskriminierungen, wie Rassismus und Antisemitismus, in die unteren Ligen.[23]
Aus den hier knapp umrissenen Problemlagen zu Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft im Allgemeinen und im Fußball im Besonderen ergeben sich für die vorliegende Untersuchung folgende Schwerpunkte und Leitfragen: Unabdinglich für eine differenzierte Betrachtung von Antisemitismus im Fußball ist zunächst, die gesamte Bandbreite der antisemitischen Gebrauchsweisen im Fußballumfeld zu ermitteln und darzustellen, in welchen Situationen sowie in welchen Kontexten die Aussagen oder Handlungen getätigt werden. Eine solche Datengrundlage fehlt bisher. Um diese Lücke zu schließen, habe ich zum einen qualitative Experteninterviews geführt und zusätzlich bereits vorhandenes Interviewmaterial ausgewertet. Zum anderen habe ich wissenschaftliche Arbeiten und Texte ausgewertet, die Antisemitismus, Diskriminierung und Fanverhalten im Fußball behandeln und analysieren. Von diesem Datenmaterial ausgehend, sollen die soziokulturellen Fundamente, Begründungen, Deutungsmöglichkeiten, Motive und die Funktionalität von antisemitischer Kommunikation und Stereotypen als Mittel der Beschimpfungs- und Abwertungskultur von Fußballfans untersucht werden. Ferner soll gefragt werden, in welchem Zusammenhang antisemitische Verhaltensweisen – verbale und physische – im Fußball mit anderen Diskriminierungsformen in der fußballtypischen Kommunikation stehen.
Konkret soll folgenden Fragen nachgegangen werden: Wie findet Vergemeinschaftung mit Hilfe antisemitischer Abgrenzung statt und welche kollektiven Selbstbilder werden dafür unter Fußballfans konstruiert? Welche Eigenschaften und Verhaltensweisen werden den jeweiligen Gruppen zugeschrieben?[24] Welche Funktion hat die antisemitische Kommunikation im Fußball, wenn gegnerische Fangruppen, Spieler und Vereine mit der Zuschreibung »Jude« belegt werden, auch wenn sie keine Juden sind? Was macht die andere Fangruppe zur »Judengruppe«, was trennt die eigene Gruppe von der als »Judengruppe« bezeichneten? Des Weiteren soll ermittelt werden, wie das antisemitische Verhalten von Fußballanhängern eingeordnet werden kann. Gibt es eine Bedeutungsverschiebung im Sprachgebrauch beim Fußball hinsichtlich des Gebrauchs und der Bedeutung des Lexems »Jude«?[25] Ist eine Kommunikationslatenz auch im Fußball wirkmächtig gewesen? Übernimmt das Stadion hier eine Ventilfunktion oder kann es als Brennglas für gesellschaftliche Phänomene gesehen werden? Zusätzlich stellt sich die Frage, ob es hinsichtlich antisemitischer Verlautbarungen und Handlungen eine Schnittmenge und sich gegenseitig verstärkende Tendenzen zwischen den rechts[26] offenen und neonazistischen Fangruppen und den sich als unpolitisch bezeichnenden Fangruppen gibt. Welches sind hier mögliche Widersprüche oder Abgrenzungsformen?
2. Fußball und Gesellschaft
Fußball ist nach wie vor mit der Vorstellung verknüpft, es handle sich um einen Unterschichtensport. Tatsächlich hat es jedoch, insbesondere im Profibereich, während der letzten Jahrzehnte massive Veränderungen gegeben. Bis in die 1980er Jahre wurde Fußball in Deutschland von einem Publikum aus der Arbeiterschaft getragen.[1] Seit den 1990er Jahren hat sich Fußball, insbesondere der Profifußball, verändert. Fußball ist heute in viel stärkerem Maße kommerzialisiert, als dies noch in den 1980er Jahren der Fall war.[2] Er hat in Deutschland seitdem stark an gesellschaftlicher Akzeptanz gewonnen, und die Zusammensetzung der Zuschauer_innen sowie Fanszenen haben sich seit Mitte der 1990er Jahre stark verändert.[3] Merkmal dieser Entwicklung ist zunächst der massive Anstieg der Zuschauer_innenzahlen. In der Saison 2016 /17 verfolgten über 19 Millionen Zuschauer_innen die Spiele der ersten und zweiten Bundesliga live im Stadion.[4] Damit ist ein neuer Rekordwert erreicht worden. Die durchschnittliche Besucher_innenzahl in der ersten Liga lag zum zehnten Mal in Folge bei einem Wert von über 40.000 Gästen.[5] Der gestiegene Zuschauer_innenschnitt erstreckt sich auch auf die unteren Profiligen.[6]
Seit den 1990er Jahren werden durch die TV-rechtliche Vermarktung der Übertragungsrechte von Spielen jährlich große Geldsummen an die Bundesligavereine abgeführt. Im Zuge der größtmöglichen Vermarktung der Fußballspiele für Fernsehübertragungen wurde der Spieltag weiter gesplittet.[7] So wurde 1993 etwa vom Deutschen Sportfernsehen (DSF), das die Rechte an der zweiten Liga besaß, das »Montagabendspiel« eingeführt.[8] Zusätzlich kam, ab der Saison 2008 /09, mit der dritten Bundesliga eine weitere Profiliga hinzu. Erste Profiklubs veränderten ihre Vereinsstruktur, orientierten sich stärker an Unternehmensstrukturen und wurden zu Aktiengesellschaften. Der Verkauf und die Vermarktung der Teams und ihr Merchandising wurden massiv verstärkt; Profiklubs gleichen sich heute in ihrer Vereinsführung immer mehr großen Unternehmen an. In der Saison 2016 /2017 wurden im Profibereich der ersten beiden Bundesligen über vier Milliarden Euro umgesetzt[9] – die dreizehnte Umsatzsteigerung in Folge.[10] Um diesen Umsatz stetig zu steigern, sollte das Produkt und Ereignis Live-Fußballspiel gewinnbringender vermarktet werden. Ein Ziel von Fußballverbänden war und ist es, den Sport für breitere und vor allem auch finanzstärkere Bevölkerungsschichten zu öffnen. Dafür musste »der Fußball« von seinem gesellschaftlich negativ konnotierten Bild, insbesondere seiner Nähe zu Gewalt und Rassismus, befreit werden.[11] Denn erst damit schien es möglich, eine kontinuierlich steigende Profitrate aus dem Produkt Fußball zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wurden im Zuge der Vorbereitung zur Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland viele der alten maroden Stadien von Grund auf erneuert oder ersetzt.[12] Es wurden zahlreiche Vorkehrungen getroffen, um gewalttätige Auseinandersetzungen in den Stadien zu verhindern. Überwachungstechnologien (Crowd Control) haben seit den 1990er Jahren, durch die Nutzung durch die Polizei und die Installation durch die Vereine, vermehrt Einzug in die Stadien gehalten, die sich daraufhin, so Roman Horak, in Hochsicherheitstrakte und Orte der Kontrolle verwandelt hätten.[13] Georg Spitaler spricht gar vom »Testraum für neue Überwachungstechnologien«.[14] Vorläufiger Höhepunkt war die durch ein Papier der Deutschen Fußballliga (DFL) ausgelöste Debatte im Jahr 2012 um das »sichere Stadionerlebnis«.[15] Flankiert wurde diese Debatte durch eine auch von der Politik polarisierend geführte Diskussion um Gewalt in den Fußballstadien, die auf den Faktor »Angst« und die Gefahren beim Besuch von Fußballspielen setzte.[16]
Diese Kommerzialisierung und Umgestaltung des Profifußballs verlief nicht konfliktfrei.[17] Fans wurden nicht in die Planungen der Umgestaltung des Produkts Fußball einbezogen und hatten zum Teil andere Vorstellungen davon, was Fußball ist und sein soll.[18] Erst durch Initiativen aus den Fanszenen wurden einige Entwicklungen abgeschwächt oder verändert und die Fanszenen letztendlich stärker in Planungen einbezogen.[19] Aber auch heute noch wehren sich Teile der Fanszenen gegen die Kommerzialisierung, der sie die Schuld daran geben, dass sich das Verhältnis zwischen Fan auf der einen sowie dem Spieler und dem Verein auf der anderen Seite entfremde. Für den Fan werde durch die neueren Veränderungen das ursprüngliche Erlebnis Fußball beschnitten bzw. beseitigt.[20] Hier wird deutlich, dass das Produkt Profifußball in einem Spannungsverhältnis verschiedener Interessen steht.[21] Insgesamt kann festgehalten werden, dass Fußball seit den 1980er Jahren in der gesellschaftlichen Wahrnehmung stark an Bedeutung hinzugewonnen hat. Kaum ein Ereignis wird von mehr Menschen regelmäßig aufmerksam verfolgt[22] oder erfreut sich einer so großen Beliebtheit.[23] Profifußball hat sich zu einer der größten gesellschaftlichen Bühnen in Deutschland entwickelt.[24]
Dem gegenüber steht die Entwicklung im Amateurfußball. Die kommerziellen Entwicklungen haben den Amateurbereich kaum berührt, viele der Vereine kämpfen um ihr finanzielles Überleben. Wie Horak zeigt, hat sich, im Gegensatz zu den oberen Ligen, die Zusammensetzung der Anhänger_innenschaft im Amateurbereich in den letzten 20 bis 25 Jahren weniger stark verändert.[25] Eine Studie zum Zuschauer_innenverhalten beschreibt, wie sich rassistische und rechtsextreme Verhaltensweisen aus den oberen Ligen in die Amateurligen verlagert haben.[26] Die Gründe für diese Entwicklung werden von den Verfassern der Studie dem mangelnden Angebot pädagogischer Arbeit mit Fans, schwächeren Kontrollen durch Vereine und Polizei, dem geringeren Druck durch Medien und Öffentlichkeit, entsprechende Vorfälle an die Öffentlichkeit zu bringen, und einer unzureichenden finanziellen Ausstattung sowie mangelndem Engagement der Vereine zugeschrieben.[27] Ob die Verlagerung wirklich so stattgefunden hat, oder ob nicht eher mit der angenommenen Abnahme diskriminierender Verhaltensformen in den Bundesligen[28] die Sicht auf die Amateurligen frei geworden ist und Diskriminierungen dort seitdem stärker wahrgenommen werden, ist bisher nicht untersucht worden.[29]
Für das Thema Antisemitismus im Fußball sind die Unterschiede zwischen Amateur- und Profifußballligen und die kommerzielle Entwicklung der letzten Jahrzehnte von zentraler Bedeutung. Die Bedingungen für die Vereine und Zuschauer_innen in den Amateurligen unterscheiden sich sehr stark von denen der Bundesligen. Die finanziellen Möglichkeiten – zum Beispiel für die Fanbetreuung oder für Kampagnen gegen Antisemitismus – sind deutlich begrenzter als bei Profivereinen. Außerdem sind die mediale Präsenz und Aufmerksamkeit um einiges geringer als im Profifußball. Die Voraussetzungen für antisemitische Kommunikation und Handlungen gestalten sich vor diesem Hintergrund in den Amateur- und Profiligen unterschiedlich.
Was das Erlebnis Fußball ausmacht, ist umstritten. In der Literatur werden verschiedene soziologische Begriffe und Erklärungen genutzt, um Fußball und das, was im Fußball passiert, als ein besonderes bzw. spezielles außergesellschaftliches Ereignis innerhalb der Gesellschaft zu beschreiben. So könnten sich im Fußball »persönliche Ventile« öffnen,[30] eine »heiße Atmosphäre« erlebt[31] und der »emotionale Kick« erfahren werden.[32] Fußball biete eine »karnevaleske Sonderwelt«,[33] in der eine Rauscherfahrung erlebt werden könne.[34] Fußball habe außerdem die Funktion eines »Katalysators für Vergemeinschaftung«.[35] Er sei »Abbild«[36] oder »Spiegelbild«[37] der Gesellschaft, aber auch ein »Brennglas«,[38] in dem etwa »Antisemitismus und Sexismus […] wie durch eine Lupe an Schärfe gewinnen« könnten.[39] Fußball übernehme also die Rolle eines Seismographen für gesellschaftspolitische Entwicklungen.[40] Im Stadion begegneten wir damit ausschließlich Verhaltensweisen, die auch in der Gesellschaft im alltäglichen Leben so angetroffen werden könnten. Die fußballspezifischen Verhaltensweisen, vor allem die, die für Aufsehen sorgen, seien also gar nicht besonders, da sie ja genau so auch in der gesamten Gesellschaft praktiziert werden könnten. Dies nehme dem Fußball eigentlich seine Sonderrolle. Trotzdem sei das Fußballstadion als Raum markiert, »in dem andere Regeln gelten als in anderen gesellschaftlichen Sphären«.[41] Fußball ist also nicht nur Abbild der gesellschaftlichen Verhältnisse, wie Eva Kreisky zusammenfasst, »er erweist sich auch als höchst ausdrucksstarkes ›Realitätsmodell‹, ja als Seismograph gesellschaftlicher wie politischer Brüche und Transformationen«.[42] Passiert hier etwas, dann verweist dies auf ungelöste gesellschaftliche Probleme oder Problemfelder. Klaus Theweleit formuliert es noch weitgehender: »Regel: Wer mitbekommt, was sich im Fußball wann und wie verschiebt, ist über andere Gesellschaftsbereiche osmotisch informiert.«[43]
Ausgehend von Begriffen wie »Identität«,[44] »Vergemeinschaftung«,[45] »Katharsis«,[46] »Ehre« und »Männlichkeit«[47] versuchen soziologische Forschungen zu erklären, was das Besondere am Fußball im Vergleich zur Gesellschaft ist und warum diskriminierende Verhaltensweisen im Fußball verbreitet sind. Ich werde im Folgenden diese Begriffe vorstellen und im Hinblick auf ihre Brauchbarkeit für meine Analyse antisemitischer Verhaltensweisen im Fußballumfeld diskutieren.
2.1 Katharsis
Dass Fußball eine Ventilfunktion besitzt, soll immer wieder erklären, weshalb im Fußball Dinge geschehen und Handlungen vollzogen werden, die in der Gesellschaft so nicht geschehen würden.[48] Offene rassistische, nationalistische und antisemitische Verhaltensweisen seien gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert, weshalb »Fußball (wie Sport überhaupt) zum nützlichen Surrogat« werde.[49] Gemeint sind damit aber auch weitergehende grenzüberschreitende Handlungen, wie exzessiver Alkoholgenuss, also Taten, »die dem reibungslosen Funktionieren im Alltag geopfert werden müssen«,[50] bei denen regelmäßig Grenzen des Normalen übertreten werden würden. Diese Handlungen könnten mit jedem Besuch eines Fußballspiels wiederholt werden und würden dabei helfen, das unbefriedigende[51] gesellschaftliche Leben zu ertragen: »Das ungelebte Leben sucht im Stadion einen Ersatz.«[52] Der Gang ins Stadion stelle demnach einen Reinigungsgang, eine Katharsis, dar,[53] bei dem jede und jeder Einzelne sich von den Strapazen, angestauten Frustrationen und anderen Widrigkeiten des gesellschaftlichen Lebens reinwaschen bzw. lösen oder befreien könne.[54] Da dies aber unzureichend, da nicht nachhaltig und nur temporär, geschehe, müsse das Stadion immer wieder aufs Neue aufgesucht werden.[55] Dembowski beschreibt die Funktion von Fußball als Ort des Abreagierens noch differenzierter:
»Die kontinuierliche Beschäftigung mit dem Fußballsport bietet seinen Fans Platz für Rituale des Abreagierens – sei es durch überhöhten Jubel und Enttäuschung oder Diskriminierung und Gewalt. Aber auch Humor und Witz, Ironie und Kreativität prägen das Bild der Fankulturen.«[56]
Es gebe aber auch Zuschauer_innen, die sich an diesen skizzierten Gefühlsäußerungen nicht beteiligen wollen und einfach nur zum Zuschauen ins Stadion gehen würden.[57] An diesem Punkt wird eine Dichotomie deutlich, nämlich die zwischen dem Katharsis suchenden Fan, dem im Zweifelsfalle alles recht ist, was seiner inneren Reinigung dient (wie beispielsweise antisemitische Schmähungen), und dem, der wegen des Zuschauens gekommen ist, sich lieber unterhalten lassen möchte und kein Bedürfnis danach hat, sich beim Fußballbesuch gehen zu lassen.
2.2 Identitätsbildung und Vergemeinschaftung
Im Fußball entstehen Gemeinschaften,[58] die von der räumlichen und kommunikativen Situation in den jeweiligen Stadionbereichen, in denen sich die Fans aufhalten, beeinflusst werden. Auch das Umfeld eines Vereins prägt seine Mitglieder und Fans. Insbesondere Jugendliche testen ihre Handlungsmöglichkeiten und handeln anhand der gemachten Erfahrungen Identitäten aus.[59] Junge Männer finden ein Feld vor, auf dem sie männlich konnotierte rituelle Verhaltensweisen einstudieren können.[60] Ebenso üben junge Frauen in eben dieser patriarchal geprägten Umgebung Verhaltensweisen ein, ihren Platz zu erkämpfen.[61] Mittels provokativer Inszenierung wird die Abgrenzung von der bürgerlich legitimen Kultur hergestellt und ein Wir-Gefühl befördert.[62] Es geht um die Herstellung eines gemeinschaftlichen »Wir« gegenüber den Anderen,[63] Inklusion und Exklusion werden verhandelt,[64] aber auch der Status in der eigenen Gruppe mittels der Diskriminierung von Gegnern gefestigt.[65]
Für meine Untersuchung ist der Zusammenhang von Antisemitismus und Identitätsbildung interessant. Werden gegnerische Fangruppen als »Judengruppe« bezeichnet, um die eigene Gruppenidentität zu stärken? Fußballfans, und vor allem Fangruppen, neigen dazu, sich einem höheren Ziel, dem Verein, unterzuordnen. Der einzelne Fußballfan kann in der Masse untergehen und persönliche Belange ausblenden. Dabei lösen sich politische und persönliche Differenzen auf.[66] Sozialer Stand und Klasse können zumindest temporär aufgehoben werden, was wiederum den Fußball zu einer politischen Größe werden lässt.[67]
Der Nexus von Fußball und Politik wird an einem Beispiel deutlich. Politiker bezeugen, vor allem dann, wenn sie zu einem Fußballspiel gehen, ihre Verbundenheit mit Fans.[68] Sie kokettieren damit, der gleichen Fußball-Familie anzugehören, ein Teil des proletarischen männlichen Kollektivs zu sein.[69] Und sie zehren von ihren vermeintlich gemeinsam geteilten Erfahrungen als Fans: geteiltes Leid, geteilte Freude. »Am sozialen Ort des Stadions könne selbst apolitischen Männern durch die Anwesenheit der politischen Repräsentanten Politik durch die Hintertür in Erinnerung gerufen und vermittelt werden.«[70] Die Herstellung von Verbundenheit wird angestrebt und an das Zusammengehörigkeitsgefühl appelliert. Dies sei insbesondere bei Spielen von Nationalmannschaften möglich.[71] Für Theweleit gehören Fußball und Politik unweigerlich zusammen, es lasse sich sogar von dem einen auf das andere schließen: »Wer bloß Fußball kennt, diesen aber sehr gut, wird auch in anderen Bereichen der Gesellschaft nicht orientierungslos dastehen.«[72] Nach Kreisky lassen sich die Gemeinsamkeiten von Fußball und Politik anhand einer Freund-Feind-Dichotomie ableiten, die beiden zu Grunde liege.[73] Es trete eine umfassende Vergemeinschaftung auf, die ein männliches Kollektiv, einen Männerbund entstehen lasse.[74] Dieser Männerbund zeichne sich darüber hinaus in einer deutlichen Abgrenzung nach außen aus. »Wir gegen die anderen.« Dabei würden soziale Unterschiede unter der männlichen Vergemeinschaftung und in der Abgrenzung gegen die ausgeschlossenen Anderen an Bedeutung verlieren.[75] Nach Sabine Behn und Victoria Schwenzer ist ein Merkmal der Fußballkultur die Konstruktion eines Anderen und die binäre Aufteilung der Welt.[76] Das Andere, von dem man sich abgrenzt, könne sich auf verschiedene Zuschreibungen beziehen. Entweder auf die Sexualität (Homophobie), das Geschlecht (Frauen)[77] oder auf lokale, regionale und nationale Zuschreibungen. »Wir gegen die da oben« ist eine weitere Zuschreibung. Auch die Verwendung antisemitischer Stereotype lässt sich hier einordnen. Deutlich ist, dass Fußball für die eigenen Zwecke von verschiedener Seite politisch aufgeladen wird. Zusätzlich lässt sich die im Fußball verbreitete Abgrenzung und Abwertung zum gegnerischen Verein besonders klar und einfach durch politische Abwertung aufbauen. Mit Hilfe antisemitischer Verhaltensweisen kann der Gegensatz zum abgelehnten gegnerischen Verein dabei besonders deutlich und intensiv herausgestellt werden.
Rivalität, Macht, Ehre: Der Konflikt zwischen Fangruppen
Neuere Forschungen haben herausgearbeitet, dass ritualisierte Rivalitäten,[78] die sich um Begriffe wie Macht und Ehre drehen, zentrale Kategorien sind, mit denen das Verhalten von Fußballfans analysiert und beschrieben werden kann. Hier wird die Meinung vertreten, man lebe als Fan für den Verein und die Fankultur und sei ständig für diese da.[79] Nur so könne man »echter Fan« werden. Peter Becker zeigt, dass es Begriffe wie Macht und Ehre sind, um die sich die Selbst- und Gruppenvergewisserung dreht.[80] Nur wer da mithalten könne, verdiene sich Achtung und Respekt, sei richtiger Fan.[81] Der Wertekodex werde in körperlichen und verbalen Angriffen verteidigt.[82] Die Auseinandersetzung werde immer wieder aufs Neue gesucht, bei einer Niederlage biete sich beim nächsten Aufeinandertreffen die Gelegenheit zur Rache und Revanche.[83] Letztendlich sei das Handeln vom Erwerb und der Verteidigung von Macht und Ehre bestimmt.[84] Durch die potentielle Unbeständigkeit von Macht und die Angreifbarkeit sowie die permanenten Möglichkeiten zur Kränkung der Ehre sehen sich das Individuum und die Gruppe samt Umfeld permanent im Zugzwang, ihre Ehre und Machtposition erneut herzustellen und zu bestätigen bzw. zu verteidigen.[85] Es entwickle sich ein Kreislauf oder Wettstreit,[86] in dem die Gruppe fast schon gezwungen sei, auf jede Provokation, Infragestellung oder Beleidigung adäquat, oder zumindest in gesteigerter Form, reagieren zu müssen.[87] Wenn nicht, laufe sie Gefahr, ihre Reputation zu verlieren.
Provokationen sind damit eine gezielte Infragestellung des von einer Fangruppe für sich adaptierten und in Anspruch genommenen Machtanspruchs. Wenn sich nun die angegriffene Fangruppe nicht adäquat verteidigt und den Angriff auf den eigenen Machtanspruch unwidersprochen hinnimmt bzw. sich nicht in der Lage sieht, ihn zu verteidigen, ist die Ehre der angegriffenen Fangemeinschaft in Frage gestellt und muss daher vor Untergrabung geschützt werden. Eine Provokation kann also nicht unbeantwortet bleiben: »Die Beantwortung der Provokation klärt die Macht- und Ehrfrage nicht endgültig, sondern im Gegenteil, sie wird als Gegenprovokation, die wiederum eine entsprechende Antwort erfordert, gedeutet. […] [Es] bleibt [also meist] immer noch eine Rechnung offen, bei deren Begleichung die Zinsen und Zinseszinsen mitverrechnet werden.«[88]
Es ist von immensem Vorteil für die Handlungsfähigkeit der Gruppe, wenn die Struktur homogen ist und die Trennlinien zum Gegner, aber auch zu anderen Fangruppen, eindeutig sind.
Dieses »In und Out«, die »Inklusion und Exklusion«, das dichotome »Freund- und Feindschema« ist eine wesentliche Grundvoraussetzung dafür, dass (männliche) Macht in der Kurve verteidigt, präsentiert und aufgebaut werden kann.[89] Frauen bzw. alles, was mit weiblich konnotiert wird, werden hierbei oftmals als störend empfunden.[90] »Die Stehkurven und das Stadionumfeld sind Reservate angehender Männer, deren Aktivitäten sich stets um die eng miteinander verknüpften Themen Macht und Ehre drehen.«[91] Im Umfeld eines am patriarchalen Ehrbegriff angelehnten Machtkampfes scheinen Frauen fehl am Platz zu sein. Insbesondere, wenn man sich vor Augen führt, welche Eigenschaften zur Verteidigung der Ehre und des Machtkampfs imaginiert werden: Mut, körperliche Wehrhaftigkeit, Kampfbereitschaft. Diese Attribute würden einem männlichen Rollenbild zugeschrieben, welches Frauen schon von Natur aus nicht mitbrächten:[92]
»Die grundsätzliche Ablehnung alles Weichen und Weiblichen bis hin zur Vernichtung dessen, was als unmännlich angesehen wird, verweist auf einen zentralen Aspekt des Bourdieuschen Konzepts der männlichen Herrschaft. Bourdieu arbeitet heraus, dass innerhalb der patriarchalen Gesellschaft Menschen von Ehre grundsätzlich nur Männer sein können, mit denen sich Männer messen können und müssen (Bourdieu 1997). Auf die Fußballkultur übertragen wird nachvollziehbar, warum der Rekurs auf die echte Männlichkeit identitätsstiftende Effekte bereithält. Das Messen mit den gegnerischen Fans funktioniert nur dann in einer für die Fußballfans befriedigenden Weise, wenn es sich auch um richtige Männer handelt. Die Herstellung richtiger Männer funktioniert innerhalb der herrschenden Geschlechterordnung über die zeitgleiche Konstruktion richtiger Weiblichkeit.«[93]
Der Konflikt um Macht und Ehre baut auf der patriarchalen Aufladung des Fußballs auf und verstärkt sowohl die Rivalität zum als auch die Ablehnung des gegnerischen Vereins. Und dies kann sich auch durch antisemitisches Verhalten im Fußball entladen.
2.3 Fußall als Ort für männliche Vergemeinschaftung
Dass Fußball eine ausgeprägte männliche Tradition hat, wird in sporthistorischen Forschungen immer wieder hervorgehoben. Als Argument dient hier der Verweis auf die enge Verbindung von Sport und militärischem Drill.[94] »Es ist kein Zufall, dass die Klassiker der Männlichkeitsforschung immer wieder auf die Bedeutung der im 19. Jahrhundert neuen körperlichen Praktiken des Sports für die Konstruktion moderner Männlichkeiten hingewiesen haben.«[95] Auf Fußball bezogen, vertritt Thorstein Veblen die Auffassung: »Er [der Fußball] soll nicht nur den Körper stählen, sondern angeblich auch einen männlichen Geist hervorbringen, und dies nicht nur beim Sportler selbst, sondern auch beim Zuschauer.«[96]
Das ursprüngliche Volksspiel Fußball entwickelte sich in der Industrialisierung des ausgehenden 19. Jahrhunderts zum Arbeitersport.[97] Zum Ersten Weltkrieg hin änderte sich, nach Kreisky, die soziale Zusammensetzung der Fußballspielenden und -zuschauer wieder. Zunehmend kamen alle sozialen Schichten der männlichen Bevölkerung ins Stadion. Das Spiel zog aufgrund seiner immer stärker werdenden Betonung des Kampfes vor allem Männer ins Stadion. Das Spiel und das dazugehörige Umfeld waren von nun an männlich.[98] Die Zusammensetzung der Fanszenen im Stadion beschrieb Horak schon in den 1990er Jahren für Österreich anhand dreier Kategorien von Stadionbesuchern: die urban-traditionale, die familial-kommunale sowie die medialisiert-modernisierte Figuration. Der urban-traditionale Typus sei meist bei Spielen des städtischen Amateurfußballs anzutreffen:
»Auffällig ist hier zu allererst der niedrige Anteil weiblicher Besucherinnen von nur 5 Prozent. Hier herrschte – noch? – das Regime reiner Männerkultur und zwar in einer lokal gebundenen Form. […] Der Bezirksverein erscheint so als Ort der Ausagierung lokaler männlicher Vorstadt-Identitäten.«[99]
Regionalität ist auch für die zweite Kategorie, die familial-kommunale Figuration, bezeichnend. Diese Figuration spiele vor allem auf den Spielplätzen des unterklassigen Fußballs im ländlichen Bereich eine Rolle:
»Anders als bei der urban-traditionellen Ausprägung vermittelt sich hier viel über ›kinship‹, also verwandtschaftliche Bindungen. Diese familiale Dimension offenbart sich auch durch den hohen Prozentsatz der weiblichen Besucherinnen (etwa 25 Prozent).«[100]
Hier wäre es interessant zu untersuchen, ob sich diese Zahlen auf Deutschland und andere fußballsoziologisch vergleichbare Länder übertragen lassen.
Die medialisiert-modernisierte Figuration wiederum entspricht der Veränderung in der Fanzusammensetzung, wie sie je nach Ort in unterschiedlicher Stärke und Geschwindigkeit seit etwa den 1990er Jahren zu beobachten ist.[101] Sie wird als Auftauchen von neuen Männlichkeitstypen und in der wahrnehmbaren Zunahme des Frauenanteils in den Stadien skizziert. Horak verortet diesen Typus vor allem auf der Ebene des professionellen Spitzenfußballs,[102] der in den jeweiligen Bundesligen gespielt wird. Dort gebe es, im Gegensatz zu den 1990er Jahren, wo sich »die Anwesenheit von Frauen in den Stadien der europäischen Erstdivisionäre […] auf einen durchschnittlichen Anteil von selten mehr als 12 und maximal 15 Prozent«[103] beschränkte, einen deutlichen Anstieg von Frauen als Zuschauerinnen in den Stadien. Diese Zunahme sei dabei nicht gleichmäßig im Stadion verteilt, sondern vollziehe sich insbesondere auf den Stehplatztribünen, wo Horak Zahlen von bis zu 39 Prozent ermittelt hat.[104] Almut Sülzle merkt an, dass auch die Anwesenheit von Frauen in großer Zahl nicht zur Abname der männlichen Grammatik führe.[105] Sie verweist vielmehr darauf, dass »der männliche Raum der Fankultur«,[106] trotz des für Stadionverhältnisse gar nicht so geringen Frauenanteils unter den Besucher_innen, weiter intakt bleibe und von Männern und Frauen gemeinsam hergestellt werde.[107]
Damit lässt sich erklären, warum der Fokus in der Forschung der letzten Jahre, trotz der Veränderungen in der Zusammensetzung in der Zuschauer_innenschaft, zur Erklärung und Analyse von Fanverhalten, weiterhin stark der Frage nach Konzepten von Männlichkeiten bzw. Konstruktionen von Männlichkeiten nachgeht.[108] Fußball gilt hier als einer der Orte in der Gesellschaft, an dem ein überholtes Bild von Männlichkeit konstruiert werden könne: »Um sich der Männlichkeit immer wieder zu vergewissern, bedarf es männlicher Räume (Bourdieu 1997). Das Fußballstadion ist ein solcher Ort: Hier wird der männliche Habitus konstruiert und vollendet.«[109] Fußball wird als männlicher Raum[110] beschrieben, als Ort männlicher Sozialisation. Die Fankultur folge einer männlichen Grammatik, die frauenfeindlich sei.[111] Hier würden männlich konnotierte Verhaltensformen eingeübt und verfestigt, weitertransportiert und verstärkt ins individuelle Selbstbild eingebaut. Fußball als Spektakel sei von Männern für Männer ausgerichtet,[112] eines der letzten Reservate verlässlicher Männlichkeit.[113] Im Fußball gebe es zuweilen noch die Möglichkeit, fern seines Lebens-, Liebes- und Arbeitsalltags männliche Identitäten zu zelebrieren, zu kultivieren und zu bestätigen. Fußball biete damit die Möglichkeit der (Re-)Konstruktion von Männlichkeit.[114] Das heißt jedoch nicht, dass dies überall und zu jeder Zeit möglich sei. Archaische Männlichkeitsbilder sind im Fußball nicht unhinterfragt und überall gültig, aber sie könnten in einer Hyper-Macho-Inszenierung zelebriert werden.[115]
Georg Spitaler geht davon aus, dass die im Fußball verbindenden Erfahrungswelten an die Gemeinschaftserfahrungen von klassischen Männerbünden erinnern. Das Fußballstadion und die Fußballräume (gemeint sind damit zum Beispiel Kneipen, in denen Fußballspiele im Fernsehen gemeinschaftlich verfolgt werden) werden hier auch als letzte Reservate jenseits von bürgerlicher Familie und Ehe beschrieben, wo Emotionen, seien sie nun positiv oder negativ, zugelassen, ja sogar erwünscht sind. Es könnten gemeinsame Emotionen sowie eine Körperlichkeit ausgelebt werden, die in der Öffentlichkeit einem Tabu unterlägen.[116] Im Fußball würden sich Männer mit anderen Männern zu Männergruppen zusammenschließen, um sich gegenseitig zu stärken. Dadurch würden männliche Lebenswelten und »der gewalttätige, hypermaskuline Habitus vieler Fußballfans«[117] als normales Verhalten und als vorherrschend wahrgenommen. Becker spricht von einer »Macho-Kultur«.[118] Dem folge ein Ausschluss von Frauen und damit auch ihrer Erfahrungen und Lebensrealitäten. Nach Sülzle gebe es hier eine männliche Vergemeinschaftung,[119] in der Männer männlichen Habitus spielerisch erlernen würden.[120] Laut Michael Klein wiederum geht es im Rahmen der männlichen Inszenierung im Stadion vor allem um Machtkonkurrenz. Insbesondere junge Männer würden diese Konkurrenz einstudieren, die in ihrer Identitätsentwicklung eine herausgehobene Funktion einnehme.[121] Auch nach Kreisky würden Fanszenen zu vergemeinschafteten männlichen Kollektiven, die ihre Abgrenzung zum Gegner körperlich sowie durch Kleidung samt Symbolen darstellen.[122] Michael Meuser erweitert dies auf das Fußballspiel, das neben dem »Geschehen auf den Rängen, ein ernstes Spiel ist, in dem Männlichkeit her- und dargestellt und ein Grundmuster männlicher Vergemeinschaftung eingeübt wird.«[123] Die Auseinandersetzung mit dem Gegner, sei sie nun lokal, regional oder international, orientiere sich dabei an kriegerischen Vorlagen. Namen wie »Brigade« oder »Legion« von Fangruppen verdeutlichten dieses Selbstbild. Die Verherrlichung des Kollektivs ziele dabei auf abstrakte Gebilde wie Verein, Nation und ein ominöses männliches Wir.[124]
Kreisky sieht einen weiteren Grund für die Männlichkeitskonstruktionen innerhalb von Fußballfanszenen in der seit Jahrzehnten starken symbolischen Koppelung der örtlichen Fanszenen an die jeweilige Arbeiterklasse.[125] In dieser habe es inzwischen aber durch die Veränderungen und Verschiebungen in der Arbeitswelt gravierende Veränderungen in Größe, Anzahl und gesellschaftlicher Präsenz und, damit einhergehend, Veränderungen in der Selbst-, Fremd- und Außenwahrnehmung gegeben. Nachgefragt würden mittlerweile andere Typen von männlichen Arbeitern. Die Gesellschaft habe sich weiterentwickelt und biete heute eine Vielzahl von (aus-)differenzierten Männlichkeitsbildern an. Diese Vielfalt und Komplexität werde als Bedrohung für den eigenen sozialen Status gesehen, weshalb man sich von ihnen abgrenze.[126] Dieses Abgrenzungsbedürfnis kann sich in diskriminierendem Verhalten äußern:
»Einerseits ›wir‹, die ›wirklichen Männer‹, andererseits ›sie‹ (die Spieler der gegnerischen Mannschaft, der Schiedsrichter, die Journalisten der Hauptstadt, die immer gegen uns sind), die als ›unmännlich‹ geschmäht werden, als Homosexuelle in der passiven Rolle, als betrogene Ehemänner, unterwürfige Schwächlinge, Spätentwickler, Söhne, die die Ehre ihrer Mutter nicht verteidigen können.«[127]
Die Auseinandersetzung sei sexualisiert und ziele darauf ab, das Gegenüber symbolisch zu marginalisieren.[128] Die Schmähungen hätten zum Ziel, dem Gegner den Status als Mann abzuerkennen und bedürften keines besonderen Anlasses.[129] Im Umfeld von Fußball würden so Diskriminierungsformen gelebt, zelebriert und präsentiert. Laut Becker, der sich wiederum auf Thomas Gehrmann bezieht, werde z. B. auch »Jude« mit Unmännlichkeit assoziiert.[130] Die Ablehnung wird nicht nur verbal geäußert, sondern ebenso in physische Angriffe umgesetzt. Das Stadion als Raum bietet hervorragende Voraussetzungen für die Auseinandersetzung. Die auch räumlich vorgenommene Segregation in Heim- und Auswärtsfans zwingt dem Besucher des Stadions förmlich die Kategorisierung in Wir und die Anderen bzw. in Freund und Feind auf. Eine Niederlage der Mannschaft auf dem Spielfeld kann wiederum durch den Sieg der Fans auf körperlicher Ebene gemindert bzw. aufgehoben werden:
»Den erklärten Feinden die Vereinsembleme, Fahnen, Kutten oder Schals wegnehmen sind unmittelbare Anlässe – die Niederlage auf dem Spielfeld, Fouls mit Verletzungsfolge, unterstellte Benachteiligungen durch den Schiedsrichter, eine noch ›offene Rechnung‹ vom letzten [Aufeinander-]Treffen hingegen sind mittelbare Anlässe bzw. Herausforderungen, die den Provozierten in Handlungszwang bringen, will er nicht symbolisches Kapital und konkrete Machtposition einbüßen. Das überindividuelle Zwangssystem der männlichen Fanehre läßt hier keine Entscheidungsoffenheit, es sei denn, man akzeptiert die öffentliche Bloßstellung und dem damit verbundenen Status des ›Lutschers‹ oder des ›Kuttenkindes‹.«[131]
Neben der beschriebenen patriarchalen Aufladung des Fußballs und dem Kampf um Macht und Ehre steigert die männliche Vergemeinschaftung, in der abwertenden und diskriminierenden Abgrenzung zu dem Anderen, die Konstruktion eines männlichen Wir im Fußball. Es herrscht das Bild vor, soziale Klassen würden mit dem Eintritt ins Stadion oder den Verein an Gültigkeit verlieren bzw. ihre Wirkmächtigkeit für die Zeit des Spiels einbüßen.[132] Über allem schwebt, nach Kreisky, eine vergemeinschaftende Männlichkeitsideologie.[133] Dieses männlich-romantisierte Bild vom »sozialen Ort Stadion«[134] könne durch die Veränderungen in der Zusammensetzung der Fanszene bedroht sein.[135] Das Stadion wird demgegenüber als Reservat für Männlichkeit beschrieben, als ein letztes Refugium mit Modernisierungsrückstand, in dem die Dekonstruktion von echter Männlichkeit noch nicht um sich gegriffen habe.[136] Nach Kreisky verändert sich die Zusammensetzung der Zuschauer_innen in dem Maße, wie sich auch Männlichkeitsbilder in der Gesellschaft verändern: »Kraftstrotzende Männer werden in der neoliberalen Arbeitswelt immer seltener gebraucht, statt ihrer sind in der neuen agonalen Berufswelt smarte und clevere, in Fitness-Studios gestylte Finanz- und Business-Männer gefragt. Sport erzeugt jene Körper und Mentalitäten, die in dieser schönen neuen Berufswelt als unerlässliche Qualifikation eingefordert werden.«[137] Die hegemoniale Männlichkeit der Arbeitswelt[138] könne im Stadion daher, wie Kreisky andeutet, von den neuen Männlichkeiten in der New Economy, der Kreativszene und der New Media – des selbstunternehmerischen Ich – bedroht sein. Sülzle argumentiert gegen diese These und geht davon aus, dass Männlichkeit im Stadion hilft, die »gesellschaftliche Konstruktion männlicher Herrschaft« zu naturalisieren[139] und die Vormachtstellung von Männern zu untermauern.[140] Hier wird ersichtlich, dass ein weiterer Konflikt im Fußball ausgetragen wird: der Kampf um die herrschenden Männlichkeitsbilder. Die Auseinandersetzung darum befeuert zusätzlich Rivalitäten und Abgrenzung, sie bezieht sich dabei aber nicht nur auf das Andere des gegnerischen Vereins, sondern führt auch innerhalb des eigenen Vereins, des konstruierten Wir, zu internen Konflikten. Wie bei der herabwürdigenden Abgrenzung zum Anderen des gegnerischen Vereins, wird bei den internen Konflikten mit Hilfe antisemitischer Zuschreibungen die Abwertung verstärkt.
Die hier dargestellte männlich-patriarchale Aufladung des Fußballs, so ist abschließend festzuhalten, ist ein wichtiger Grund für die abwertenden, diskriminierenden und antisemitischen Verhaltensweisen im Fußball.
3. Antisemitismus in Deutschland: Forschungsstand
Antisemitismus ist ein Problem innerhalb der deutschen Gesellschaft. Die verschiedenen Studien zu antisemitischen Einstellungen der deutschen Bevölkerung zeigen auf, dass es seit Mitte der 1950er Jahre eine kontinuierliche Abnahme von Antisemitismus gegeben hat.[1] Dieser Trend wurde, laut dem Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, in den 1980er Jahren bis zur Mitte der 1990er Jahre von einer ersten Welle mit erhöhten Werten und ab Anfang der 2000er Jahre bis zur Mitte der 2000er Jahre von einer zweiten Welle abgebrochen.[2] Aktuelle Studien gehen davon aus, dass heute zwischen 12 und 21 Prozent der deutschen Bevölkerung ein antisemitisches Weltbild haben.[3] Antisemitismus in Deutschland ist somit kein historisch überholtes Phänomen. Er passt sich vielmehr den jeweils aktuell gegebenen Bedingungen an.[4] Monika Schwarz-Friesel ist der Auffassung, es gebe heute eine niedrigere Hemmschwelle für antisemitisch und stark anti-israelische Äußerungen in der Öffentlichkeit als noch vor einigen Jahren.[5] Es bestehe ein Zusammenhang zwischen der in den Medien präsenteren anti-israelischen Berichterstattung und der temporären Zunahme von Antisemitismus seit dem Jahre 2000.[6] Unerforscht ist derzeit, »wie Antisemitismus in der Alltagskommunikation unter ›ganz normalen Jugendlichen‹ tatsächlich aussieht«.[7] In noch größerem Maße trifft dies auf den Kontext Fußball zu.
3.1 Definition von Antisemitismus
Antisemitismus als Sammelbegriff beschreibt[8] die Stigmatisierung von Menschen, egal ob jüdisch oder nicht, als Juden, die aufgrund dieser Zuschreibung mit einem (negativen) Merkmalsbündel belegt werden.[9] Der Begriff umfasst dabei »die Gesamtheit judenfeindlicher Äußerungen, Tendenzen, Ressentiments, Haltungen und Handlungen, unabhängig von ihren religiösen, rassistischen, sozialen oder sonstigen Motiven«,[10] mit denen Juden innerhalb der Gesellschaft als fremde und homogene Gruppe kenntlich gemacht werden.[11] Antisemitismus unterscheidet sich vom Rassismus darin, dass der Gruppe der Juden nicht unbedingt eine Unterlegenheit zugeschrieben wird. Der Gruppe der Juden wird eher, gespeist durch die soziale Paranoia der Weltherrschaft der Juden, eine Weltverschwörung unterstellt.[12] Nach Werner Bergmann handelt es
»sich beim Antisemitismus also nicht bloß um Xenophobie oder um ein religiöses und soziales Vorurteil, das es gegenüber Juden auch gibt, sondern um ein spezifisches Phänomen: eine antimoderne Weltanschauung, die in der Existenz der Juden die Ursache sozialer, politischer, religiöser und kultureller Probleme sieht.«[13]
Für das Konzeptualisierungsmuster Antisemitismus ist der Bezug zu Stereotypen und Vorurteilen konstitutiv. Antisemitismus dient »primär als Deutungsmuster für Juden als Andersartige, um diese zu ›Sündenböcken‹ in der hermetisch abgeschlossenen antisemitischen Wirklichkeitskonstruktion zu machen«.[14] Nach Schäuble stellen »antisemitische Topoi gesellschaftliche Ordnungsschemata dar«.[15] Antisemitismus beruhe auf einer strikten binären Codierung: einerseits die positiv besetzte homogene Wir-Gruppe; andererseits die prinzipiell negativ besetzte Ihr-Gruppe der Juden, die im existentiellen Kampf von Gut gegen Böse für das Böse steht.[16] Antisemitismus sei immer eine Differenzkonstruktion. Wenn Juden als differente Gruppe dargestellt werden, herrsche die Vorstellung vor, dass sie sich von der eigenen Gruppe, dem Selbst, maßgeblich unterscheiden müssten.[17] Zusätzlich werde die Gruppe der Juden, in die das Gegenüber einsortiert werde, als ein in sich homogenes Kollektiv wahrgenommen, das die gleichen Interessen und Ansichten vertrete.[18] Selbst wenn keine Bewertung der Fremd- und Wir-Gruppe über Attribute wie besser, schlechter oder Ähnliches vorgenommen werde, könnten die Zuschreibungen zumindest mit Gegnerschaft und Antipathie verbunden werden.[19] Bei der antisemitischen Kommunikation werde nicht nur die Fremdgruppe hergestellt, sondern auch die eigene Gruppe von dieser abgegrenzt.[20] In der Stigmatisierung werde zusätzlich eine Entscheidungsdynamik provoziert.[21] Der oder die Sprecher_in eröffne ein antisemitisches Angebot, an dem die zuhörende Person partizipieren könne. Die im Rahmen einer antisemitischen Kommunikation adressierte Person, aber auch die, die als Dritte die Kommunikation mitbekommt, müsse sich entscheiden, ob sie das Erwähnte als Antisemitismus deute oder nicht und es dementsprechend einordnen. Ist das Gesagte ein Skandal? Wie hat die sprechende Person dies gemeint? Hierauf folge die nächste Entscheidung: Wie kann / muss reagiert werden? Eine Erwiderung könnte dem Gesagten zu viel Relevanz zumessen. Durch Ignorieren oder Schweigen könnte eine Zustimmung unterstellt werden.[22] Für Adressaten und Zuhörende der Äußerung stelle dies ein Dilemma dar, das noch dadurch verstärkt werde, als dass eine Reaktion, die das Gesagte als antisemitisch dechiffriert, zu einem Selbstausschluss aus der Eigengruppe führen könnte.[23]
Insbesondere die Konzeption dichotomer Gruppen mit einhergehender Abwertung der Gruppe der Anderen als Gegner und gleichzeitiger Aufwertung und Höherstellung der eigenen Wir-Gruppe ist beim Fußball allgegenwärtig. Auf die gegnerische Gruppe werden dabei zuweilen die Stigmatisierungen und negativen Merkmalsbündel des Antisemitismus übertragen. Die Verbindung der Abwertung mit antisemitischer Zuschreibung provoziert auch beim Fußball die beschriebene Entscheidungsdynamik. Das erwähnte Dilemma des Einordnens der antisemitischen Kommunikation ist es, die insbesondere beim Fußball für so große Unsicherheit in der Auseinandersetzung mit dem antisemitischen Verhalten von Fans und Spielern führt, wie sich in dieser Untersuchung zeigen wird.
3.2 Kommunikationslatenz
Nach Werner Bergmann und Rainer Erb gibt es in der Gesellschaft ein Wissen darüber, was im Rahmen des Erlaubten über Juden nach dem Ende des Nationalsozialismus 1945 öffentlich geäußert werden darf und kann und was nicht. Sie bezeichnen dies als Kommunikationslatenz,[24] die zur Vorurteilsrepression führte:[25] Antijüdische Stereotype fanden nach 1945 in der Kommunikation nur noch eine schwache Verwendung, was zur Folge hatte, dass die Funktion des Antisemitismus »als offenes politisches und weltanschauliches Instrument verloren« ging.[26] Dementsprechend positioniert sich der oder die antisemitische Sprecher_in uneindeutig innerhalb oder deutlich außerhalb des angenommenen erlaubten Rahmens. Die zuhörende Person steht vor dem Problem, durch Erwiderung eine antisemitische Dechiffrierung des Gesagten vorzunehmen. Außerdem steht sie vor der Unwägbarkeit, wie ihre Gruppe darauf reagiert. Solange es in dieser eine Antisemitismus ablehnende Grundhaltung gibt, könnte eine positive oder positiv gedeutete Reaktion auf antisemitische Sprechweisen auch zu einem Ausschluss aus dieser führen.[27]
Weiterhin ist es wichtig, den gesellschaftlich akzeptierten Rahmen, die Kommunikationslatenz, mit einzubeziehen, denn dieser Rahmen entscheidet, wie über Juden und Antisemitismus in der deutschen Öffentlichkeit geredet wird – und geredet werden darf.[28] So werden zum Beispiel seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der Bundesrepublik die offensten Formen des Antisemitismus als Straftatbestand der Volksverhetzung unter Strafe gestellt und juristisch geahndet.[29] Kinder und Jugendliche lernen in der Schule und in den Medien nicht nur, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, sondern auch, wie gesellschaftlich angemessenes Verhalten dazu aussieht bzw. welches Verhalten erwartet wird.[30] Bernd Marin spricht davon, dass es Antisemitismus »nach 1945 als Ideologie nicht mehr geben durfte«.[31] So seien zwar in der Öffentlichkeit die direktesten Formen antisemitischer Kommunikation verschwunden, aber dies habe zu einer »›(Re)Privatisierung‹ des Antisemitismus«[32] geführt und »jenen paradoxen Zustand der Koexistenz von Vorurteilskristallisation und ›offizieller‹ Vorurteilsrepression« hervorgerufen.[33] Um dem gesellschaftlichen Standard gerecht zu werden, hat sich eine modernisierte Form des Antisemitismus entwickelt, deren Schreib- / Kommunikations- / Denk- und Ausdrucksformen durch eine ideologische Codierung nach außen getragen werden. Der Antisemitismus »hat seine Funktion als politische Ideologie verloren, existiert aber als ein diffuses, offiziell unterdrücktes Vorurteil weiter, was jedoch seine politische Verwendung keineswegs ausschließt«.[34] Dies verdeutlichen die in regelmäßigen Abständen auftauchenden politischen Skandale und Kontroversen der letzten Jahre. Exemplarisch sei hier auf die Möllemann-Debatte 2002 und die Affäre Günzel-Hohmann 2003 verwiesen. Im (scheinbaren) Gegensatz zur Kommunikationslatenz steht das Aufkommen von antisemitischen Verhaltensweisen im Fußball in den 1980er Jahren. Für die vorliegende Studie stellt sich nun die Frage, ob im Fußball die von Bergmann und Erb beschriebene Kommunikationslatenz seit den 1980er Jahren entweder nicht mehr besteht oder seit diesem Zeitpunkt einer Erosion unterliegt.
Das aus der Kommunikationstheorie stammende Konzept der provozierten Entscheidungsdynamik und der Ansatz der Wir-Gruppen erzeugenden Funktion von Antisemitismus sind für meine Untersuchung zentral, da sowohl Fangruppen als auch Mannschaften Identitäten bilden, die sich nach außen und gegenüber einem konstruierten Anderen abgrenzen. Antisemitische Stereotype beziehen sich, auch dies ist auf den Fußball übertragbar, in der Regel nicht auf direkte und persönliche Erfahrungen mit Juden, sondern auf angeeignete Sekundärerfahrungen.[35] Es wird auf einen gesellschaftlich tradierten kulturellen Wissensschatz zurückgegriffen.[36]
»Stereotype Konzeptualisierungen von Juden haben mit der tatsächlichen Realität nicht viel gemeinsam, es handelt sich um Feindbild-Konstruktionen, um weitgehend fiktive Kategorien, die aber für die Personen, die sie im Langzeitgedächtnis gespeichert haben, absolute Verbindlichkeit besitzen.«[37]
In dieser Studie soll daher berücksichtigt und untersucht werden, welche Funktionen antisemitische Handlungen und Kommunikationsweisen für den einzelnen Fan sowie für die Fangruppe haben. Ich schließe mich hier Schwarz-Friesel an, die betont, es sei »kritisch zu hinterfragen, welche Funktion genau Stereotype bei der aktuellen antisemitischen Sprachverwendung haben, wie man sie wissenschaftlich am besten beschreiben kann und wie sie an emotionale Informationsrepräsentationen gekoppelt sind«.[38]
Michael Reichelt wiederum verweist auf eine Instrumentalisierung des Begriffs »Jude« im Sprachgebrauch.[39] Das Wort »Jude« erfahre durch die synonyme Verwendung für abwertende Bezeichnungen eine Bedeutungsveränderung. Vergleichbares wird auch von John Efron in einem Artikel zum Londoner Verein Tottenham Hotspur beschrieben. Es beschreibt, wie die Bezeichnung »Yid« immer mehr als Bezeichnung für Tottenham-Fans und nicht mehr mit jüdischen Menschen in Verbindung gebracht wird.[40] Eine Bedeutungsveränderung des Begriffs »Yid« hat es, ausgehend vom Fußball, hier zumindest in Teilen der Gesellschaft gegeben. Antisemitismus unterliegt gesellschaftlichen Reaktionsroutinen. Er ist moralisch aufgeladen und ruft damit Handlungen hervor. Dabei unterscheidet sich aber individuell, was als Antisemitismus wahrgenommen wird und was nicht.[41] Außerdem ist zu beachten, »dass ein Verständnis von Antisemitismus, das diesen als einheitliches und in sich geschlossenes System immergleicher Vorurteile, Stereotype oder Einstellungen begreift, nicht hinreichend ist«.[42] Auf den Fußball bezogen heißt dies, die verschiedenen antisemitischen Verhaltensweisen zu differenzieren und nicht pauschal allen an den Handlungen Beteiligten ein geschlossenes antisemitisches Weltbild zu unterstellen.
3.3 Antisemitische Differenzkonstruktion
Mit Hilfe von Antisemitismus können Grenzen gezogen und eine Identität als Wir-Gruppe konstruiert werden.[43] Antisemitismus kann somit gruppenbildende Funktionen besitzen. Die Konstruktion differenter Gruppen ermöglicht es, die Eigengruppe in der Selbstwahrnehmung als höherwertig darzustellen und wahrzunehmen, wenn demgegenüber Fremdgruppen abgewertet und als minderwertig angesehen werden. Dies gestattet es insbesondere auch Jugendlichen, die ihren eigenen sozialen Status als schwach und marginalisiert betrachten, sich in der Abgrenzungsauseinandersetzung zu behaupten.[44] Die Verteidigung der eigenen Gruppenidentität wird als identitätsstiftende und -wahrende Komponente angenommen.[45] Soziale Selbstpositionierung kann durch die Verortung der eigenen Gruppe gegenüber der jüdischen Fremdgruppe[46] anhand von Kategorien wie besser–schlechter, oben–unten vorgenommen und damit eine komplexitätsreduzierte Sicht auf die soziale Realität generiert werden.
Schäuble kommt in einer Studie aus dem Jahre 2012, die Antisemitismus bei Gruppen von Jugendlichen untersucht, zu dem Schluss: Juden werden als eine Gruppe wahrgenommen, »die anders ist als wir«. Juden würden sich von der eigenen Gruppe, dem Wir, unterscheiden. Die Eigengruppe werde dabei nicht nur als das Normale, sondern auch als das Höherwertige angesehen.[47] Juden würden gegenüber der eigenen, nichtjüdischen Gruppe kulturell und religiös different wahrgenommen: als Gruppe, die sich als nicht »richtige« deutsche Gruppe von der Gruppe der »wahren« Deutschen unterscheide.[48] Im Gegensatz zu Schäuble sehe ich hier jedoch noch keinen Antisemitismus, da nur eine Andersartigkeit festgestellt wird. Es ist damit eine Differenzwahrnehmung. Erst wenn die Wahrnehmung der Andersartigkeit mit Abwertung, Ablehnung und /oder Höher- / Minderwertigkeit belegt wird, spreche ich von Antisemitismus. Schäuble kommt weiter zu dem Schluss, dass Juden eine Homogenität in der Kollektivgruppe »Juden« zugeschrieben wird. Es bestehe die Annahme, »dass das Verhältnis von Juden und Nicht-Juden durch schwer überbrückbare und das Zusammenleben erschwerende oder gar verunmöglichende Unterschiede bestimmt ist«.[49] Auch diese Feststellung ist, ohne die Verknüpfung mit der Abwertung von Juden, erst einmal eine Differenzwahrnehmung. Interessant ist hier für mich, dass diese Feststellungen und die weiteren Annahmen auf die Verhaltensweise von Fans und Fangruppen übertragbar sind, die oft eine parallele Sichtweise auf gegnerische Fangruppen haben. Auch hier wird von einem gegnerischen Kollektiv ausgegangen, das sich von dem eigenen grundlegend unterscheide. Die Unterscheidung in der Vereinsangehörigkeit wird häufig mit abwertenden, negativen Merkmalen aufgeladen. Dazu werden zum Beispiel Geschichten tradiert, die die gegnerische Gruppe gegenüber der eigenen abwertet. Zusätzlich werden Attribute wie »feige« und »hinterhältig« mit der abgewerteten gegnerischen Fangruppe assoziiert, die dem ehrenhaften Selbstbild der Eigengruppe massiv zuwider sind.
3.4 Intendierter – nicht intendierter Antisemitismus
Schwarz-Friesel beschreibt antisemitische Äußerungen »als Verbalmanifestationen von stereotypen Konzeptmustern und negativ geprägten Emotionseinstellungen«.[50] Der verbale Antisemitismus[51] könne explizit oder implizit geäußert werden.[52] Zusätzlich gelte es, zwischen intentionalem und nicht-intentionalem verbalen Antisemitismus zu unterscheiden.
»Die nicht-intentionale Variante ist dadurch gekennzeichnet, dass bei der Produktion der Äußerung auf der konzeptuellen Planungsebene keine bewusste antisemitische mentale Repräsentation vorliegt, sondern der Verbalisationsprozess durch unbewusste mentale Stereotype und / oder habitualisierte Floskeln sowie Idiome beeinflusst wird.«[53]
Beim nicht-intentionalen Antisemitismus unterscheidet Schwarz-Friesel zusätzlich zwei Varianten. Die erste Variante beschreibt die Sprachproduktion aufgrund von mentalen stereotypen Konzeptmustern, die die Verbalisierung bewusst beeinflussen. Dazu gehören Äußerungen, die sich auf eine angeblich spezifische Physiognomie von Juden beziehen, oder Äußerungen, denen das Stereotyp zu Grunde liegt, Juden seien keine Deutschen und ihre Heimat sei Israel. Die vorgenommenen Äußerungen würden dabei nicht zwingend eine judenfeindliche Haltung intendieren.[54]
Bei der zweiten Variante wird die mentale Produktion von Äußerungen durch abgespeicherte Verbindungen zu Redewendungen und Floskeln beeinflusst. Eine antisemitische Intention liege auch diesen zumeist nicht zu Grunde:
»Es handelt sich hierbei um sprachliche Phrasen im deutschen Sprachgebrauch, die seit Generationen im Diskurs benutzt werden, aber nicht (notwendigerweise) intentional diskriminierend (und auch nicht – wie in der ersten Variante – auf bewussten Konzeptualisierungsprozessen basierend) benutzt werden. Durch ihre (unbewusste) klischeefestigende und stereotyperhaltende Funktion jedoch tragen sie zum Erhalt kommunikativer Schablonen bei.«[55]
Dies sei etwa dann der Fall, wenn sprachlich ein Dualismus von Deutschen und Juden hergestellt werde. »Demgegenüber bestimmen bewusste antisemitische mentale Repräsentationen im Fall des intentionalen verbalen Antisemitismus die Sprachproduktion.«[56]
Beim intentionalen Antisemitismus liege die Handlungsabsicht in einer absichtlichen direkten Abwertung von Juden. Diese könne sich in Verallgemeinerungen äußern, in der von Einzelnen auf die Gruppe geschlossen werde. Intentionaler Antisemitismus liege auch bei einer rassistischen Definition von Juden vor sowie dann, wenn die deutsche Verantwortung für den Holocaust angezweifelt, relativiert oder geleugnet werde.[57]
Beide Varianten des Antisemitismus, die intentionale und die nicht-intentionale, kommen bei der gegenseitigen Abwertung von Vereinen, Fans und Spielern im Fußball vor. Häufig mischen sich diese beiden Ebenen im Fußball, weshalb es schwer ist, die verschiedenen Vorfälle als eindeutig antisemitisch intendierte oder nicht-intendierte Handlungen einzuordnen. Die antisemitischen Stereotype werden auf Individuen und soziale Formationen bezogen:[58] »Dies umschließt auch jene Individuen, denen die Angehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Formation fehlerhaft zugesprochen wird.«[59] Nach Schäuble sollten außerdem diejenigen Aussagen über Juden als potentiell antisemitisch wahrgenommen werden, in denen es um Typologisierungen von Juden gehe.[60]
»Als besonders produktive Varianten sind auf der Lexemebene pejorative Nomina wie Determinativkomposita (Niggerbrut, Judenpack, Ausländerabschaum), Adjektive (dämlich, schamlos, gerissen, schmutzig) und Verben (beuten aus, nutzen aus, verschwenden, überfluten) zu nennen«,
stellt Schwarz-Friesel fest.[61] Durch Substantive werden Zuschreibungen verbalisiert. Dadurch, dass etwas mit einem Namen bezeichnet wird, wird es abgegrenzt und spezifiziert. Des Weiteren wird das Substantiv mit Eigenschaften belegt.[62] Die Äußerung »Du Jude!« ist beispielsweise solch eine Substantivierung. Wenn dies nun auch noch mit einer zusätzlichen Beschreibung einer Tierart verknüpft wird, wird zusätzlich das Unmenschliche hervorgehoben: »Du Judensau!« oder »Judenschwein!«. In der Abwertung findet eine Aufwertung und Abgrenzung als Mensch gegenüber einer Tierart statt.[63] Damit unterliegen solche Bezeichnungen Pejorisierungsmustern.[64] Im Fußball gibt es eine Reihe von Beispielen, in denen gegnerische Vereine oder Fans z. B. als »Jude XY« tituliert werden, wobei für XY der reale Vereinsname eingesetzt wird.
3.5 Abwertung
In Anlehnung an Antje Hornscheidt et al. gehe ich von einer pragmatischen Sicht auf Sprache aus, die jegliche sprachliche Äußerung als Handlung wahrnimmt und als solche beschreibt.[65] Diskriminierung über Sprache ist eine gewalttätige Handlung.[66] Sprachliche Gewalt wird hier, im Gegensatz zur körperlichen Gewalt, als symbolische Gewalt begriffen.[67] Um in dieser Studie Antisemitismus beschreib- und analysierbar zu machen, greife ich zudem auf den Begriff der Pejorisierung zurück, den ich, in Anlehnung an Hornscheidt, als ein Modell zur Analyse von antisemitischen Äußerungen verwende.[68] Pejorisierung beschreibt sprachliche Handlungen, mit deren Hilfe Einzelne oder Personengruppen abgewertet werden. Konkret heißt dies,
»dass eine Beschimpfung von einer Person durch eine andere eine dritte Person bzw. eine abstraktere soziale Position diskriminiert und in der konkreten Beschimpfung einer Person durch eine andere eine strukturelle pejorisierende Diskriminierung einer Dritten realisiert wird«.[69]
Aussprechende und Adressierte einer Pejorisierung müssen nicht mit den »Diskriminierten und Privilegierten in eins fallen«. Außerdem können »[p]rivilegiert positionierte Personen«[70] zwar beschimpft, aber nicht pejorisiert werden.[71] Nach Hornscheidt besteht eine Pejorisierung auch dann, wenn die sprachliche Diskriminierung indirekt eine Person »›treffen‹ kann, indem bestimmte personen- und gruppenbezogene Normvorstellungen über diese sprachlich realisiert werden. […] In und durch sie werden strukturell diskriminierende Vorstellungen zu Menschengruppen aufgerufen.«[72] Die Anwesenheit der sprachlich diskriminierten Personen oder Personengruppen sei dabei nicht vonnöten.[73] Diese Feststellung ist für die Beschreibung von Antisemitismus im Fußball von Interesse, weil es sich hier, wie bei der Verbalisierung, erneut um die Diskriminierung von konstruierten oder nicht anwesenden Gruppen handelt. Mit dem Instrument der Pejorisierung können des Weiteren Sprachhandlungen auch als Diskriminierung bewertet werden, wenn die Betroffenen der Handlung diese selbst nicht als solche auffassen.[74] Antisemitismus als sprachliche Diskriminierung ist »an die kontinuierliche Re-Aktivierung von (teils bewussten, teils unbewussten, zum Teil stark emotional kodierten) Vorurteilen« gebunden.[75] Die Polarisierungen, die durch Pejorisierungen geschaffen werden, bewerten Personen nach Normalitätsvorstellungen, die damit reproduziert werden: »Sie grenzen ab, schließen aus oder ordnen zu, indem sie eine als existent angenommene Normalität voraussetzen und konstruieren und dieser gegenüber das Andere, Abweichende sprachlich benennend schaffen.«[76] Verhaltensweisen, die der Norm entsprechen, unterliegen einer positiven Wahrnehmung. Verbal abgewertet werden dem gegenüber Verhaltensweisen, die als un-normal gelten. Bestätigt wird damit wiederum die Allgemeingültigkeit der normalen Verhaltensweisen. »Der Rückgriff auf als allgemein bekannt angenommenes Wissen setzt Allgemeingültigkeit und allgemeine positive Wertung dessen voraus, z. B. auch durch die zu benennenden Personen. Diese würden andernfalls die Äußerungen nicht als abwertend verstehen können.«[77] Die mit der Zuschreibung »Jude« konventionalisierte Abwertung bedarf keiner weiteren Erklärung, da die implizierte Diskreditierung als allgemeingültige Selbstverständlichkeit angenommen wird. Auf den Fußball übertragen bedeutet dies, dass die Wir-Gruppe, der eigene Verein, als Norm angesehen wird. Der gegnerische Verein, der abgewertet wird, gilt demnach als un-normal. Um diese Abwertung zu verdeutlichen, bedienen sich Fans oder andere Angehörige des Vereins des Lexems »Jude« in der abwertenden Beschreibung des gegnerischen Vereins.
3.6 Antisemitische Kommunikation unter Jugendlichen
Antisemitische Kommunikation wird im Alltag an verschiedenen Orten und in verschiedenen Kontexten sichtbar. Insbesondere in der Beschimpfungskultur unter Jugendlichen taucht Antisemitismus regelmäßig auf.[78] Die Verwendung des Lexems »Jude« als Schimpfwort scheint dabei in den letzten Jahren zugenommen zu haben. Diese These treffe ich aufgrund von persönlichen Beobachtungen[79] und der Auswertung meiner Interviews, in denen es auch immer wieder Hinweise zur Unterstützung dieser These gab. Umstritten ist, ob die Intention in der Verwendung des Lexems »Jude« wirklich anti-jüdisch bzw. antisemitisch aufgeladen ist.[80] Die Semantik des Lexems ist nicht deutungsleer, sondern zumeist verbunden mit diversen Zuschreibungen, die mal stärker, mal schwächer an antisemitischen Stereotypen orientiert sind. Dieser Beobachtung ist bisher wissenschaftlich kaum nachgegangen worden. Eine der wenigen Studien, die sich mit dieser Thematik befasst, ist die von Schäuble. Sie weist darauf hin, dass Jugendliche häufig »Jude« und ethnisierende Sprüche unkritisch, wenn nicht verharmlosend, als Schimpfwort verwenden.[81]
Schäuble beobachtet in ihren Gruppengesprächen, dass sich Jugendliche untereinander als »Jude« beschimpfen oder dies als Beschimpfung für nicht anwesende Personen benutzen. Für Schäuble sind solche Beschimpfungen in zweierlei Hinsicht interessant. Zum einen als Abwertung, die wirklich anti-jüdisch intendiert ist, zum anderen aber auch als Stigmatisierungspotential, von dem die Jugendlichen zu wissen meinen, dass es allem als jüdisch Identifizierten zu Grunde liegt. In diesen Beschimpfungen zeige sich aber nicht zwingend eine anti-jüdische Haltung. Beide Formen würden allerdings aufgrund von gruppendynamischen Interaktionsprozessen und der Emotionalität der Abgrenzung ineinander übergehen.[82] Es ist meines Erachtens davon auszugehen, dass Jugendliche dieses angelernte Verhalten mit zum Fußball tragen und dort reproduzieren.
Wie Schäuble weiter aufzeigt, scheint es »nicht sinnvoll, von einem einheitlichen Antisemitismus unter Jugendlichen auszugehen«.[83] Antisemitismen seien heterogen und unterschiedlich stark in der Gesellschaft verwurzelt. Auf ihr Repertoire könne als Deutungsofferte frei zurückgegriffen werden. Warum allerdings auf sie zurückgegriffen werde, muss im jeweiligen Fall immer wieder neu analysiert und ermittelt werden. So könnten auch gleichlautende antisemitische Formulierungen jeweils eine andere Bedeutung bzw. Intention haben.[84] Schäuble weist darauf hin, dass in der Sprache der Jugendlichen die unterschiedlichen antisemitischen Kommunikationen in verschiedener Quantität und Qualität vorkämen. Viele Jugendliche scheinen ihr »antisemitisches Vorwissen« ziemlich kritiklos zu verwenden.[85] Schäuble ist nicht der Meinung, es sei sinnvoll, diese Jugendlichen alle als »Antisemiten« zu bezeichnen. Dies stehe aber im Widerspruch zu der gesellschaftlich weit verbreiteten Annahme, dass antisemitische Aussagen nur vor dem Hintergrund eines gefestigten antisemitischen Weltbildes getroffen werden könnten. Das treffe aber nicht unbedingt zu, da neben einem weit verbreiteten antisemitischen Wissen und dem Gebrauch antisemitischer Stereotype, »ohne sich dessen negativem Hintergrund bewusst zu sein« bzw. »ohne diesen so zu meinen«, oft zu viele Widersprüchlichkeiten auftauchen. Antisemitische Aussagen seien damit zwar weiterhin problematisch, würden aber nicht auf einer antisemitischen Ideologie aufbauen.[86] Diesen Einwand erachte ich als sehr wichtig, um einen differenzierten Blick auf die antisemitisch konnotierten Verhaltensweisen im Fußball zu behalten. Nach Schäuble gehe es bei den Schmähungen »oft weniger um die Bewertung von anderen […], als vielmehr um eine Zur-Schau-Stellung und ein Auskosten von Ekel und Verachtung«.[87]
An Schäubles Herangehensweise ist kritisch zu hinterfragen, wie festgelegt wird, ab welchem Punkt eine Aussage als antisemitisch eingestuft werden muss und bis zu welchem Punkt sie dies noch nicht ist. Schäuble vermutet, wobei sie sich auf Didier Lapeyronnie bezieht, dass Juden meist wohl nicht die Hauptadressaten der Jugendlichen in einer beschimpfenden Kommunikation seien.
»Nicht nur, weil antisemitische Beschimpfungen, wie Lapeyronnie erklärt, gesellschaftlich besonders geächtet seien, sondern weil Fremdkategorisierungen, die sich zwar prinzipiell für beliebige Abgrenzungen nach oben oder unten eigneten, in der Jugendkommunikation eher konkrete Personen aus dem Handlungsfeld der Jugendlichen beträfen.«[88]
Damit ist aber noch nicht erklärt, warum es zu antisemitischen und antijüdischen Abgrenzungen kommt. Des Weiteren bleibt offen, ob bestimmte situative Anlässe oder Verhaltensweisen antisemitische Kommunikation befördern bzw. wahrscheinlich machen. Wenn eine (antisemitische) Schmähung gegen eine Person gerichtet, diese Person als »Jude« oder »jüdisch« bezeichnet wird, dann wird diese Person(engruppe) zum »Juden« transformiert und übernimmt die damit verbundenen und zugeschriebenen Merkmale. Sie wird neu erschaffen und mit einer Reihe von zugewiesenen Attributen und Eigenschaft belegt.[89] Und genau dieser Vorgang ist im Fußball zu beobachten, wenn der gegnerische Verein, das Andere, als »Jude« bezeichnet wird. Das Stigma des Juden wird als Abgrenzung und distanzschaffende Kommunikation eingesetzt.[90] Die stigmatisierte Person oder Gruppe wird zum Stigmaträger und damit der jüdischen Kollektivgruppe zugeordnet.[91] Das funktioniert freilich nur, wenn die der Kollektivgruppe zugeordneten Eigenschaften und Attribute negativ konnotiert sind. Genau dies ist bei den antisemitischen Verhaltensweisen im Fußball in der Regel gegeben.
4. Antisemitismus im Fußball: Forschungsstand
Es gibt nur eine geringe Anzahl von Publikationen, die das Auftreten von antisemitischen Stereotypen im Fußballumfeld als eigenständiges Phänomen behandeln, und noch weniger Studien setzen sich mit den dafür verantwortlichen spezifisch fankulturellen Ursachen auseinander.[1] Die wissenschaftliche Literatur zum Verhalten von Fußballfans konzentrierte sich lange vor allem auf das Problem der Gewalt.[2] Diskriminierendes Verhalten wurde in der Regel nur im Hinblick auf Rassismus und Xenophobie gesehen und untersucht,[3] Antisemitismus unter Rassismus[4] oder Rechtsextremismus[5] subsumiert und nicht als Diskriminierungsform gesehen, die spezifischen Konstruktionsprinzipien unterliegt.[6] Hinzugekommen sind in den letzten Jahren wissenschaftliche Abhandlungen sowie Studien zu Homophobie und Sexismus im Fußball.[7]
Diejenigen Studien, die antisemitische Verhaltensweisen zumindest teilweise mit untersuchen, diskutieren das Phänomen des Antisemitismus im Fußball am Rande,[8] weisen aber zugleich ausdrücklich auf die Gefahren des als normal empfundenen Antisemitismus hin: »Gerade diese schleichende, scheinbar normale Form des Antisemitismus, die von Fan zu Fan tradiert wird, ist es, die uns sehr wohl als problematisch erscheint, weil sie häufig als Banalität abgetan wird und gedankenlos weitergegeben wird.«[9]





























