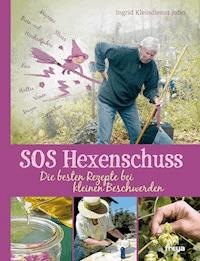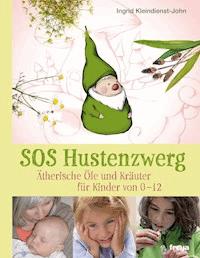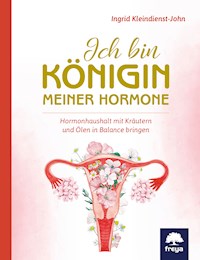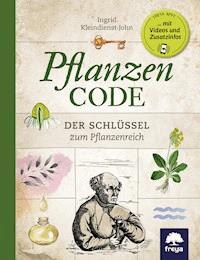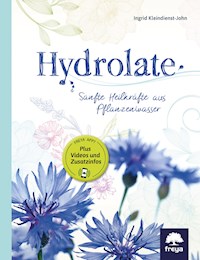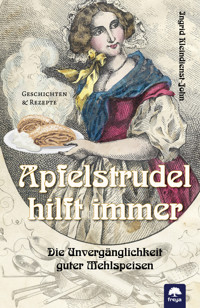
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Freya
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der Apfelstrudel, ein beliebtes Gebäck in Österreich und der ehemaligen Österreich-Ungarischen Monarchie, genießt auch heute noch besondere Beliebtheit. Doch nicht nur der Apfelstrudel hält verlockende Seiten bereit, es gibt eine Vielzahl von Mehlspeisen, die in der Familie der Autorin regelmäßig gebacken wurden. Viele dieser süßen Leckereien sind eng mit familiären Geschichten verknüpft. Tauchen Sie ein in die vergangenen Zeiten mit ihren Erzählungen und Gebäcktraditionen! Zahlreiche Rezepte zum Selbermischen, Backen und Kochen warten auf Sie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ingrid Kleindienst-John
Apfelstrudel hilft immer
die Unvergänglichkeit guter Mehlspeisen
Geschichten & Rezepte
ISBN 978-3-99025-477-6
© 2023 Freya Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Layout: freya_art, Jessica Kandler und Regina Raml-Moldovan
Lektorat: Dorothea Forster
Bildmaterial: Ingrid Kleindienst-John, weitere siehe Seite 176
printed in EU
Anmerkung: Die hier wiedergegebenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt, dennoch übernimmt weder die Autorin noch der Verlag eine Haftung für Schäden, welcher Art auch immer, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der hier vorgestellten Anwendungen ergeben könnten.
Sie kennen das sicherlich auch ...
Familiengeschichte
Erinnerung an meine Großmutter
Apfelstrudel hilft immer
Also zum Apfelstrudel
Äpfelstrudel
Gezogener Apfelstrudel
Wie war das eigentlich damals?
Tschechien, die Erste
Brandteigkrapferl
Raisenmarkt im Wienerwald
Topfenknödel mit Kompott
Gainfarn – Die Appolonia
Weintrauben-Nuss-Strudel
Wundsalbe der Appolonia
Josefa, die Reisende
Apfelspalten
Scheiterhaufen
Heidensterz
Burghausen
Bayerische Maultaschen
Bayerische Dampfnudeln
Salzburger Nockerl
Karoline, die Heilbademeisterin und Kräuterfrau
Kaiserschmarrn
Ich bin leider keine begnadete Köchin
Millirahmstrudel der Barbara
Leopoldine, die Stiefgroßmutter
Germknödel
Neustift am Rande Wiens
Böhmische Palatschinken
Die böhmische Mischpoche
Himbeersosz
Böhmische Dalken
Nochmals Tschechien
Powidl-Tascherl
Topfentascherl
Ungarn war auch dabei ...
Grammel-Pogatscherl (Tepertős pogácsa)
Kirschenschmarrn
Ödenburger Nudelauflauf
Somlauer Nockerl
Geschichte aus dem Wienerwald vom Hans-Onkel
Lärchenpechsalbe
Die Urgroßmutter aus Hochrotherd
Spitzwegerich-Hustensirup
Erdäpfel-Auflauf
Pepperl und die Mama
Erdäpfelbrot der Anna-Tant
Erdäpfelbrot mit Germ
Feiertagsspeise: Reis Trauttmannsdorff
Gusti
Mohnnudeln mit Zwetschkenröster
Nachkriegszeiten
Schnelle Pofesen
Grießschmarrn, Variante 1
Grießschmarrn, Variante 2
Die gefallene Kredenz
Apfeltorte
Weihnachtszeit – Kekserlzeit
Vanillekipferl
Mürbe Sterne
Zwetschkenbrot
Kletzenbrot-Variante
Jedes Jahr im Advent
Germteigstrudel
Die Geburtstagstorte
Geburtstags-Schokoladentorte
Oma
Süßer Nachtisch – Hexenschaum
Erdäpfel-Platzki
Tante Frieda und der Münchner Opa
Tante Friedas Semmelschmarrn
Tante Sissy
Cremeschnitten
Tante Trude
Tante Trudes Sparkuchen
Gartenfreuden und Mehlspeisgenuss
Gartenleben in Kritzendorf
Brauner Kirschenkuchen
Gartenleben an der Alten Donau
Kirschenstrudel
Gartenleben im Kahlenbergerdorf
Haselnusstorte der Sophie
Überbackene Topfenpalatschinken
Die „ungarische“ Großmutter von Kurt
Ribiselkuchen mit Schaum
Gesztenyepüre – Kastanienpüree
Erlebnis Mehlspeisküche: Ilona
Ilonas gedeckter Apfelkuchen
Ilonas Karottenkuchen
Selbst ist die Frau
Topfenteig-Apfelstrudel
Ingrids Germteigguglhupf
Buchteln mit Vanillesauce
Reisauflauf
Obstknödel – immer ein Genuss!
Obstknödel aus Erdäpfelteig
Obstknödel aus Brandteig
Topfenknödel mit oder ohne
Kurt hat Geburtstag
Malakofftorte
Sigrid
Kardinalschnitte
Obstkuchen für alle Fälle
Silvia
Marmor-Guglhupf
„Grabeland“
Rhabarberkuchen
Zwischen den Weltkriegen
Polenta
Traude
Ölteig-Kuchen
Tante Christl und Pepi-Onkel
Grießauflauf
Tante Christls Topfentorte
Schwestern ...
Biskuitroulade
Marillenauflauf
Süße Früchtchen
Hollerkoch mit Äpfeln und Zwetschken
Erinnerungen
Danke!
Rezepte von A–Z
Apfelspalten
Äpfelstrudel
Apfeltorte
Bayerische Dampfnudeln
Bayerische Maultaschen
Biskuitroulade
Böhmische Dalken
Böhmische Palatschinken
Brandteigkrapferl
Brauner Kirschenkuchen
Buchteln mit Vanillesauce
Cremeschnitten
Erdäpfel-Auflauf
Erdäpfelbrot der Anna-Tant
Erdäpfelbrot mit Germ
Erdäpfel-Platzki
Feiertagsspeise: Reis Trauttmannsdorff
Geburtstags-Schokoladentorte
Germknödel
Germteigstrudel
Gesztenyepüre – Kastanienpüree
Gezogener Apfelstrudel
Grammel-Pogatscherl (Tepertős pogácsa)
Grießauflauf
Grießschmarrn, Variante 1
Grießschmarrn, Variante 2
Haselnusstorte der Sophie
Heidensterz
Himbeersosz
Hollerkoch mit Äpfeln und Zwetschken
Ilonas gedeckter Apfelkuchen
Ilonas Karottenkuchen
Ingrids Germteigguglhupf
Kaiserschmarrn
Kardinalschnitte
Kirschenschmarrn
Kirschenstrudel
Kletzenbrot-Variante
Lärchenpechsalbe
Malakofftorte
Marillenauflauf
Marmor-Guglhupf
Millirahmstrudel der Barbara
Mohnnudeln mit Zwetschkenröster
Mürbe Sterne
Obstknödel aus Brandteig
Obstknödel aus Erdäpfelteig
Obstkuchen für alle Fälle
Ödenburger Nudelauflauf
Ölteig-Kuchen
Polenta
Powidl-Tascherl
Reisauflauf
Rhabarberkuchen
Ribiselkuchen mit Schaum
Salzburger Nockerl
Scheiterhaufen
Schnelle Pofesen
Somlauer Nockerl
Spitzwegerich-Hustensirup
Süße Früchtchen
Süßer Nachtisch – Hexenschaum
Tante Christls Topfentorte
Tante Friedas Semmelschmarrn
Tante Trudes Sparkuchen
Topfenknödel mit Kompott
Topfenknödel mit oder ohne
Topfentascherl
Topfenteig-Apfelstrudel
Überbackene Topfenpalatschinken
Vanillekipferl
Weintrauben-Nuss-Strudel
Wundsalbe der Appolonia
Zwetschkenbrot
Sie kennen das sicherlich auch ...
... diesen Moment, in dem man – ganz plötzlich und unvorbereitet – in einer Art Déjà-vu an eine Situation oder ein Geschehnis erinnert wird, das einen Jahre zuvor beschäftigt hat. Mir jedenfalls geht es immer wieder einmal so, dass ich mich bei den möglichsten und unmöglichsten Gelegenheiten an die Familiengeschichten erinnere, die mir meine Großmutter erzählt hat.
Diese Erinnerungen prägen uns alle, sie stehen für unsere Vergangenheit und jene unserer Familie.
Ich kann Ihre Erinnerungen nicht erzählen, aber meine. Und da gibt es natürlich drumherum auch eine ganze Reihe unterschiedlichster Geschichten. Es sind nicht immer nur jene aus meiner direkten Verbindung zur Vergangenheit, also zu meinen Eltern und Großeltern, sondern auch Erzählungen, die in meiner Familie zur Familiengeschichte wurden. Und diese Geschichten haben sich interessanterweise in Form von Speisen niedergeschlagen.
Familiengeschichte
Ein altes Buch meiner Großmutter, in dem auf der Rückseite des Vorsatzblatts in Kurrentschrift Notizen gemacht worden waren, brachte mich auf die Idee, mich näher mit meinen Ahnen auseinanderzusetzen. Diese Notizen erzählten, dass einer meiner Ururgroßonkel trockenen Fußes über den Neusiedlersee gegangen war, und haben mich veranlasst, mich mit der Geschichte Österreichs zu beschäftigen, die eng verknüpft mit der Geschichte meiner Familie ist. Eng verknüpft deshalb, weil der Vielvölkerstaat der alten Monarchie die Schicksale Einzelner wie in einem Mixer durcheinandergewürfelt und neu verteilt hat. Jemand, der in Süd-Ungarn geboren wurde, konnte durch seine Dienstverhältnisse nach Prag oder Brünn gelangen, jemand aus der Steiermark nach Tirol oder Salzburg usw.
Ich begann anhand alter Dokumente den Versuch einer Chronologie. Und stieß naturgemäß bald an Grenzen. Die ältesten Dokumente reichten bis etwa 1840 zurück. Dann fiel mir ein handschriftlicher Brief zu, weder Kurrent noch sonst leicht lesbar. Zum Glück fand ich einen alten Herrn, der mit dem Entziffern von alten Schriften vertraut war und der mir in der Folge noch viele wertvolle Hinweise auf geschichtliche Zusammenhänge geben sollte.
Wo bekommt man die Informationen, die man für eine erfolgreiche Familienforschung benötigt?
Ich wandte mich an die jeweils zuständigen erzbischöflichen Ordinariate in Österreich, mit der Bitte, in den mir aus den vorliegenden Dokumenten bekannten Pfarren Nachforschungen betreiben zu dürfen. Das ist eine relativ einfache Sache. Gegen eine geringe Gebühr erhält man die Erlaubnis in Form eines Schreibens, das man in den jeweiligen Pfarren vorlegen muss. Und dann hängt es vom jeweiligen Pfarrherrn ab, ob er gewillt ist, einem Einblick in die Matrikenbücher der Pfarre zu gewähren oder nicht. Diese Bücher sind teilweise schon sehr alt und verschlissen, Kostbarkeiten auf ihre Art. Es gibt deren oft sehr viele: Sterberegister, Geburtsregister und Heiratsregister. In alter Zeit war die Registratur des Menschenlebens den Pfarreien anvertraut.
Oft ist die Schrift in diesen Büchern schlecht bis gar nicht lesbar. Die Handschriften sind so unterschiedlich, wie sie nur sein können. Und oft sind die Bücher durch die diversen Kriege, Brände oder Verwüstungen der Kirchenhäuser beschädigt oder gar in Verlust geraten. Es ist also nicht einfach, fortlaufende Informationen zu erhalten.
Dazu kommt, dass viele Hinweise oft nicht ganz verständlich sind, dass Namen oftmals in verschiedener Schreibweise vorkommen und man dann nicht sicher sein kann, ob und welche die richtige ist und ob man sich noch auf der richtigen Spur befindet. Heute ist durch die Digitalisierung vieler Kirchenbücher die Spurensuche stark vereinfacht, aber dennoch sind die alten Schriftformen immer noch mühsam zu lesen.
Ortsnamen haben sich im Laufe der Zeit verändert oder sind ganz verschwunden, viele Kirchen sind den gleichen Heiligen in unterschiedlichen Ortschaften geweiht. Das macht die Orientierung schwierig, vor allem, wenn kein Ort dazu bekannt ist.
Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass sich diese Kirchenhäuser weit verstreut in den Ländern der ehemaligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie befinden. Denn kaum jemand von uns kann von seiner Familie sagen, dass sie ausschließlich an einem bestimmten Ort über die Jahrhunderte hinweg zu Hause war. Zumindest ist immer irgendjemand von einem anderen Ort dazugekommen.
Schließlich und endlich hat man eine stattliche Anzahl von Informationen gesammelt. Interessant wird es jetzt, denn es kommt der historische Hintergrund dazu, vor dem das Leben der Vorfahren abgelaufen ist. Mich hat immer fasziniert, wie weit die Menschen oft von ihrem eigentlichen Zuhause weggekommen sind. Wo sie geboren wurden und wo sie starben. Wo ihre Kinder zur Welt kamen und unter welchen Bedingungen sie lebten.
Auf diese Weise wird einem oft vieles über das eigene Wesen klar, wenn es auch über diesen Umweg der Ahnenforschung geschieht. Da war vielleicht ein Bruder Leichtfuß darunter und wir selbst haben ein – vielleicht unerklärbares – Bedürfnis danach, einmal so richtig über die Stränge zu hauen.
Oder auch anderes: vielleicht ein gehäuftes Vorkommen von N.N.-Einträgen in den Kirchenbüchern, was so viel heißt wie, Vater wurde nicht genannt oder ist unbekannt – welches Frauenschicksal steht da wohl dahinter? Ledige Mütter hatten es früher nicht gerade leicht ...
Als ich im Zusammenhang mit meiner eigenen Forschung eine alte Karte über die Länder der Monarchie organisierte, wurde mir erst das große Ausmaß dieses österreichisch-ungarischen Herrschaftsgebietes klar. Und wenn man dann die Überlegung anstellt, wie denn das mit dem Reisen vor etwa 200 Jahren (nur als Beispiel) war, so muss man angesichts der Wegstrecken und -zeiten Hochachtung vor dem Unternehmungsgeist und Mut so manches Vorfahren bekommen. Und beileibe nicht nur der männlichen Vorfahren!
In meiner Familie ist z. B. eine meiner Urururgroßmütter von der tiefsten Südsteiermark bis nach Salzburg und sogar München gekommen – wo sie als Kinderfrau und Dienstmädchen verdingt war – zu Fuß, in Kutschen und auf holprigen Wegen!
Und dann erst die Vermischung der verschiedensten Völker. In meiner Familie heiratete ein Förster aus der Gegend von Prag eine Hietzingerin (Hietzing gehört zu Wien) und lebte mit ihr dann im südlichen Niederösterreich. Ein tschechischer Ulan liebte eine feurige Ungarin und der Sohn der Südsteirerin vermählte sich mit einer Burghausenerin, um mit ihr zuerst in Salzburg und später in München zu leben.
Hat man Zeit und Muße, sich mit den Berufen der einzelnen Menschen zu beschäftigen, kommt man manchmal aus dem Staunen nicht heraus. Einige dieser Berufe sind uns heute nahezu unbekannt. Die Wertigkeit, die diese Berufe früher hatten, was sie uns über die Möglichkeiten der Menschen erzählen, vielleicht auch über ihre Lebensgeschichte, ist spannender als so mancher Roman.
Was sagt es uns, wenn z. B. Privatier als Berufsbezeichnung steht? Hatte dieser Mann Geld, Häuser, Grundstücke, von denen er leben konnte, oder war er einfach ein arbeitsloses Nichts? Die Berufsbezeichnungen hatten vielfach mit dem Stand der Menschen zu tun.
War jemand Gärtnereibesitzer, dann war das schon etwas vor 150 Jahren. Aber auch die Bezeichnung verwitwete Brauereibesitzersgattin erzählt ein wenig über die Frau, die hinter dieser Betitelung (im Jahr 1834) zu finden war: Hat sie die Brauerei selbst weitergeführt? Wie hat sie ihr Leben gemeistert? Oder das Schicksal einer Kinderfrau: Sie konnte erst im – zu dieser Zeit hohen – Alter von 30 Jahren heiraten und bekam ihr eigenes erstes Kind mit 32, für das 18. Jahrhundert galt sie da schon als reichlich überwutzelt. Und bekam in der Folge doch noch drei weitere Kinder! Sie starb übrigens mit 89 Jahren – eine Seltenheit damals!
Trotz aller Mühen, die so eine Spurensuche mit sich bringt: Ich bin der Meinung, dass sie sich allemal lohnt. Vor allem, wenn man sich dabei seiner eigenen Wurzeln bewusst wird und sich darauf besinnt, dass die Familie den Grund bildet, auf dem wir bauen können. Vielleicht bekommen Sie selbst auch Lust darauf, Ihre Familiengeschichte neu aufzurollen, anders zu betrachten und die überlieferten Erzählungen für sich und Ihre Kinder aufzuschreiben ...
Meine Großmutter Maria, genannt Mitzi, war für mich ein wichtiger Bezugspunkt in meinen Kindheits- und Jugendjahren, wohl der wichtigste, denke ich, und auch noch, als ich bereits selbst Kinder bekommen hatte, war das noch so. Was es mit dem Apfelstrudel und noch vielen anderen Mehlspeisen, die ich großteils heute noch mit Begeisterung herstelle, auf sich hat – das ist meiner Beziehung zur Großmutter zu verdanken.
Erinnerung an meine Großmutter
Ihr liebes Gesicht mit den melancholisch-fröhlichen Augen ist im Gedächtnis verhaftet, als hätte ich sie eben besucht und mit ihr den neuesten Familienklatsch ausgetauscht.
Seit Einsetzen meiner Erinnerung laborierte Großmutter an einem offenen Geschwür am Bein. Als Kind habe ich öfter voll Faszination und Ekel beim Verbinden der Wunde zugesehen, ohne den Blick abwenden zu können. Das eigentliche Leiden – ihre Herzschwäche – wurde in der Familie nie als Krankheit angesehen.
In der Erinnerung aus Kindertagen war die Großmutter ein ewig arbeitendes, mürrisches Wesen und bei jedem Besuch war ich von neuem erstaunt über die Gebrechlichkeit und Zartheit dieser Frau.
In ihren letzten Lebensjahren hat sie ihre Einsamkeit mit den Erinnerungen an ihre beiden Ehemänner und ihre erste große Liebe geteilt, unvergessen in der ältesten Tochter. Zeitweise wurde sie unterbrochen in ihren Selbstgesprächen durch den einen oder anderen Urenkel oder Enkel. Abends ersetzte das Fernsehen die nicht vorhandene Kommunikation mit den beiden stumm bei ihr sitzenden Töchtern. Später schwiegen sich die beiden über den Esstisch hinweg an – ob sie das Fehlen der Großmutter überhaupt bemerkten? Mittlerweile sind auch diese beiden Frauen hinübergegangen ...
Jeder Besuch wird von einer Jause aus Kaffee, Kuchen und Kipferln gekrönt, die der Gast allein einnimmt. Großmutter darf keinen Kaffee trinken, aber riechen darf sie ihn noch. Damals, als Großvater noch lebte – er kochte den weitaus besseren Kaffee – war das alles noch anders. In meiner Erinnerung ist er ein kleiner, wortkarger Mann, seine Herzensgüte unter brummigem Gehaben gut versteckt, belesen und sensibel.
Großmutter, die lebende Chronik der Familie, kannte die Eigenheiten der noch lebenden oder schon verstorbenen Familienangehörigen, konnte spannend über die Vergangenheit der Familie erzählen. Immer wieder ermahnte sie mich, diese Geschichten nicht zu vergessen.
Noch heute überfällt mich leises Erschauern bei der Erinnerung an ihre Sehergabe: Sie wusste die Zukunft jedes Einzelnen von uns im Vorhinein. Damals entstand ungläubiges Staunen, wenn sie die Karten aufschlug, um die Zukunft zu beschwören. In ihrem letzten Lebensjahr hatte sie Angst davor, auch vor ihrem eigenen Schicksal.
Immer hatte sie jedoch ein offenes Ohr für Probleme. Und immer Rat, ob für Liebesgeschichten oder für Lebenskrisen.
Am Tag vor ihrem Tod mein letzter Besuch bei ihr. Nach einer Herzattacke lag sie im Krankenhaus, klein, zart, im viel zu großen Bett. Ihre Hände strichen glättend über die Bettdecke, ihr Blick streifte aus dem Fenster. Draußen im Park des Krankenhauses begann der Frühling. Der Baum vor ihrem Fenster trug bereits kleine grüne Knospen. Bei meinem Eintreten glitt ein Lächeln über ihre runzeligen Züge. Das Sträußchen Schneeglöckchen, das ich auf ihren Nachttisch stellte, zog den Blick aus ihren immer noch jungen Augen an. Sie wusste, dass sie bald sterben würde, und spendete mir, die ich sie trösten wollte, Trost.
Großmutter ist nun schon seit vielen Jahren tot. Ich vermisse sie noch immer. Doch weiß ich, dass ihre Seele um mich ist und mir Schutz gewährt, wenn es mir an etwas mangelt.
Apfelstrudel hilft immer
„Sei nicht traurig, wenn ich bald einmal nimmer bin“, sagte sie, „ich werd‘ dich trotzdem überall hin begleiten, auch wennst mich nicht sehen kannst. Und vergiss nicht: Apfelstrudel hilft immer!“ In der darauffolgenden Nacht ging sie friedlich von uns.
Die Erinnerung an sie katapultiert mich einige Jahre zurück. Ich kam jede Woche zwei Mal zu Besuch, zum Kaffee, wie sie immer sagte. Und da konnte ich meine kleinen und größeren Kümmernisse bei ihr abladen. Bei Häferlkaffee und Apfelstrudel, manchmal war‘s auch ein Kipferl. Aber der Apfelstrudel ...
Dieser Apfelstrudel wurde nach altem Familienrezept gebacken. Wie Großmutter erzählte, stammte dieses Rezept noch von ihrer Ururgroßmutter, also meiner Ururururgroßmutter väterlicherseits. Das brachte mich damals auf den Gedanken, mich intensiv mit meiner Herkunft und vor allem mit den Frauen unserer Familie zu beschäftigen. So begebe ich mich auf eine Reise in die Vergangenheit, um herauszufinden, was denn das mit dem Apfelstrudel so auf sich hat.
Wichtiger ist mir: Was haben diese Frauen uns außer Rezepten sonst noch hinterlassen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind? Vielleicht ist ja das eine oder andere traditionell überlieferte Wissen für uns auch heute noch von Wert – immer war ja in unserer Familie auch von Kräutern und deren hilfreicher Wirkung die Rede ...
Also zum Apfelstrudel
Bei meinen Forschungen zur Familiengeschichte kam ich weit zurück, bis ins 16. Jahrhundert. Ob es da wohl schon Apfelstrudel in seiner heutigen Form gegeben hat? Das älteste schriftlich überlieferte Rezept, dessen ich bis jetzt habhaft werden konnte, stammt aus einem Kochbuch, das ich von meiner Oma geerbt habe. Im Buch Die wirtschaftliche und geschickte Wiener Köchin aus dem Jahr 1858 findet sich folgendes Rezept: