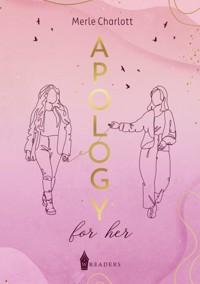Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie lange braucht ein gebrochenes Herz, um zu heilen? Reicht ein halbes Jahrzehnt aus, um über sie hinwegzukommen? Ember hat Amherst, Sutton und das Gedichteschreiben hinter sich gelassen. Fünf Jahre später hat ihr neues Leben in London sie voll im Griff. Doch dieses Leben hält Herausforderungen bereit, die Embers gesamte Identität infrage stellen. Währenddessen hat Sutton Ember hinter sich gelassen. Fünf Jahre später hat ihr altes neues Leben in Amherst sie voll im Griff. Doch als ihre eigene Hochzeit näher rückt, kann sie die Fragen nicht länger ignorieren. Wie lange braucht ein gebrochenes Herz, um zu heilen? Reichen 3.328 Meilen aus, um über sie hinwegzukommen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Triggerwarnung
Dieses Buch enthält Inhalte, die triggern könnten.
Diese sind: Mental Health Disorders, Tod, Krankheit, körperliche Gewalt, Homophobie, Alkohol- und Drogenmissbrauch.
Disclaimer
Die Autorin verwendet gendergerechte und inklusive Sprache.
Foto © Lisa Frädrich
Über die Autorin
Merle Charlott wurde 1996 in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen geboren. Mittlerweile lebt sie als Kreativschaffende gemeinsam mit ihren beiden Katern Kai und Uwe mitten auf dem Hamburger Kiez. Ihre Gedichte und Projekte teilt sie auf ihrem Instagram Account (@holmaldenmerlott). »Apology for Me« ist die Fortsetzung ihres Debütromans.
WREADERS E-BOOK
Band 277
Dieser Titel ist auch als Taschenbuch erschienen
Vollständige E-Book
Copyright © 2025 by Wreaders Verlag, Sassenberg
Verlagsleitung: Lena Weinert
Druck: Custom Printing
Bestellung und Vertrieb: Nova MD GmbH, Vachendorf
Umschlaggestaltung:Jessica Rose
Lektorat: Annalena Rauh, Lektorat Hygge
Satz: Riva Ellis
www.wreaders.de
Für jene, die Herzen brechen.
Für die, die Herzen heilen.
Für alle, die Angst haben, sich neu zu verlieben und es trotzdem tun.
Für jede großartige Frau in meinem Leben.
Für mich.
Dear Me.
This.
This is a
question for you.
This.
This is a
question for us.
Was it love —
Or was it
just the idea
of something
less than
love?
© 04/2023 Merle Charlott
My Playlist
Dear Reader – Taylor Swift
Anti-Hero – Taylor Swift
Nobody Likes Hospitals – Giant Rooks
I Don’t Wanna Love You Anymore – LANY
Landslide – Dagny
Almost (Sweet Music) - Hozier
Woman – Mumford & Sons
Lessons – Dermot Kennedy
I miss you, I’m Sorry – Grace Abrams
1 step forward, 3 steps back – Olivia Rodrigo
Ich lieb dich kaputt – Schmyt
Drachenfrucht – Ennio
Alleine – Berq
Fieber – Nina Chuba
Zorn & Liebe feat. Nina Chuba - Provinz
Reicht dir das – Provinz
Poetry — Wrabel
14 – Clinton Kane
Chocolate – The 1975
So Long, London – Taylor Swift
London Is Lonely – Holly Humberstone
What Was I Made For? — Billie Eilish
champagne problems – Taylor Swift
I love you, I’m sorry – Gracie Abrams
us (feat. Taylor Swift) – Gracie Abrams
god damn feelings – Benjamin Amaru
Here With Me – Elina
Matilda – Harry Styles
exile (feat. Bon Iver) – Taylor Swift
The Manuscript – Taylor Swift
Prolog
»To live lasts
always, but to
love is firmer
than to live.«
– Emily Dickinson, early 1870s
Ember
Der englische Dramatiker William Shakespeare behauptete einst, dass diejenigen, die ihre Liebe nicht zeigten, gar nicht erst richtig lieben würden.
Noch nie zuvor hatte ich mich von meinem guten alten Freund so verspottet gefühlt. Letztlich kam ich jedoch zu der Auffassung, dass seine Worte nur so wehtaten und mich in meinem Stolz verletzten, weil sie der Wahrheit entsprachen.
Ich hatte Sutton geliebt. Nicht nur auf dem Papier, sondern auch heiß und innig zwischen den Laken ihres Bettes, wenn niemand außer uns zu Hause war. Ehrlich und aufrichtig hinter verschlossenen Türen. Unwiderruflich und leidenschaftlich, sofern keiner hinsah. Ich hatte Sutton wahrhaftig geliebt. Aber ich war nicht bereit gewesen, allen diese Gefühle zu offenbaren. Also ließ Sutton meine Liebe fallen, denn solange sie nur zwischen uns beiden existierte, war sie nicht mehr als eine Idee.
Wofür aber schrieb ich dann noch? Ohne meine einzige Leserin war die Liebe nicht mehr als eine irrtümlich gewählte Ansammlung leerer Worte. Eine Idee, die nicht einmal auf dem Papier eine Daseinsberechtigung hatte.
Act 4
The poet & her sister
»To miss you, Sue,
is power.«
– Emily Dickinson, September 1871
Fünf Jahre später
Januar 2030
Kapitel 1
»I watched her face to see which way
She took the awful news –«
– Emily Dickinson
Ember - London
Veränderungen, so sagte man, bahnten sich nicht völlig unbemerkt an. Manchmal schlichen sie, unauffällig auf zarten Zehenspitzen, und plötzlich, obwohl du sie hättest hören sollen, standen sie vor dir und du konntest nichts anderes tun, als sie zu akzeptieren.
»Wissen Sie, was ein Zervixkarzinom ist?« Dr. Greene schaute von der Akte, in der sie meine Untersuchungsergebnisse aufbewahrte, zu mir auf. Sie sah mich direkt an. Von ihren blaugrünen in meine tiefbraunen Augen. Als wollte sie meine Seele mit ihrem Blick berühren.
Ich wusste, was ein Zervixkarzinom war. Jede Frau sollte wissen, was ein Zervixkarzinom war. Meine Mutter hatte eins gehabt. Sie erfuhr es mit dreiunddreißig. Ein paar Monate später ließ sie es durch eine Hysterektomie entfernen. Seitdem konnte sie keine Kinder mehr bekommen.
»Die Ergebnisse sind ziemlich ernüchternd« war kein Satz, den man von seiner Gynäkologin hören wollte. »Sie haben eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs, Ms. Dawson.«
Noch während die Worte durch mein Bewusstsein hallten, klärte sie mich über die Behandlungsmöglichkeiten auf.
Ich wusste bereits, dass ich den gleichen Weg wählen würde, für den meine Mutter sich damals entschieden hatte. Auch wenn die Entfernung meiner Gebärmutter bedeutete, dass ich keine Kinder mehr bekommen könnte. Wobei »bekommen« eine irreführende Formulierung war. Ich würde nie Kinder gebären. Das wollte ich sowieso nie, doch die Tatsache, dass ich es nun auch nicht könnte, löste ein ungeahntes Gefühl von Kontrollverlust in mir aus.
In etwa die gleiche Art von Kontrollverlust, den ich verspürte, als Dr. Greene mir erklärte, wodurch ich an einem Zervixkarzinom erkrankt war. HPV. Humane Papillomviren. Eine sexuell übertragbare Infektion.
Noch bevor ich mich dazu entscheiden konnte, das Behandlungszimmer zu verlassen, blätterte sie in meiner Krankenakte eine Seite um. Unser Gespräch hatte also gerade erst begonnen.
Veränderungen gingen immer mit Neuigkeiten einher. Einer Nachricht, mit der man nicht gerechnet hatte, oder aber einer Nachricht, die man bereits hören konnte, lange bevor sie ausgesprochen wurde.
»Da wäre noch etwas anderes, Ms. Dawson.« Dr. Greene räusperte sich. Ich konnte sie am Klang ihrer Stimme erkennen. Die Nachricht, die sich ankündigte.
»Ja, ich weiß«, sagte ich also, ehe sie überhaupt zu Wort kam.
»Sie tragen auch das Brustkrebsgen in sich.«
Manchmal fragte ich mich, ob es Fälle gab, von denen sie sich als Ärztin nicht distanzieren konnte. Schicksale, die ihr nähergingen, als sie es sollten.
»Sie sind jung, es gibt gute Möglichkeiten zur Vorsorge. In Anbetracht Ihrer Situation sollten Sie aber sofort damit beginnen.«
Für Vorsorge war es – mit sechsundzwanzig – eigentlich schon zu spät. Das war es, was sie wirklich damit ausdrücken wollte. Es gab nur noch die Möglichkeit, zu handeln.
Ich ließ Dr. Greene mit meinem Entschluss zurück, mich zwei Operationen zu unterziehen. Sie drückte mir mehrere Broschüren in die Hand. Dass so etwas überhaupt noch hergestellt wird.
Ich hatte mich im Voraus online informiert, mich eingelesen und mich gedanklich auf dieses Gespräch vorbereitet. Dadurch nahm ich den Veränderungen, die mir bevorstanden, die Macht, mich zu übermannen.
Dr. Greene sprach es nicht aus, doch aus ihrem Blick las ich die Auffassung heraus, dass mir der Ernst der Lage nicht bewusst wäre. Sie lag falsch. Mir war durchaus der Ernst der Lage bewusst. Nur ging ich zu gelassen damit um. Ich glaubte, ich wäre klüger als der Tod. Als könnte ich ihn überlisten, indem ich ihm gerade noch einmal so von der Schippe sprang.
Wir waren nicht mehr so gute alte Bekannte wie noch vor ein paar Jahren. Doch wie das mit guten alten Bekannten nun einmal war, entschied die Zeit, wie sich die Beziehung zueinander veränderte. Und so war aus einem anderen guten alten Bekannten ein Freund geworden.
Ein guter, alt bekannter Freund, der auf mich wartete, als ich das Behandlungszimmer verließ.
Direkt gegenüber der Tür stand eine rosa angemalte Holzbank, die nur den Anschein eines Wartebereichs kreieren sollte. Er hatte es sich trotzdem darauf bequem gemacht. Lehnte sich mit dem Rücken an die beige gestrichene Wand, scrollte mit einem desinteressierten Blick durch sein Smartphone. Wir befanden uns in der Gynäkologie. Die Arbeitskleidung des Pflegepersonals und der Ärzt:innen war farblich an die Sitzbank angepasst. Es wurde krampfhaft versucht, ein veraltetes Gender-Klischee zu bedienen. Einzig das türkise Laminat schien sich gegen das lächerliche Rollenbild auflehnen zu wollen.
»Gute oder schlechte Nachrichten?«, wollte er wissen.
Er hatte mich in die Praxis begleitet, weil wir uns eine Wohnung teilten und befreundet waren. Ich hatte nicht von ihm verlangt, dass er auf mich wartete. Ich hatte sogar damit gerechnet, dass er es nicht täte, und war überrascht zu sehen, dass er es doch gemacht hatte. Wie ich glaubte, weil wir miteinander schliefen. Wie er mir in ein paar Tagen verraten würde, war der Grund für sein Warten jedoch der Umschlag, der heute Morgen in der Post gelegen hatte.
Ein Brief, dessen Inhalt ich kannte, ganz ohne ihn geöffnet zu haben. Die Trockenblume unter dem Wachsstempel verriet sie. Die Gedanken an Sutton waren auch in diesem schweren Moment bei mir.
»Es ist Krebs. Nicht ganz. Bloß eine Vorstufe davon«, entgegnete ich ihm stumpf und wenig empathisch. Fast schon emotionslos. Etwas, das sich in den letzten Jahren nicht geändert hatte. Meine nicht vorhandene Feinfühligkeit.
Selbst wenn ich gewollt hätte, wäre ich nur in der Lage gewesen, einen Funken davon zu entwickeln. Aber mit dem Wollen war das so eine Sache. Es war einfacher gewesen, meine Gefühle auszuschalten. Denn nichts zu fühlen war leichter, als den Schmerz zu überwinden, den Sutton hinterlassen hatte.
»Bloß Krebs?« Er erhob sich von der Bank. In seiner Stimme klang ein Anflug von Sorge.
»Gebärmutterhalskrebs«, stellte ich klar. Er schluckte.
»Ember …«
Aus seinem Mund hörte sich mein Name wie ein Geschwür an. Es fiel mir schwer, seinen auszusprechen. Dabei war er in den letzten Wochen von einem guten Freund zu mehr als nur einem Freund geworden. Oder aber zur Befriedigung eines simplen Bedürfnisses. Ein Pflaster, das sich über die Wunde legte, welche die Einsamkeit hinterlassen hatte.
Körperliche Nähe – so oft sie auch zwischen Sutton und mir stattgefunden hatte – war mir noch immer suspekt und ich ließ mich lediglich darauf ein, um meiner Abneigung auf den Grund zu gehen. Mittlerweile vermutete ich auch dahinter die Angst vor einem Kontrollverlust. Viel mehr ein Problem, bei dem wohl eine Therapie helfen würde. Doch auch hier glaubte ich, klüger zu sein.
Meine erfolgreichste Bewältigungsstrategie war Konfrontation. Und diese Art der Konfrontation war einen Meter neunundachtzig groß, sportlich, auf sein Äußeres bedacht und intellektueller, als es auf den ersten Blick den Anschein machte. Auch wenn es kaum möglich schien, liebte er Shakespeares Werke mehr, als ich es tat, und war emotional ebenso wenig verfügbar wie ich. Wir hatten vieles gemeinsam. Insbesondere die Gewissheit, dass wir unsere Herzen an dem Ort zurückgelassen hatten, an dem sie gebrochen worden waren. Amherst.
»Ich werde eine Hysterektomie machen lassen.« Ich musste ihm nicht erklären, was es damit auf sich hatte. Seine Mutter war an Gebärmutterhalskrebs gestorben. Sie war heroinabhängig gewesen und hatte sich jeden neuen Schuss durch Sex verdient, für den sie sich hatte bezahlen lassen. Ungeschützten Sex. Sie war siebzehn gewesen als sie starb. Und er gerade erst wenige Monate alt. Die Wahrheit kannte er erst seit einem Jahr.
Und diese Wahrheit hatte irgendetwas in ihm verändert. Seine Beziehung zu sich selbst, vor allem aber seine Beziehung zu weiblich gelesenen Personen. Es hatte etwas in ihm geheilt und gleichzeitig etwas anderes in ihm zerbrochen. Er war zerrissen und verbissen. Er war nicht mehr als ein unvollendetes Gesamtwerk aus Farben und Pinselstrichen, die seine Vergangenheit achtlos über die Leinwand gezogen hatte.
»Du wirst keine Kinder haben können«, gab er zu bedenken.
»Ich werde keine Kinder gebären können«, betonte ich und fügte hinzu: »Wie gut, dass ich vor Kurzem zum wiederholten Mal Tante geworden bin.«
Sarkasmus, dunkler, pechschwarzer Sarkasmus war meine einzige Verteidigung.
»Ems …« Wieder sagte er meinen Namen. Diesmal klang es verdächtig nach einem Seufzen.
»Charles …« Nur schwerfällig ging mir nun auch sein Name über die Lippen.
Er schwieg. Wir wussten von Beginn an, dass die Sache mit uns ein Ablaufdatum haben würde, und wir waren uns ebenso darüber im Klaren, dass wir dieses Ablaufdatum längst überschritten hatten.
Sutton – Amherst
»Hast du die Briefe nach London zur Post gebracht?« Als er von der Arbeit nach Hause kam, fragte er nicht, wie es mir ging oder wie mein Tag gewesen war. Das Einzige, das Arvin interessierte, war, ob ich das getan hatte, worum er mich gebeten hatte. Bevor er das Haus verlassen hatte – vor viereinhalb Tagen.
»Selbstverständlich, Darling.«
Meinen passiv-aggressiven Unterton überhörte er mit purer Absicht.
»Komisch«, bemerkte er. »Ich habe noch nichts von Ems und Vinnie gehört.«
Er stellte seine Aktentasche auf der Kommode neben der Eingangstür ab, schlüpfte aus seinen Schuhen und hängte seine Jacke an die Garderobe. Als er seinen Schal mit Schwung abnahm, kam mir der Schwall eines süßen Parfüms entgegen. Es war ein penetrant lieblicher Geruch. Ich trug keine lieblichen Düfte.
»Vielleicht solltest du deine Schwestern häufiger anrufen«, gab ich zu bedenken. »Wenn du Interesse an ihrem Leben zeigen würdest, täten sie das sicher auch umgekehrt.«
»Es reicht doch, dass sich meine Langzeitfreundin übermäßig für das Leben meiner Schwestern interessiert, oder?« An seiner Mütze hing ein langes, rotes Haar. Ich hatte mir vor über einem Jahr die Haare abrasiert und ließ sie seitdem zurückwachsen. Rot färbte ich sie nie.
»Wobei …« Arvin warf einen prüfenden Blick in den Spiegel neben der Garderobe. In seinem Nacken waren Kratzspuren erkennbar. Für wie alt hielt er sich? Jung genug, um weiterhin mit Zwanzigjährigen in die Kiste zu springen. »Du interessierst dich nur für das Leben einer meiner Schwestern.«
Ich würde mich nicht dafür rechtfertigen und Tatsachen aufzählen, die unumstößlich waren. Wir wussten beide, dass ich mich unglücklich in Ember verliebt hatte. Genauso wie wir beide wussten, dass ich die heimliche Beziehung zu ihr beendet hatte, weil sie meine Gefühle nicht offen erwiderte, so wie ich es mir wünschte. So wie ich es gebraucht hätte. Wir wussten beide, dass ich noch immer nicht darüber hinweg war und ich mich nur für ihn entschieden hatte, weil ich nicht alleine sein konnte. Es war erbärmlich und entwürdigend. Es war kein Tag in den letzten fünf Jahren vergangen, an dem wir einander nicht emotional betrogen hatten. Wir lebten längst in einer offenen Beziehung, doch es war mehr als nur Sex. Auf einer tieferen, gefühlsbasierten Ebene gingen wir einander noch immer fremd.
Wenn wir nicht mit jemand anderem schliefen, dann dachten wir an sie. Sie. In der Mehrzahl. Ember. Rachel … Mrs. Carpenter … Ms. Lachlan, wie sie nun hieß. Ember. Rachel und –
Es würde mich zu viel Zeit und Mühe kosten, mich an den Namen jeder Frau zu erinnern, mit der Arvin ins Bett stieg. Doch denken, denken konnte er nur an eine.
Greta. Unser Kindermädchen. Ein zwanzigjähriges Au-Pair aus Schweden. Ich hatte nicht vor, sie bei ihrer Agentur anzuschwärzen; eigentlich konnte sie mir nur leidtun. Denn wie mir schien ihr irgendetwas an Arvin zu gefallen und was genau das war, fragte ich mich bis heute. Er hatte sein Aufbaustudium erfolgreich in den Sand gesetzt – und arbeite als überbezahlter Praktikant und Handlanger in der Kanzlei seines Vaters. Sein Alkoholproblem hatte er nicht in den Griff bekommen. Er arbeitete aber auch nicht daran.
»Daddy!« Unser vierjähriger Sohn kam aufgeregt die Treppe heruntergelaufen und sprang ihm freudig in die Arme. Arvin war so selten zu Hause, dass Hunter gar nicht anders konnte, als seinen Vater zu vergöttern. Denn immer, wenn er wieder einmal für ein paar Tage verschwand, brachte er ihm bei seiner Heimkehr als Entschädigung ein Geschenk mit. Ich hasste es, dass mein Kind mit dem Wissen aufwuchs, dass eines seiner Elternteile sich seine Liebe erkaufte. Arvin spiegelte das Verhalten seines eigenen Vaters in Perfektion wider.
»Na, Champ, schau mal, was ich hier habe!« Er trug ihn locker auf einem Arm, während er einen Baseball aus seiner Manteltasche zog. Den dazugehörigen Handschuh hatte er Hunter beim letzten Mal geschenkt.
»Wie cool!« Unser Sohn bestaunte den Baseball und fragte Arvin, ob er seinen Handschuh dazu holen dürfte.
»Und wo willst du das mit ihm üben?«, merkte ich spitz an. »Draußen im Garten liegt meterhoher Schnee.«
Die Winter in Massachusetts waren lang und hart. Dunkel, trüb und grau.
»Wie geht es Oscar und Sylvie?« Er wechselte ungeniert das Thema und setzte Hunter ab, damit er in sein Zimmer laufen konnte. Ich sah bereits vor mir, wie sich die beiden im Wohnzimmer Bälle zuwarfen.
Vor neun Monaten hatte ich Zwillinge zur Welt gebracht. Obwohl wir einander verabscheuten und unsere Liebe ebenso gefroren schien wie das Eis an der Fensterscheibe, gab es diese Momente, in denen wir aus Wut miteinander schliefen. Davor stritten wir uns meist. Schrien uns lauthals an und warfen uns üble Dinge an den Kopf. Verbal zumindest. Irgendwann, wenn wir aufhörten zu schreien und Ruhe einkehrte, überbrückten wir die Stille damit, uns zu küssen. Ich war süchtig danach, ihn zu küssen. Weil seine Lippen mich an sie erinnerten.
»Greta legt die beiden gerade schlafen«, ließ ich ihn wissen.
»Ich werde nach ihnen schauen«, meinte er nüchtern und verschwand die Treppe hinauf. Hunter, der gerade mit seinem Baseballhandschuh aus seinem Zimmer gelaufen kam, blieb enttäuscht an Ort und Stelle stehen.
In mich hinein seufzend blickte ich ihm nach. Ein Kopfschütteln war es mir nicht mehr wert. Ich wusste, dass er Greta in unserem Bett um den Verstand vögeln würde. Also steckte ich Hunter in seinen Schneeanzug und fuhr zu Rachel. Sie war kurz nach Embers Uniabschluss in die Stadt zurückgekehrt. Genau zu dem Zeitpunkt, als Ember Amherst gemeinsam mit Clara verlassen hatte.
Rachel wollte zwar, dass ihre Töchter in der Gegenwart ihres Vaters großwurden, doch sie war nicht wegen Jay wieder hergezogen. Sie war meinetwegen zurückgekommen, hatte das Mary’s Crisis gekauft, als es nach einem Brand hatte schließen müssen, und Enzo zum Geschäftsführer gemacht. Er war der einzige Freund, den ich in Amherst hatte. Ohne ihn und Rachel würde ich vereinsamen. Aber vielleicht, ja vielleicht, tat ich das längst.
Ember
Ich weigerte mich, den Brief zu öffnen, der seit heute Morgen auf dem Küchentisch lag. Mittlerweile hatte ich ihn mit in mein Zimmer genommen und hielt den Umschlag wie ein Buch zwischen meinen Händen, während ich seit einer geschlagenen Stunde regungslos auf der Kante meines Bettes saß.
Die Wahrheit war, dass wir alle die oder der Böse in der Geschichte anderer waren. Wir begingen Fehler, sagten Dinge, die wir nicht so meinten, und taten Dinge, die nicht rückgängig zu machen waren. Eine Geschichte lebte von ihren Figuren. Eine Geschichte lebte von der Kunst ihrer Erzählenden. Eine Geschichte hatte immer zwei Seiten. Die der Absendenden und die der Adressaten. Eine Geschichte benötigte eine Autorin und diese Autorin war es leid, der Legitimation ihrer Worte auf jeder Seite hinterherzujagen.
»Weißt du, warum ich mich regelrecht weigere, mich zu verlieben?« Clara hatte schon vor zwei Minuten an meiner Tür angeklopft. Als ich nicht reagierte, war sie trotzdem in mein Zimmer gekommen. Jetzt setzte sie sich zu mir aufs Bett. »Weil ich diesen Herzschmerz, den du seit Jahren mit dir herumträgst, nie so gut meistern könnte wie du.«
Ich legte den Umschlag wieder zur Seite und sah zu ihr. In ihr elfengleiches Gesicht. Sie schaute müde aus. Ähnlich wie ich, aber anders. Denn ihr gelang es, sich dabei noch immer perfekt zu schminken und den Schein zu bewahren, alles sei in Ordnung. Zumindest ansatzweise.
»Willst du nicht auch einmal eine dieser hoffnungslos romantischen Liebesgeschichten erleben, die du regelrecht verschlingst?«
Clara las mindestens zwei Bücher pro Woche. Ihre Lieblingsautorinnen waren Emily Henry und Sally Rooney. Ich hielt nicht viel von neuer Literatur. Darin unterschieden wir uns.
»Ich lese sie lieber«, meinte sie schwach lächelnd. »Denn bei dieser Art von Büchern weiß ich immer, wie sie ausgehen werden. Es gibt keine bösen Überraschungen.«
Erste Kapitel waren die schwierigsten. Denn der Anfang entschied darüber, ob die Worte eine Leserschaft davon überzeugten, auf die nächste Seite umzublättern und das Buch nicht einfach wieder zuzuschlagen.
»Du hingegen liebst das Drama und unvorhersehbare Wendungen«, schmunzelte sie mit Blick auf mein Bücherregal. Ein Klassiker reihte sich an den nächsten. Große Namen geschichtsträchtiger Schreiber:innen.
Eine shakespeare’sche Tragödie zum Beispiel war in fünf Akten aufgebaut. Die Handlung verlief zunächst aufsteigend, spannend, aber nicht zu aufregend. Mein Freund Will führte die Lesenden unterschwellig an ein Problem heran, das im dritten Akt seinen Höhepunkt fand. Danach fiel die Handlung rapide ab. Es gab keine Möglichkeit mehr für die Held:innen, das Blatt noch zum Guten zu wenden.
Aber das hier war keine shakespear’sche Tragödie. Das hier war nicht einmal die Tarnung eines überschwänglichen Dramas wert. Es handelte sich schlicht und ergreifend um die popkulturelle Darstellung der hypothetischen Liebesgeschichte zweier Frauen aus dem neunzehnten Jahrhundert, die vielleicht nicht mehr als enge Freundinnen gewesen waren. Mit Sicherheit sagen konnte man nur, dass sie Schwägerinnen gewesen waren.
»Ich bin mir sicher, du wirst den Inhalt dieses Briefes irgendwann einmal zu Papier bringen.« Clara schnappte sich die Post aus Amherst und drückte mir den leeren Umschlag wieder in die Hände. »Vielleicht schreibst du ein Buch drüber. Das hätte doch was, oder? Du, die Autorin deiner eigenen, herzzerreißenden Liebesgeschichte. Womöglich könnte das dein Weg sein, endlich über sie hinwegzukommen.«
Doch die Autorin dieser Geschichte hielt mich wiederholt zur Närrin. In der Literatur war es unüblich, die Klimax in den ersten Akt zu verlegen. Unumkehrbare Veränderungen, erschütternde Hiobsbotschaften, ernüchternde Schicksalsschläge, noch bevor die Seitenzahl dreistellig wurde – ich riet meinen Studierenden meist davon ab, den Gehalt ihrer Worte bereits am Anfang des Manuskripts mit dem Pulver der Unglaubwürdigkeit zu verschießen. Doch ich hielt mich auch nur für eine mittelmäßig begabte Dozentin. Freies Sprechen lag mir nicht und wenn ich versuchte, jemandem etwas zu erklären, schaute ich oft in erstaunte und zugleich fragende Gesichter.
Eine Geschichte nachzuerzählen, die das Leben schrieb, war, wie stille Post zu spielen. Die Informationen, die wiedergegeben wurden, veränderten sich mit dem, was zuvor gehört und verstanden wurde. Womit wir wieder zum Beginn meines inneren Konflikts gelangten. Eine Geschichte hatte immer zwei Seiten. Die der Absendenden und die der Adressaten. Und manche Geschichten benötigten keine Absendenden, weil die Adressaten die Nachricht bereits gehört hatten.
»Ich kann bei dir bleiben, wenn dir das hilft.« Clara strich mir über den Arm. »Du musst da nicht alleine durch. Ich weiß, wie weh sie dir getan hat. Und was auch immer da stehen mag, wird vielleicht noch mehr weh tun. Aber ich bin an deiner Seite, okay?«
Ich musste den Brief nicht lesen, um zu wissen, welche Nachricht er beinhaltete. Ich konnte die Worte erahnen, weil das Papier ihr Flüstern preisgab. Es raschelte und knisterte. Brannte lichterloh in meinen Gedanken. Brannte – brannte ein tiefes Loch in mein Herz hinein. Oder in die Lücke, an der einst mein Herz verweilt hatte.
Als ich es doch tat und ihre Worte in mich aufsaugte, wurde ich zu nichts mehr, als zu meiner eignen Marionette.
Denn was wir alle zu spät erkannten, war, dass wir die Autor:innen unserer eigenen Geschichten waren. Und damit waren wir die Einzigen, die uns jemals verspotten konnten. Die Einzigen, die uns zu Närr:innen hielten. Die Einzigen, die uns zu Bösen machten.
Ich tat, wie ich mir auftrug, und öffnete die Klappkarte, die bereits auf den ersten Blick verdächtig nach einer Einladung aussah. Es war keine Nachricht, die ich bereits gehört hatte, sondern eine Nachricht, auf die ich lange hatte warten müssen.
Manche Veränderungen kündigten sich mit einer gewissen Vorlaufzeit an. Sodass stets die Möglichkeit bestand, sich darauf vorzubereiten. Man sollte meinen, die Einladung zur Hochzeit meines Bruders wäre eine solche Nachricht. Eine Nachricht, die ich ebenso gefasst und gelassen aufnahm, wie die alarmierenden Veränderungen meines Gesundheitszustands. Doch der Anschein trog.
Sutton hatte dem Umschlag eine Notiz beigelegt. Ich war mir sicher, dass niemand sonst diese Notiz erhalten hatte. Ich war mir sicher? Nein, ich wusste, dass niemand sonst diese Notiz erhalten hatte. Denn dies war eine Nachricht, die nur für mich bestimmt war. Ein Gedicht an die Dichterin.
Mr. and Mrs. Edgar C. Dawson request the pleasure of your company at the marriage of their son Wyatt Arvin to Sutton Hope Grey. Sunday, the first of July two thousand thirty at half after four.
He –
Might be
The last sentence.
But you –
You are
The plot.
Manche Geschichten begannen mit einer Lüge. Einer Lüge, die ihre Autorin sich selbst erzählte.
Kapitel 2
»I would not paint – a picture –
I’d rather be the One«
– Emily Dickinson, 1862
Arvin
Liebe – sofern man die Worte meiner Schwester verwenden wollte –, Liebe war vergänglich. Und Vergänglichkeit hatte viele Facetten. Hauptsächlich Hässlichkeit. Liebe – falls man meine Worte verwenden wollte – war hässlich.
Warum erzählte ich das? Warum beschäftigte ich mich überhaupt mit der Definition und Sinnhaftigkeit von Liebe? Einem Gefühl, das mir vor langer Zeit abhandengekommen war. Wahrscheinlich, um ferner der Frage auf den Grund zu gehen, wann und vor allem warum mir die Liebe abhandengekommen war.
Als ich Sutton das erste Mal gesehen hatte, war sie bereits ein paar Tage in der Stadt gewesen. Zweiundzwanzig und gerade erst aus Manhattan hergezogen. Die Großstadt hatte ihre Spuren hinterlassen. Sie passte nicht in die Kleinstadt. Sie fiel auf. Sie fiel mir auf.
Sie hatte auf der Treppe vor dem Eingang des Antiquitätenladens ihrer Schwester gesessen. Zu ihren Füßen einen Coffee-To-Go-Becher aus dem Mary’s Crisis. Der Braune aus nachhaltigen, recycelten Materialien zum Aufpreis von einem Dollar, den hier keiner sonst bereit war zu zahlen.
Meine Schwester Ember war Stammkundin im einzigen rein veganen Café der Stadt gewesen. An diesem Tag saß sie wie immer in dem grünen Ohrensessel vorm Schaufenster, wo sie normalerweise unzählige Stunden verharrte. Dem waldgrünen Ohrensessel, wie sie sagen würde. Warum auch immer es wichtig war, die Farbe eines Gegenstandes so genau wie möglich zu spezifizieren.
Während Ember tief in ihr Notizbuch versunken gewesen war, hatte sich Sutton in ihrem Anblick verloren. Ich hatte es sofort gewusst. Konnte es in ihren Augen sehen. Ja, Sutton war vielleicht mir aufgefallen, aber Ember – Ember war Sutton aufgefallen.
Sie hatte sie durch die Linse ihrer Kamera beobachtet. Es war eine alte, analoge Kamera. Ein teures Hobby. Aber auch ein schönes. Es passte zu ihr, auch wenn es sie zum Klischee machte.
Ich hatte sie von der Straßenecke aus im Blick behalten. Kam gerade aus der Kanzlei meines Vaters. Hatte dort die Nacht verbracht und den x-ten Kater in dieser Woche ausgeschlafen. War gegangen, bevor der erste Anzugträger das Büro betrat. Wenn ich betrunken nach Hause gekommen wäre, hätte mein Vater mich bemerkt und mir eine Standpauke über Moral, Zucht und Ordnung gehalten. Er hatte an diesen Tagen oft bis tief in die Nacht an seinem Schreibtisch gesessen.
Sutton, die Fremde aus New York, hatte einen gewöhnungsbedürftigen Kleidungsstil. Ich stieß sie völlig vorverurteilend in die Öko-Schublade und hatte auch nicht vor, sie dort alsbald wieder herauszulassen. Ich stempelte sie ab. Ich schloss die Möglichkeit aus, dass ich jemals mit ihr im Bett landen würde, doch auf ihre verschrobene Art hatte sie etwas Anziehendes.
Ein paar Wochen später hatten wir das erste Mal miteinander geschlafen. Es war heißer, wilder, rein auf Befriedigung orientierter Sex gewesen. Ich wünschte, wir könnten das wiederholen. Wenn wir jetzt miteinander schliefen, dann war der Sex nichts als wütend. Wütend, aber gut. Besser als mit all den anderen, doch viel zu selten. Sutton schlief lieber mit Frauen. Mit einer Frau, um genau zu sein. Rachel Lachlan war die ultimative Inkarnation einer Femme fatale. Woher ich den Begriff kannte? Ember hatte ihn mir beigebracht und erklärt.
Femme fatale; eine besonders attraktive und verführerische Frauenfigur in Kunst und Literatur. Was – wenn man die Worte meiner Schwester verwenden wollte – Mrs. Carpenter zu einem stilistischen Mittel machte.
Sutton
Ich war heimatlos in einen Hafen eingefahren, der Schiffbrüchigen keine Zuflucht gewährte. Seit fünf Jahren tat ich tagein, tagaus nichts anderes, als mich zu verstecken. Vor dem Gerede und den neugierigen Blicken der Leute.
Mein Schwager Willem hatte Amherst neun Monate nach dem Tod meiner Schwester verlassen. Er behielt das Greyhouse, doch es blieb auf unbestimmte Zeit geschlossen. Verstaubte vor sich hin und wurde zu dem, was es einst verkaufte. Zu einer Antiquität.
Zu meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag hatte Arvin mir das Greyhouse geschenkt. Er hatte es Willem zu einem Spottpreis abgekauft. Erst ein halbes Jahr später war ich bereit gewesen, den Laden zu betreten. Es fühlte sich falsch an, zwischen all den alten, ausrangierten, unter einer dicken Staubschicht verschwindenden Dingen zu stehen. Ich wollte keine Antiquitäten verkaufen, das war Hunters Leidenschaft gewesen, nicht meine.
Ihre Gegenwart war in jedem Gegenstand spürbar. Mein Kopf betrog meine Augen regelmäßig mit der Vorstellung, sie noch immer hinter dem Tresen sitzen zu sehen. Sie lächelte mir ermutigend zu, als wollte sie sagen, dass sie hinter jeder meiner Entscheidungen stehen würde, egal, welche Konsequenzen diese mit sich brachten.
Also veranstaltete ich einen Flohmarkt, um all das Zeug auf einen Schlag loszuwerden. Ich behielt nur einen alten Massivholzschreibtisch, zwei Staffeleien, drei Regale und vier analoge Kameras. Von dem Erlös der anderen Dinge kaufte ich mir ein paar Zimmerpflanzen für den grünen Flair, Filme für die Kameras, Leinwände und Farbe. In der Hoffnung, ich würde dadurch den Bezug zu meiner Leidenschaft wiederfinden.
Während ich im Greyhouse mein Atelier einrichtete, stattete mir Embers Tante Lorna einen Besuch ab. Sie kündigte sich nicht an. Das tat Tante Lorna grundsätzlich nicht. Sie kam und ging, wie es ihr beliebte. Verließ die Stadt manchmal für mehrere Monate, und wenn sie zurück war, blieb sie nur ein paar wenige Tage. Northhill war nicht ihr Zuhause, sondern ihr Lager.
Arvin und ich lebten zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr auf Northhill. Sein Vater ertrug meine Anwesenheit nur mit dem nötigen Abstand. Der einzige Grund, warum er meine bloße Existenz duldete, war die Tatsache, dass ich die Mutter seiner Enkel war. Doch Edgar war weiterhin der Auffassung, ich würde seinen Sohn ausschließlich wegen dessen Erbe daten. Das Geld und das soziale Ansehen der Dawsons könnten mich dabei nicht weniger interessieren. Aber sie brachten gewisse Vorzüge mit sich und ich hatte gelernt, diese für mich zu nutzen.
Wir hatten ein Haus direkt gegenüber dem Dickinson Museum gemietet. Ich schrieb mich für einen Kunstkurs am Amherst College ein und wählte im Nebenfach Literatur, nur damit ich weiterhin im Museum arbeiten konnte. Ich blieb Sue und bekam in jedem Semester eine neue Emily an die Seite gestellt. Aber auch im echten Leben war ich eine junge Mutter, die vom Vater ihres Kindes hintergangen wurde. Und wie Sue war ich eine Mutter, die dem Mann an ihrer Seite etwas vortäuschte.
Meine emotionalen Seitensprünge verarbeitete ich seither in meiner Kunst. Doch anders als Ember und Emily wollte ich meine Werke nicht länger verstecken. Ich wollte mich nicht länger verstecken. Ich wollte zu der Version von Sue werden, die nicht länger im Schatten der Familie stand, in die sie eingeheiratet hatte. Ich wollte zu der Version von mir werden, über die geredet wurde, weil ihre Kunst die Leute überwältigte, faszinierte und beeindruckte. Ich wollte beeindruckend sein.
Lorna war eines der Poster aufgefallen, die ich ein paar Monate zuvor überall in der Stadt verteilt hatte. Ich lud Amherst dazu ein, meiner ersten Vernissage beizuwohnen.
»Eine Frage der Unvollkommenheit?« Mit Nachdruck hatte sie mir einen der Flyer auf den Schreibtisch gepfeffert.
»Es ist auch schön, dich zu sehen, Lorna.« Wir waren in den letzten Jahren nie wirklich warm miteinander geworden. Doch sie war mir immer noch sympathischer als Arvins Eltern. Was auf Gegenseitigkeit beruhte.
»Warum hast du mir all das hier verschwiegen?« Sie deutete in den noch sehr leeren und kahlen Raum. Alles, was das Greyhouse zu diesem Zeitpunkt beherbergte, waren die Kunstwerke, an denen ich arbeitete. Malereien, die Rachel und mich zeigten, ohne Rachel und mich zu zeigen.
Ich war gerade dabei gewesen, mir im Hinterzimmer eine Dunkelkamera einzurichten.
»Ich bin ein Niemand«, sagte ich nun. »Warum solltest du dich für die Kunst eines Niemands interessieren?«
Lorna stellte Kunst aus, die Rang und Namen hatte. Die sich einer großen Beliebtheit erfreute und bereits ein Stammpublikum mit sich brachte. Wie sollte sie sonst Geld verdienen?
»Jede:r hat eine Geschichte zu erzählen, auch ein Niemand«, entgegnete sie. »Und du, süße, unscheinbare Sutton, hältst Geschichten zurück, die ich nur zu gerne hören würde.«
Einfach so hatte Lorna mich zu ihrem neuen Projekt gemacht – das ich bis heute geblieben war.
»Ich will, dass du was über die Liebe machst.« Nachdem sie wieder einmal für Wochen im Ausland verschwunden war, kehrte sie unangekündigt nach Amherst zurück. Im Schlepptau hatte sie ihr neues, altes Spielzeug. Die personifizierte Exzentrik. Kurt Brewster, der Gitarrist der Indieband Rooftops, mein ehemaliger Kollege aus dem Mary’s Crisis. Und eine fixe Idee, die sie unmittelbar mit mir umsetzen wollte.
»Du willst, dass ich etwas über meine Liebe zu Arvin ausstelle?« Ich beobachtete Kurt dabei, wie er sich breitbeinig an meinen Schreibtisch setzte und sich die Gliederpuppe von der Platte schnappte, um daran herumzuspielen.
»Nicht zu Arvin.« Meine Verlobung mit ihrem Neffen ließ Lorna unbeeindruckt. »Ich will, dass du etwas über deine Liebe zu dir selbst machst.«
»Selbstliebe«, säuselte Kurt unverständlich in Gedanken und stellte die Puppe zurück an ihren Platz. »Darüber könnte ich eigentlich mal einen Song schreiben.«
Ich schenkte ihm einen ungläubigen Blick. Er war mir suspekt. Wie ein Charakter aus den Sims, völlig unfähig, in der realen Welt zu überleben und sich anzupassen.
»Kurt«, zischte Lorna in einem anmaßenden Ton. »Du hast Sendepause!«
Kurt und Lorna hatten in den letzten Jahren immer mal wieder etwas miteinander gehabt. Sie konnten weder miteinander noch ohneeinander.
»Was immer du willst, Babe!« Er erhob sich, schlängelte sich durch die Staffeleien und versuchte in den leeren Leinwänden, die ich darauf abgestellt hatte, einen tieferen Sinn zu finden.
Wenn ich ehrlich war, wäre ich sehr interessiert daran gewesen, einen Rooftops-Song über das Thema Selbstliebe zu hören. Denn mir war unklar, wie ich dies in seiner Komplexität umsetzen und verbildlichen sollte.
»Wann ist meine Abgabefrist?« Es war ausgeschlossen, dass Lorna mit sich diskutieren ließ. Wenn sie sich eine Idee in den Kopf gesetzt hatte, dann wurde diese auch umgesetzt. Wenn ich klug war, kam ich ihren Vorstellungen also einfach nach. Denn letztlich war sie es, die es mir ermöglichte, meinen Traum zu leben.
»Was hältst du davon, wenn wir eine Vernissage am Sonntag nach deiner Hochzeit veranstalten? Ihr habt doch sowieso nicht vor, in die Flitterwochen zu fliegen …« Lorna war eine Freundin klarer Ansagen. Sie hatte das alles bereits durchgeplant. Es gab für mich nicht einmal die Möglichkeit, mein Veto einzulegen.
»Du heiratest?« Kurt musterte mich fragend. »Bis eben habe ich gedacht, du wärst erst zwanzig oder so.«
Ich sah davon ab, ihm mitzuteilen, dass ich drei Kinder zur Welt gebracht hatte. Denn diese Information stand in keinerlei Verbindung zu meinem Alter oder der Tatsache, die steuerrechtlichen Vorzüge der Ehe genießen zu wollen.
»Kurt!« Lorna fuhr ihn spitz an und warf ihm ihre Autoschlüssel entgegen. »Fahr doch schon mal nach Northhill.«
Missbilligend und unelegant fing er die Schlüssel mit einer Hand auf. »Hat mich gefreut, dich mal wiederzusehen, Susan.«
»Sutton«, verbesserte ich ihn. Nicht zum ersten Mal.