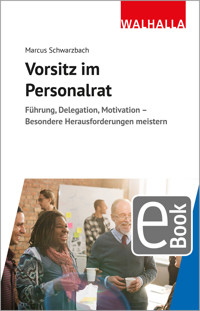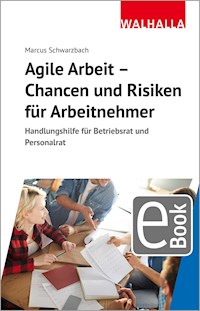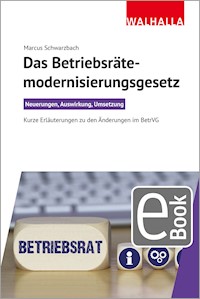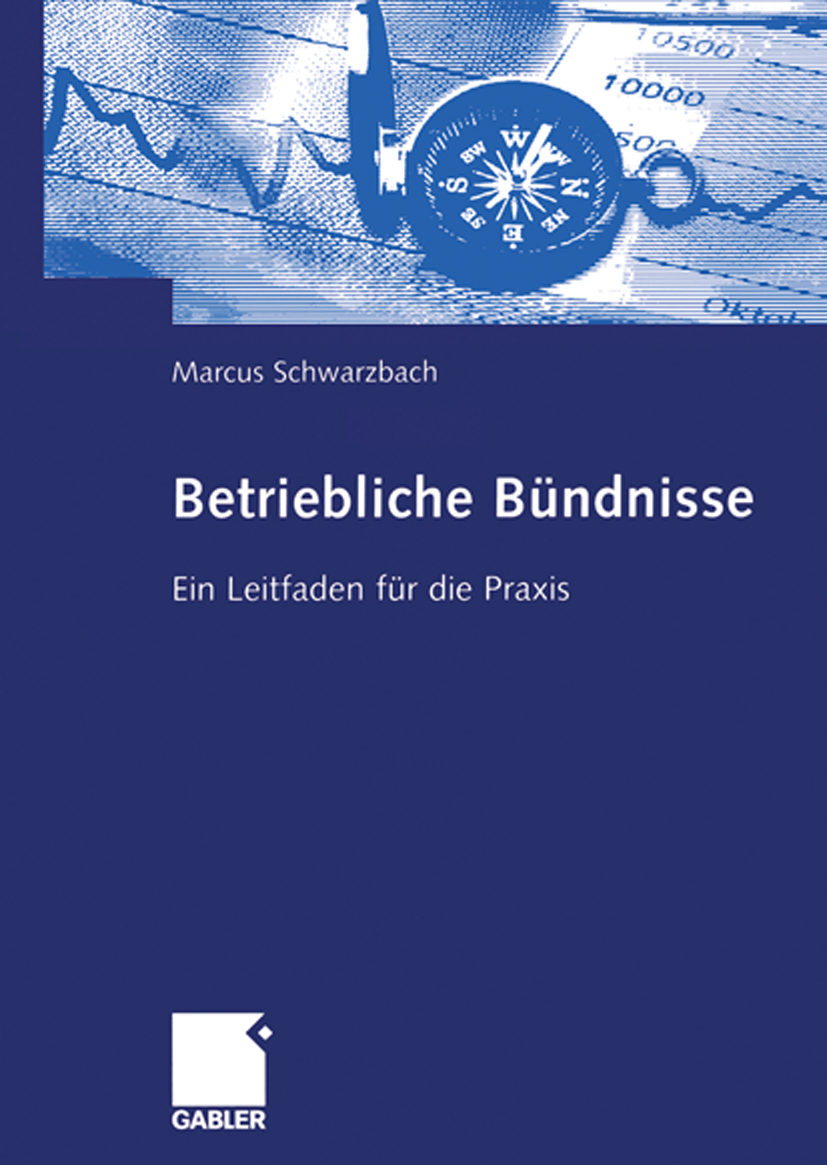16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Walhalla Digital
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Agieren statt Reagieren
Ein wichtiges Thema für viele Personal- und Betriebsräte ist die Sicherung von Arbeitsplätzen. Diese können aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sein: u.a. neue Technik, Kostensenkungen, Verlagerung von Arbeit oder Umstrukturierungen. Durch die Digitalisierung gewinnen auch Fragen der Qualifizierung für Arbeitnehmer immer mehr an Bedeutung, um den eigenen Arbeitsplatz zu erhalten.
Hier ist es seitens der Arbeitnehmervertretung erforderlich, frühzeitig aktiv zu werden: Informationen zu beabsichtigen Änderungen müssen beschafft werden, Vorschläge gemacht und umgesetzt werden. Dies gilt sowohl für den personellen Bereich als auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Unternehmerische oder behördliche Planungen müssen kritisch hinterfragt werden.
Dies setzt Strategieentwicklung im Gremium und ein entschlossenes Handeln voraus. Für Personal- und Betriebsräte ist es daher umso wichtiger, die eigenen Rechte zu kennen und auch auszuüben.
Arbeit sichern – Positives Krisenmanagement führt verschiedene Szenarien auf, warum Arbeitsplätze unter Druck geraten können. Es zeigt Handlungsmöglichkeiten und Beispiele, die den Personal- und Betriebsrat bei der Sicherung von Arbeitsplätzen unterstützen sollen. So werden u.a. Mitbestimmungsrechte aufgeführt oder Hinweise zu Betriebs- oder Dienstvereinbarungen im Hinblick auf die Arbeitsplatzsicherung gegeben.
Dabei kommen nicht nur die „klassischen“ Themen der Personal- und Betriebsratsarbeit wie Arbeitszeit oder Förderung des internen Stellenmarktes zur Sprache. Vielmehr werden Impulse gegeben und Handlungsoptionen vorgestellt, die Aktivität statt Passivität ermöglichen.
Damit werden die Arbeitnehmervertreter in die Lage versetzt, mit eigenen Vorschlägen, und im Zusammenwirken mit dem Vorgesetzten, die Interessen der Belegschaft wahr zu nehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Ähnliche
1. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected] Web
Kurzbeschreibung
Agieren statt Reagieren
Ein wichtiges Thema für viele Personal- und Betriebsräte ist die Sicherung von Arbeitsplätzen. Diese können aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sein: u.a. neue Technik, Kostensenkungen, Verlagerung von Arbeit oder Umstrukturierungen. Durch die Digitalisierung gewinnen auch Fragen der Qualifizierung für Arbeitnehmer immer mehr an Bedeutung, um den eigenen Arbeitsplatz zu erhalten.
Hier ist es seitens der Arbeitnehmervertretung erforderlich, frühzeitig aktiv zu werden: Informationen zu den beabsichtigten Änderungen müssen beschafft werden, Vorschläge gemacht und umgesetzt werden. Dies gilt sowohl für den personellen Bereich als auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Unternehmerische oder behördliche Planungen müssen kritisch hinterfragt werden.
Dies setzt Strategieentwicklung im Gremium und ein entschlossenes Handeln voraus. Für Personal- und Betriebsräte ist es daher umso wichtiger, die eigenen Rechte zu kennen und auch auszuüben.
Arbeit sichern – Positives Krisenmanagement führt verschiedene Szenarien auf, warum Arbeitsplätze unter Druck geraten können. Es zeigt Handlungsmöglichkeiten und Beispiele, die den Personal- und Betriebsrat bei der Sicherung von Arbeitsplätzen unterstützen sollen. So werden u.a. Mitbestimmungsrechte aufgeführt oder Hinweise zu Betriebs- oder Dienstvereinbarungen im Hinblick auf die Arbeitsplatzsicherung gegeben.
Dabei kommen nicht nur die „klassischen“ Themen der Personal- und Betriebsratsarbeit wie Arbeitszeit oder Förderung des internen Stellenmarktes zur Sprache. Vielmehr werden Impulse gegeben und Handlungsoptionen vorgestellt, die Aktivität statt Passivität ermöglichen.
Damit werden die Arbeitnehmervertreter in die Lage versetzt, mit eigenen Vorschlägen, und im Zusammenwirken mit dem Vorgesetzten, die Interessen der Belegschaft wahr zu nehmen.
Autor
Marcus Schwarzbach, Berater in Mitbestimmungsfragen, erfahrener Referent für Personal- und Betriebsräte, erfolgreicher Fachautor.
Schnellübersicht
Vorwort
1. Arbeitsplatzsicherung als Herausforderung
2. Die besondere Bedeutung der Informationsrechte
3. Arbeitsplatzsicherung beim Einsatz neuer Technik
4. Digitalisierung, Qualifizierung und Arbeitsplatzsicherung
5. Hilfe von außen – Förderung durch die Agentur für Arbeit
6. Förderung des internen Stellenmarktes
7. Arbeitszeit und Arbeitsplatzsicherung
8. Die besondere Rolle des Wirtschaftsausschusses
9. Wirtschaftliche Angelegenheiten hinterfragen
10. Alternativen zu Outsourcing
11. Innovationsmanagement zur Arbeitsplatzsicherung
12. Tarifliche Öffnungsklauseln nutzen
13. Interessenausgleich und Sozialplan
14. Mehr Erreichen durch den Einbezug der Belegschaft
15. Literaturhinweise
Auszüge aus referenzierten Vorschriften
Vorwort
Arbeitsplätze sind gefährdet
Abkürzungen
Arbeitsplätze sind gefährdet
Neue Technik, Verlagerung von Arbeit oder Umstrukturierungen – Arbeitsplätze können aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sein. Für Personal- und Betriebsräte ist es deshalb eine wichtige Aufgabe, die Beschäftigung im Betrieb zu sichern. Für Arbeitnehmervertretungen, die neben dem üblichen „Tagesgeschäft“ oftmals nicht ausreichend Zeit haben, sich mit dem Thema Arbeitsplatzsicherung ausführlich zu beschäftigen, soll dieser Band einen Überblick geben, welche Handlungsmöglichkeiten in der Praxis bestehen.
Personal- und Betriebsräte sollten ihre Vorschlagsrechte frühzeitig einsetzen, um der Gefährdung von Arbeitsplätzen vorzubeugen. Wie die Gremien eine eigene Strategie entwickeln können, zeigt dieses Buch. Es werden Beispiele zur Sicherung der Beschäftigung dargestellt. Dabei werden nicht nur die „klassischen“ Themen der Betriebs- und Personalratsarbeit wie Arbeitszeit oder Förderung des internen Stellenmarktes erläutert. Vielmehr werden dem Betriebsrat Handlungsmöglichkeiten vorgestellt, die ein Agieren statt Reagieren ermöglichen. Durch die Digitalisierung gewinnen Fragen der Qualifizierung für Arbeitnehmer immer mehr an Bedeutung, um den eigenen Arbeitsplatz zu erhalten.
In der Praxis ist dies nicht immer einfach. Eine Kollektivvertretung zeichnet sich nicht nur durch die Zusammenfassung aller einzelnen Interessen aus, sondern muss übergreifend agieren und kann durchaus Positionen vertreten, die dem Wunsch einzelner Mitarbeiter auf den ersten Blick widersprechen und diesen gegenüber umfassend erläutert werden müssen. Dies kann beispielsweise beim leidigen Thema Überstunden der Fall sein. Wenn eine Gruppe von Mitarbeitern den Antrag des Arbeitgebers auf Überstunden befürwortet, kann der Personalrat diesen trotzdem ablehnen, wenn so die Chance besteht, die Übernahme befristet eingestellter Arbeitnehmer durchzusetzen. Umso wichtiger ist eine Strategie der Personal- und Betriebsräte, die den Arbeitnehmern gegenüber offensiv dargestellt wird.
Personal- und Betriebsräte können ihr Vorschlagsrecht jederzeit nutzen und müssen nicht abwarten, bis der Arbeitgeber Planungen zum Personalabbau vorlegt. Beim Vorschlagsrecht kann unterschieden werden zwischen Vorschlägen im personellen Bereich und in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Bei manchen Themen, etwa Outsourcing, sind in erster Linie Beschäftigte in Industrie oder Dienstleistungsbranchen betroffen, Betriebsräte haben deshalb Ideen zur Gegenwehr entwickelt. Aber diese Beispiele können auch Personalräten Anregungen geben, um eigene Ideen zu entwickeln.
Diese Publikation soll Personal- und Betriebsräten Mut machen, mit eigenen Vorschlägen die Interessen der Belegschaft wahrzunehmen.
Meine Erfahrungen als Referent für Betriebs- und Personalratsseminare und als Sachverständiger für Betriebsräte fließen in dieses Buch ein. Für Fragen, Anregungen und Kritik bin ich dankbar. Zu erreichen bin ich per E-Mail unter: [email protected]
Kaufungen, August 2020
Marcus Schwarzbach
Hinweis: Wir wollen unseren Leserinnen und Lesern eine schnelle und zuverlässige Hilfe an die Hand geben und verwenden daher – ausschließlich im Interesse der Lesefreundlichkeit – die männliche Sprachform.
Abkürzungen
Abs.AbsatzArbSchGArbeitsschutzgesetzArbZGArbeitszeitgesetzAT-AngestellteAußertarifliche AngestellteAz.AktenzeichenBAGBundesarbeitsgerichtBAuABundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinBBiGBerufsbildungsgesetzBeschl.BeschlussBetrVGBetriebsverfassungsgesetzBPersVGBundespersonalvertretungsgesetzd. h.das heißtEuGHEuropäischer GerichtshofigaInitiative Gesundheit und Arbeit der Deutschen Gesetzlichen UnfallversicherungLAGLandesarbeitsgerichtLPVG NRWLandespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-WestfalenMiLoGMindestlohngesetzNPersVGPersonalvertretungsgesetz des Landes NiedersachsenNr.NummerRKWRationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen WirtschaftSGB IIISozialgesetzbuch Drittes BuchSGB IXSozialgesetzbuch Neuntes BuchTVöDTarifvertrag für den öffentlichen DienstTzBfGTeilzeit- und BefristungsgesetzUrt.Urteil1. Arbeitsplatzsicherung als Herausforderung
1. Wichtiges Thema für Personal- und Betriebsrat
2. Agieren statt reagieren
3. Vorschlagsrechte nutzen
4. Strategieentwicklung der Arbeitnehmervertretung
1. Wichtiges Thema für Personal- und Betriebsrat
Ein wichtiges Thema für viele Personal- und Betriebsräte ist die Sicherung von Arbeitsplätzen. Dies setzt Strategieentwicklung im Gremium und ein entschlossenes Handeln voraus.
Ein betriebliches Beispiel verdeutlicht die Möglichkeiten:
Der Arbeitgeber konfrontiert den Betriebsrat mit seinen Planungen für das nächste Jahr. Die Kosten im Personalbereich sollen um einen zweistelligen Millionenbetrag gesenkt werden. Wie dieses Ziel erreicht werden soll, ließ der Arbeitgeber zunächst offen. Konkrete Zahlen, wie viele Mitarbeiter entlassen werden sollen, nannte er nicht.
Der Betriebsrat wurde mit diesen Vorstellungen konfrontiert, die Belegschaft gleichzeitig vom Arbeitgeber informiert. Der Betriebsrat besteht aus elf Mitgliedern, wobei dem fünfköpfigen Wirtschaftsausschuss nur ein Betriebsratsmitglied angehört.
In der Sitzung besteht Einigkeit:
Der Betriebsrat muss eine eigene Strategie entwickeln.
2.Es handelt sich um eine umfassende Aufgabe des Gremiums, nur durch Arbeitsteilung kann sich der Betriebsrat dieser Aufgabe stellen.
Inhaltlich will der Betriebsrat in enger Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsausschuss Alternativen zur Personalkosteneinsparung entwickeln:
Statt Personalkosten die Sachkosten senken – dazu müssen einzelne Kostenblöcke hinterfragt und Alternativen erarbeitet werden. Dazu werden je nach Abteilung Arbeitsgruppen von Betriebsrats- und Wirtschaftsausschuss-Mitgliedern gegründet.
Auch will die Arbeitnehmervertretung Verbesserungsvorschläge für den Vertrieb erarbeiten, um den Umsatz zu steigern.
Neben einem Aufruf an die Belegschaft, Vorschläge einzureichen, bezieht der Betriebsrat auch Kollegen ein, die der Arbeitgeber als interne Auskunftsperson nach § 80 Abs. 2 Satz 3 BetrVG freistellen muss.
Vorteile dieser Strategie
Der Betriebsrat streitet für ein eigenes Konzept – statt sich durch ein reines Nein-Sagen zu den Arbeitgeberplanungen in die Defensive zu bringen. Da der Betriebsrat diese Vorgehensweise gemeinsam erarbeitet hat, sind bei der konkreten Vorgehensweise auch eher alle Betriebsratsmitglieder zur Mitarbeit zu motivieren – oder bereits von sich aus motiviert!
2. Agieren statt reagieren
Personal- und Betriebsräte stehen Personalabbau-Drohungen häufig hilflos gegenüber. „Entschieden ist entschieden, da können wir nichts machen“, ist oftmals die Einschätzung auch gestandener Arbeitnehmervertreter. Diese resignative Haltung hat einen realen Hintergrund und basiert auf betrieblichen Erfahrungen, da Unternehmen häufig Vorschläge oder Einwände von Personal- und Betriebsrat unberücksichtigt lassen.
Die rechtlichen Handlungsmöglichkeiten zeigen jedoch, dass Betriebsräte durchaus unternehmerische Planungen kritisch hinterfragen können. Dabei ist der Grundsatz wichtig, je früher sich die Arbeitnehmervertretung einbringt, umso eher können die Führungsentscheidungen verhindert oder verändert werden. Dies setzt ein entschlossenes Vorgehen bei der Informationsbeschaffung voraus.
Besondere Bedeutung haben für Betriebsräte die Möglichkeiten zur Beschäftigungssicherung nach § 92a BetrVG, die einen Verhandlungsanspruch enthalten, ohne dass bereits ein Sozialplan angestrebt werden muss. Das Vorschlagsrecht kann jederzeit (!) eingesetzt werden, um der Gefährdung von Arbeitsplätzen vorzubeugen.
Der Betriebsrat kann also jederzeit Vorschläge unterbreiten und den Arbeitgeber zu Gesprächen auffordern. Der Betriebsrat kann so agieren und muss nicht abwarten, bis eine betriebliche Kostensenkungsdebatte Arbeitsplätze infrage stellt.
3. Vorschlagsrechte nutzen
§ 92a BetrVG wurde mit dem Ziel der Arbeitsplatzsicherung in das Gesetz aufgenommen. Danach kann der Betriebsrat dem Arbeitgeber Vorschläge zur Sicherung und Förderung der Beschäftigung machen:
Unter „Beschäftigungssicherung“ ist der Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze zu verstehen.
Der Begriff „Beschäftigungsförderung“ ist dagegen weiter zu fassen. Denn so wird der Betriebsrat aufgefordert, Vorschläge zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze zu unterbreiten. Dies kann sich auch auf Mitarbeiter mit befristeten Arbeitsverträgen oder die Übernahme Auszubildender beziehen.
Aus Sicht der Betriebsräte kann diese Regelung des BetrVG ebenfalls eingesetzt werden, um über Gegenvorschläge zum geplanten Personalabbau zu verhandeln.
Nach § 92a BetrVG kann der Betriebsrat dem Arbeitgeber Vorschläge unterbreiten. Dies können insbesondere solche zur Arbeitsplatzsicherung zu folgenden Themen sein:
eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit,
die Förderung von Teilzeitarbeit und Altersteilzeit,
neue Formen der Arbeitsorganisation,
Änderungen der Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe,
die Qualifizierung der Arbeitnehmer,
Alternativen zur Ausgliederung von Arbeit,
Alternativen zur Vergabe an andere Unternehmen sowie zum
Produktions- und Investitionsprogramm.
Diese Auflistung ist aber nicht abschließend. Sollte der Betriebsrat weitere Ideen haben, muss der Arbeitgeber darüber verhandeln.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Vorschläge mit dem Betriebsrat zu beraten. Hält der Arbeitgeber die Vorschläge des Betriebsrats für ungeeignet, hat er dies zu begründen. In Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern erfolgt die Begründung schriftlich.
Der Betriebsrat kann – um seine Vorschläge zu untermauern – zu den Beratungen einen Vertreter der Agentur für Arbeit hinzuziehen. Auch der Arbeitgeber hat nach § 92a Abs. 2 BetrVG diese Möglichkeit.
Ein spezielles Vorschlagsrecht zur Arbeitsplatzsicherung nach § 92a BetrVG hat der Personalrat leider nicht. Aber auch Vorschlagsreche nach Personalvertretungsgesetzen ermöglichen ein Agieren. Nach § 68 Abs. 1 Nr. 1 BPersVG kann die Personalvertretung Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen, beantragen. Dazu gehört auch die Sicherung von Arbeitsplätzen. Landesvertretungsgesetze sehen vergleichbare Regelungen vor.
Gemäß § 66 BPersVG sollen Dienststellenleiter und Personalrat einmal monatlich zusammenkommen, um über betriebliche Themen zu beraten. Dies ermöglicht dem Personalrat, in Anlehnung an das Vorschlagsrecht des Betriebsrats, Vorschläge zur Arbeitsplatzsicherung zu machen.
4. Strategieentwicklung der Arbeitnehmervertretung
Gerüchte oder bereits konkrete Planungen, die einen Personalabbau betreffen, stellen für den Betriebs- oder Personalrat und all seine Mitglieder eine emotionale Belastung dar. Unter Umständen erzeugt die Geschäftsführung zeitlichen Druck, die betroffenen Kollegen möchten Genaues erfahren. Für die Arbeitnehmervertretung ist es deshalb wichtig, einen „kühlen Kopf“ zu bewahren. Das Gremium sollte sich zunächst über die aktuelle Lage klar werden, dann seine Ziele formulieren und erst danach rechtliche und betriebliche Handlungsmöglichkeiten analysieren.
Zur Sicherung der Arbeitsplätze empfiehlt sich ein Vorgehen in folgenden Schritten:
Wie ist die Situation?
Welche Beschäftigten und Abteilungen sind von einem Personalabbau betroffen?
Was sagt die Geschäftsführung/Dienststellenleitung verbindlich zu Planungen, die zu Personalabbau führen können?
Welche Ursachen hat die Entscheidung des Unternehmens?
Sind die geschilderten Gründe plausibel oder erscheinen sie der Arbeitnehmervertretung vorgeschoben?
Was ist das Ziel?
Die Forderungen des Betriebsrats sind zu klären.
Dafür sollte sich der Betriebsrat ausführlich Zeit nehmen. Die Forderung des Betriebsrats sollte sein: der Erhalt aller oder doch möglichst vieler Arbeitsplätze!
Vorschläge zu personellen Fragen und wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne der Arbeitsplatzsicherung sollten hier diskutiert werden.
Wie können die Forderungen durchgesetzt werden?
Hier beginnt die rechtliche Prüfung: Welche Gesetze gibt es, die weiterhelfen können?
Enthalten für den Betrieb geschlossene Betriebs- oder Dienstvereinbarungen bereits Regelungen, die Arbeitsplatzsicherung ermöglichen?
Gibt es in einem für den Betrieb gültigen Tarifvertrag Ansprüche zur Arbeitsplatzsicherung?
Welche Alternativen sind aus Sicht des Betriebsrats machbar oder denkbar?
Wie kann die Arbeitnehmervertretung ihre Argumentation aufbauen? Vor allem muss dem Arbeitgeber deutlich gemacht werden, dass der geplante Personalabbau nicht als Normalität angesehen wird.
Wie kann die Belegschaft in die Meinungsbildung und Auseinandersetzung einbezogen werden (Flugblätter, Betriebsversammlungen, Betriebsbegehungen zur direkten Kontaktaufnahme)?
Diese Auseinandersetzungen können nicht allein vom Betriebs- oder Personalrat geführt werden. Deshalb ist zu klären, ob er Bündnispartner gewinnen kann (z. B. Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, Gewerkschaften, Agentur für Arbeit)?
Wie wird sich der Arbeitgeber verhalten?
Wie kann auf Gegenargumente reagiert werden?
Personal- und Betriebsräte sollten auch den Beschäftigten gegenüber Transparenz herstellen und ihre Vorschläge darstellen. So wird auch der Belegschaft deutlich, welche Aktivitäten die Arbeitnehmervertretung entwickelt.
2. Die besondere Bedeutung der Informationsrechte
1. Weitergabe von Informationen ist entscheidend
2. Rechtzeitige Information maßgeblich
3. Kriterium der menschengerechten Arbeitsplatzgestaltung
4. Bedeutung des Wirtschaftsausschusses
5. Personalplanung
6. Bedeutung der Personalbedarfsplanung
7. Vorschläge zur Einführung einer Personalplanung
1. Weitergabe von Informationen ist entscheidend
Ohne Informationen können Personal- und Betriebsräte die Interessen der Arbeitnehmer nicht wahrnehmen. Das zeigt sich insbesondere bei Fragen der Digitalisierung: Neue Begriffe signalisieren Umbrüche. Der Begriff Smartphone ist einem vertraut. Aber was hat es mit einer Smart Factory auf sich? Um smart zu sein, muss ein System Daten und Informationen aufnehmen, auswerten und weitergeben können. Kernstück ist eine rundum vernetzte und voll automatisiert gesteuerte Produktion. Sie beruht auf technologischer Intelligenz, die in Produkten und Maschinen eingebunden wird. Dies alles hat Auswirkungen auf Arbeitsplätze.
Beispiel „Crowdsourcing“ und Informationsrechte
Internetplattformen ermöglichen die gezielte Verlagerung von Aufgaben und können Arbeitsplätze im Betrieb gefährden. Crowdsourcing verknüpft das Auslagern von Arbeit, also „Outsourcing“ mit einem Aufruf an eine Menge, die „Crowd“. Arbeit, die bislang im Unternehmen selbst erledigt wurde, soll ausgelagert werden, hier über das Internet. Das Zerlegen von Arbeit in kleine und zumeist einfache Tätigkeiten ermöglicht es dem Unternehmen, auf eine Unmenge an Anbietern zurückzugreifen, die sich weltweit unterbieten. Crowdsourcing ist aber nicht nur bei kleinen Nebenjobs oder einfachen Aufgaben bedeutsam. Auch hochqualifizierte Arbeitnehmer können von einschneidenden Veränderungen betroffen sein.
Die besonderen Aufgaben des Betriebsrats zeigt das Beispiel eines Software-Unternehmens. Dieses plante Crowdsourcing mit einem firmeneigenen Internetportal. Es werden große Projekte in kleine Pakete zerlegt, die 40 bis 80 Stunden umfassen.
Vor Einführung des Konzeptes bestand für den Betriebsrat die Problematik darin, erst einmal einen Überblick über die geplanten Veränderungen zu erhalten. Zunächst hieß es, es gebe eine neue Software. Dann zeigte sich, der Arbeitgeber will mit der neuen Software auch eine Leistungsbewertung durchführen. Die erzielten „Points“ sollten zu einer Beurteilung der Arbeitsleistung jedes Arbeitnehmers genutzt werden. Weitere Informationen, die der Betriebsrat anforderte, machten deutlich: Freie Programmierer oder Angestellte aus dem Betrieb sollen sich auf Online-Ausschreibungen bewerben.
Mitbestimmungsrecht beim „Technikeinsatz“
Das entschlossene Vorgehen des Betriebsrats, auch durch Aufzeigen der betroffenen Mitbestimmungsrechte beim Technikeinsatz nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG verhinderte die Arbeitgeberplanung. Der Betriebsrat konnte verhindern, dass Programmierer in der Bundesrepublik durch diese Versteigerungs-Plattformen ihren Arbeitnehmerstatus verlieren.
Diese neuen Formen der Arbeitsorganisation können von Unternehmern genutzt werden, um die Struktur des Arbeitsvertrages hin zum Werkvertrag zu verändern, quasi ein „Werkvertrag 2.0“. Die arbeitsvertragliche Verpflichtung zur Erbringung einer Arbeitsleistung ergibt sich aus § 611 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Danach ist der Arbeitnehmer „zur Leistung der versprochenen Dienste“ verpflichtet. Der Inhalt dieser Pflicht ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag, der Ort, Zeit und Art der Arbeit enthalten sollte. Geschuldet wird die Leistung einer bestimmten Tätigkeit. Im Gegensatz dazu ist beim Werkvertrag die Arbeit Mittel zum Erfolg. Es zählt nur noch ein bestimmtes Ergebnis oder ein Produkt. Hierbei spielt es keine Rolle, in welcher Zeit eine Arbeit abgeschlossen wird.
Der Arbeitsrechtler Thomas Klebe betont, dass der Arbeitnehmerstatus nicht automatisch durch diese neue Technik entfällt: „Das so genannte interne Crowdsourcing läuft über firmeneigene Plattformen. Die Crowdworker sind und bleiben in diesem Fall normale Beschäftigte mit allen Arbeitnehmerrechten. Bei externem Crowdsourcing ist das anders. Dabei werden die Crowdworker bisher als Selbstständige, als Unternehmer, behandelt.“ Verstehen kann die Arbeitnehmervertretung diese Entwicklung aber nur, wenn vorab Informationen eingefordert werden.
2. Rechtzeitige Information maßgeblich
Dieses Beispiel zeigt: Personal- und Betriebsräte sind bei neuer Technik besonders gefordert. Durch Mitbestimmungsrechte müssen Vereinbarungen durchgesetzt werden, die Arbeitsplätze schützen. Damit der Betriebs- oder Personalrat eigene Ideen entwickeln kann, sind umfassende Informationen von großer Bedeutung.
Die Interessen der Beschäftigten können nur zielgerichtet durchgesetzt werden, wenn ein Überblick über Planungen des Unternehmens besteht. Auch die Mobilisierung der Beschäftigten kann nur bei einem entsprechenden Wissensstand über Entwicklungen und Planungen des Unternehmens gelingen. Informationsrechte haben deshalb bei der Arbeitsplatzsicherung eine große Bedeutung.
Deshalb hat der Arbeitgeber die Personal- und Betriebsräte rechtzeitig und umfassend zu unterrichten.
Eine rechtzeitige Information liegt vor,
wenn der Betriebsrat vor der Entscheidung des Arbeitgebers und bevor Tatsachen geschaffen wurden, die Möglichkeit hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Die Arbeitnehmervertretung ist bereits zu informieren, wenn der Arbeitgeber erste Überlegungen in dieser Angelegenheit unternimmt.
Denn der Personal- bzw. Betriebsrat ist in die Lage zu versetzen, in eigener Verantwortung zu prüfen, ob und welche Aufgaben sich aus dieser Information für das Gremium ergeben und welche weiteren Rechte wie etwa Mitbestimmungsrechte abzuleiten sind. Auch muss der Betriebs- oder Personalrat die Möglichkeit haben, seine Vorstellungen in den Entscheidungsprozess des Unternehmens einzubringen.
Eine umfassende Information muss nicht nur den Umfang der geplanten Maßnahme und die zu erwartenden Auswirkungen auf die Mitarbeiter enthalten, sondern auch die Gründe für die Planungen. Ziel des Gesetzgebers ist es, eine Wissensparität zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat bzw. Personalrat herzustellen.
Unterrichtungsanspruch
Der Unterrichtungsanspruch nach § 80 Abs. 2 BetrVG besteht nicht nur dann, wenn Beteiligungsrechte des Betriebsrats bereits feststehen. Vielmehr soll es dem Betriebsrat auch ermöglicht werden, in eigener Verantwortung zu prüfen, ob sich überhaupt Aufgaben für ihn ergeben und ob er aktiv werden muss. Es steht dem Arbeitgeber nach § 80 BetrVG grundsätzlich frei zu entscheiden, in welcher Form er den Auskunftsanspruch des Betriebsrats erfüllt. Insbesondere bei umfangreichen, komplexen Informationen kann aber eine schriftliche Auskunft notwendig sein (BAG, Beschl. v. 10.10.2006 – Az. 1 ABR 68/05).
Nach § 90 BetrVG ist der Betriebsrat rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen über Planungen
von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Fabrikations-, Verwaltungs- und sonstigen betrieblichen Räumen,
von technischen Anlagen,
von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen oder
der Arbeitsplätze
zu unterrichten. Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat bereits im Planungsstadium die vorgesehenen Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Arbeitnehmer, insbesondere auf die Art ihrer Arbeit und die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Beschäftigten darzustellen. Im Sinne des Gesetzes ist auch eine mögliche Gefährdung der Arbeitsplätze darzustellen. Zu den Auswirkungen zählen beispielsweise
nicht nur der Umfang der Arbeitsinhalte,
sondern auch mögliche Rationalisierungspotenziale, die sich aus den Änderungen ergeben können.
Die Digitalisierung führt zu Bildschirmarbeitsplätzen. Diese Arbeitsplätze können je nach Gestaltung erhebliche Auswirkungen auf die Art der Arbeit haben. Die Folge können gesundheitliche Belastungen, Arbeitsbeanspruchung, Leistungsverdichtung, Leistungskontrolle, erhöhte Qualifikationsanforderungen und Arbeitsplatzverlust sein.
3. Kriterium der menschengerechten Arbeitsplatzgestaltung
Die Information hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass Vorschläge und Bedenken des Betriebs- oder Personalrats bei der Planung noch berücksichtigt werden können. Dabei sind die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit zu berücksichtigen. Der Gesetzgeber zeigt damit den Willen, dass nicht nur Rentabilitätsgründe die Grundlage für solche Entscheidungen sein sollen. Die Arbeit soll sich auch nach den Bedürfnissen der arbeitenden Menschen richten und muss für den einzelnen Beschäftigten auf Dauer ausführbar sein. Über diese Informationen sollen Personalrat/Betriebsrat und Arbeitgeber beraten. Im Sinne einer menschengerechten Arbeitsgestaltung sollen Maßnahmen getroffen werden,
durch die das „System Mensch und Arbeit“ beeinflusst werden kann.
Die Arbeit soll nicht krank machen und den Bedürfnissen des arbeitenden Menschen gerecht zu werden.
Überforderungen sollen bereits im Vorfeld vermieden werden, die Arbeit muss auf Dauer ausführbar sein.
Im Rahmen der Arbeitsplatzsicherung ist die Frage nach der menschengerechten Gestaltung der Arbeit von Bedeutung, da nicht selten vom Management errechnete Produktivitätsfortschritte durch den Einsatz neuer Technik auf eine Leistungsverdichtung für die Beschäftigten zurückzuführen sind. Werden daraufhin beispielsweise Aufgaben, die bisher drei Arbeitnehmer geführt haben, durch Umsetzung des Projektes auf dann nur noch zwei Mitarbeiter verteilt, sind diese Vorgaben oftmals nicht durch den Einsatz vermeintlich effektiverer Technik erzielt worden, sondern basieren nur auf der Vorgabe der Unternehmensleitung zur Reduzierung von Personal.
Umstrukturierungsplanungen erfordern umfassende Unterlagen
Personal und Betriebsräte müssen bei der Beratung über Umstrukturierungsplanungen auf der Vorlage detaillierter Unterlagen bestehen.
Kosten-Nutzen-Analysen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen müssen kritisch hinterfragt werden, da diese Berechnungen oft auf Annahmen beruhen, die eine stärkere Arbeitsbelastung der Beschäftigten vorsehen und so Personal einsparen sollen.
An oberster Stelle der Rationalisierungsbestrebungen steht die Begrenzung so genannter nicht-wertschöpfender Tätigkeiten. Dazu zählen im Industriebereich das Holen von Werkzeugen, Reparaturarbeiten oder die Nachbearbeitung, im Verwaltungsbereich kann der Gang zum Drucker dazugehören. Übersehen wird dabei gerne: Diese Arbeiten dienen den Beschäftigten nicht etwa nur dazu, auch eine kleine Verschnaufpause zu haben, sie sind vielmehr in der Regel Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Erledigung der Arbeit. Unternehmensberater können diesen Zeitaufwand niedriger ansetzen oder streichen, um ein hohes Einsparpotenzial zu erzielen.
Im Ergebnis haben dann – um bei dem Beispiel der Reduzierung von drei auf zwei Arbeitnehmer in dem Bereich zu bleiben – die weiterhin tätigen Mitarbeiter eine größere Arbeitsmenge zu bewältigen, während der dritte Kollege möglicherweise sogar entlassen wird.
Personal- und Betriebsräte können in diesem Zusammenhang auf arbeitsschutzrechtliche Vorschriften verweisen, da auch die Vermeidung von psychischen Belastungen und Stress zu den Pflichten des Arbeitgebers im Rahmen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes gemäß § 5 ArbSchG zählt. Deshalb sind Informationen über die Hintergründe des Einsparpotenzials bei Umstrukturierungen besonders wichtig.
Auch der Personalrat ist nach § 68 Abs. 2 BPersVG (und vergleichbaren Regelungen der Landespersonalvertretungsgesetze) rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. So besteht bei Technikeinsatz nach § 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG (und vergleichbaren Regelungen der Landespersonalvertretungsgesetze) Mitbestimmung, was auch die umfassende Information über diese Technik voraussetzt.
Der Betriebsrat fordert den Arbeitgeber auf, bereits im Planungsstadium über geplante Umstrukturierungen rechtzeitig und umfassend gemäß § 80 Abs. 2 und § 90 BetrVG zu informieren. Dies kann folgendermaßen aussehen:
„An die Geschäftsführung
Auskunfts- und Beratungsrechte gemäß § 80 Abs. 2 und § 90 BetrVG
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Betriebsrat hat erfahren, dass Sie Umstrukturierungen in den Abteilungen planen. Bisher liegen uns dazu keine Planungsunterlagen vor. Wir verweisen auf unsere umfassenden Informationsrechte gemäß § 80 Abs. 2 und § 90 BetrVG. Danach ist der Betriebsrat bei der Planung künftiger Änderungen im arbeitstechnischen Bereich, der Änderung von Arbeitsverfahren und -abläufen sowie der Umgestaltung der Arbeitsplätze einzubeziehen.
Wir erwarten innerhalb von einer Woche die Zusendung umfassender Planungsunterlagen, insbesondere zu den Punkten
betroffene Bereiche/Abteilungen und Mitarbeiter,
Änderungen von Arbeitsverfahren und -abläufen,
arbeitsorganisatorische Änderungen,
Auswirkungen auf die Mitarbeiter.
Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass eine Umsetzung der Maßnahme nur möglich ist, nachdem mit dem Betriebsrat eine umfassende Unterrichtung und Beratung stattgefunden hat und Betriebsvereinbarungen zur Absicherung der Beschäftigten abgeschlossen wurden.
Mit freundlichen Grüßen
(Betriebsratsratsvorsitzende/r)“
4. Bedeutung des Wirtschaftsausschusses
Eine wichtige Bedeutung hat in diesem Zusammenhang der Wirtschaftsausschuss, der in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten zu unterrichten ist. Personalräte haben nach § 65a LPVG NRW bzw. § 60a NPersVG Möglichkeiten, über den Wirtschaftsausschuss aktiv zu werden. Nach § 106 BetrVG hat der Unternehmer den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend über die wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten. Auch die Auswirkungen auf die Personalplanung sind darzustellen.
Der Wirtschaftsausschuss hat die Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten zu beraten und die Betriebs- bzw. Personalräte zu unterrichten. Der Wirtschaftsausschuss benötigt zumindest folgende Informationen über den Stand der Planungen:
Welche Ziele verfolgt der Arbeitgeber mit der geplanten Umstrukturierung?
Welche Kosten entstehen?
Welche Kosten-Nutzen-Analysen anhand verschiedener Szenarien liegen vor?
Welche Auswirkungen haben die Planungen auf die Beschäftigten?
Sämtliche wirtschaftlichen Planungen, die Auswirkungen auf die Beschäftigten haben können, sind dem Wirtschaftsausschuss zur Beratung vorzulegen. Die Bereiche, über die der Arbeitgeber zu informieren hat, sind sehr umfassend. Der Wirtschaftsausschuss ist danach über sämtliche organisatorischen Änderungen zu informieren. Der Arbeitgeber muss deshalb von sich aus – ohne Aufforderung – über diese Planungen berichten. Sollten jedoch keine offiziellen Informationen vorliegen, hat der Wirtschaftsausschuss diese Unterlagen einzufordern (siehe auch: Kap. 8 Die besondere Rolle des Wirtschaftsausschusses).
5. Personalplanung
Nach § 92 Abs. 1 BetrVG hat der Arbeitgeber den Betriebsrat rechtzeitig und umfassend über die Personalplanung, insbesondere den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf zu unterrichten.
Dem Betriebsrat sind Unterlagen über die sich daraus ergebenden personellen Maßnahmen und Maßnahmen der Berufsbildung vorzulegen.
Zudem hat der Arbeitgeber über die Personalplanung, d. h. über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen und über die Vermeidung von Härten, zu beraten.
Definition Personalplanung
Personalplanung ist eine Methode zur Planung einer „möglichst weitgehenden Übereinstimmung zwischen zukünftigen Arbeitsanforderungen (qualitativ und quantitativ) und dem dann einsetzbaren Personal nach Qualifikation und Zahl, wobei die unternehmerischen Ziele und Interessen der Arbeitnehmer soweit wie möglich in Einklang zu bringen sind“, so formuliert es das Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft (RKW-Handbuch, Praxis der Personalplanung, Teil I, Kap. 3.1).
Aus der Formulierung „anhand von Unterlagen“ folgt, dass die Unterlagen dem Betriebsrat dauerhaft zu überlassen sind. Denn nur eine dauerhafte Aushändigung der Unterlagen ermöglicht es dem Betriebsrat, sich so in die Materie der Personalplanung einzuarbeiten, dass er seine Mitwirkungsrechte sinnvoll wahrnehmen kann. Die Vorlage von Personalplanungsunterlagen soll dem Betriebsrat die Prüfung ermöglichen, ob die vom Arbeitgeber für seine Personalplanung genannten Gründe auch tatsächlich zutreffen.
Frühzeitige Einbeziehung des Betriebsrats
Der Betriebsrat muss bereits im Planungsstadium einbezogen werden, damit noch eine Möglichkeit der Einflussnahme besteht. Damit der Betriebsrat einen Überblick über eine mögliche Personalfluktuation erhält, sind folgende Informationen über zu erwartenden personellen Ersatzbedarf von Bedeutung:
Sind Eigenkündigungen bekannt?
Sind voraussichtliche Anträge auf Elternzeit bekannt?
Welche Mitarbeiter haben in absehbarer Zeit Anspruch auf Rentenzahlungen oder können Altersteilzeit beantragen?
Werden Mitarbeiter den Betrieb zur Weiterbildung oder zur unbezahlten Freistellung zumindest zeitweise verlassen?
Regelungen im Personalvertretungsgesetz
Im BPersVG sind die Beteiligungsrechte des Personalrats bei Einzelmaßnahmen zur Personalplanung an verschiedenen Stellen geregelt. So hat der Personalrat beispielsweise Mitbestimmungsrechte
bei Richtlinien über die personelle Auswahl,
bei Beurteilungsrichtlinien,
bei Fragen der Fortbildung,
bei Stellenausschreibungen und
bei der Aufstellung von Sozialplänen.
Darüber hinaus hat der Personalrat ein Anhörungsrecht nach § 78 Abs. 3 Satz 3 BPersVG, wenn die Dienststelle Maßnahmen zur Personalplanung trifft und diese an die höhere Dienststelle weitergeleitet werden. Die Stellungnahme des Personalrats ist auch der übergeordneten Dienstbehörde vorzulegen.
Der Planungsbegriff umfasst schon systematische Vorüberlegungen. Die Planung ist das systematische Suchen und Festlegen von Zielen sowie das Vorbereiten von Aufgaben, deren Durchführung zur Zielerreichung erforderlich ist. Unter die Personalplanung nach § 92