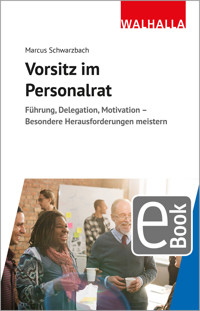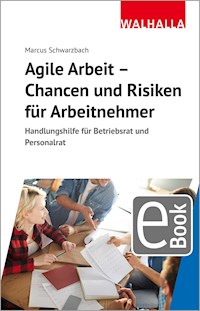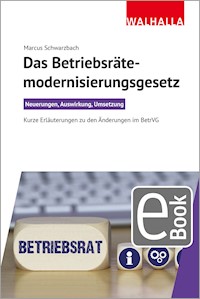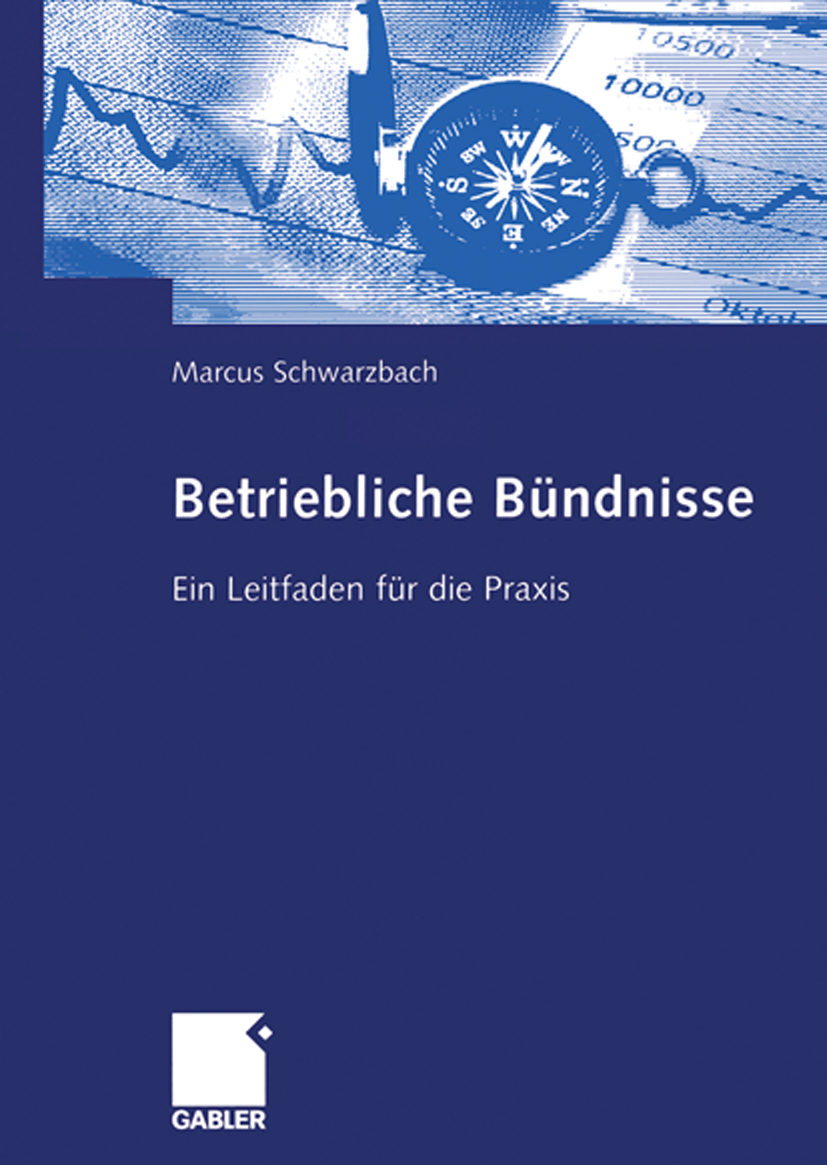16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Walhalla Digital
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Modernisierung der Arbeit
Die Arbeitswelt verändert sich radikal. Die Technik steuert Arbeitsprozesse in der Verwaltung. Arbeitnehmer müssen sich in Dienststellen und Betrieben auf neue Arbeitsbedingungen einstellen.
Personal- und Betriebsräte sind bei diesen Veränderungen gefordert. Sie müssen Arbeitsbedingungen mitgestalten, Verhaltenskontrollen verhindern und Qualifizierungsmaßnahmen sicherstellen. Für die Arbeitnehmervertretung ist entscheidend, Umbrüche zu erkennen und frühzeitig zu agieren:
- Was bedeutet digitale Arbeit?
- Welche Aufgaben hat der Personal- bzw. Betriebsrat bei der Einführung digitaler Arbeit?
- Welche Auswirkungen hat digitales Arbeiten für den Arbeitnehmer?
- Welche technischen Voraussetzungen erfordert digitale Arbeit?
- Welche Rolle spielt digitale Arbeit bei der Personalplanung?
- Welche Qualifikationen sind gefordert?
Dieses Praxis-Handbuch Digitale Arbeit, E-Government, Arbeit 4.0 stellt die zu erwartenden Veränderungen verständlich dar. Checklisten erleichtern die Umsetzung in die Praxis, Musterformulierungen für Dienst- und Betriebsvereinbarungen zeigen Handlungsmöglichkeiten auf. Der rechtliche Rahmen wird anhand von Betriebsverfassungsgesetz, Personalvertretungsrecht und Arbeitsschutzbestimmungen erläutert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Ähnliche
1. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected] Web
Kurzbeschreibung
Modernisierung der Arbeit
Die Arbeitswelt verändert sich radikal. Die Technik steuert Arbeitsprozesse in der Verwaltung. Arbeitnehmer müssen sich in Dienststellen und Betrieben auf neue Arbeitsbedingungen einstellen.
Personal- und Betriebsräte sind bei diesen Veränderungen gefordert. Sie müssen Arbeitsbedingungen mitgestalten, Verhaltenskontrollen verhindern und Qualifizierungsmaßnahmen sicherstellen. Für die Arbeitnehmervertretung ist entscheidend, Umbrüche zu erkennen und frühzeitig zu agieren:
Was bedeutet digitale Arbeit?Welche Aufgaben hat der Personal- bzw. Betriebsrat bei der Einführung digitaler Arbeit?Welche Auswirkungen hat digitales Arbeiten für den Arbeitnehmer?Welche technischen Voraussetzungen erfordert digitale Arbeit?Welche Rolle spielt digitale Arbeit bei der Personalplanung?Welche Qualifikationen sind gefordert?Dieses Praxis-Handbuch Digitale Arbeit, E-Government, Arbeit 4.0 stellt die zu erwartenden Veränderungen verständlich dar. Checklisten erleichtern die Umsetzung in die Praxis, Musterformulierungen für Dienst- und Betriebsvereinbarungen zeigen Handlungsmöglichkeiten auf. Der rechtliche Rahmen wird anhand von Betriebsverfassungsgesetz, Personalvertretungsrecht und Arbeitsschutzbestimmungen erläutert.
Autor
Marcus Schwarzbach, Berater in Mitbestimmungsfragen, erfahrener Referent für Personal- und Betriebsräte, erfolgreicher Fachautor.
Schnellübersicht
Vorwort
1. Moderne Arbeit ist digitale Arbeit
2. Digitale Arbeit: Was planen Arbeitgeber und Dienststelle?
3. Arbeitsplatzsicherung: Technik ersetzt Mensch?
4. Mobile Arbeit: Pflicht zur ständigen Erreichbarkeit?
5. Arbeit 4.0: Gestaltung der Arbeitsbedingungen
6. E-Government: Handlungsfeld des Personalrats
7. Big Data im Betrieb: Den gläsernen Arbeitnehmer verhindern
8. Wissensmanagement: Qualifizierungsmöglichkeiten für digitale Arbeit
9. Digitale Arbeit: Strategieplanung von Personal- und Betriebsrat
10. Literaturverzeichnis
Auszüge aus referenzierten Vorschriften
Vorwort
Die Zukunft ist heute
Abkürzungen
Die Zukunft ist heute
Die Arbeitswelt vernetzt sich immer mehr und wird digitaler. Nach einer Studie des Branchenverbands Bitkom aus dem Jahr 2013 gehören Computer und Mobiltelefone bei rund 60 Prozent der Beschäftigten zur Standardausstattung. Während im Jahr 2002 71 Prozent der Unternehmen Computer einsetzten und 62 Prozent das Internet nutzten, sind es heute jeweils 90 Prozent.
„Dank“ Smartphones ist Arbeit nicht mehr zwangsläufig an einen bestimmten Ort und feste Zeiten gebunden. Die Klagen im Betrieb über die ständige Erreichbarkeit werden größer – für immer mehr Beschäftigte verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit. Die Technik, die das Privatleben so erleichtert, indem 24 Stunden am Tag aktuelle Nachrichten abgefragt oder Urlaubsziele erkundet werden können, hat auch ihre negativen Seiten. Ständige Erreichbarkeit kann für Dauerstress und krankmachende Arbeitsbedingungen sorgen.
Das wirkt sich auch auf den öffentlichen Dienst aus. E-Government bezeichnet die Kommunikation zwischen staatlichen Stellen und Bürgern, die auf elektronischer Datenübertragung beruht. Die Auswirkungen auf die Beschäftigten sind gravierend. Der Technikeinsatz führt zu radikaler Umgestaltung und dem Wegfall von Arbeitsplätzen: einerseits entfallen einfachere Tätigkeiten, beispielsweise von Schreibkräften, andererseits wird der Leistungsdruck durch technische Steuerung der Arbeitsprozesse zunehmen.
Bei cyber-physischen Systemen (CPS) steuern sich „intelligente“ Maschinen, Betriebsmittel und Lagersysteme in der Produktion eigenständig per Software. Das Thema ist nicht so fern, wie viele denken – denn das „Internet der Dinge“ verspricht eine Vernetzung vieler Lebensbereiche per World Wide Web: etwa Kühlschränke, die eigenständig Lebensmittel „nachkaufen“, und Waschmaschinen, die nur starten, wenn der Strompreis niedrig ist. Dieses Konzept soll die virtuelle mit der realen Welt vereinen. Dabei werden Objekte scheinbar schlau (smart) und können Informationen austauschen. Die Basis dafür sind Chips und deren Programmierung, durch die Waren oder Geräte nicht nur eine eigene Identität in Form eines Codes erhalten, sondern auch Zustände erfassen und Aktionen ausführen können. Die Übertragung dieser Logik auf Werkhallen ist die Grundidee von „Industrie 4.0“, bei der oft auch von Arbeit 4.0 gesprochen wird.
Personal- und Betriebsräte sind gefordert, die Arbeitsbedingungen der digitalen Arbeit über Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen zu regeln. Dieses Handbuch stellt die rechtlichen Möglichkeiten dar und schildert anhand von Beispielen und Checklisten, wie die Arbeitnehmervertretung vorgehen sollte.
Meine Erfahrungen als Referent in Seminaren oder als Sachverständiger für Personal- bzw. Betriebsräte fließen in dieses Buch ein.
Für Fragen, Anregungen oder Kritik bin ich dankbar. Zu erreichen bin ich per E-Mail unter: [email protected]
Marcus Schwarzbach
Abkürzungen
Abs.AbsatzaibArbeitsrecht im Betrieb (Zeitschrift)ArbSchGArbeitsschutzgesetzArbZGArbeitszeitgesetzAz.AktenzeichenBAGBundesarbeitsgerichtBAuABundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinBDSGBundesdatenschutzgesetzBetrVGBetriebsverfassungsgesetzBGBBürgerliches GesetzbuchBGIBerufsgenossenschaftliche InformationBildscharbVBildschirmarbeitsverordnungBSIBundesamt für Sicherheit in der InformationstechnikBPersVGBundespersonalvertretungsgesetzBVerwGBundesverwaltungsgerichtBYODBring your own device (Nutzung privater Technik für die Arbeit)bzw.beziehungsweiseCBTComputer Based TrainingCPScyber-physische SystemeCRMCustomer-Relationship-ManagementCuAComputer und Arbeit (Zeitschrift)ggf.gegebenenfallsKAPOVAZKapazitätsorientierte variable ArbeitszeitLAGLandesarbeitsgerichtMDMMobile-Device-Management (Mobilgeräteverwaltung)Nr.NummerRFIDradio-frequency identification (Identifizierung mithilfe elektromagnetischer Wellen über Chips)TzBfGTeilzeit- und BefristungsgesetzTVöDTarifvertrag des öffentlichen DienstesWBTWeb Based Trainingz. B.zum Beispiel1. Moderne Arbeit ist digitale Arbeit
1. Was bedeutet „Digitale Arbeit“?
2. Big Data in Dienststelle und Betrieb
3. E-Government: Digitale Arbeit in der öffentlichen Verwaltung
4. Mobile Arbeit
5. Das „Internet der Dinge“ im Betrieb
6. Crowdsourcing
7. Veränderte Arbeitswelt für Arbeitnehmer
1. Was bedeutet „Digitale Arbeit“?
Digitalisierung verändert die Welt, in der wir leben. Das gilt auch und in besonderem Maße für die Arbeitswelt. Eine schlüssige Definition „digitaler Arbeit“ formuliert Thorben Albrecht, Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium (Albrecht 2015): „Vier Merkmale können hierfür hilfreich sein:
Die umfangreiche Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (z. B. PC, Laptop, Smartphone, Breitband-Internet) und Anwendersoftware,
die grundlegende Unterstützung der Arbeitsprozesse durch computerisierte, vernetzte Maschinen (z. B. Fertigungsroboter),
die Gestaltung digitaler Produkte durch Programmierungen etc. und
die Vermittlung von Dienstleistungen über Online-Plattformen (z. B. Cloud-Working).“
Die Auswirkungen mancher technischer Neuerung sind heute nicht konkret vorhersagbar. Der 3D-Druck etwa scheint eine Revolution im Produktionsbereich zu ermöglichen. Jedes Teil, jedes Produkt kann individuell hergestellt werden. Formel-1-Teams erzeugen manche Teile für die Fahrzeuge bereits im Drucker, statt sie aufwendig gießen zu lassen. „Dieses Thema ist deshalb so spannend, weil die Digitalisierung die Art und Weise, wie wir produzieren und wie wir arbeiten werden, grundlegend verändert. Damit betrifft es alle Wirtschafts- und auch Gesellschaftsbereiche“, betont Irene Bertschek vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW).1
Noch ist das Ausdrucken von Metallteilen deutlich teuerer als die klassische Produktion, 3D-Drucker werden derzeit nur für die Herstellung hochpreisiger Einzelteile eingesetzt. Inzwischen nutzt aber auch die Medizinbranche die Technologie: 3D-Drucker erzeugen individuell angepasste Zahnkronen.
„Die Software sagt dem Drucker, wie er das Material formen soll, und der trägt dann eine Schicht über der anderen auf“, erläutert Ortwin Renn von der Universität Stuttgart. „Und während eine computergesteuerte Fräsmaschine Ihnen nur exakt das eine Teil zurechtfräsen konnte, für das sie eingerichtet war, sind die Formen jetzt vollkommen variabel. Sie können mit einem Gerät ganz unterschiedliche Maschinenteile drucken.“2
Auch bei Möbelstücken oder Werkzeugersatzteilen könnte der Kunde zukünftig selbst per Drucker aktiv werden. Die derzeit erhältlichen 3D-Drucker für den Hausgebrauch, die ab 1.000 Euro erhältlich sind, sind für solche Anwendungen nicht präzise genug. Doch in den kommenden Jahren dürfte sich das ändern. Welche Auswirkungen diese Entwicklung auf die Arbeitsplätze hat, ist heute kaum absehbar.
Neue Technologien, insbesondere Software und computergestützte Systeme, verändern nicht nur in der Industrie Arbeitsprozesse und Tätigkeitsprofile. Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2015 (Buhr 2015) beschreibt verschiedene Szenarien der digitalen Arbeit:
Das Automatisierungsszenario
Systeme lenken Menschen. Kontroll- und Steuerungsaufgaben werden durch die Technologie übernommen. Sie bereitet Informationen auf und verteilt diese in Echtzeit. Beschäftigte werden durch cyber-physische Systeme (CPS) gelenkt und übernehmen vorrangig ausführende Tätigkeiten. Die Fähigkeiten von gering Qualifizierten werden dabei entwertet.
2.Das Hybridszenario
Kontroll- und Steuerungsaufgaben werden kooperativ und interaktiv durch Technologien, vernetzte Objekte und Menschen wahrgenommen. Die Anforderungen an die Arbeitnehmer steigen, da sie deutlich flexibler sein müssen.
3.Das Spezialisierungsszenario
Menschen nutzen Systeme. CPS ist ein Werkzeug und wirkt entscheidungsunterstützend. Die dominante Rolle der Facharbeit bleibt erhalten.
Keines dieser Szenarien wird ausschließlich in dieser Ausprägung Realität werden. Aber die Veränderungen werden weitgehend sein. Viele einfache Tätigkeiten fallen durch Technikeinsatz weg. Wurden früher in einem Versicherungsunternehmen eingehende Vertragsanträge in der Poststation sortiert und anschließend an die Sachbearbeiter verteilt, geht diese Beantragung des Kunden über Internet per Datenleitung direkt an den Arbeitsplatz des Versicherungsangestellten. Für diesen Transport wird kein Mensch mehr benötigt. „Menschen werden dann vor allem noch für die Bewältigung von Ausnahmesituationen gebraucht“, erläutert der Arbeitswissenschaftler Ulrich Klotz (CuA 6/2012, S. 18). Das betrifft „auch viele Arbeiten, die gar nicht so einfach sind wie es auf den ersten Blick scheint – zum Beispiel im Haushalt, im Gesundheitssektor, in der Pflege usw. Hingegen werden wir sehen, dass aufgrund der rapiden Fortschritte beim automatischen Verstehen menschlicher Sprache zahllose routinehafte Tätigkeiten in Call-Centern, Banken, Versicherungen, Anwaltskanzleien usw. unter die Räder kommen“, so Klotz (CuA 6/2012, S. 18).
Menschliche Arbeit in der digitalen Welt wird anspruchsvoller, erfordert eine immer bessere Ausbildung und permanente Weiterbildung. Für diese Spezialisten hat Peter F. Drucker vor gut 50 Jahren den Begriff „Wissensarbeiter“ geprägt. Bedeutsam sind diese Wissensarbeiter vor allem, weil die Informationsmenge extrem anwächst. Diese gigantische Lawine an Informationen und neuem Wissen kann nur durch stärkere Spezialisierung bewältigt werden.
vgl. www.absatzwirtschaft.de/forschungsinstitut-zew-digitalisierung-gefaehrdet-5-millionen-jobs-in-deutschland-57513
2vgl. www.nationalgeographic.de/reportagen/interview-ihr-zahnarzt-druckt-die-krone-selbst
2. Big Data in Dienststelle und Betrieb
In diesem Zusammenhang ist oft von „Big Data“ die Rede. Big Data steht für sehr große Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen, die mit spezieller Software ausgewertet werden. Er wird aber inzwischen auch als Synonym für neue Hard- und Software verwendet, die es ermöglicht, unterschiedliche Daten in verschiedenen Formaten nach beliebigen Kriterien auszuwerten.
Dabei ist Big Data eigentlich nichts völlig Neues. Über ähnliche Auswertungsmöglichkeiten verfügten bereits ältere betriebliche Konzepte, wie etwa „Data Warehouse“ oder „Data Mining“. Heutige Technik ist jedoch leistungsfähiger und kann Daten so schneller auswerten.
Algorithmen zur Datenauswertung
Dabei sind auch Algorithmen bedeutsam. Algorithmen sind mathematische Gleichungen und damit die Basis für Softwareprogramme. Sollen beispielsweise aus einer Datenmenge bestimmte Daten gefunden werden, kann nach Begriffen gesucht werden.
Algorithmen übersetzen kausale Annahmen in Rechenprogramme. Deren Einsatz ist heute in vielen Betrieben bereits Alltag, etwa wenn Auswertungen einer Datenbank zur Beantwortung für – aus Unternehmenssicht entscheidungsrelevante – Fragen genutzt werden:
Welchen Kunden sollte wann welches Angebot unterbreitet werden?
Bei welchem Kundenprofil lohnt sich ein Außendienstbesuch?
Welche Kunden droht das Unternehmen zu verlieren?
Das wirkt sich auch auf das Arbeitsleben aus. In das Suchprogramm können dabei Annahmen einfließen, die falsch oder diskriminierend sind. Mit der neuen Technik kann ein Mitarbeiterprofil erstellt werden. „Das Verfahren erlaubt verdächtige Verhaltensmuster zu entdecken und diese weiter zu detaillieren. Mit Loss Prevention und Co., das heißt durch den Einsatz von Data Mining, werden auffällige Kassiererinnen und Kassierer oder einzelne Filialen analysiert und können dann gezielt nach besonderen Fragestellungen untersucht werden“, erläutert die Fachzeitschrift „Arbeitsrecht im Betrieb“ anhand eines Beispiels aus dem Einzelhandel (vgl. Wilke, in: aib 3/2006, S. 155–162).
Dabei wird anhand folgender Fragen analysiert:
Bei welchem Kassiererprofil lohnt sich eine gezielte Überwachung?
Gibt es riskantes Personal (Teilzeitbeschäftigte, Aushilfen, Alleinerziehende)?
Gibt es auffällige Altersgruppen bei den Beschäftigten?
Wie lassen sich Transaktionen, die einen bestimmten Betrag übersteigen, erklären?
Schon heute werden Bewerbungen von Programmen vorsortiert – die Gefahr ist groß, dass Personen, die durch dieses „Raster fallen“, gar keine Chance haben, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden.
Weitere Beispiele zeigen, welche Risiken aus Sicht der Arbeitnehmer bestehen:
Auch Tätigkeiten können entfallen. Selbst im Journalismus hat die Automatisierung eingesetzt. Zum Beispiel lässt die „LA Times“ inzwischen einige ihrer Texte von Computeralgorithmen schreiben.
Arbeitsschritte können aufgrund von Ermittlungen anhand der Algorithmen vorgegeben werden, etwa indem Kunden automatisch ausgewählt, direkt per Technik angeschrieben werden und der Arbeitnehmer dann darauf reagieren muss, wenn sich der Kunde meldet.
Call Centrifizierung der Arbeitswelt
In vielen Betrieben sind technisch-organisatorische Veränderungen durch digitale Arbeit im Gange, die seit langem aus Callcentern bekannt sind. Die Technik ermöglicht es, die Beschäftigten ständig zu überwachen, zu bewerten und zu steuern. Die gleichen Erfahrungen machen Kollegen in anderen Unternehmen, in Verkaufs- und Serviceabteilungen, im stationären Einzelhandel, in Versicherungen oder etwa Banken. Von einer sogenannten Call Centrifizierung spricht deshalb Klaus Heß von der Technologie-Beratungsstelle NRW (vgl. Heß, in: CuA 9/2015, S. 13):
Automatisierte Arbeitsverteilung
In Bereichen mit Kundenkontakt haben die Mitarbeiter keinen Einfluss mehr auf die Entscheidung, welche Arbeitsvorgänge sie übernehmen. Stattdessen wird die eingehende Arbeit automatisiert durch Workflowsysteme in persönliche Arbeitskörbe verteilt und gesteuert.
Kontrolle durch Monitoring
Über das Monitoring werden Beschäftigte sowie Kunden ausgespäht, jeder Kundenkontakt dokumentiert, durch das Kundenbeziehungsmanagement nachverfolgt und ausgewertet, das heißt transparent gemacht.
Geschäftsprozessoptimierung
Der Geschäftsprozess beginnt mit der Kundenanfrage und reicht bis zur Feststellung der Kundenzufriedenheit. Gemessen werden etwa die Bearbeitungsdauer, Gesprächsdauer, Wartezeiten, Antwortzeiten, Prozessdurchlaufzeiten oder Service Level. Auf dieser Basis werden die Prozesse ständig gemessen, standardisiert und durch Zeitvorgaben kontrolliert.
Flexibilisierung des Arbeitskräfte-Managements
Mithilfe statistischer Erhebungen und Vorhersagen des Arbeitsanfalls und Kundenverhaltens sollen stundentaktgenaue Vorgaben des Arbeitsvolumens ermittelt werden, um Personalkapazitäten, Dienstpläne und die Verteilung der Arbeitszeiten bis hin zur Lage der Pausen zu steuern.
Zwar wird der Begriff „Callcenter“ oft vermieden, vielmals ist von Kunden- oder Service-Centern die Rede. Nichtsdestotrotz handelt es sich um das Callcenter-Prinzip, wenn es um die Einführung solcher organisatorischer und technischer Arbeitssysteme geht – und daraus Umstrukturierungen resultieren. Diese Entwicklung müssen Personal- und Betriebsräte genau prüfen und die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer beobachten.
3. E-Government: Digitale Arbeit in der öffentlichen Verwaltung
Auch in der öffentlichen Verwaltung ist digitale Arbeit auf dem Vormarsch. Die Einführung von E-Government bedeutet für die Beschäftigten nicht nur eine weitere Technisierung des Arbeitsalltags.
E-Government ist nicht so ganz neu. Bereits seit den 1990er-Jahren entwickelten sowohl der Bund als auch die Länder verschiedene Initiativen und Projekte. Angefangen beim Programm der Bundesregierung „Moderner Staat – Moderne Verwaltung“ über die Initiative „Bund online 2005“ bis hin zum nunmehr in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung.
Die Arbeitsabläufe werden gravierend verändert. Die technische Revolution wurde im Büro schon öfters ausgerufen. Bereits die Einführung der Textverarbeitung und die verbesserte Archivierung von Akten über PC haben die Arbeit enorm rationalisiert. Leistungsfähigere Technik und weiterentwickelte Software sollen zukünftig – so die Planungen vieler Dienststellenleiter und Unternehmensberater – im Verwaltungsbereich zu Produktivitätsfortschritten führen, die einen tiefgreifenden Abbau von Arbeitsplätzen zur Folge haben.
Vernetzte Computer und spezielle Software – Groupware genannt – ermöglichen den Verwaltungsangestellten einen gemeinsamen Zugriff auf eine Datenbank.
Die Weiterleitung der Post erfolgt durch technische Steuerung. Dieses Workflow-System gibt die Arbeitsschritte entsprechend den Vorgaben des Managements weiter. Das führt zu einer automatischen Steuerung der Arbeit, mit weitgehenden Kontrollmöglichkeiten für die Dienststelle.
Dazu passt auch das Beispiel „SharePoint“. SharePoint ist eine höchst flexibel einsetzbare Software, die verschiedene Anwendungen zur Verfügung stellt. Sie dient in Dienststellen und Behörden zunehmend als Plattform zur Zusammenarbeit. Mitarbeiter tauschen sich aus und Suchfunktionen helfen, den Überblick zu behalten. Es werden betriebliche Blogs eingerichtet.
Doch der virtuelle Arbeitsplatz kann auch zur Kontrolle genutzt werden. Es besteht erheblicher Regelungsbedarf zum Schutz der Beschäftigten. Es lassen sich Verhaltensweisen der Arbeitnehmer nachvollziehen. Kontrolle ist möglich, indem die Kommunikation ausgewertet wird, etwa wer mit wem chattet, welche Einträge in Blogs erfolgen (vgl. Müller, in: CuA 12/2015, S. 4).
Gleichzeitig verfolgen Bund und Länder das Ziel, für die Bürger neue Online-Nutzungsmöglichkeiten für öffentliche Dienstleistungen zu schaffen. Zukünftig sollen alle angebotenen Dienstleistungen der Verwaltung über das Internet genutzt werden können. Das persönliche Aufsuchen soll die Ausnahme sein. Das führt zu erheblichen Veränderungen der Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst.
Personalräte sind daher gefordert, negative Folgen abzuwenden. Das Bundespersonalvertretungsgesetz bietet Personalräten bei E-Government eine Vielzahl von Mitbestimmungsrechten. Der moderne Staat soll aus Sicht vieler Politiker ein „schlanker Staat“ sein. Das bedeutet weiteren Personalabbau im öffentlichen Bereich.
Der Einsatz neuer Technik wird deshalb in erster Linie als Rationalisierungsinstrument gesehen. Wichtiges Ziel des Personalrats muss deshalb die Sicherung der Arbeitsplätze sein.
4. Mobile Arbeit
Ein weiteres Element der Digitalisierung ist mobile Arbeit. Überall, wo ein Internetzugang zur Verfügung steht, kann gearbeitet werden. Als Endgerät reicht ein Smartphone. Ob die Arbeit hiermit von zu Hause aus oder unterwegs erledigt wird, ist allenfalls eine Frage der arbeitsrechtlichen Zulässigkeit, nicht aber der technischen Voraussetzungen.
Eine Voraussetzung dafür ist Cloud-Computing. Dieses „Rechnen in der Wolke“ definiert das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik:
„Cloud-Computing bezeichnet das dynamisch an den Bedarf angepasste Anbieten, Nutzen und Abrechnen von IT-Dienstleistungen über ein Netz. Angebot und Nutzung dieser Dienstleistungen erfolgen dabei ausschließlich über definierte technische Schnittstellen und Protokolle. Die Spannbreite der im Rahmen von Cloud-Computing angebotenen Dienstleistungen umfasst das komplette Spektrum der Informationstechnik und beinhaltet unter anderem Infrastruktur (z. B. Rechenleistung, Speicherplatz), Plattformen und Software.“3
Daneben gewinnt der Einsatz mobiler Geräte (z. B. von Smartphones oder Tablet-PCs) weiter an Bedeutung. Kennzeichnend ist dabei, dass zunehmend Anwendungen (englisch: applications, kurz: Apps) aus dem Internet heruntergeladen werden. Ebenso findet die Verarbeitung aller Daten im Internet statt. Anders ausgedrückt: Ohne Anbindung an die „Cloud“ funktioniert hier gar nichts mehr. So wird mobiles Arbeiten erleichtert, ein Arbeiten fernab von Zeiterfassung und ohne Einhaltung von gesetzlichen Ruhezeiten oder Pausen kann so eine Negativ-Vision darstellen.
Mobile Arbeit verändert das Verständnis von Arbeit. Die klare Trennung zwischen Arbeit und Privatleben kann entfallen, für Personal- und Betriebsräte stellt sich die Frage, wo der Arbeitsort ist und wie die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben an dieser Arbeitsstätte überprüft werden kann. Aus Sicht der Arbeitnehmervertretung ergibt sich erheblicher Regelungsbedarf.
vgl. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/_content/m/m04/m04446.html
5. Das „Internet der Dinge“ im Betrieb
Digitale Arbeit ist auch im Produktionsbereich ein Thema – Industrie 4.0 nimmt immer mehr an Bedeutung zu: Bei cyber-physischen Systemen steuern sich intelligente Maschinen, Betriebsmittel und Lagersysteme in der Produktion eigenständig. Das Thema ist nicht so fern, wie viele denken – denn das „Internet der Dinge“ verspricht eine Vernetzung per Internet in der Freizeit: Kühlschränke, die eigenständig Lebensmittel nachkaufen, Waschmaschinen, die nur starten, wenn der Strompreis niedrig ist. Das „Internet der Dinge“ soll die virtuelle mit der realen Welt vereinen. Die Basis dafür sind Chips, durch die Waren oder Geräte nicht nur eine eigene Identität in Form eines Codes erhalten, sondern auch Zustände erfassen und Aktionen ausführen können.
Die Übertragung dieser Logik auf Werkshallen ist die Logik der Industrie 4.0. Somit fällt auch Industrie 4.0 unter die Definition von digitaler Arbeit. Häufig wird auch von der Smart Factory gesprochen. Die Smart Factory ist ein Betrieb, der IT-Technik zur Produktentwicklung, die Produktion, die Logistik und die Koordination der Schnittstellen zu den Kunden nutzt, um flexibler auf Anfragen reagieren zu können. In der Smart Factory sollen Menschen, Maschinen und Ressourcen wie in einem sozialen Netzwerk miteinander kommunizieren.
Industrie 4.0 ist der Name eines von der Bundesregierung geförderten Forschungsprogramms. Es soll eine vierte Stufe der Industrialisierung signalisieren. Während die erste Stufe der Einsatz der Dampfmaschine war, folgte die industrielle Massenproduktion etwa in der Automobilindustrie durch Henry Ford. Die Automatisierung durch IT-Technik, die sogenannte Digitale Revolution, ist gekennzeichnet durch eine rasante Entwicklung der Informationstechnik. Dabei wird der Computer zum Arbeitsmittel, der komplexe Arbeitsabläufe selbstständig erledigen kann. Die vierte industrielle Revolution basiert auf Cyber-Physical-Systems. Hinter dem englischen Begriff steht, dass sich
Weiches wie Software und Wissen
mit Hardware, das heißt elektronischen Bauteilen und Maschinen, direkt und über das Internet verbindet.
Bislang ist die Rolle des Menschen in der Arbeit 4.0 eher vage beschrieben. Einerseits heißt es, der Mensch wird als kreativer Planer, Steuerer und Entscheider das Maß aller Dinge bleiben. Gleichzeitig sollen Assistenzsysteme die Anforderungen an die Beschäftigten soweit reduzieren, dass ein kurzes Anlernen ausreicht. Die Folge: niedrige Entlohnung. Assistenzsysteme könnten etwa über ein Smartphone agieren, den Arbeitnehmer unterstützen oder ihm Anweisungen geben.
Vorzeigefabrik der Industrie 4.0
Die Zukunft hat in einigen Betrieben schon begonnen. Die programmierbare Simatic-Steuerung ist weltweit eines der gefragtesten Produkte im Siemens-Konzern. Das Produkt ist vielseitig, kann den Vorhang in der Schulturnhalle ebenso steuern wie das Fließband der Autowerke.
Der Siemens-Konzern hat im oberpfälzischen Amberg eine digitale Vorzeigefabrik erstellt. Alle Bauteile lassen sich identifizieren, jedes Produkt wird digital erfasst. Einzelne Arbeitsschritte sind per Knopfdruck nachvollziehbar. Das Management spricht von mehr als 50 Millionen Datensätze, die täglich auf diese Weise erfasst werden.
Neben der Datenfülle fällt in Amberg ein weiteres Element der Industrie 4.0 auf. Die Produktion erfolgt „on Demand“ – für die Belegschaft heißt das, direkt nach Kundenauftrag zu produzieren. So wird kurzfristiger reagiert und das mit dem Anspruch, 24 Stunden nach der Bestellung eine Simatic auszuliefern.
Dieses betriebliche Beispiel macht auch deutlich: Die totale Überwachung des Arbeitnehmers ist hier nicht mehr nur eine theoretische Möglichkeit, sondern problemlos möglich. Keine Überraschung dürfte es sein, dass die Frage, wie die Kontrolle von Arbeitnehmern verhindert werden kann, ein wichtiges Handlungsfeld für Betriebsräte ist (vgl. Kraft, in: Die Mitbestimmung 1/2/2015, S. 30).
„Bitte färbe mich rot“
Durch die informationstechnische Vernetzung kann der Rohling einer Produktionsmaschine mitteilen, wie er bearbeitet werden will. „Er beantragt beim Roboter: ‚Bitte färbe mich rot’ oder ‚Schleife mich an dieser Stelle’“, beschreibt Wolfgang Wahlster, Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. „Das ist eine völlige Umkehrung der bisherigen Produktionslogik.“4 Die Dinge sind mit Sensoren versehen und kommunizieren im Herstellungsprozess untereinander. In der Fabrik heißt das, ein Werkstück gibt eine Botschaft ab: „Ich bin in dem und dem Zustand. Was ist der nächste Schritt?“ Die Werkbank ordert dann ein Roboterfahrzeug heran, der das Stück zur nächsten Station bringt.
„In der Produktionsarbeit der Zukunft sind die Menschen stärker die Dirigenten und Koordinatoren der Fabrik. Die harte Muskelarbeit und auch einen Teil der Denkarbeit übernehmen die Maschinen“, schildert Professor Gunther Reinhart, Technische Universität München, seine Sicht zur Rolle des Menschen bei der Produktionssteuerung der Zukunft (vgl. Fraunhofer-Institut IAO, S. 48).
VW-Vorstand Horst Neumann prognostiziert, dass vor allem durch die Robotisierung bei VW mittelfristig taktgebundene Arbeit, die etwa die Hälfte in der Produktion ausmacht, wegfällt – und zukünftig mehr Wissensarbeit sowie Arbeit am Menschen entstehen wird (vgl. Müller, in: CuA 6/2015, S. 23).
Klar ist somit: Arbeitsplätze sind gefährdet, durch Technik wird vorhandenes Beschäftigungsvolumen reduziert. Die Veränderungen gehen aber weiter: Hybride Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass neben den Beschäftigten auch die Technologie Prozesse steuert. Bekannt ist die Zusammenarbeit von Mensch und automatisierter Steuerung etwa durch die Arbeit von Piloten.
Für das Unternehmen hat die Technik zweifellos Vorteile. Sie kann Daten, Diagnosen und Arbeitsanweisungen präsentieren. Die Beschäftigten können weit weniger Daten verarbeiten und weniger Komplexität berücksichtigen als Maschinen. Gleichzeitig geht es um die entscheidende Frage, ob die letztendliche Entscheidung beim Menschen bleibt.
Die Zusammenarbeit mit intelligenter Technologie kann neue Probleme für die Arbeitnehmer mit sich bringen. Menschen werden in hybriden Systemen eine hohe Verantwortung tragen, während sie zugleich der Technologie unterlegen sind. Sie können weit weniger Daten verarbeiten und weniger Komplexität berücksichtigen als Maschinen – zugleich aber wird von ihnen erwartet, Fehler der technologischen Systeme schnell zu korrigieren. Das können sie aber immer weniger, weil ihnen durch die Automatisierung eigene Erfahrungen mit der Prozesssteuerung und damit Kompetenzen verloren gehen.
www.taz.de/!5075654
6. Crowdsourcing
Der Begriff „Crowdsourcing“ verknüpft „Outsourcing“, das heißt das Auslagern von Arbeit, mit einem Aufruf an eine Menge („Crowd“). Ein Beispiel dafür ist Wikipedia, bei dem eine Gruppe von Menschen unentgeltlich ein Lexikon betreibt.
Alleine in der Bundesrepublik gibt es inzwischen Hunderttausende solcher digitaler Crowd-Arbeiter. Sie fotografieren Produkte in Geschäften, kategorisieren Waren für Online-Kataloge oder bewerten Serviceleistungen.
Aber auch anspruchsvollere Aufgaben warten auf Internetnutzer, etwa die Entwicklung von Software. Das Unternehmen „Local Motors“ entwirft und produziert Autos – mit nur rund 100 fest angestellten Beschäftigten und einer „Crowd“ von geschätzt 45.000 Entwicklern.
Im großen Stil eingeführt hat dieses Aufspalten der Arbeit Amazon – der Versandkonzern wollte 2005 zum Weihnachtsgeschäft erstmals CDs auf seinen Webseiten anbieten. Dazu mussten hunderttausende Cover geprüft werden. Als Ergänzung der Technik kontrollierten Menschen, also Tausende „Crowdworker“, die diese Akkordarbeit für ein paar Dollar erledigen.
Crowdsourcing beinhaltet, dass Arbeit, die bislang im Unternehmen selbst erledigt wurde, ausgelagert wird. Unter Crowdsourcing versteht man die „Strategie des Auslagerns einer üblicherweise von Erwerbstätigen entgeltlich erbrachten Leistung durch eine Organisation oder Privatperson mittels eines offenen Aufrufes an eine Masse von unbekannten Akteuren, bei dem der Crowdsourcer und/oder die Crowdsourcees frei verwertbare und direkte wirtschaftliche Vorteile erlangen.“ (Papsdorf 2009, S. 69)
Crowdworking-Plattformen wie „Clickworker“ sind die Vorboten einer neuen Arbeitsorganisation. Bei den Internetmarktplätzen für Arbeit ist die Macht klar aufseiten der Auftraggeber. Bezahlt wird oft nur, wer zuerst eine Lösung einreicht, die den Anforderungen des Auftraggebers entspricht.
Der Arbeitsrechtler Thomas Klebe, Leiter des Hugo Sinzheimer Instituts in Frankfurt/Main, betont, dass der Arbeitnehmerstatus nicht automatisch durch Crowdsourcing entfällt: „Das sogenannte interne Crowdsourcing läuft über firmeneigene Plattformen. Die Crowdworker sind und bleiben in diesem Fall normale Beschäftigte mit allen Arbeitnehmerrechten. Bei externem Crowdsourcing ist das anders. Dabei werden die Crowdworker bisher als Selbstständige, als Unternehmer, behandelt und fallen nicht einmal unter den Schutz des Heimarbeitsgesetzes.“5 Die soziale Lage der Crowdworker müsse grundlegend verbessert werden, meint Klebe. Die Plattformbetreiber sind auf faire allgemeine Geschäftsbedingungen zu verpflichten. An dieser Stelle fehlt bisher das Handeln des Gesetzgebers.
vgl. www.igmetall.de/interview-mit-arbeitsrechtler-thomas-klebe-zum-thema-14335.htm
7. Veränderte Arbeitswelt für Arbeitnehmer
Veränderte Arbeitsplätze durch digitale Arbeit erhöhen die Anforderungen an Personal- und Betriebsräte. Es zeigt sich erheblicher Regelungsbedarf aus Sicht der Arbeitnehmer:
Arbeitsplatzsicherung: Technik ersetzt Mensch?
Technik ersetzt immer menschliche Arbeit – das ist seit der Industrialisierung so. Deshalb sind auch bei digitaler Arbeit Strategien zur Sicherung von Arbeitsplätzen gefordert.
Mobile Arbeit: Pflicht zur ständigen Erreichbarkeit?
Die Arbeitszeit ist immer ein hart umkämpftes Thema im Betrieb, ob bei Tarifverhandlungen oder bei Regelungen in Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen – so wird es auch bei Arbeit 4.0 sein. Die Technik ermöglicht die ständige Erreichbarkeit der Arbeitnehmer, was zu erheblichen Belastungen und Einschränkungen des Privatlebens führen kann.