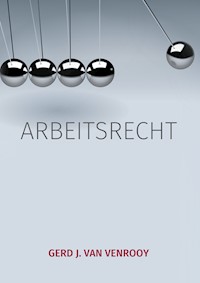
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Arbeitsrecht ist das sozialrelevante Rechtsgebiet schlechthin. Da es kein Arbeitsgesetzbuch gibt, lebt Arbeitsrecht vor allem von den Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts. Deshalb geht es dem Buch darum, das Bundesarbeitsgericht möglichst oft in seiner eigenen Diktion zu Wort kommen zu lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1380
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Arbeitsrecht befasst sich mit realen Interessen, solchen also, die auch dann bestünden, wenn man vom „Arbeitsrecht“ nichts wüsste. Dies zeichnet das Arbeitsrecht – zusammen mit einigen Aspekten des Zivilrechts – vor allen anderen Rechtsgebieten aus. Dem gegenüber steht seine hohe Problematik, die sich ergibt aus dem Fehlen eines Arbeitsgesetzbuchs, dem daraus folgenden, durch keine systemwahrenden Erwägungen gestörten Eingriffswillen der Sozialpolitik und insbesondere einer intensiven Abhängigkeit von der BAG-Judikatur, die man eigentlich stets und insgesamt vor Augen haben müsste, was natürlich unmöglich ist. Diese schwierigen Umstände erlauben in keinem Augenblick eine wirklich rechtssichere Gesamtdarstellung. Der hier gleichwohl unternommene Überblick über die arbeitsrechtliche Seite des Arbeitslebens ist daher ein Wagnis. Zur juristischen Qualifikation seiner Rechtsprechung mag das BAG selbst zu Wort kommen (2019-06-12, 7 AZR 429/17):
„Höchstrichterliche Rechtsprechung ist kein Gesetzesrecht und erzeugt keine damit vergleichbare Rechtsbindung. Eine in der Rechtsprechung bislang vertretene Gesetzesauslegung aufzugeben, verstößt nicht als solches gegen Art. 20 Abs. 3 GG. Die über den Einzelfall hinausreichende Geltung fachgerichtlicher Gesetzesauslegung beruht allein auf der Überzeugungskraft ihrer Gründe sowie der Autorität und den Kompetenzen des Gerichts. Die Änderung einer ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung ist auch unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes grundsätzlich dann unbedenklich, wenn sie hinreichend begründet ist und sich im Rahmen einer vorhersehbaren Entwicklung hält. Soweit durch gefestigte Rechtsprechung ein Vertrauenstatbestand begründet wurde, kann diesem erforderlichenfalls durch Bestimmungen zur zeitlichen Anwendbarkeit oder Billigkeitserwägungen im Einzelfall Rechnung getragen werden.”
BAG-Zitate (gegebenenfalls auch anderer Gerichte) werden verwendet, wo immer sich das anbietet. Programm dieses Buches ist es, die Thematik anhand von als solchen gekennzeichneten Entscheidungsauszügen im Wortlaut systematisch abzuhandeln, wenn entsprechende Texte zur Verfügung stehen. Die Zitat-Dichte hängt davon ab, wie oft sich das BAG eines Themas angenommen hat; auf den diversen Teilgebieten des Arbeitsrechts ist sie ganz unterschiedlich ausgeprägt. Die Auswahl des Stoffs und seine Aufteilung in diesem Buch richten sich nach ihrer gewichteten Bedeutung.
Nichts in diesem Buch sollte als Rechtsberatung verstanden werden. Erst die Beschäftigung mit dem einzelnen Fall, insbesondere und vor allem seinem Tatsachenmaterial, aber ganz gewiss auch dem Arbeitsvertrag sowie etwa einschlägigen Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen, erlaubt eine Beurteilung der Rechtslage.
Meerbusch, im Dezember 2021
Gerd J. van Venrooy
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Lesetechnische Vorbemerkung
Geschichte des modernen Arbeitsrechts
A
RBEITSRECHT IM VORINDUSTRIELLEN
U
MFELD
A
RBEITSRECHT WÄHREND DER
I
NDUSTRIALISIERUNG
A
RBEITSRECHT IN DER
W
EIMARER
R
EPUBLIK
A
RBEITSRECHT UNTER DEM
N
ATIONALSOZIALISMUS
A
RBEITSRECHT IM HEUTIGEN
D
EUTSCHLAND
Grundthemen des Arbeitsrechts
R
ECHTSGEBIET
A
RBEITSRECHT
A
RBEITNEHMER
A
RBEITNEHMERÄHNLICHE
P
ERSONEN
A
RBEITGEBER
Rechtsquellenlehre
E
INGANGSÜBERLEGUNG
A
RBEITSVERTRAG
D
IREKTIONSRECHT DES
A
RBEITGEBERS
T
ARIFVERTRAG
B
ETRIEBSVEREINBARUNG
N
ORMEN ÖFFENTLICH
-
RECHTLICHER
K
ÖRPERSCHAFTEN
S
UPRANATIONALE
N
ORMEN
Allgemeines Arbeitsrecht
A
RBEITSVERTRAG
: A
NBAHNUNG
Schuldverhältnis der Vertragsverhandlungen
Anbahnungspflichten des Arbeitgebers in spe
Anbahnungspflichten des Arbeitnehmers in spe
A
RBEITSVERTRAG
: Z
USTANDEKOMMEN
Konsensualvertrag
Fehlende Willensübereinstimmung
Bestehende Willensübereinstimmung
Sonderkonstellationen
A
RBEITSVERTRAG
: A
NFÄNGLICHE
N
ICHTIGKEIT
Gesetzliche Schriftform
Rechtsgeschäftliche Schriftform
Doppelte Schriftform
Abschlussverbot
Teilnichtigkeit
A
RBEITSVERTRAG
: V
ERNICHTUNG
Fehlerhaftes Zustandekommen
Anfechtung wegen Täuschung
Anfechtung wegen Irrtums
Anfechtungswirkung
A
RBEITSVERTRAG
: I
NHALT
Gegenseitiger Vertrag
Hauptgestaltungen
A
RBEITSVERTRAG
: S
TANDARDVARIANTEN IM
A
RBEITSLEBEN
Teilzeitarbeitsvertrag
Probearbeitsvertrag
Arbeitsvertrag mit Befristungen
Leiharbeitsvertrag
Zwischenmeistervertrag
Arbeitsvertrag unter Bedingungen
Berufsausbildungsvertrag
A
RBEITSVERTRAG
: N
EBENTÄTIGKEIT
A
RBEITSVERTRAG
: E
RFÜLLUNGSORT
G
LEICHBEHANDLUNGSGRUNDSATZ
: A
LLGEMEINE
R
EGELN
G
LEICHBEHANDLUNGSGRUNDSATZ
: AGG
Ausgangspunkt
Benachteiligung
Zulässige unterschiedliche Behandlung
Rechtsfolgen unzulässiger Benachteiligung
G
ESAMTZUSAGE
B
ETRIEBLICHE
Ü
BUNG
A
LLGEMEINE
G
ESCHÄFTSBEDINGUNGEN IM
A
RBEITSRECHT
Einordnung
Zugang: § 310 Abs. 4 BGB
Arbeitsverträge unter dem AGB-Recht des BGB
Kontrollobjekte
Einbeziehungskontrolle
Inhaltskontrolle
Rechtsfolgen nach unwirksamen AGB
Einzelheiten
A
RBEITSVERTRAGLICHE
V
ERWEISUNG AUF
T
ARIFVERTRÄGE
Individualarbeitsrecht
A
USLEGUNG VON
A
RBEITSVERTRÄGEN
A
LLGEMEINE
R
ECHTSLAGE DES
A
RBEITNEHMERS
Gegenseitiger Vertrag
Entgeltzahlungsanspruch
Ausschlussfristen
Beschäftigungsanspruch
Probezeit
Urlaubsrecht
Entgeltfortzahlung für Feiertage
S
ONDERÜBERLEGUNGEN ZUM
A
RBEITNEHMER
Nebenpflichten
Wettbewerbsverbot
Verschwiegenheit
Auskunft
Schadensabwendung
Herausgabe
V
ERSCHIEDENES ZUM
A
RBEITNEHMER
Nachweisgesetz und Tarifverträge
Freiwillige Leistungen
Widerruf der Dienstwagennutzung
Personaleinkauf
Betriebliche Altersversorgung
Vertrauen auf Neubegründung eines Arbeitsverhältnisses
L
EISTUNGSSTÖRUNGEN BEIM
A
RBEITNEHMER
Einleitung
Nichterfüllung
Schadensersatz bei Nichterfüllung
Kündigung bei Nichterfüllung
Schlechterfüllung
Schadensersatz bei Schlechterfüllung
Mankohaftung bei Schlechterfüllung
Kündigung bei Schlechterfüllung
A
LLGEMEINE
R
ECHTSLAGE DES
A
RBEITGEBERS
Entgeltzahlungspflicht
Allgemeines
Trinkgeld
Bedienungsgeld
Direktionsrecht
S
ONDERÜBERLEGUNGEN ZUM
A
RBEITGEBER
Nebenpflichten
Auskunft
Schadensübernahme
Schweigepflicht
V
ERSCHIEDENES ZUM
A
RBEITGEBER
Versetzung – Umsetzung – Abordnung
Sperrabreden
L
EISTUNGSSTÖRUNGEN BEIM
A
RBEITGEBER
Einleitung
Schuldnerverzug des Arbeitgebers
Annahmeverzug des Arbeitgebers
Betriebsrisiko und Arbeitskampfrisiko
B
EDEUTUNG VON
§ 623 BGB
Rechtspolitischer Hintergrund
Schriftformgebot
Vertretung
Konsequenzen aus § 623 BGB
K
ÜNDIGUNGSRECHT
: E
INLEITUNG
K
ÜNDIGUNGSRECHT
: O
RDENTLICHE
K
ÜNDIGUNG
Kündigung
„Widerruf“ der Kündigung
„Rücknahme“ der Kündigung
Kündigungsfristen
Voraussetzungen der Kündigung: Anhörung des Betriebsrats
Voraussetzungen der Kündigung: Schwerbehinderte
Voraussetzungen der Kündigung: Massenentlassung
Unwirksamkeit der Kündigung
Regelungsbereich des KSchG
Zivilrechtlicher Rückgriff
Eingriffsvoraussetzungen
Sozial ungerechtfertigte Kündigung
Personenbedingte Kündigung
Personenbedingte Kündigung: Krankheit
Personenbedingte Kündigung: Verdacht
Verhaltensbedingte Kündigung
Verhaltensbedingte Kündigung: Abmahnung
Abmahnung im Recht der verhaltensbedingten Kündigung
Kündigungsrechtlich relevante Abmahnung
Konkret formulierte Abmahnung
Abmahnungen und aktueller Vorwurf gegen Arbeitnehmer
Abmahnung und Stellungnahme des Betriebsrats
Abmahnungsbefugnis
Erforderlichkeit einer Abmahnung allgemein
Abmahnung als Verzicht auf eine Kündigung
Abmahnung als ausreichende Reaktion
Abmahnung im Leistungsbereich
Abmahnung im Vertrauensbereich
Wiederholte Abmahnungen
Abgrenzung der Abmahnung
Kenntnis von einer Abmahnung
Abmahnung an Betriebsratsmitglieder
Abmahnung im Rahmen von § 178 Abs. 2 Satz 1 SGB IX
Abmahnung und Meinungsfreiheit des Arbeitnehmers
Vorgehen gegen eine Abmahnung
Anspruch auf Entfernung einer Abmahnung aus der Personalakte
Prozessrecht
Betriebsbedingte Kündigung
Betriebsbedingte Kündigung: Auftragsrückgang
Betriebsbedingte Kündigung: Wiedereinstellungsanspruch
Betriebsbedingte Kündigung: § 1a KSchG
Betriebsbedingte Kündigung: Soziale Auswahl
Betriebsbedingte Kündigung: Druckkündigung
K
ÜNDIGUNGSRECHT
: Ä
NDERUNGSKÜNDIGUNG
Einfache Änderungskündigung
Überflüssige Änderungskündigung
Entgegnungsvarianten des Arbeitnehmers
Schweigen
Ausdrückliche Ablehnung
Glatte Annahme
Annahme unter Vorbehalt
Änderungsschutzklage
Streitgegenstand
Prüfungsgegenstand
K
ÜNDIGUNGSRECHT
: A
USSERORDENTLICHE
K
ÜNDIGUNG
Basis
Wichtiger Grund
Zwei-Wochen-Frist
Fristlauf
Kenntnis seitens des Kündigungsberechtigten
Kenntnis der relevanten Tatsachen
K
ÜNDIGUNGSRECHT
: A
RB
GG-K
ÜNDIGUNGSSCHUTZ
Initiativlast des Arbeitnehmers
Klage gegen die ordentliche Kündigung
Erweiterter punktueller Streitgegenstandsbegriff
Nachschieben von Kündigungsgründen
Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers
Klage gegen die außerordentliche Kündigung
Prozessuale Lage des Arbeitnehmers
Nachschieben von Kündigungsgründen
Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers
K
ÜNDIGUNGSRECHT
: K
ÜNDIGUNGEN UND
A
USLANDSBERÜHRUNG
B
ETRUG GEGENÜBER DEM
S
OZIALVERSICHERUNGSTRÄGER
A
UFHEBUNGSVERTRÄGE
Zivilrechtliche Ausgangslage
Arbeitsrechtliche Fortsetzung
Vertragsinhalt
Ausgleichsklauseln
Abstandnahme vom Aufhebungsvertrag
Abwicklungsverträge
Aufklärungspflichten
A
RBEITSRECHTLICHE
F
REISTELLUNG UND
S
USPENDIERUNG
Z
EUGNISANSPRUCH
M
ELDEPFLICHTEN BEI
B
EENDIGUNG VON
A
RBEITSVERHÄLTNISSEN
B
ETRIEBSÜBERNAHMERECHT
: § 613
A
BGB
Übernahme von Betrieben und Betriebsteilen
Einzelheiten
T
EILZEITRECHT
Teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer
Förderung der Teilzeitarbeit
Anspruch auf zeitlich nicht begrenzte Verringerung der Arbeitszeit
Anspruch auf zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit
Anspruch auf Verlängerung der Arbeitszeit
Arbeitsplatzteilung
Arbeit auf Abruf
Urlaubsanspruch von Teilzeitarbeitnehmern
B
EFRISTUNGSRECHT
Gesetzliche Interessenlage
Befristet beschäftigter Arbeitnehmer
Befristung ohne Sachgrund
Befristung mit Sachgrund
Regelungsbereich des § 15 TzBfG
Rechtsfolgen unwirksamer Befristung
Anrufung des Arbeitsgerichts
Auflösend bedingter Arbeitsvertrag
Einzelheiten
A
RBEITNEHMERÜBERLASSUNGSRECHT
Wirtschaftliche Interessenlage
Arbeitnehmerüberlassung
Arbeitsvertrag zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer
Rechtsverhältnis zwischen Verleiher und Entleiher
Rechtsverhältnis zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer
Arbeitsschutzrecht
G
RUNDSÄTZLICHES
G
EFAHRENSCHUTZ
Gesundheitsschutz
Sachschutz
A
RBEITSZEITSCHUTZ
Vorrang des Arbeitsvertrags
Gleitende Arbeitszeit
Schichtarbeit
Überarbeit und Mehrarbeit
Kurzarbeit
Höchstarbeitszeit nach dem ArbZG
Arbeitszeitrechtliche Aufzeichnungspflicht
E
NTGELTSCHUTZ
Überblick
Pfändungsschutz
Insolvenzrechtlicher Schutz
Zivilrechtlicher Schutz
Kollektivarbeitsrechtlicher Schutz
Schutz gemäß MiLoG
Schutz gemäß AEntG
Schutz bei Arbeitsunfähigkeit
M
UTTERSCHUTZ
A
RBEITSUNFALLSCHUTZ
D
ATENSCHUTZ
Problematik des Datenschutzrechts
§ 26 BDSG
§ 4 BDSG
Rechtsfolgen nach unzulässiger Datenverarbeitung
Vorrangige Datenschutzbestimmungen
A
RBEITSSTRAFRECHT
Kollektives Arbeitsrecht: Koalitionsrecht
A
RBEITSRECHTLICHE
K
OALITIONEN
M
ERKMALE ARBEITSRECHTLICHER
K
OALITIONEN
Regelungsprinzip
Privatrechtliche Vereinigung
Gegnerfreie unabhängige Vereinigung
Vertretung sozialer Mitgliederinteressen
Koalitionseigenschaft vor der Arbeitsgerichtsbarkeit
B
ETÄTIGUNG
A
RBEITSRECHTLICHER
K
OALITIONEN
Zutritt von Gewerkschaftsbeauftragten zu Betrieben
Konkurrenzlagen
Tarifdurchsetzung
Internes Verbandsrecht
Kollektives Arbeitsrecht: Tarifrecht
T
ARIFVERTRAG
Funktionalität des Tarifvertrags
Schriftform des Tarifvertrags
Lückenschließung in Tarifverträgen
Rückwirkung von Tarifverträgen
Nachwirkung von Tarifverträgen
Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen
Arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne von § 12a TVG
T
ARIFAUTONOMIE
T
ARIFVERTRAG UND
G
ESAMTRECHTSORDNUNG
Einfluss des GG
Einfluss sonstigen Rechts
T
ARIFVERTRAG UND
A
RBEITSRECHTSORDNUNG
Betriebliche Individualebene
Betriebliche Kollektivebene
Tarifkonkurrenz
Grundlegendes
§ 4a TVG
Tarifpluralität
T
ARIFFÄHIGKEIT
T
ARIFZUSTÄNDIGKEIT
S
CHULDRECHTLICHER
A
SPEKT VON
T
ARIFVERTRÄGEN
Tarifvertrag und Koalitionsvertrag
Friedenspflicht
Durchführungspflicht
Ausdrückliche Pflichten
N
ORMATIVER
A
SPEKT VON
T
ARIFVERTRÄGEN
Auslegungsgrundsätze
Gesetzliche Regelung
Grundsätzliches
Tarifgebundenheit: § 3 Abs. 1 TVG
Tarifgebundenheit: Blitzaustritt und Blitzwechsel
Tarifgebundenheit: Nachbindung
Inhaltsnormen
Abschlussnormen
Beendigungsnormen
Betriebsnormen
Betriebsverfassungsrechtliche Normen
Gemeinsame Einrichtungen
Tarifvertrag und Arbeitsverhältnis
Günstigkeitsprinzip
Tarifliche Entgeltbedingungen
Abgrenzung
Verrechnungsklausel
Begrenzte Effektivklausel
Effektivgarantieklausel
Besitzstandsklausel
Verdienstsicherungsklausel
N
ORMATIVER
A
SPEKT VON
T
ARIFVERTRÄGEN
: G
ELTUNGSBEREICH
Vorbemerkung
Räumlicher Geltungsbereich
Betrieblicher Geltungsbereich
Fachlicher Geltungsbereich
Persönlicher Geltungsbereich
Zeitlicher Geltungsbereich
Kollektives Arbeitsrecht: Arbeitskampfrecht
B
EGRIFFLICHE
A
SPEKTE
W
IRTSCHAFTLICHE
A
SPEKTE
D
EUTSCHE
A
USGANGSRECHTSLAGE
U
NIONSRECHTLICHE
A
USGANGSLAGE
Ü
BERLEGUNGEN ZU WEITEREN
R
ECHTSQUELLEN
Rückverweisung
IAO
EMRK
ESC
V
ERHÄLTNIS
A
RBEITSKAMPF
-S
TAAT
Grundsatz
Staatlich beeinflusste Leistungen
Staatliche Teilnahme an Arbeitskämpfen
V
ERHÄLTNIS
A
RBEITSKAMPF
-B
ETRIEBSVERFASSUNGSRECHT
Betriebsratssystem im Arbeitskampf
Mitbestimmungsreduktion im Arbeitskampf
V
ERHÄLTNIS
A
RBEITSKAMPF
-I
NDIVIDUALARBEITSRECHT
Bedeutung der kollektiven Sicht
Entgeltfortzahlung bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit
Entgeltfortzahlung für Feiertage
Urlaubsrecht im Arbeitskampf
G
RUNDVORAUSSETZUNGEN DES
A
RBEITSKAMPFS
Rechtmäßiges Arbeitskampfziel
Rechtmäßigkeit von Arbeitskampfinhalten
Formerfordernisse bei Arbeitskämpfen
S
TREIK
Gewerkschaftsmitglieder und Außenseiter
Streikvarianten
Überbrückende Maßnahmen
S
TREIK UND
Z
URÜCKBEHALTUNG
A
USSPERRUNG
Einleitung
Abwehraussperrung
Angriffsaussperrung
Betriebsstilllegung
Kollektives Arbeitsrecht: Schlichtungsrecht
G
RUNDLAGE
Z
WANGSSCHLICHTUNG
Kollektives Arbeitsrecht: Betriebsverfassungsrecht
B
ETRIEBSBEGRIFF UND
U
NTERNEHMENSBEGRIFF
G
EMEINSAMER
B
ETRIEB
A
RBEITNEHMERMINIMUM
B
ETRIEBSRAT
V
ERTRAUENSVOLLE
Z
USAMMENARBEIT
S
ONDERFORMEN DES
B
ETRIEBSRATS
B
ETRIEBSTEILE UND
K
LEINSTBETRIEBE
A
RBEITNEHMERBEGRIFF DES
§ 5 B
ETR
VG
Arbeitnehmer nach § 5 Abs. 1 BetrVG
Zwei-Komponenten-Lehre
Zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte
Nicht-Arbeitnehmer nach § 5 Abs. 2 BetrVG
Leitende Angestellte nach § 5 Abs. 3 und 4 BetrVG
Arbeitsgerichtliche Klärung der Arbeitnehmereigenschaft
W
AHL DES
B
ETRIEBSRATS
Wahlberechtigung
Wählbarkeit
Belegschaftsstärke
Wahlzeitpunkt
Wahlregeln
Wahlgrundsätze
Wahlvorstand
Wahldurchführung
Allgemeine Bestimmungen
Betriebsratsfähige Organisationseinheit
Besondere Auseinandersetzungen
Wahlanfechtung
Wahlabsicherung
Wahlkosten
Wahlbehinderung
Wahlbeeinflussung
A
MTSZEIT DES
B
ETRIEBSRATS
Grundnorm
Übergangsmandat
Restmandat
Erlöschen der Mitgliedschaft
Ersatzmitglieder
V
ERLETZUNG GESETZLICHER
P
FLICHTEN
Exklusivität der Sanktionen
Regelungsbereich von § 23 Abs. 1 BetrVG
Ausschluss von Betriebsratsmitgliedern
Auflösung des Betriebsrats
Regelungsbereich von § 23 Abs. 3 BetrVG
G
ESCHÄFTSFÜHRUNG DES
B
ETRIEBSRATS
Vorsitzender
Betriebsausschuss
Ausschüsse und Arbeitsgruppen
Sitzungen
Vorbereitung
Durchführung
Teilnahmerechte
Beschlüsse
Geschäftsordnung
Arbeitsversäumnis
§ 37 Abs. 1 BetrVG
§ 37 Abs. 2 BetrVG
§ 37 Abs. 3 BetrVG
§ 37 Abs. 4 BetrVG
§ 37 Abs. 5 BetrVG
§ 37 Abs. 6 BetrVG
§ 37 Abs. 7 BetrVG
Freistellungen
Sprechstunden
Kosten
B
ETRIEBSVERSAMMLUNG
G
RUNDSÄTZE FÜR DIE
Z
USAMMENARBEIT
Verhältnis zu § 2 Abs. 1 BetrVG
Regelmäßige Besprechungen
Verhandlungs- und Einigungspflicht
Unzulässigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen
Unzulässigkeit friedensstörender Aktivität
Unzulässigkeit parteipolitischer Betätigung
Konkurrierende Gewerkschaftsbetätigung
G
RUNDSÄTZE FÜR DIE
B
EHANDLUNG DER
B
ETRIEBSANGEHÖRIGEN
E
INIGUNGSSTELLE
Einsetzung
Verfahren
Entscheidung
Kosten
B
ETRIEBSVEREINBARUNGEN
Durchführung von „Vereinbarungen“
Begriff der Betriebsvereinbarung
Typen der Betriebsvereinbarung
Verzicht nach § 77 Abs. 4 Satz 2 BetrVG
Konkurrenzen
Tarifüblichkeitssperre
Betriebsvereinbarungen untereinander
Betriebsvereinbarung und Arbeitsvertrag
Auslaufen von Betriebsvereinbarungen
Regelungsabreden
F
UNKTIONSBESTIMMUNGEN
Schutz von Betriebsratsmitgliedern
Schutz auszubildender Betriebsratsmitglieder
Geheimhaltungspflicht
Datenschutz
A
LLGEMEINE
A
UFGABEN DES
B
ETRIEBSRATS
Aufgabenverzeichnis des § 80 Abs. 1 BetrVG
Informationsanspruch des Betriebsrats
Sachverständige und Betriebsrat
M
ITWIRKUNGS
-
UND
B
ESCHWERDERECHT DES
A
RBEITNEHMERS
Einleitung
Unterrichtung und Erörterung
Anhörung
Einsicht in die Personalakten
Beschwerderecht
Vorschlagsrecht
M
ITBESTIMMUNG NACH
§ 87 A
BS
. 1 B
ETR
VG: S
TANDARDTHEMEN
Tarifvorrang
Unterlassungsanspruch
Initiativrecht des Betriebsrats
Kollektiver Bezug
M
ITBESTIMMUNG NACH
§ 87 A
BS
. 1 N
R
. 1 B
ETR
VG
M
ITBESTIMMUNG NACH
§ 87 A
BS
. 1 N
R
. 2 B
ETR
VG
M
ITBESTIMMUNG NACH
§ 87 A
BS
. 1 N
R
. 3 B
ETR
VG
M
ITBESTIMMUNG NACH
§ 87 A
BS
. 1 N
R
. 4 B
ETR
VG
M
ITBESTIMMUNG NACH
§ 87 A
BS
. 1 N
R
. 5 B
ETR
VG
M
ITBESTIMMUNG NACH
§ 87 A
BS
. 1 N
R
. 6 B
ETR
VG
M
ITBESTIMMUNG NACH
§ 87 A
BS
. 1 N
R
. 7 B
ETR
VG
M
ITBESTIMMUNG NACH
§ 87 A
BS
. 1 N
R
. 8 B
ETR
VG
M
ITBESTIMMUNG NACH
§ 87 A
BS
. 1 N
R
. 9 B
ETR
VG
M
ITBESTIMMUNG NACH
§ 87 A
BS
. 1 N
R
. 10 B
ETR
VG
M
ITBESTIMMUNG NACH
§ 87 A
BS
. 1 N
R
. 11 B
ETR
VG
M
ITBESTIMMUNG NACH
§ 87 A
BS
. 1 N
R
. 12 B
ETR
VG
M
ITBESTIMMUNG NACH
§ 87 A
BS
. 1 N
R
. 13 B
ETR
VG
M
ITBESTIMMUNG NACH
§ 87 A
BS
. 1 N
R
. 14 B
ETR
VG
F
REIWILLIGE
B
ETRIEBSVEREINBARUNGEN
A
RBEITSSCHUTZ UND
U
NFALLVERHÜTUNG
A
RBEITSPLATZ
, A
RBEITSABLAUF
, A
RBEITSUMGEBUNG
Unterrichtung und Beratung
Mitbestimmung
P
ERSONELLE
A
NGELEGENHEITEN
Personalplanung
Beschäftigungssicherung
Ausschreibung von Arbeitsplätzen
Personalfragebogen und Beurteilungsgrundsätze
Auswahlrichtlinien
Betriebliche Bildungsmaßnahmen
§ 96 BetrVG
§ 97 BetrVG
§ 98 BetrVG
Personelle Einzelmaßnahmen
Einstellung
Eingruppierung und Umgruppierung
Versetzung
Zustimmungsverweigerung
Frist
Unterlassungsanspruch
Mitbestimmung bei Kündigungen
Außerordentliche Kündigung gegenüber Betriebsratsmitgliedern
W
IRTSCHAFTLICHE
A
NGELEGENHEITEN
Wirtschaftsausschuss
Aufgaben
Einsetzung
Organisation
Unterrichtung der Arbeitnehmer
Betriebsänderungen im Sinne der §§ 111 bis 113 BetrVG
Betriebsänderungen
Interessenausgleich
Sozialplan
Nachteilsausgleich
Funktion
Zahlungspflicht
§ 113 Abs. 1 und 2 BetrVG
§ 113 Abs. 3 BetrVG
T
ENDENZBETRIEBE UND
R
ELIGIONSGEMEINSCHAFTEN
Tendenzbetriebe
Religionsgemeinschaften
S
TRAF
-
UND
O
RDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT
Arbeitsgerichtsverfahren
E
INORDNUNG
E
IGENE
A
KTENFÜHRUNG
U
RTEILSVERFAHREN
Voraussetzungen
Bürgerliche Rechtsstreitigkeit
Arbeitnehmereigenschaft
Varianten im Urteilsverfahren
Güteverfahren
Klageschrift
Leistungsklage: Arbeitspflicht
Leistungsklage: Entgeltzahlungspflicht
Unterlassungsklage
Antrag auf einstweilige Verfügung
Rechtsmittel
B
ESCHLUSSVERFAHREN
A
USSETZUNG VON
V
ERFAHREN ANALOG
§ 148 A
BS
. 1 ZPO
Internationales Arbeitsrecht
A
NWENDBARES
R
ECHT
: V
ERORDNUNG
(EG) N
R
. 593/2008 – R
OM
I
A
RBEITSVERTRAGSSTATUT
Arbeitsvertragsstatut nach Art. 8 Rom I
Arbeitsvertragsstatut nach § 15 Satz 1 AEntG
S
PRACHFRAGE
A
UFKLÄRUNG FREMDEN
R
ECHTS
G
ERICHTSSTAND
: V
ERORDNUNG
(EU) N
R
. 1215/2012 – E
U
GVVO
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Entscheidungen sind solche des BAG, wenn nichts anderes angegeben ist.
AAG
Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung (Aufwendungsausgleichsgesetz)
aaO
am angegebenen Ort
ABlEU
Amtsblatt der Europäischen Union
Abs.
Absatz, Absätze
ÄApprO
Approbationsordnung für Ärzte
a. E.
am Ende
AEntG
Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz)
AEUV
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AG
Amtsgericht
AGB
Allgemeine Geschäftsbedingung(en)
AGG
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AktG
Aktiengesetz
ALR
Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten
AOG
Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit
ArbGG
Arbeitsgerichtsgesetz
ArbnErf
Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
ArbSchG
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz)
ArbPlSchG
Gesetz über den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung zum Wehrdienst (Arbeitsplatzschutzgesetz)
ArbSchV
Arbeitsschutzverordnung
ArbZG
Arbeitszeitgesetz
ARD
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland
ASiG
Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
AÜG
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
BAG
Bundesarbeitsgericht
BAnz
Bundesanzeiger
BÄO
Bundesärzteordnung
BBiG
Berufsbildungsgesetz
BDSG
Bundesdatenschutzgesetz
BEEG
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
BetrAVG
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung
BetrVG
Betriebsverfassungsgesetz
BFDG
Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl
Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes; Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BPersVG
Bundespersonalvertretungsgesetz
BSG
Bundessozialgericht
BT-Drs
Drucksache des Deutschen Bundestags
BUrlG
Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz)
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerwG
Bundesverwaltungsgericht
D
Digesten
DGB
Deutscher Gewerkschaftsbund
DS-GVO
Datenschutz-Grundverordnung
EG
Europäische Gemeinschaft
EGBGB
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
EGMR
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EinhV
Ausführungsverordnung zum Gesetz über die Einheiten im Messwesen und die Zeitbestim-mung (Einheitenverordnung)
EinhZeitG
Gesetz über die Einheiten im Messwesen und die Zeitbestimmung (Einheiten- und Zeitgesetz)
EinigVtr
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag)
Einl
Einleitung
EMRK
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
EntgFG
Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz)
EntgTranspG
Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern
ESC
Europäische Sozialcharta
EStG
Einkommensteuergesetz
ErbStG
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz
EU
Europäische Union
EuGH
Gerichtshof der Europäischen Union
EuGVVO
Verordnung (EU) Nr. 1215/2012
EUV
Vertrag über die Europäische Union
EWG
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
FeV
Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung)
ff
folgende
FPfZG
Gesetz über die Familienpflegezeit (Familienpflegezeitgesetz)
GefStoffV
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung)
GeschGehG
Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
GewO
Gewerbeordnung
GG
Grundgesetz
GGO
Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien
GRC
Charta der Grundrechte der Europäischen Union
GVG
Gerichtsverfassungsgesetz
GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HAG
Heimarbeitsgesetz
Halbs.
Halbsatz, Halbsätze
HGB
Handelsgesetzbuch
HwO
Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung)
IAO
Internationale Arbeitsorganisation
InsO
Insolvenzordnung
ISO
Internationale Organisation für Normung
JArbSchG
Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz)
KG
Kommanditgesellschaft
KRG
Kontrollratsgesetz
KSchG
Kündigungsschutzgesetz
KunstUrhG
Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie
lit., litt.
Buchstabe(n)
LPartG
Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetzt)
MiLoG
Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns
MitbestG
Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz)
MuSchG
Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz)
NachwG
Nachweisgesetz
Nr., Nrn.
Nummer(n)
oHG
Offene Handelsgesellschaft
OWiG
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
PartG
Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz)
PflegeZG
Gesetz über die Pflegezeit (Pflegezeitgesetz)
PrGS
Preußische Gesetz-Sammlung
PrKG
Gesetz über das Verbot der Verwendung von Preisklauseln bei der Bestimmung von Geld-schulden (Preisklauselgesetz)
PStG
Personenstandsgesetz
RABl
Reichsarbeitsblatt
RAG
Reichsarbeitsgericht
RE
Regierungsentwurf
RG
Reichsgericht
RGBl
Reichsgesetzblatt
Rom I
Verordnung (EG) Nr. 593/2008
RPflG
Rechtspflegergesetz
SächsBGB
Bürgerliches Gesetzbuch für das Königreich Sachsen
SeeArbG
Seearbeitsgesetz
SGB
Sozialgesetzbuch
SoKaSiG2
Gesetz zur Sicherung der tarifvertraglichen Sozialkassenverfahren (Zweites Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz)
SprAuG
Gesetz über Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten (Sprecherausschußgesetz)
StGB
Strafgesetzbuch
StVG
Straßenverkehrsgesetz
SvEV
Verordnung über die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des Arbeitgebers als Arbeitsentgelt (Sozialversicherungsentgeltverordnung)
TKG
Telekommunikationsgesetz
TMG
Telemediengesetz
TVG
Tarifvertragsgesetz
TVGDV
Verordnung zur Durchführung des Tarifvertragsgesetzes
TVöD
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TzBfG
Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge
UmwG
Umwandlungsgesetz
Unterabs.
Unterabsatz, Unterabsätze
UWG
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
VKA
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
VkBkmG
Gesetz über die Verkündung von Rechtsverordnungen und Bekanntmachungen (Verkündungs- und Bekanntmachungsgesetz)
VwGO
Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG
Verwaltungsverfahrensgesetz
WiGBl
Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
WO
Erste Verordnung zur Durchführung des Betriebsverfassungsgesetzes (Wahlordnung)
WpÜG
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
WRV
Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919 (Weimarer Reichsverfassung)
ZPO
Zivilprozessordnung
Lesetechnische Vorbemerkung
Diese Ausführungen ersparen keinen Blick in Gesetze und Verordnungen. Sie wollen die Beschäftigung mit den Originalwortlauten von Vorschriften im Gegenteil sogar fördern. Wenn also auf Normen (Art. 2 EGBGB) verwiesen wird, müssen diese nachgelesen werden; anderenfalls wird ein Verständnis des Buchtexts nicht gelingen. Im Übrigen muss Sicherheit hergestellt werden, dass die Bestimmungen unverändert geblieben sind (http://www.gesetze-im-internet.de). Und wo das sinnvoll erscheint, werden sie auch wörtlich wiedergegeben. Gerichtsentscheidungen werden über das Aktenzeichen ohne Weiteres im Internet gefunden, jedenfalls meistens.
In Vorschriftentexten ist immer auf eines zu achten: Überschriften ohne Klammern sind amtliche; sie sind also im Rahmen der Auslegung der so bezeichneten Vorschriften heranzuziehen. Zu solchen Überschriften tendiert mittlerweile der Gesetzgeber. Eckig eingeklammerte Überschriften sind vom jeweiligen Verlag hinzugesetzt und damit juristisch belanglos, auch wenn sie meistens willkommene Hilfe bieten. Verlässlich sind beide Arten ganz gewiss nicht immer; es kommt durchaus vor, dass sie Nichtjuristen in die Irre führen und bei Juristen die Frage aufwerfen, was die Verfasser eigentlich dachten.
Das Paragraphenzeichen (§) erklärt sich vom Lateinischen her. Es sind zwei ineinander verschlungene „s“, die stehen für signum sectionis, Zeichen der Zerschneidung, der Trennung demnach. Ein doppeltes Paragraphenzeichen dient zur Aufnahme aller im Anschluss genannten Paragraphen, also nicht nur von zweien.
Wenn in juristischen Gedankenfolgen Wendungen wie „grundsätzlich“, „im Grundsatz“, „prinzipiell“, „im Prinzip“ oder Ähnliches verwendet werden, heißt das abweichend vom üblichen deutschen Sprachgebrauch, aber durchaus richtiger, dass es Ausnahmen gibt. Das muss man sich merken; anderenfalls missversteht man juristische Texte. – Auch wenn man selbst geschäftliche Absichten in juristische Worte fasst, insbesondere wenn man Formulare entwickelt, sind solche Ausdrücke unbedingt zu vermeiden. Im Ernstfall bekäme man sie entgegengehalten; für Allgemeine Geschäftsbedingungen steht das in genereller Fassung im Gesetz, nämlich in § 305c Abs. 2 BGB. Immerhin, laut BGH trägt diese Regel nicht, wenn beide Vertragsparteien eine Klausel übereinstimmend verstanden haben (2002-03-22, V ZR 405/00).
Trifft eine Vorschrift oder Überlegung nach ihrem Wortlaut „unbeschadet“ anderer Bestimmungen oder Erwägungen zu, dann greifen diese ebenfalls ein, ohne aber erstere zu verdrängen (2020-09-09, 4 AZR 385/19); das kann im je konkreten Fall zu nur mühsam auflösbaren Konkurrenzerwägungen führen.
Nach Art. 82 Abs. 1 Satz GG werden Gesetze im BGBl verkündet. Der dortige Satz 2 lässt für Verordnungen eine andere Verkündungsweise zu, wenn sich das aus einem Gesetz ergibt. Dieses Gesetz ist das VkBkmG, das in seinem § 2 vor allem, aber nicht ausschließlich, den BAnz vorsieht, der für Verordnungen auf dem Gebiete des Arbeitsrechts nicht übersehen werden sollte, wenn eine Fundstelle gesucht wird. Ergänzend gilt § 76 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 1 GGO.
In Übereinstimmung mit BGH, 2018-03-13, VI ZR 143/17, wird das generische Maskulinum verwendet. Der offiziellen Rechtschreibung wird nicht immer gefolgt. In Entscheidungszitaten enthaltene allgemeine Wortabkürzungen sind aufgelöst, mit Ausnahme solcher Abkürzungen, die in der Rechtssprache gängig sind; Fettunterlegungen und Kursivschrift sind hier und innerhalb von Vorschriften hinzugefügt; Weiterverweisungen sind in aller Regel entfernt; Abkürzungen von Vorschriften sind gelegentlich geändert.
Geschichte des modernen Arbeitsrechts
ARBEITSRECHT IM VORINDUSTRIELLEN UMFELD
Man könnte mit einer einleitenden kurzen Darstellung der Geschichte des Arbeitsrechts gut in der Antike beginnen. Unser Zivilrecht basiert auf Römischem Recht. Es ist immer wieder interessant, auf die römischen Quellen zurückzugreifen und sich dabei vor Augen zu führen, dass die meisten Gestaltungsideen zum Zivilrecht aus jener Zeit stammen. Arbeitsrecht gehört im Wesentlichen zum Zivilrecht, weshalb man auch zum Arbeitsrecht dort fündig wird. In den großen Städten des Römischen Reichs gab es eine ansehnliche Zahl von persönlich freien Lohnabhängigen. Durchaus also hätte sich ein Arbeitsrecht als Rechtsgebiet formen können. Aber eben dazu kam es nicht. Einige wenige Grundlagen wurden formuliert. Insgesamt jedoch waren die persönlich freien Lohnabhängigen wirtschaftlich zu schwach, als dass sie ihre Belange so intensiv hätten wahrnehmen können, dass die Rechtsordnung eine Antwort in der Form eines Systems für nötig hätte zu halten brauchen. Es zeigt sich später immer wieder, dass das Arbeitsrecht – nicht nur das kollektive, sondern auch das individuelle – seine Entwicklung der jeweiligen sozialen Stärke der Arbeitnehmerschaft schuldet, wenn auch keineswegs durchgängig deren Initiative.
Von einer solchen Stärke konnte im vorindustriellen Umfeld – dieses hier verstanden als die Epoche, auf die die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts unmittelbar folgte – noch lange nicht die Rede sein. Lohnabhängige waren jedenfalls in dieser Eigenschaft im Grunde rechtlos. Sie hatten keinen Platz in der ständischen Ordnung, waren weder Bürger noch Bauern, wobei es den Bauern juristisch auch nicht viel besser ging als den ursprünglich nicht vielen Lohnabhängigen. Aber deren Zahl vergrößerte sich im Laufe der Zeit. Es entstand staatlicherseits Interesse daran, dieses Thema juristisch zu behandeln. So kam es in Preußen zur Gewerbefreiheit mit Gesetz von 1810-10-28 (PrGS 1810, Seite →; heute § 1 GewO) und damit zur Freiheit, die in diesem Rahmen erforderlichen Verträge, demnach auch Arbeitsverträge zu schließen, dies nach dem Gesetz von 1811-09-07 (PrGS 1811, Seite →, Nr. 7; heute §§ 41 Abs. 1, 105 Satz 1 GewO). Im Nachhinein wurde klar: Wer zuvor quasirechtlos war, der war es dann erst recht: Der einzelne Lohnabhängige musste seine Arbeitskraft „verkaufen“ zu den Bedingungen, die er auf dem nunmehr freien Arbeitsmarkt antraf (prinzipiell anders ist es heute immer noch nicht). Rechtlich wurden Arbeitgeber und Lohnabhängige frei. Soziologisch jedoch erhielten nur die Arbeitgeber ihre Freiheit. Von Sozialpolitik war noch nichts zu spüren.
ARBEITSRECHT WÄHREND DER INDUSTRIALISIERUNG
In der Periode der Industrialisierung verschärfte sich die Lage der Lohnabhängigen erheblich. Ihre Zahl stieg durch stetes Bevölkerungswachstum und dadurch, dass die Landwirtschaft immer weniger Personal benötigte. Die durch keine begleitenden Maßnahmen abgefederte Vertragsfreiheit drückte die Löhne ganz folgerichtig, denn eine nennenswerte Verhandlungsposition hatten die Lohnabhängigen nicht. Verborgen blieb dem Staat die Situation nicht, aber er reagierte nur zögerlich; die Wurzel des Problems wollte er nicht antasten. Also versuchte er, durch Arbeitsschutzmaßnahmen zugunsten der Lohnabhängigen zu intervenieren. Der Vorteil bestand darin, dass die Vertragsfreiheit als Ausgangspunkt erhalten blieb, die Arbeitgeberseite indes nicht mehr soviel damit anfangen durfte wie zuvor. Zivilrecht wurde also durch öffentliches Recht eingedämmt. Dieser Grundsatz findet sich heute auch in § 1 GewO.
Erster Schritt in Preußen war das gern erwähnte Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken von 1839-03-09 (PrGS 1839, Seiten →-→). Es verfügte Beschäftigungsverbote und Beschränkungen der Arbeitszeit (heute Gegenstand des JArbSchG, das nach § 18 Abs. 2 ArbZG diesem vorgeht). Bei genauerem Hinsehen gehört es aber nicht in diesen Zusammenhang. Hinter diesem Regulativ stand als Auslöser das Militär, das wegen verbreiteter Kinderarbeit zu wenig tauglichen Nachwuchs bei sich ankommen sah. Sodann fiel der preußischen Bürokratie ein Zusammenhang auf zwischen Kinderarbeit und der Verletzung der Schulpflicht. Sozialpolitik lässt sich so nicht darstellen; aber vom Ergebnis her war ein Anfang gemacht.
Deutlich arbeitsschutzrechtlich liest sich unter 1849-02-09 die Befreiung (PrGS 1849, Seite →, § 49 Abs. 2) von einer großenteils bestehenden vertraglichen Pflicht, an Sonntagen und Feiertagen zu arbeiten (heute §§ 1 Nr. 2, 9 bis 13 ArbZG). Wieweit die Kirchen als Initiatoren in Betracht kommen, sei hier dahingestellt. Jedenfalls: Mangels staatlicher Durchsetzung blieb die Regelung ohne Folge.
Auch unter 1849-02-09 fällt die Formulierung des Truckverbots (PrGS 1849, Seiten →-→, →, §§ →-→, →), das den Arbeitnehmern Sicherheit gab, das vereinbarte Entgelt in Geld zu bekommen, und nicht etwa im Wege der Verrechnung mit andersartigen Leistungen. Nachzulesen ist das heute in § 107 GewO.
Wesentlich war unter 1891-06-01 ein Gesetz zur Abänderung der Gewerbeordnung (RGBl 1891, Seiten →-→); es brachte die Einführung einer Gewerbeaufsicht, wie sie heute immer noch in § 139b GewO geregelt ist.
Der damaligen Politik gelang mit der Einführung einer zwingenden, von Gesetzes wegen bestehenden Sozialversicherung ein systempflegender Geniestreich. Krankenversicherung von 1883-06-15 (RGBl 1883, Seiten →-→; heute SGB V), Unfallversicherung von 1884-07-06 (RGBl 1884, Seiten →-→; heute SGB VII), Rentenversicherung von 1889-06-22 (RGBl 1889, Seiten →-→; heute SGB VI), Reichsversicherungsordnung von 1911-07-19 (RGBl 1911, Seiten 509-838) und Angestelltenversicherung von 1911-12-20 (RGBl 1911, Seiten 989-1061) gaben der Arbeitnehmerschaft endlich eben die soziale Sicherheit zurück, die ihre landgebundenen Vorfahren in deren bäuerlicher Umgebung praktisch von Natur aus hatten, und noch mehr. Arbeitsrechtlich wird der Vorteil der Sozialversicherung vorwiegend darin gesehen, dass sie die Abgrenzung der Arbeitnehmer von den Selbständigen und dann auch der Arbeiter von den Angestellten leistete. Das ist einerseits richtig, andererseits viel zu wenig: Durch das den Arbeitnehmern aufgespannte soziale Netz bekam das gesamte Arbeitsrecht den entscheidenden Schub; Arbeitsrecht und soziale Realität begannen, sich im Zuge fernerer Evolution einander anzugleichen.
Ein weiteres Feld als das des bloßen Arbeitsschutzes beschritt der Staat mit der Schaffung von Gewerbegerichten durch Gesetz von 1890-07-29 (RGBl 1890, Seiten →-→). Dessen § 12 Abs. 1 lautete: „Die Beisitzer müssen zur Hälfte aus den Arbeitgebern, zur Hälfte aus den Arbeitern entnommen werden.“ Und § 11 Abs. 1 sagte: „Der Vorsitzende sowie dessen Stellvertreter dürfen weder Arbeitgeber noch Arbeiter sein.“ Nicht nur durften die Arbeiter an dieser neuen Einrichtung teilnehmen; sie konnten auch nicht majorisiert werden. Für die juristische und soziologische Emanzipation der Arbeiter hat dieses Gesetz wohl weit mehr bewirkt als bloße staatliche Eingriffe in die Betriebshoheit der Arbeitgeber. – Kaufmannsgerichte für kaufmännisches Personal wurden unter 1904-07-06 errichtet (RGBl 1904, Seiten →-→). – Beide Gerichtsarten sahen nur eine Berufung zum jeweiligen Landgericht, also zur Zivilgerichtsbarkeit, vor; dort endete der Instanzenzug.
Mit der Herstellung der Koalitionsfreiheit im Norddeutschen Bund durch § 152 der Gewerbeordnung von 1869-06-21 (BGBl 1869, Seiten →-→, →; heute unter anderem Art. 9 Abs. 3 Satz 1 und 2 GG) konnte die Gewerkschaftsidee Fuß fassen, die später in immer dichterer Folge zum Abschluss von Tarifverträgen führte (heute TVG). Nicht nur sozial-, sondern auch verfassungspolitisch darf man diese Entwicklung nicht unterschätzen: Sie bedeutete auf Gewerkschaftsseite den Schritt von der eigentlich einmal angestrebten Revolution hin zum systemkonformen Handeln in Vertragsform.
ARBEITSRECHT IN DER WEIMARER REPUBLIK
Die Weimarer Zeit erlebte eine hohe Aktivität auf dem Gebiet arbeitsrechtlicher Gesetzgebung, dies zunächst auf einer außerordentlich brüchigen Grundlage: Die Sozialisierung der Wirtschaft war großes Thema; ein sozialistisches Rätesystem rückte in greifbare Nähe. Kaum bekannt ist heute noch, dass der Begriff „Betriebsrat“ mit Bezug auf eine derartige Sozialordnung gebildet wurde. Eine zentrale Einigung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das nach den Verhandlungsführern später so genannte Stinnes-Legien-Abkommen, verhinderte einen solchen Irrweg: Die Arbeitgeber erkannten die freien Gewerkschaften als Vertreter der Arbeitnehmer an und sagten zu, die von ihnen abhängigen Gewerkschaften, von denen es nicht wenige gab, nicht mehr zu unterstützen. Beide Seiten bekundeten ihr Interesse an Kollektivvereinbarungen, also vor allem an Tarifverträgen. Vom Staat wurde auf dieser Basis die Tarifvertragsverordnung von 1918-12-23 (RGBl 1918, Seiten 1456-1467) erlassen, in der in Form von Arbeitnehmerausschüssen auch eine Urform betrieblicher Mitbestimmung angelegt war. – Das Betriebsrätegesetz sah dann unter 1920-02-04 (RGBl 1920, Seiten →-→) nicht nur Betriebsräte, sondern auch einen Kündigungsschutz vor (heute KSchG). – Der Achtstundentag (heute § 3 Satz 1 ArbZG) wurde unter 1918-11-23/1919-03-18 realisiert (RGBl 1918, Seiten 1334-1336; 1919, Seiten →-→). – Eine vollständige, wenn auch organisatorisch noch nicht verselbständigte (Erinnerung daran in 2011-09-21, 5 AZR 629/10) Arbeitsgerichtsbarkeit mit drei Instanzen trat aufgrund Gesetzes von 1926-12-23 (RGBl I 1926, Seiten 507-524) an die Stelle der Gewerbegerichte und der Kaufmannsgerichte (heute ArbGG). – Und es gab eine weitere sozialrechtliche Großtat: Errichtet wurde unter 1927-07-16 (RGBl I 1927, S. 187-218) eine Arbeitslosenversicherung (heute SGB III).
ARBEITSRECHT UNTER DEM NATIONALSOZIALISMUS
In der nationalsozialistischen Periode wurden die entscheidenden Systemelemente des Arbeitsrechts auf den Kopf gestellt. Das AOG von 1934-01-20 (RGBl I, Seiten →-→) wandelte es um in eine staatliche Veranstaltung mit Überwachung jedes Betriebs und Tarifordnungen in der Form von Rechtsverordnungen. Starke Bemühungen, auch für das Arbeitsrecht eine neue, nämlich nationalsozialistische, Dogmatik zu formulieren, blieben letztlich folgenlos. Der Staat brach kriegsbedingt zusammen, noch bevor die an dieser Diskussion Beteiligten sich einigen konnten.
ARBEITSRECHT IM HEUTIGEN DEUTSCHLAND
Die arbeitsrechtliche Jetzt-Zeit fing nach dem Zweiten Weltkrieg mit erheblichen Verwerfungen an, diese beruhend darauf, dass die ausländischen Militärs anhand politischer Maximen punktuell in das Arbeitsrecht eingriffen, ohne dabei die Notwendigkeit im Blick zu behalten, dass es als Gesamtordnung Bestand hätte haben müssen. Diese begann erst nach einer Reihe von Jahren wieder Gestalt zu zeigen. Ein TVG und ein KSchG konnten noch friedlich eingeführt werden. Bei der unternehmerischen und der betrieblichen Mitbestimmung gewann man dann den Eindruck, dass die Gewerkschaften vergessen hatten, woher sie kamen. Die – damals im Übrigen ungewöhnlich heftige – Auseinandersetzung ging in der Tat wie schon zu Beginn der Weimarer Republik um die Frage, ob freies Wirtschaften die prinzipielle Lösung sein sollte oder eine von den Gewerkschaften (zur Weimarer Zeit: den Räten) jedenfalls mitgesteuerte Ökonomie. Das BetrVG und später das MitbestG blieben dann schließlich auf dem Boden liberaler Wirtschaftspolitik – diese jedenfalls nach deutschem Verständnis: Die Reaktion ausländischer Arbeitsrechtler, vor allem aus den USA, auf eine Schilderung des deutschen Arbeitsrechts ist oft noch immer von Unglauben geprägt, von komplettem Unverständnis, wie dergleichen in einer solchen Wirtschaftsordnung funktionieren kann. – Die weitere Entwick-lung ist gekennzeichnet sowohl von der arbeitsrechtlich immer rastlos gebliebenen Gesetzgebung als auch von der arbeitsrechtlichen Judikatur, die sich seit 1953 auf ein neues ArbGG stützt, das nun auch einen organisatorisch selbständigen, dreigliedrigen Instanzenzug kennt.
Grundthemen des Arbeitsrechts
RECHTSGEBIET ARBEITSRECHT
Jedes Rechtsgebiet wird umgrenzt durch alle Normen, die sich mit seiner Materie befassen. Eine solche Definition triff immer zu, denn sie ist tautologisch: Man liest das heraus, was man zuvor hineingelesen hat. Wenn demnach „Arbeitsrecht” alle Normen umfasst, die sich auf Arbeitnehmer beziehen, ist das ebenso richtig wie seine Charakterisierung als Sonderrecht der abhängig Beschäftigten. Sollen diese oft gelesenen Maximen aber eine über Formales hinausgehende Auskunft geben, muss man sich erst Gewissheit verschafft haben über die Begriffe „Arbeitnehmer” und „abhängig Beschäftigter” wie auch über die Frage, ob beide wirklich dasselbe bedeuten (nein, durchaus nicht). Eine solche Klärung ist aber nur möglich, wenn man über Arbeitsrecht schon Entscheidendes weiß. Die angebotenen Standarddefinitionen öffnen folglich keine Tür zum Umgang mit dem Arbeitsrecht.
Bemerkenswert ist es, dass sich niemand um das Wort „Arbeit“ zu scheren scheint, das doch eigentlich Ausgangspunkt jedweder arbeitsrechtlicher Überlegung sein könnte. Im BGB kommt es vor, aber erst in § 631 Abs. 2, also gerade nicht in arbeitsrechtlichem Kontext. Diese allgemeine Interesselosigkeit deutet darauf hin, dass eine Begriffsklärung das Arbeitsrecht intellektuell nicht bereichern würde. – Was physikalisch unter „Arbeit“ verstanden wird, ist hier ohne Belang.
Jedoch hilft die Gesetzeslage, wenn man wissen will, was Arbeitsrecht ist. Die §§ 2, 2a und 3 ArbGG beschreiben detailliert, in welchen Zusammenhängen die Arbeitsgerichte ausschließlich zuständig sind. Jedenfalls dann hat man es mit „Arbeitsrecht“ zu tun. Wie gesagt: jedenfalls. Das Arbeitsrecht ist voller Normen, die ihrerseits nach öffentlichem Recht (Verwaltungsrecht, Sozialrecht), Ordnungswidrigkeitenrecht und Strafrecht funktionieren und demnach nicht von den Arbeitsgerichten gehandhabt werden. Sie sollte man sich als doppelt qualifiziert vorstellen, mithin als auch arbeitsrechtlich. Das BVerfG sagt: „Die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG. Der Kompetenztitel ,Arbeitsrecht’ begründet eine umfassende Kompetenz für privatrechtliche wie auch öffentlich-rechtliche Bestimmungen über die Rechtsbeziehungen im Arbeitsverhältnis“ (2018-06-06, 1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14). – Auf dieser Basis hat man Zugang zum Arbeitsrecht. Bemerkenswert ist übrigens, dass in § 2 Abs. 1 ArbGG Arbeitnehmer und Arbeitgeber erst unter Nr. 3 genannt werden. Tarifrecht (Nr. 1), Koalitions- und Arbeitskampfrecht (Nr. 2) schienen dem Gesetzgeber einen stärkeren Akzent auf das Rechtsgebiet zu setzen als Auseinandersetzungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Dies ist historisch betrachtet sicherlich die richtige Sicht der Dinge.
ARBEITNEHMER
Gewiss, das Alltags-Arbeitsrecht hat mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu tun. Noch nicht lange ist es her, da definierte man den „Arbeitnehmer“ mangels besserer gesetzlicher Grundlage mit Hilfe von § 84 Abs. 1 Satz 2 HGB (Reminiszenz in 2019-01-21, 9 AZB 23/18). Dort steht immer noch: „Selbständig ist, wer im wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann.“ Ein Umkehrschluss aus diesem Satz ergab den Arbeitnehmer, also denjenigen, dessen Tätigkeit und Arbeitszeit fremdbestimmt sind, nämlich dem Direktionsrecht des Arbeitgebers unterliegen. Und so kann man es mittlerweile in § 611a Abs. 1 Satz 1 und 3 BGB nachlesen und die gute Frage anschließen, ob man hier durchgreifend mehr erfährt, als man schon angesichts § 106 Satz 1 GewO gewusst hat. Wegen der letztzitierten Vorschrift ist hinzuzusetzen, dass die §§ 105 bis 110 GewO gemäß § 6 Abs. 2 GewO auf alle Arbeitnehmer anzuwenden sind, also nicht nur auf diejenigen, die man früher „gewerbliche Arbeitnehmer“ zu nennen pflegte.
Der Arbeitnehmer arbeitet nach § 611a Abs. 1 Satz 1 BGB auf der Grundlage eines Arbeitsvertrags (2020-05-27, 5 AZR 247/19). Ein solcher Vertrag enthält die Verpflichtung des Arbeitnehmers zur Leistung „weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit“. Geht er die Verpflichtung ein, hat er sich zum Arbeitnehmer gemacht; ohne Tautologie geht es auch hier nicht. Einen Erfolg schuldet der Arbeitnehmer nicht, sondern „Dienste“, wie § 611 Abs. 1 BGB zu entnehmen ist. Würde er einen Erfolg schulden, wäre man im Werkvertragsrecht, nämlich in § 631 Abs. 2 BGB (2013-09-25, 10 AZR 282/12). Dort ist die Rede davon, dass ein Erfolg „durch Arbeit oder Dienstleistung“ herbeizuführen sein kann. Das zeigt, dass die Unterscheidung zwischen § 611 BGB einerseits und § 631 BGB andererseits einige Aufmerksamkeit verlangt bei der praktischen Rechtsprüfung oder je nach Komplexität der Fallgestaltung zumindest verlangen könnte.
Von ungebrochen hoher Bedeutung ist das, was das BAG schon seit langer Zeit praktiziert hatte und was heute in § 611a Abs. 1 Satz 6 BGB steht: „Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an.“
Die gesetzliche Terminologie springt ohne Erläuterung vom „Arbeitsvertrag“ zum „Vertragsverhältnis“ und „Arbeitsverhältnis“. Letzteres ist ein spezielles Vertragsverhältnis. Es ist dasjenige Dauerschuldverhältnis, das durch den Arbeitsvertrag entsteht. Ein Dauerschuldverhältnis lässt während seiner Laufzeit ständig neue Leistungs-, Neben- und Schutzpflichten entstehen. So unterscheidet es sich vom einmaligen vertraglichen Leistungsaustausch, den man etwa beim Kaufvertrag vorfindet.
§ 611a Abs. 1 Satz 6 BGB setzt sich über den Wortlaut von Verträgen glatt hinweg. Die Vertragsparteien können hinschreiben, was sie wollen: Zeigt ihr tatsächlicher Umgang miteinander, dass die eine Vertragspartei weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit für die andere leistet, ist die sie verbindende Rechtsbeziehung ein Arbeitsverhältnis.
§ 611a Abs. 1 Satz 6 BGB ist eine Schutzbestimmung, die dem Arbeitsrecht Vertragsverhältnisse zuweist, die zu ihm passen. Man darf nicht vergessen, dass es hier nicht nur um eine privatrechtsdogmatische Einordnung mit vielfältigen arbeitsrechtlichen Folgerungen geht, sondern auch um Sozialrecht. Mit dem Arbeitsverhältnis verknüpft sind mindestens die Kranken- und die Arbeitslosenversicherung sowie die Pflicht des Arbeitgebers zur Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit und zur Abführung der Lohnsteuer. Nicht nur Arbeitnehmer, sondern eben auch der Staat in einigen seiner Erscheinungsformen haben ein durchgreifendes Interesse daran, dass das Arbeitsrecht und seine Konsequenzen wenigstens dort zum Zuge kommen, wo sich das aus den Tatsachen eigentlich ohnehin ergeben würde. Entschließt sich der Arbeitgeber, sein vertraglich bestehendes Weisungsrecht nicht auszuüben, ist das demnach belanglos (2007-01-25, 5 AZB 49/06). Der Anordnungsgehalt von § 611a Abs. 1 Satz 6 BGB, den es zur Zeit dieser BAG-Entscheidung noch nicht einmal gab, lässt sich nicht umdrehen; niemand wäre in einer solchen Konstellation schutzbedürftig. Zu berücksichtigen ist auch, dass an die Adresse wirklicher leitender Angestellter im Sinne von § 5 Abs. 3 BetrVG die Erteilung von Weisungen eher die Ausnahme ist. Die arbeitsrechtliche Realität hat das BAG mithin getroffen.
Dies gilt auch für 2001-12-12, 5 AZR 253/00: Trotz der Erteilung von „Anweisungen“ (das BAG benutzt diesen Ausdruck zweifellos bewusst, um sich von „Weisungen“ abzusetzen) liegt kein Arbeitsverhältnis vor, wenn der Verpflichtete seine Leistungen nicht allein erbringen kann und sie entgegen der Grundregel von § 613 Satz 1 BGB durch Hilfskräfte erbringen lassen darf. Auch bei einem Dienstverhältnis also, das kein Arbeitsverhältnis ist (so der Eingangswortlaut von § 621 BGB), muss der Dienstberechtigte schließlich ausdrücken dürfen, was er von dem Dienstverpflichteten erwartet. – Zweifel darf man hingegen anmelden gegenüber der „Crowdworker“-Entscheidung 2020-12-01, 9 AZR 102/20, der zufolge ein Arbeitsverhältnis selbst dann gegeben sein kann, wenn keine primäre Pflicht zum Tätigwerden besteht, wenn also im Grunde genommen gar kein Dienstverpflichteter vorhanden ist, zumindest keiner aufgrund Dauerschuldverhältnisses.
Vorsichtshalber ist noch anzufügen, dass es arbeitsrechtliche Vorschriften mit eigenem Arbeitnehmerbegriff gibt, wie zum Beispiel § 5 ArbGG oder § 5 Abs. 2 Nr. 1 EntgTranspG. Darauf ist ebenso zu achten wie auf etwaige unionsrechtliche Einflüsse (2019-01-21, 9 AZB 23/18; 2020-06-25, 8 AZR 145/19).
§ 5 Abs. 1 Satz 1 ArbGG unterscheidet die Arbeitnehmer noch in Arbeiter und Angestellte. Auch in § 622 Abs. 1 BGB scheinen diese Begriffe noch auf. Doch zeigt der dort folgende, eine sogenannte Legaldefinition erzeugende Klammerzusatz „(Arbeitnehmer)”, dass sich die Arbeitnehmer nach der derzeitigen Auffassung des BGB-Gesetzgebers durch Arbeiter und Angestellte definieren. Ähnlich verfährt § 5 Abs. 1 Satz 1 BetrVG. – „Arbeiter werden durch ihre körperliche, „Angestellte“ durch ihre geistige Tätigkeit charakterisiert. Danach richtete sich ihre jeweilige Sozialversicherung; das war der springende Punkt. Mittlerweile wird hier keine Aufmerksamkeit mehr verlangt.
„Leitende Angestellte“ werden innerhalb der passenden Verknüpfungen besprochen. Da dieser Personenkreis im Wesentlichen „geistig“ zu arbeiten pflegt, ist die Ausgangsbezeichnung „Angestellte“ zwar richtig. Aber es hätte genügt, sie nur mit dem substantivierten Partizip „Leitende“ zu belegen (so verfährt die Betriebspraxis ohnehin), denn hierin steckt ihre – deutliche und doch oft verkannte – rechtliche Problematik, nicht darin, dass sie Angestellte sind.
ARBEITNEHMERÄHNLICHE PERSONEN
Vorschriften (etwa § 5 Abs. 1 Satz 2 ArbGG und § 12a TVG) sprechen gelegentlich von arbeitnehmerähnlichen Personen; deshalb muss das Thema hier des Zusammenhangs wegen erwähnt werden. Gemeint sind Personen, die persönlich unabhängig sind, jedoch wirtschaftlich abhängig und damit ähnlich schutzbedürftig (2019-01-21, 9 AZB 23/18) wie typischerweise Arbeitnehmer. Es geht hier in Wahrheit um nichts anderes als den soeben schon erwähnten eigenen Arbeitnehmerbegriff der einen oder anderen arbeitsrechtlichen Norm. Diese sagen jeweils selbst, welche Personen sie erfassen wollen. Zu diesem Zweck umschreiben sie, wo nach Ansicht des Gesetzgebers erforderlich, auch selbst, wer arbeitnehmerähnliche Personen sind, weshalb sie sich aber genau das hätten sparen können. Denn ihr Anwendungsbereich ergibt sich mithin nicht aus dem Wort, sondern aus seiner Erläuterung. Arbeitnehmerähnliche Personen sind demnach auch die in § 1 HAG erwähnten, obwohl dort der folglich überflüssige Ausdruck erst gar nicht benutzt wird. Das BAG sieht das aber anders; ihm zufolge hat man es mit einem unbestimmten, also durchaus anwendbaren Rechtsbegriff zu tun (2019-01-21, 9 AZB 23/18).
ARBEITGEBER
Es liegt nahe zu behaupten, dass der Begriff des Arbeitgebers über den des Arbeitnehmers definiert wird. Inhaltlich nichts anderes wird ausgesagt, wenn man sich auf den Hinweis beschränkt, der Arbeitgeber sei der Vertragspartner des Arbeitnehmers. Viel wird damit nicht kundgetan; denn das Umgekehrte würde in gleicher Weise zutreffen. Es ist einfacher zu sagen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber die beiden Parteien des Arbeitsvertrags sind. Das erspart zwar nicht die Tautologie, aber dem Arbeitgeber-Phänomen die gerade unter sozialem, soziologischem und geschichtlichem Aspekt völlig verfehlte Behauptung einer Abhängigkeit von dem des Arbeitnehmers.
Aus der handelsrechtlichen Terminologie sind vielleicht noch der konkrete und der abstrakte Prinzipal bekannt. „Konkret“ ist der Arbeitgeber als natürliche Person, „abstrakt“ als juristische Person oder Personengesamtheit (BGB-Gesellschaft, oHG, KG). In jedweder Gestaltung ist Arbeitgeber derjenige, der den Arbeitsvertrag mit dem Arbeitnehmer geschlossen hat. Von selbst versteht es sich, dass der abstrakte Prinzipal natürlicher Personen bedarf, um gegenüber Arbeitnehmern zu agieren, insbesondere ihnen Weisungen zu erteilen. Diese sind aber nicht auch ihrerseits Arbeitgeber.
Man begegnet allerdings gelegentlich einer arbeitsrechtlichen Hypertrophierung dieser eigentlich recht einfachen Unterscheidung. Selbst das BAG ist davon nicht frei. Sein Diktum „Der persönlich haftende Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft ist Arbeitgeber der Arbeitnehmer der Kommanditgesellschaft im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 3 ArbGG“ (2006-02-28, 5 AS 19/05) irritiert erheblich, auch wenn es sich auf beliebig viele frühere Entscheidungen und eine herrschende Literaturmeinung stützt. Gern einzuräumen ist, dass der einschränkende Zusatz „im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 3 ArbGG“ eine dogmatische Zuspitzung vermeidet. Gleichwohl: Auch wenn § 3 ArbGG von seiner Idee her eher nicht passt (was eine Analogie aber auch nicht durchgreifend verhindern würde), hätte man doch kein Problem damit zu sagen, dass der KG-Komplementär vor dem Arbeitsgericht persönlich auf Arbeitsvergütung in Anspruch genommen werden kann. Man mag den Text von § 2 Abs. 1 Nr. 3 ArbGG nach Sinn und Zweck (erweiternd) auslegen oder ihn als lückenhaft und mithin als ausfüllungsbedürftig bezeichnen. Oder man dürfte darauf hinweisen, dass der Komplementär gesellschaftsrechtlich haftet, und eben nicht arbeitsrechtlich schuldet, und dass dann, wenn er verklagt wird, die Klage sich gesellschaftsrechtlich betrachtet immer noch gegen den Arbeitgeber richtet, sodass § 2 Abs. 1 Nr. 3 ArbGG glatt erfüllt wäre. Alles ist besser, als den Komplementär selbst als Arbeitgeber zu bezeichnen, was er nun einmal nicht ist. – Dafür darf auch die Entscheidung 1929-01-19, RAG. 473/28, angeführt werden, die entgegen dem BAG eben nicht für seine Position spricht. – Richtig ist auch die BGH-Entscheidung 1981-01-29, II ZR 92/80. Hier die Feststellung des BGH zu beanstanden, dass GmbH-Geschäftsführer Arbeitgeberfunktionen ausüben, befremdet sowohl gesellschaftsals auch arbeitsrechtlich: Eine GmbH ist juristische Person und mithin handlungsunfähig; sie handelt mittels des Geschäftsführers; es geht gar nicht anders. Soweit das Gesellschaftsrecht. Arbeitsrechtlich (siehe schon oben) bedient sich der abstrakte Prinzipal natürlicher Personen in der Beziehung zu seinen Arbeitnehmern. Der BGH verhält sich zu beiden Rechtsgebieten vollkommen konsequent.
Ob das „Gesetz über die Schaffung eines besonderen Arbeitgebers für Hafenarbeiter (Gesamthafenbetrieb)” hier wirklich als besondere Gestaltung angeführt werden sollte, wie das doch oft geschieht, darf man sich fragen. Nach diesem Gesetz sind reale Arbeitsverhältnisse zwischen unständigen Hafenarbeitern und dem Gesamthafenbetrieb gewollt, weil er nämlich diesem Zweck seine gesetzlich vermittelte Existenz schuldet. Der Gesamthafenbetrieb ist Arbeitgeber, wie auch der Verleiher nach dem AÜG Arbeitgeber ist. Was hier und nach § 4 Abs. 2 TVG durch vielfältige „gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien” unter dem Stichwort „Ausgliederung von Arbeitgeberfunktionen” geschieht, ändert nichts daran, dass Arbeitgeber existieren und identifizierbar bleiben.
Rechtsquellenlehre
EINGANGSÜBERLEGUNG
Die Rechtsquellenlehre im Arbeitsrecht wurde (und wird vielleicht immer noch) gern anhand einer Normenpyramide veranschaulicht, innerhalb deren die jeweils höhere Stufe allen folgenden vorgehen soll. Wenn man Art. 31 GG („Bundesrecht bricht Landesrecht“) liest, hat man eine Vorstellung von dem System, das man sich als in der Normenpyramide ausgedrückt vorstellt. Zunächst liegt die Frage nahe, ob insoweit für das Arbeitsrecht wirklich etwas Besonderes gilt oder doch nur das, was in jedem Rechtsgebiet Standard ist. Man darf jedoch bestätigen, dass das Arbeitsrecht aus der vertrauten Betrachtung fällt. Auf letzter Stufe findet man hier nämlich das Direktionsrecht des Arbeitgebers; das gibt es zwangsläufig nirgends sonst im Privatrecht. Im strengen Sinne trifft man hier zwar nicht auf „Normen“, aber aus Sicht von Arbeitnehmern wäre das nur ein Streit um Worte: Es sind gerade die aus dem arbeitsrechtlichen Direktionsrecht sich entwickelnden Weisungen, die den Tagesablauf von Arbeitnehmern weit intensiver und auch unangenehmer gestalten (können) als jedwedes Gesetz. Und irgendwo im unteren Drittel der Pyramide sind Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung angesiedelt. Sie enthalten, soweit sie sich auf Arbeitnehmer beziehen, echte Normen, wie das in § 4 Abs. 1 Satz 1 TVG und § 77 Abs. 4 Satz 1 BetrVG zu lesen ist. Auch diese beiden Normarten gibt es nur im Arbeitsrecht. Die Idee von der Normenpyramide liegt also gewiss nicht neben der Realität.
Unvollkommen ist das Modell gleichwohl. Am Beispiel des leitenden Angestellten sei das veranschaulicht. Kommt ein Arbeitsvertrag zustande, der einen Arbeitnehmer zum leitenden Angestellten macht, gilt für ihn das BetrVG nicht, so § 5 Abs. 3 Satz 1 BetrVG. Wenn er also wirklich leitender Angestellter im Sinne von § 5 Abs. 3 Satz 2 BetrVG ist, was nach der BAG-Rechtsprechung eher selten zutrifft (wenigstens auch nicht entfernt so oft, wie es im Betriebsleben geglaubt wird), dann haben die Parteien des Arbeitsvertrags das BetrVG zugunsten und zulasten dieses Arbeitnehmers ausgeschaltet. Zwar ist das so, weil es in § 5 Abs. 3 Satz 1 BetrVG steht, demnach von Gesetzes wegen. Aber aktualisiert wird die Vorschrift durch privaten Vertrag. Nur weil die Parteien es wollen, findet das BetrVG keine Anwendung. Und man darf sicher sein, dass die Parteien jedenfalls dieses Thema nicht übersehen haben.
Ein anderes Beispiel: Ein Arbeitsverhältnis fällt unter einen bestimmten Entgelt-Tarifvertrag. Der das Arbeitsverhältnis begründende Arbeitsvertrag sieht aber ein Entgelt vor, das über dem Tarifentgelt liegt. Der Tarifvertrag scheint also nicht zum Zuge zu kommen. Dieser erste Eindruck täuscht. Denn der Tarifvertrag sichert dem Arbeitnehmer immer noch das Tarifentgelt als Mindestentgelt. Auch über eine Änderungskündigung (der das BAG bei Entgeltfragen ohnehin deutlich zurückhaltend begegnet) kann der Arbeitgeber dieses Mindestentgelt nicht unterschreiten.
Man wird sich also merken, dass jede auf ein Arbeitsverhältnis bezogene, wegen welcher Konfliktlage auch immer nötige Rechtsprüfung beim Arbeitsvertrag beginnt. Nach Erledigung dieser Aufgabe sieht man die Normenpyramide in der ganz anschaulichen Form vor sich, wie sie noch Bedeutung hat für dieses Arbeitsverhältnis. § 105 GewO gibt eine Idee davon. Und man hat nun auch das Bild vor sich, in dem als unterste Pyramidenstufe eine unbegrenzte Vielzahl von Arbeitgeberweisungen eine sich mehr und mehr verjüngende Menge anderer Rechtsquellen trägt. Es versteht sich, dass man es mit einem hermeneutischen Zirkel zu tun bekommt, einem ständigen Hinauf- und Hinunterblicken zwischen dem Arbeitsvertrag und den Normen, die auf ihn und das durch ihn konstituierte Arbeitsverhältnis einwirken „wollen“. BAG-Entscheidungen beleuchten oft hervorragend, wie sich mit Hilfe des hermeneutischen Zirkels sinnvolle Ergebnisse einstellen vor dem Hintergrund, dass es kein Arbeitsgesetzbuch gibt, entgegen Art. 30 Abs. 1 Nr. 1 EinigVtr nicht einmal ein Arbeitsvertragsgesetzbuch. Im Übrigen hatte schon Art. 157 Abs. 2 WRV eine arbeitsrechtliche Kodifikation in Aussicht gestellt; so ist der Wortlaut „Das Reich schafft ein einheitliches Arbeitsrecht“ zu verstehen.
Die im Folgenden unter „Rechtsquellenlehre“ behandelten Themen werden später unter anderen Gesichtspunkten erneut Gegenstand von Ausführungen sein. Zur Rechtsquellenlehre werden gern auch der Gleichbehandlungsgrundsatz und die Betriebliche Übung geschlagen. Hier erscheinen sie unter der Überschrift „Allgemeines Arbeitsrecht“.
ARBEITSVERTRAG
Der Arbeitsvertrag wird in § 611a BGB, § 105 Satz 1 GewO als Konkretisierung von § 311 Abs. 1 BGB beschrieben. Je übersichtlicher er ist, desto gewisser ist es, dass er selbst nur die Anpassung eines bestimmten Falls an einen durch Tarifvertrag ohnehin bereits definierten Leistungsaustausch darstellt. In solchen Konstellationen pflegen jedenfalls die Vertragstätigkeit mit entgeltrelevantem Kurzwort und der Grundbetrag der Vergütung genannt und die tarifliche Einstufung angegeben zu werden. Das geschieht aber eher zur Vermeidung von Missverständnissen. Denn durch § 611a Abs. 2 BGB („Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.“) oder durch § 611 Abs. 1 BGB („… der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.“) wird eine solche Notwendigkeit nicht begründet: Auch wenn der Arbeitsvertrag insoweit schweigt, ist „vereinbarte Vergütung“ über § 4 Abs. 1 Satz 1 TVG das Tarifentgelt. Ein Papier, das sich auch zur Vergütung äußert, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer aber nach § 2 Abs. 1 Satz 1 NachwG aushändigen (dort Satz 2 Nr. 6). Mit dem Zustandekommen des Arbeitsvertrags hat diese „Niederschrift“ aber nichts zu tun. Anderenfalls würde es entgegen § 2 Abs. 1 Satz 1 NachwG nicht genügen, dass sie erst „spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses“ übergeben zu werden braucht. Doch dürfte das NachwG praktisch hohen Einfluss auf Umfang und Inhalt des Arbeitsvertrags haben. Denn nach § 2 Abs. 4 NachwG erübrigt sich die Übergabe der Niederschrift, wenn dem Arbeitnehmer ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt worden ist, der die vom NachwG verlangten Angaben enthält. Da mag es je nach Organisation des jeweiligen Personalwesens einfacher sein, gleich Arbeitsverträge auszufertigen, in denen auch das NachwG abgearbeitet ist. Zu zahlen ist das Arbeitsentgelt nach § 107 GewO und abzurechnen im Rahmen dessen, was § 108 GewO vorschreibt. Immerhin lernt man aus § 2 Abs. 4 NachwG, dass der Arbeitsvertrag als solcher keinem gesetzlichen Schriftformzwang unterliegt, § 125 Satz 1 BGB also hier nicht zugreift. Heutzutage werden schriftlose Arbeitsverträge die Ausnahme sein, jedenfalls wo es nicht darum geht, das Bestehen von Arbeitsverhältnissen gegebenenfalls leicht abstreiten oder die Beweislage hinsichtlich der getroffenen Absprachen verdunkeln zu können – vor allem zulasten der Sozialversicherung. Aber während der Vollbeschäftigung in den Fünfzigerjahren war Mündlichkeit bei Arbeitern doch eher die Regel; aus dem „Lohnstreifen“ ergab sich alles Wissenswerte.
DIREKTIONSRECHT DES ARBEITGEBERS
Der Wortlaut des Arbeitsvertrags und auf ihn gestützte Weisungen des Arbeitgebers strukturieren die Durchführung des Arbeitsverhältnisses. Je weniger Text ein Arbeitsvertrag enthält, desto weiter reicht das Direktionsrecht des Arbeitgebers, zumindest nach typischer Arbeitgeber-Vorstellung. § 106 GewO und § 611a Abs. 1 Satz 2 BGB äußern sich zum Direktionsrecht, wie bereits mehrfach erwähnt. § 106 Satz 1 GewO ergänzt die BGB-Vorschrift aber in bedeutsamer Weise. Dort steht nämlich „soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind“. Das zeigt, dass auch mit Bezug auf das Direktionsrecht ein hermeneutischer Zirkel am Werk ist, dass also der Arbeitgeber hier nicht alle Freiheit hat, die er sich vielleicht zubilligen möchte.
Eine weitere Einschränkung tritt hinzu: Sein Direktionsrecht darf er nämlich nur „nach billigem Ermessen“ ausüben, mithin unter der Ägide von § 315 BGB. Dort ist vor allem Abs. 3 Satz 1 zu beachten: Entspricht eine erteilte Weisung nicht der Billigkeit, ist sie für den Arbeitnehmer nicht verbindlich. Darum wurde im Arbeitsrecht heftig gestritten: Es könne doch nicht sein, dass ein Arbeitnehmer die Ausführung einer Weisung ablehne mit dem Hinweis darauf, dass der Arbeitgeber eine andere Weisung habe erteilen müssen oder aber gar keine Weisung habe geben dürfen. Er möge sein Recht vor Gericht suchen; aber zunächst einmal solle er tun, was der Arbeitgeber von ihm verlangt habe – durchaus gut verständlich im Hinblick auf betriebliche Abläufe. Das BAG ist indes nicht einverstanden und setzt den Wortlaut von § 315 Abs. 3 Satz 1 BGB durch (2017-10-18, 10 AZR 330/16), im Übrigen nicht den des dortigen Satzes 2: Es ist klar, dass es der Arbeitsgerichtsbarkeit das dortige Ersatzbestimmungsrecht nicht zubilligt. Zum Thema drückt es sich schon im dortigen Leitsatz recht deutlich aus: „Ein Arbeitnehmer ist nach § 106 Satz 1 GewO, § 315 BGB nicht – auch nicht vorläufig – an eine Weisung des Arbeitgebers gebunden, die die Grenzen billigen Ermessens nicht wahrt (unbillige Weisung).“ Also: „auch nicht vorläufig“.
Es liegt nahe, dass ein Arbeitnehmer, der sich auf einen solchen konfliktträchtigen Standpunkt begibt, wegen Fehleinschätzung der Rechtslage das Risiko von Sanktionen auf sich nimmt. Diese – Abmahnungen und Kündigungen – sind aber ihrerseits rechtlicher Überprüfung zugänglich. Das weiß natürlich auch der Arbeitgeber. Man wundert sich aber doch, dass selbst ein großer Arbeitgeber wie der in dem hier vorgetragenen Fall nicht fähig war, wenigstens aus Vorsicht die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Der BAG-Hinweis in 2017-10-18, 10 AZR 330/16 auf die Rechtslage nach dem SeeArbG mag durchaus interessieren, auch wenn sie arg speziell ist: Nach § 32 Satz 2 SeeArbG hat das Besatzungsmitglied „den Anordnungen der zuständigen Vorgesetzten Folge zu leisten“. Dies ist die heuervertragliche Folgepflicht. Aber der Gesetzgeber hat angesichts der Besonderheiten der Seefahrt noch ein Übriges getan; und eben das gibt es im Bereich der hier erörterten Vorschriften nicht: Nach § 124 Abs. 1 Satz 1 SeeArbG besteht die öffentlich-rechtliche Pflicht der Besatzungsmitglieder, vollziehbare Anordnungen der Vorgesetzten unverzüglich zu befolgen, insbesondere (Satz 2) zur Gefahrenabwehr. Dieser Gesetzeslage durfte das BAG das seine Auffassung unterstützende Argument entnehmen, dass regulär eine unbillige Weisung „auch nicht vorläufig“ befolgt zu werden braucht.
Eine Abwandlung der vertraglichen Tätigkeit durch Erteilung von Weisungen gesteht das BAG selbst dann nicht zu, wenn das Entgelt unverändert gezahlt wird (2018-10-24, 10 AZR 19/18). Klar ist, dass diese Rechtsprechung desto größere Bedeutung hat, je detaillierter der Arbeitsvertrag die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung des Arbeitnehmers umschreibt.
TARIFVERTRAG
An dieser Stelle interessiert nur, dass Tarifverträge einen normativen Teil enthalten können und in der Tat auch meistens haben, wenn sie nämlich Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern regeln. Dieser normative Teil ist in dem schon erwähnten § 4 Abs. 1 Satz 1 TVG angesprochen. Hier steht das, was die Arbeitnehmer naturgemäß am meisten interessiert, nämlich was sie verdienen, und umgekehrt: was der Arbeitgeber zu zahlen hat. Der Phantasie tarifvertraglicher Gestaltung sind allerdings nur wenige Grenzen gesetzt. Alles (zum Beispiel auch Urlaubsfragen) kann aufgenommen werden, was nicht gegen höherrangiges Recht verstößt (denn auch der Tarifvertrag ist Teil der Normenpyramide) sowie Inhalt, Abschluss oder Beendigung von Arbeitsverhältnissen betrifft. Eine Bindung daran besteht nach Abs. 3 nicht, wenn der Tarifvertrag Abweichungen zulässt oder wenn solche Abweichungen zugunsten von Arbeitnehmern wirken. Arbeitsverträge können also ohne Weiteres übertarifliche Leistungen vorsehen. Sie tun das oft, aber dann eher nicht, wenn in einer Branche die Fluktuation von Arbeitnehmern von der Arbeitgeberseite nicht als Last empfunden wird. Dann soll das Entgelt weder den Arbeitgeberwechsel hemmen noch einen Anreiz dazu darstellen, und es verbleibt beim Inhalt des Tarifvertrags als erlaubtem Konditionenkartell. Wo man mehr auf das eine (übertarifliche Leistungen) und mehr auf das andere (nur Tarifleistungen) Phänomen trifft, ändert sich entsprechend den Gegebenheiten des Arbeitsmarkts. Herrscht Arbeitnehmermangel, werden Arbeitgeber übertarifliche Leistungen anbieten, wenn sie ihre Stellen besetzen wollen.
Die tarifvertragliche Bindung beschränkt sich nach Abs. 1 Satz 1 auf die „beiderseits Tarifgebundenen“, also nach § 3 Abs. 1 TVG auf die Mitglieder der Tarifvertragsparteien und diejenigen Arbeitgeber, die selbst einen Tarifvertrag abgeschlossen haben. Tarifvertragsparteien sind nach § 2 Abs. 1 TVG „Gewerkschaften, einzelne Arbeitgeber sowie Vereinigungen von Arbeitgebern“. Arbeitgeber, die gemäß ihrer eigenen Tarifbindung tarifliche Leistungen zu erbringen haben, fragen oft nicht nach der Tarifbindung ihrer Arbeitnehmer, sondern richten sich im Verhältnis zu allen Arbeitnehmern nach dem Tarifvertrag. Das vereinfacht die Abrechnung und sorgt für Betriebsfrieden. Die Gewerkschaften wissen nie so recht, ob sie das eigentlich gern sehen sollten. Doch können sie auf einer solchen Basis immer ganze Belegschaften unterschiedslos ansprechen und auf ihre Verdienste hinweisen, dies auch in der Hoffnung, weitere Mitglieder zu werben.
Tarifverträge werden von der Inhaltskontrolle nach §§ 305ff BGB nicht erfasst, so § 310 Abs. 4 Satz 1 BGB.
Im Arbeitsleben gern übersehen wird § 4 Abs. 4 Satz 1 TVG: „Ein Verzicht auf entstandene tarifliche Rechte ist nur in einem von den Tarifvertragsparteien gebilligten Vergleich zulässig.“ Der Tarifvertrag setzt sich also immer durch, es sei denn, die Parteien, die ihn abgeschlossen haben, sind mit einem Verzicht (per definitionem:) ausnahmsweise einverstanden. Um „entstandene tarifliche Rechte“ kann es sicherlich nur dann gehen, wenn beiderseits Tarifgebundene einen Verzicht vereinbaren wollen, also nicht, wenn nur kraft Arbeitsvertrags Tarifleistungen erbracht werden (zu achten ist aber auch dann auf 2016-12-15, 6 AZR 478/15). „Verzicht“ ist jedwede Abrede, in der ein Arbeitnehmer eine wirtschaftliche, aus einem Tarifvertrag entspringende Position aufgibt, ohne Rücksicht darauf, ob das Wort „Verzicht“ benutzt wird. „Vergleich“ ist der in arbeitsrechtlichen Zusammenhängen eher seltene materiell-rechtliche Vergleich nach § 779 BGB, aber eben auch der hochrelevante Prozessvergleich, wie er oft schon in der Güteverhandlung zustande kommt (§ 54 Abs. 3 ArbGG). In der Prozesspraxis hilft man sich gern über § 4 Abs. 4 Satz 1 TVG hinweg, und zwar mit der schwachen Ausrede, Vergleiche über die Tatsachengrundlagen von entstandenen tariflichen Rechten





























