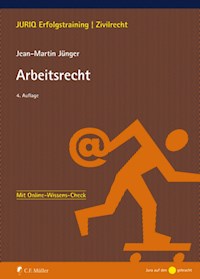
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Schwerpunkte Pflichtfach
- Sprache: Deutsch
Der Inhalt: Das Skript stellt die für das erste Staatsexamen in der Pflichtfachprüfung relevanten Bereiche des Arbeitsrechts dar und gliedert sich in vier Hauptabschnitte: Grundzüge des Arbeitsrechts, Individualarbeitsrecht (Begründung, Inhalt und Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Bestandsschutz; Leistungsstörungen und Haftung im Arbeitsverhältnis), Kollektivarbeitsrecht (Abschluss und Wirkung von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen) und dem Verfahren vor dem Arbeitsgericht (Zuständigkeit, Urteilsverfahren, insb. Kündigungsschutzklage und Beschlussverfahren). Die Konzeption: Die Skripten "JURIQ-Erfolgstraining" sind speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten und bieten ein umfassendes "Trainingspaket" zur Prüfungsvorbereitung: Die Lerninhalte sind absolut klausurorientiert aufbereitet; begleitende Hinweise von erfahrenen Repetitoren erleichtern das Verständnis und bieten wertvolle Klausurtipps; im Text integrierte Wiederholungs- und Übungselemente (Online-Wissens-Check und Übungsfälle mit Lösung im Gutachtenstil) gewährleisten den Lernerfolg; Illustrationen schwieriger Sachverhalte dienen als "Lernanker" und erleichtern den Lernprozess; Tipps vom Lerncoach helfen beim Optimieren des eigenen Lernstils; ein modernes Farb-Layout schafft eine positive Lernatmosphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Arbeitsrecht
von
Rechtsanwalt Jean-Martin Jünger
4., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-9185-4
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.dewww.cfmueller-campus.de
© 2020 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-Training.
In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.
Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolgreich Ihre arbeitsrechtlichen Kenntnisse!
[Bild vergrößern]
Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfällen verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klausurtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Informieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation, Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Verbesserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.
Dieses Skript wurde 2020 auf den neuesten Stand gebracht. Es gab seit der Erstellung der 1. Auflage nur wenige ausbildungsrelevante Gesetzänderungen im Arbeitsrecht; diese wurden selbstverständlich eingepflegt. Weiterhin habe ich besonders viel Wert darauf gelegt, den Anregungen aus der Leserschaft und von Rezensenten nachzukommen. Daher wurden sehr viele Beispiele aus der Rechtsprechung in das Skript aufgenommen, bevorzugt natürlich die aktuellsten Urteile der höchstrichterlichen Ebene.
Auf gehtʼs – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!
Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: [email protected]. Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen. Oder Sie wenden sich direkt an den Verfasser unter [email protected].
Mannheim, im Februar 2020
Jean-Martin Jünger
JURIQ Erfolgstraining – die Skriptenreihe von C.F. Müllermit Online-Wissens-Check
Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
•
Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts.
•
Eine individuelle Lernfortschrittskontrolle zeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse.
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monaten zur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Unter den Ulmen 31, 50968 Köln zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: [email protected].
zurück zu Rn. 74, 257, 420, 556, 605
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. TeilGrundzüge des Arbeitsrechts
A.Zum Skript
B.Struktur des Arbeitsrechts
C.Rechtsquellen des Arbeitsrechts und ihre Rangfolge
I.Normenhierarchie
II.Quellen
1.Europarecht
2.Verfassungsrecht
3.Einfaches Recht
4.Sonstige Rechtsquellen
2. TeilIndividualarbeitsrecht
A.Grundbegriffe
I.Arbeitsvertrag
II.Arbeitnehmer
1.Privatrechtlicher Vertrag
2.Vertrag nach §§ 611a Abs. 1 S. 1 BGB
3.Unselbstständigkeit der Dienstleistung
III.Arbeitnehmerähnliche Personen
IV.Scheinselbstständigkeit
V.Übungsfall Nr. 1
VI.Arbeitgeber
VII.Betrieb
1.Organisatorische Einheit
2.Verfolgung eines arbeitstechnischen Zwecks
VIII.Betriebsrat
1.Betriebsratsfähigkeit des Betriebs
2.Aufgaben des Betriebsrates
B.Die Anbahnung und Begründung eines Arbeitsverhältnisses
I.AGG-Schutz des Arbeitnehmers
1.Die Benachteiligung
2.Ausnahmsweise gerechtfertigte Benachteiligung
3.Rechtsfolgen
a)§ 15 AGG
b)Beweislastverteilung im Rahmen des § 15 AGG
c)Höhe des Schadensersatz- und Entschädigungsanspruchs
d)Entgelttransparenzgesetz
II.Der Arbeitsvertrag
1.Wirksamkeit des Arbeitsvertrags
a)Beschränkte Geschäftsfähigkeit
b)§§ 134, 138 Abs. 1 BGB
2.Die Anfechtung des Arbeitsvertrages
a)Anfechtung wegen arglistiger Täuschung
b)Eigenschaftsirrtum
c)Fragenkatalog
3.Das fehlerhafte Arbeitsverhältnis
4.Übungsfall Nr. 2
5.Abwandlung zu Übungsfall Nr. 2
6.Die AGB-Kontrolle
a)Anwendung der AGB-Kontrolle auf Arbeitsverträge
b)Allgemeine Geschäftsbedingung
c)Wirksamer Einbezug der AGB in den Vertrag
d)Verdrängung durch vorrangige Individualabrede?
e)Keine überraschende Klausel im Sinne von § 305c Abs. 1 BGB
f)Auslegung
g)Die Inhaltskontrolle am Maßstab der §§ 307 Abs. 1 und 2, 308 und 309 BGB
h)Rechtsfolgen
7.Betriebliche Übung
8.Gesamtzusage
C.Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
I.Hauptleistungspflichten
1.Arbeitnehmer
2.Arbeitgeber
II.Nebenpflichten
1.Arbeitnehmer
2.Arbeitgeber
III.Leistungsstörungen im Arbeitsverhältnis
1.„Ohne Arbeit kein Lohn“
a)Verzug des Arbeitnehmers
b)Unbezahlte Freistellung von der Arbeitspflicht
2.„Lohn ohne Arbeit“
a)Mutterschaftsentgelt
b)Erholungsurlaub und gesetzliche Feiertage
c)Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit im Krankheitsfall
d)Unmöglichkeitsentgelt
e)Vorübergehende Verhinderung nach § 616 BGB
f)Annahmeverzug des Arbeitgebers
g)Freistellung bis zum Ende der Kündigungsfrist
h)Betriebsrisiko, § 615 S. 3 BGB
i)Übungsfall Nr. 3
j)Besonderheiten in der Haftung
k)Übungsfall Nr. 4
IV.Beendigung des Arbeitsverhältnisses
1.Allgemeines
2.Befristung
a)Sachgrundbefristung
b)Sachgrundlose Befristung
c)Formvorschrift
d)Ende des Arbeitsverhältnisses
3.Auflösende Bedingung
4.Aufhebungsvertrag
a)Zustandekommen des Aufhebungsvertrages
b)Form
c)Widerruf
V.Die Kündigung
1.Die Zulässigkeit einer Kündigungsschutzklage
2.Die Begründetheit einer Kündigungsschutzklage
a)Ordnungsgemäße Kündigungserklärung
b)Kein Ausschluss der ordentlichen Kündigung
c)Zustimmungsbedürftigkeit
d)Die Anhörung des Betriebsrates
e)Anzeigebedürftigkeit
f)Einhaltung der Klagefrist, §§ 4, 7 KSchG
g)Voraussetzungen nach dem Kündigungsschutzgesetz
h)Die außerordentliche Kündigung, § 626 BGB
i)Änderungskündigung
j)Verdachtskündigung
k)Druckkündigung
l)Kündigungsschutz im Kleinbetrieb
m)Der besondere Kündigungsschutz
3.Übungsfall Nr. 5
D.Der Betriebsübergang, § 613a BGB
I.Überblick
II.Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des § 613a BGB
1.Übergang eines Betriebs(-teils)
a)Betriebs(-teil)
b)Übergang
c)Auf einen anderen Inhaber
2.Vorliegen eines Rechtsgeschäfts
3.Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers
III.Unterrichtung über den Betriebsübergang
IV.Rechtsfolgen des Betriebsübergangs
1.Übergehen des Arbeitsverhältnisses
2.Haftung
3.Kündigungsverbot „wegen“ des Betriebsübergangs
3. TeilKollektivarbeitsrecht
A.Das Koalitionsrecht
I.Begriff der Koalition
II.Merkmale der Koalition
1.Zweckbestimmung
2.Freiwilligkeit und Dauerhaftigkeit
3.Gegnerunabhängigkeit
4.Sonstige Voraussetzungen
B.Tarifvertragsrecht
I.Tarifvertrag
II.Wirksames Zustandekommen eines Tarifvertrages
1.Einigung
2.Parteien des Tarifvertrags
a)Tariffähigkeit
b)Tarifzuständigkeit
3.Form
III.Aufgaben eines Tarifvertrags
IV.Bindung an den Tarifvertrag
1.Voraussetzungen der Tarifgebundenheit
2.Geltungsbereich
3.Allgemeinverbindlichkeit
4.Rechtsfolge der Bindung
C.Das Arbeitskampfrecht
I.Begriff
II.Streik
1.Rechtmäßigkeit des Streiks
2.Legitimes Ziel
3.Kein Verstoß gegen die Friedenspflicht
4.Organisation durch eine Gewerkschaft
5.Verhältnismäßigkeit
6.Rechtsfolgen
a)Rechtmäßiger Streik
b)Rechtswidriger Streik
c)Folgen für unbeteiligte Arbeitnehmer
III.Die Aussperrung
1.Rechtmäßigkeit
2.Rechtsfolgen
D.Das Betriebsverfassungsrecht
I.Grundsätzliche Prinzipien
II.Räumlicher Geltungsbereich
III.Sachlicher Geltungsbereich
IV.Persönlicher Geltungsbereich
V.Organe der Betriebsverfassung
VI.Der Betriebsrat
1.Rechtsstellung
2.Schutz des Betriebsrates
3.Rechte des Betriebsrats
a)Informationsrechte
b)Widerspruchsrechte
c)Anhörungsrechte
d)Beratungsrechte
e)Zustimmungsverweigerungsrechte
f)Zustimmungsrechte
4.Beteiligung in besonderen Angelegenheiten
a)Soziale Angelegenheiten, §§ 87 ff. BetrVG
b)Personelle Einzelmaßnahmen, §§ 99 ff. BetrVG
5.Betriebsvereinbarung/Regelungsabrede
a)Betriebsvereinbarung
b)Regelungsabrede
4. TeilDas Verfahren vor den Arbeitsgerichten
A.Aufbau
B.Zuständigkeit der Arbeitsgerichtsbarkeit
C.Verfahrensarten
I.Urteilsverfahren
1.Zulässigkeit einer Klage vor dem Arbeitsgericht
a)Sachliche Zuständigkeit
b)Örtliche Zuständigkeit
c)Parteifähigkeit
d)Prozessvertretung
e)Prozessfähigkeit und Prozessführungsbefugnis
2.Begründetheit der Kündigungsschutzklage
a)Die besondere Kündigungsschutzklage
b)Die allgemeine Feststellungsklage wegen eines Kündigungssachverhalts
c)Der kombinierte Feststellungsantrag
3.Feststellungsklage
4.Leistungsklage
5.Gestaltungsklage
II.Beschlussverfahren
1.Sachliche Zuständigkeit
2.Örtliche Zuständigkeit
3.Beteiligte
4.Prozessvertretung
5.Sonstige Besonderheiten
Sachverzeichnis
Literaturverzeichnis
Junker
Grundkurs Arbeitsrecht, 17. Aufl. 2018
Lieb/Jacobs
Arbeitsrecht, 9. Aufl. 2006
Michalski
Arbeitsrecht, 7. Aufl. 2008
Müller-Glöge/Preis/Schmidt (Hrsg.)
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 18. neu bearbeitete Auflage 2018 (zitiert: ErfK-Bearbeiter)
Thomas/Putzo (Hrsg.)
Kommentar zur Zivilprozessordnung, 38. Aufl. 2017 (zitiert: Bearbeiter in Thomas/Putzo)
Thüsing/Dütz
Arbeitsrecht, 23. neu bearbeitete Aufl. 2018
Staudinger (Hrsg.)
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch,Bearbeitung 2011 (zitiert: Staudinger-Bearbeiter)
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Wie lernen Menschen?
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 2Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen
In jedem Beruf ist der Arbeitsplatz ein sehr wichtiger Einflussfaktor auf unsere Leistung, natürlich auch während des Studiums. Günstige oder ungünstige Arbeitsbedingungen entscheiden mit darüber, wie wohl wir uns fühlen, ob wir uns gut konzentrieren können oder schnell ermüden. Vielleicht wird es jetzt etwas unbequem für Sie, weil Sie sich an bestimmte Grundregeln gewöhnen müssen, Ihren Schreibtisch aufräumen, Ihre Arbeitsplatzergonomie verändern. Alle Tipps und Hinweise werden Ihnen aber das Lernleben erleichtern.
Lerntipps
Arbeiten Sie immer an einem festen Arbeitsplatz!
Wenn Sie einmal am Schreibtisch, dann auf dem Sofa und später im Bett lernen, dann ist das zwar bequem und abwechslungsreich, nur es wird Ihnen schwer fallen, die richtigen Funktionen zu erkennen. Was ist Arbeit, was ist Freizeit, was lenkt mich ab etc.? Bei Pausen- und Freizeittätigkeiten wird der Schreibtisch verlassen. Dies sollten Sie konsequent auch beim Essen, Telefonieren mit Freunden, Musik hören, Computer spielen einhalten. Der Freizeitbereich wird dadurch für Sie attraktiver.
Machen Sie einen Arbeitsplatz-Check bevor Sie loslegen!
Der Schreibtisch ist nur für die Arbeit bestimmt. Überprüfen Sie Ihren Arbeitsplatz vor Arbeitsbeginn auf sachfremde Gegenstände – die können ablenken, Sie an Ihr Hobby erinnern. Sie möchten dann am liebsten das tun, was mehr Spaß macht und Sie von den vermeintlich unangenehmen Dingen abhält. Suchen Sie erst alle arbeitsrelevanten Unterlagen zusammen, damit Sie Ihre Arbeit nicht immer wieder unterbrechen. Sie fangen sonst die Arbeit stets wieder neu an. Das hört sich alles sehr diszipliniert an. Es verbessert aber Ihre Arbeitsmoral und damit gleichzeitig Ihren raren Freizeitausgleich.
Unterscheiden Sie konsequent Arbeit und Freizeit!
Der Freizeitbereich sollte so abgeschirmt sein, dass Sie dort nur die angenehmen, entspannenden und ausgleichenden Dinge tun – und das mit gutem Gewissen. Sie haben es sich ja mit Disziplin verdient. Auch hier bitte konsequent bleiben. Falls Ihnen z. B. ein Fachbuch in die Hände fällt, so sollten Sie es von dort entfernen. Entscheiden Sie sich bewusst – entweder weiter auf dem Sofa entspannen oder an den Schreibtisch gehen und es dort lesen. Ein Fachbuch im Bett zu lesen, führt nicht selten zu schlechterem Behalten oder sogar Schlafstörungen.
„Ergonomisieren“ Sie Schreibtisch und Schreibtischstuhl!
Richten Sie Ihre Büromöbel so ein, dass Sie gesundheitliche Schäden vermeiden und vorzeitige Ermüdungen verhindern. Dazu folgende Hinweise:
•
Arbeitsplatte ca. 75 cm hoch einstellen, so dass Unterarme im aufrechten Sitz locker aufliegen können.
•
Sitzhöhe so einstellen, dass bei aufgestellten Füßen, die Oberschenkel waagerecht ausgerichtet sind und ohne Druck aufliegen.
•
Wählen Sie einen Stuhl mit fester Rückenlehne, damit Sie sich häufig anlehnen können, das Gesäß weit nach hinten.
•
Licht von vorne oder seitlich, d. h. bei Rechtshändern von links.
•
Arbeitsmittel wie Schreibgeräte liegen für den direkten Zugriff bereit.
•
Gleiches gilt für Gesetzestexte, Lehrbücher und Nachschlagewerke.
•
Am besten in Reichweite eine Pin-Wand für Merkzettel mit Regeln, Terminen, Notizen.
Optimieren Sie auch den PC-Arbeitsplatz!
•
Monitor so aufstellen, dass sich weder Licht noch Fenster darin spiegeln.
•
Möglichst wenig Helligkeitsunterschiede zwischen Raumlicht und Monitorhelligkeit.
•
Höhe des Monitors: Mittelachse des Monitors knapp unter Augenhöhe des Betrachters.
•
Entfernung zwischen Monitor und Auge mindestens 30 cm, Schriftgröße auf 120 bis 150% anpassen
•
Brillenträger benötigen eventuell eine sog. „Computerbrille“, also eine Lesebrille für eine etwas größere Distanz.
Multimedia kann das Lernen beeinträchtigen!
PC oder Notebook sind aus Lernsituationen kaum wegzudenken und stellen eine große Hilfe dar. Bitte beachten Sie aber auch folgende Hinweise:
•
Aus (heruntergeladenen) Texten am Bildschirm zu lernen, ist ungünstig, da die jeweils vorherigen Seiten und die folgenden nicht sichtbar sind. Damit fehlt uns eine Gesamtorientierung zum Beispiel zum schnellen Vor- und Zurückblättern wie in einem Skript oder Buch.
•
Wenn z. B. bei einer Lernsoftware stets neue Seiten aufgerufen werden, dann ist das zwar interessant und animierend, das Kurzzeitgedächtnis wird aber zu stark beansprucht. Uns fehlt die manchmal zwar langweilige, aber lerntechnisch wichtige Redundanz der Inhalte.
•
Die Augenermüdung am Bildschirm ist insgesamt größer als beim Buchlesen, deshalb sind spezielle sehr einfache Augenentspannungsübungen (z. B. mit Akupressur) sinnvoll.
•
Viele nutzen den PC dazu, um sich in einer Pause abzulenken oder sich zu belohnen. Problematisch ist, dass sich das frisch gelernte Material noch im Kurzzeitspeicher des Gehirns befindet und noch nicht verankert ist. Für ein PC-Spiel wird jetzt dort sehr viel Arbeitspeicher in Anspruch genommen und das „alte“ Lernmaterial rausgeworfen. Schade, oder? Aber etwa 30 Minuten nach der Lerneinheit geht es wieder, die Lerndaten sind dann auf der „Lernfestplatte gespeichert“.
•
Auch Hintergrundmusik belegt den Arbeitsspeicher. Werden unterschiedliche Sinneskanäle bedient, konkurrieren sie miteinander. Lesen erfolgt zum Beispiel über inneres Mitsprechen und Musik hindert an diesem Mitsprechen.
•
Also schalten Sie ab, auch wenn Musik angenehme Emotionen auslöst und grundsätzlich motivierend und lernförderlich wirken kann. Am besten hören Sie Musik in Ihrer Erholungspause.
Die Bibliothek: Eine weitere Möglichkeit zwischen Arbeit und Freizeit zu differenzieren!
Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn der Wohnbereich beengt ist und eine Differenzierung durch verschiedene Räume schwer möglich ist. Denken Sie daran, dass das Lernen nicht auf Ihren Wohnbereich beschränkt sein muss. In einem Lesesaal oder einer Bibliothek lässt es sich vielleicht sogar besser lernen, wenn man dazu neigt, sich von der Arbeit abzulenken – hier herrscht eher „Arbeitsatmosphäre“.
Auch in der Bibliothek abschirmen!
Die Universitätsbibliothek verfügt meist über stille Arbeitsbereiche, Sie können auch in öffentliche Bibliotheken gehen. Meist sind dort auch Getränkeautomaten, Kopierer etc. vorhanden. Falls Sie viele Freunde und Bekannte haben, sollten Sie die Institutsbibliothek vielleicht meiden. Ein Schwätzchen ist gut, zu viel Ablenkung addiert sich aber schnell zu einem Nachmittag ohne Lernen – und das kann frustrieren. Suchen Sie sich einen entlegenen und schwer einsehbaren Bereich. Setzen Sie sich mit dem Rücken zum Zugangsbereich.
Lernen Sie, arbeitshemmende Kontaktmöglichkeiten zu vermeiden. Man kann sich für einen gemeinsamen Kaffee, ein gemeinsames Essen verabreden. Das hat die angenehme Nebenwirkung, dass Sie eine schöne Perspektive für die anstehende Arbeitspause haben. Also fleißig arbeiten und sich dann für sein Lernverhalten belohnen.
Das „Kleinbüro“ in die Bibliothek mitnehmen und einrichten!
Wählen Sie möglichst stets den gleichen Arbeitsplatz, damit Sie sich nicht immer wieder eingewöhnen müssen und Sie das Gefühl bekommen „das ist mein Arbeitsplatz“. Richten Sie sich ein transportables „Kleinbüro“ ein, das in Ihre Aktentasche oder einen Rucksack passt. In diesem mobilen Büro sollten enthalten sein: Schreibbuch oder Ringbuch mit diversen Einlagen, Schreibgeräte nebst Ersatz, diverse Karteikarten, Schnellhefter mit Unterlagen, Schmierzettel für Zwischennotizen, falls zulässig und vorhanden, ein Notebook. Auch Kleingeld für Automaten, Schließfächer, Snacks.
1. TeilGrundzüge des Arbeitsrechts
A.Zum Skript
B.Struktur des Arbeitsrechts
C.Rechtsquellen des Arbeitsrechts und ihre Rangfolge
1. Teil Grundzüge des Arbeitsrechts › A. Zum Skript
A.Zum Skript
1
Das wegen des steten Wandels des Arbeitsmarktes immer wichtiger werdende Arbeitsrecht spielt auch in der rechtswissenschaftlichen Ausbildung eine zunehmend große Rolle. Die meisten Bundesländer bieten Arbeitsrecht als Wahlfachgruppe an, oft ist dieses Fach aber auch ein Teil des Pflichtfachstudiums und/oder des Vorbereitungsdienstes.
2
Dieses Skript soll dem Lernenden den Einstieg in das Rechtsgebiet des Arbeitsrechts erleichtern und ist gleichzeitig zur schnellen Wiederholung kurz vor der Prüfung geeignet. Wo möglich, wurden Parallelen zum bereits erlernten allgemeinen Zivilrecht aufgezeigt, um den Arbeitsaufwand erträglicher zu gestalten.
3
Das Skript ist nicht als rein wissenschaftliches Lehrwerk zu verstehen, sondern vielmehr als eine Lernhilfe, die das (Er-)Lernen des klausurrelevanten Examensstoffes unter Anführung wichtiger Rechtsprechung und interessanter Übungsfälle erleichtern soll. Unabdingbar für ein gutes Bestehen der Klausur ist nach Erfahrung des Verfassers aber die konkrete und selbstständige Fallbearbeitung. Es wird daher dringend empfohlen, nach Lektüre des vorliegenden Skripts Übungsfälle aus einschlägigen Büchern und Zeitschriften nicht nur durchzulesen, sondern selbstständig aufzuarbeiten. Dies ist zwar ein harter, aber sehr Erfolg versprechender Weg, den gelesenen Stoff zu vertiefen und verarbeiten zu lernen. Denn dann muss man in der Klausur nicht erst überlegen, an welcher Stelle und mit welchen Formulierungen er die bloß gelesene Theorie nun in ein brauchbares Gutachten umsetzen kann.
4
Nicht zuletzt aus Gründen der besseren Verständlichkeit wird dieses prüfungsorientierte Skript nicht mit allzu vielen theoretischen Streitigkeiten belastet. Problemschwerpunkte werden „vor Ort“ erläutert. Dabei wird aufgezeigt, wie die Rechtsprechung das entsprechende Problem löst. Diese Darstellung gewährleistet im Gegensatz zur bloßen Aufzählung von Einzelproblemen, dass der Kandidat für eventuelle Problemstellungen sensibilisiert wird, sie erkennt und selbstständig unter Anwendung des Gelernten lösen kann. Gerade diese Fähigkeit ist für ein Bestehen einer juristischen Prüfung von entscheidender Bedeutung.
5
Wie in jedem anderen Rechtsgebiet ist auch im Arbeitsrecht die Kenntnis der wesentlichen Begriffe unabdingbar, um vertieft in die Materie einsteigen zu können. Daher werden in den folgenden Teilen dieses Skripts zunächst wichtige Grundlagen erläutert, bevor die eigentliche Darstellung des jeweiligen Arbeitsrechtsausschnitts beginnt.
1. Teil Grundzüge des Arbeitsrechts › B. Struktur des Arbeitsrechts
B.Struktur des Arbeitsrechts
6
Dem Grunde nach besteht das Arbeitsrecht aus zwei Gebieten, dem Individualarbeitsrecht und dem Kollektivarbeitsrecht.
Wie im Schaubild erkennbar, werden dem individuellen Arbeitsrecht diejenigen Regelungen zugeordnet, die die Rechtsbeziehungen zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer regeln. Zum kollektiven Arbeitsrecht gehören hingegen Angelegenheiten zwischen Arbeitgebern bzw. ihren Koalitionen (Arbeitgeberverbänden) einerseits und Gewerkschaften und Mitbestimmungsorganen (z.B. Betriebsrat) andererseits.
[Bild vergrößern]
7
Die Zuordnung eines Problems in eines der beiden Teilgebiete ist in der Regel recht einfach. Ähnlich wie in der Verwaltungsklausur bei der Einordnung einer Streitigkeit zum öffentlichen Recht muss man danach fragen, welche Norm den Streit maßgeblich bestimmt und wer an ihm beteiligt ist. Verlangt der Arbeitnehmer etwas von seinem Arbeitgeber, handelt es sich meist um einen Fall aus dem Individualarbeitsrecht. Spielen hingegen zum Beispiel Betriebsräte und ihr Verhältnis zum Arbeitgeber eine Rolle, liegt der Schwerpunkt auf dem kollektiven Recht.
8
Selbst wenn ein Fall unproblematisch in eine der beiden Säulen des Arbeitsrechts einsortiert werden kann, darf die jeweils andere Säule aber keinesfalls ignoriert werden. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wichtige Normen des anderen Gebiets starken Einfluss auf die Falllösung haben oder haben können.
Der Arbeitnehmer hat einen Arbeitsvertrag mit seinem neuen Arbeitgeber geschlossen, wonach er an einer bestimmten Maschine des Werkes ab dem 1. Februar beschäftigt werden soll.
Der Arbeitgeber bittet den Betriebsrat nach § 99 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) um Zustimmung zur Einstellung des Arbeitnehmers. Der Betriebsrat verweigert die Zustimmung.
Die Situation ist nun Folgende: Der Arbeitnehmer hat ab dem 1. Februar einen vertraglichen Beschäftigungsanspruch an der im Arbeitsvertrag näher bestimmten Maschine. Der Arbeitgeber darf ihn aber nicht an der Maschine einsetzen. Denn: die Einstellung des Arbeitnehmers i.S.d. BetrVG, nämlich die tatsächliche Zuweisung des Arbeitsplatzes an den neuen Arbeitnehmer, bedarf der Zustimmung des Betriebsrats, § 99 Abs. 1 BetrVG. Der Arbeitgeber muss zunächst die fehlende Zustimmung des Betriebsrats durch das Arbeitsgericht ersetzen lassen. Dies kann einige Wochen oder Monate dauern.
Macht der Arbeitnehmer nun Anfang Februar seinen Beschäftigungsanspruch geltend, verlangt er die Erfüllung einer rechtlich unmöglichen Leistung.[1] Arbeitslohn steht ihm aber nach den Regeln des Annahmeverzugs trotzdem zu.
Ergebnis: Nach individuellem Arbeitsrecht besteht der Anspruch des Arbeitnehmers auf Beschäftigung, nach kollektivem Recht ist dem Arbeitgeber die Zuweisung des Arbeitnehmers an die Maschine untersagt („betriebsverfassungsrechtliches Beschäftigungsverbot“[2]). Wer nur die individuell-rechtliche Seite des Falles beleuchtet, kommt zur falschen Lösung.
9
Das Beispiel zeigt, dass trotz der vermeintlichen Zweiteilung des Arbeitsrechts eine starke Verknüpfung beider Säulen besteht, sodass immer alle einschlägigen Normen beachtet werden müssen, egal welchem Gebiet sie entstammen. Die folgenden Erläuterungen (Teile 2 und 3) sind dem entsprechend auch der besseren Übersichtlichkeit halber zwar in die Bereiche „Individualarbeitsrecht“ und „Kollektivarbeitsrecht“ aufgeteilt. Die Verbindungspunkte werden aber an den jeweiligen Stellen aufgezeigt, sodass beim Lernen bereits eine Sensibilität für beide Säulen betreffende Rechtsprobleme geschaffen wird.
10
Zunächst jedoch wird im Folgenden ein kurzer Überblick über die Rechtsquellen des Arbeitsrechts gegeben. Die Kenntnis der Quellen und ihrer Hierarchie ist unabdingbar, weil dadurch Kollisionen verschiedener Normen aufgelöst werden können.
Anmerkungen
BAGE 97, 276-294.
BAGE 97, 276-294.
1. Teil Grundzüge des Arbeitsrechts › C. Rechtsquellen des Arbeitsrechts und ihre Rangfolge
C.Rechtsquellen des Arbeitsrechts und ihre Rangfolge
11
Das deutsche Arbeitsrecht ist insofern eine Besonderheit in der Rechtslandschaft, als es kein einheitliches Gesetzbuch gibt, das alle Fragen zu dem Thema regelt. Das Arbeitsrecht ist vielmehr in einigen allgemeinen und in zahlreichen speziellen Gesetzbüchern „verteilt“. Ergänzt wird das geschriebene Recht durch die Rechtsprechung, die hier wie in kaum einem anderen Gebiet umfassend auf die geltende Rechtslage einwirkt, sie gestaltet und zuweilen auch verändert.
1. Teil Grundzüge des Arbeitsrechts › C. Rechtsquellen des Arbeitsrechts und ihre Rangfolge › I. Normenhierarchie
I.Normenhierarchie
12
Wie in jedem Rechtsgebiet existiert auch im Arbeitsrecht eine Normenhierarchie der Rechtsquellen, an deren Spitze über dem Grundgesetz stehendes Europarecht steht, während am unteren Ende das dispositive, also das abdingbare, Gesetzesrecht zu finden ist. Prinzipiell geht demnach auch hier das ranghöhere dem rangniederen Gesetz vor. Auflockerungen von diesem strengen Rangverhältnis können jedoch durch eine Besonderheit des Arbeitsrechts, dem Günstigkeitsprinzip, hervorgerufen werden. Im Einzelfall kann die rangniedere Vorschrift der ranghöheren ausnahmsweise vorgehen, wenn sie für den Arbeitnehmer günstiger ist als die eigentlich anwendbare Norm.
13
Die Rangfolge der verschiedenen Rechtsquellen lässt sich wie folgt darstellen:
1.
Zwingendes Gesetzesrecht
a)
EG-/EU-Recht
b)
Grundgesetz
c)
Einfaches Recht
2.
Zwingende Kollektivvereinbarungen
a)
Der jeweils gültige und anwendbare Tarifvertrag
b)
Betriebsvereinbarungen/Dienstvereinbarungen
3.
Arbeitsvertrag inklusive …
a)
… allgemeiner Arbeitsbedingungen
b)
… betrieblicher Übung
c)
… Direktionsrecht des Arbeitgebers (§ 106 GewO)
4.
Dispositive Kollektivvereinbarungen
a)
Tarifvereinbarung
b)
Betriebsvereinbarung
5.
Dispositives Gesetzesrecht (z.B. § 616 BGB)
Dispositives Gesetzesrecht lässt eine Abweichung, die zum Nachteil für den Arbeitnehmer ist, grundsätzlich zu.
1. Teil Grundzüge des Arbeitsrechts › C. Rechtsquellen des Arbeitsrechts und ihre Rangfolge › II. Quellen
II.Quellen
14
Wie soeben dargestellt, sind zahlreiche Gesetze, Richtlinien und sonstige Rechtsnormen zu beachten, wenn man einen arbeitsrechtlichen Fall lösen muss.
1.Europarecht
15
Entsprechend der oben dargestellten Rangfolge ist das geltende EU-Recht als Erstes zu erwähnen. Als wichtigstes gesetzliches Regelungswerk ist der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (abgekürzt mit „AEUV“) zu nennen. Darin sind wichtige Grundsätze geregelt, etwa das allgemeine Diskriminierungsverbot in Art. 18 AEUV, die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Art. 45 AEUV und die Entgeltgleichheit in Art. 157 AEUV.
2.Verfassungsrecht
16
Das Grundgesetz enthält wichtige Grundrechte, die auf das Arbeitsrecht einwirken. Die allgemeinen Grundrechte sind – da die Arbeitsvertragsparteien nicht zu den staatlichen Adressaten der Grundrechte gehören – nur über sogenannte Einfallstore (z.B. §§ 242, 315 BGB) des Zivilrechts zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber z.B. bei Ausübung des billigen Ermessens i.S.d. § 315 Abs. 1 BGB darauf achten muss, dass er die familiäre Situation (Art. 6 GG) oder die Religionsfreiheit (Art. 4 GG) des Arbeitnehmers hinreichend in seine Überlegungen mit einbezieht.
Eine Einzelhandelskauffrau arbeitet in ihrem ehemaligen Ausbildungsbetrieb, einem Kaufhaus. Sie hat türkische Wurzeln. Der Arbeitgeber beschäftigt im Verkauf ca. 85 Arbeitnehmer, im Verwaltungsbereich 8 Arbeitnehmer, in der Warenannahme 2 Arbeitnehmer und mit Hausmeisteraufgaben 3 Mitarbeiter. Nach der Elternzeit erklärte die Arbeitnehmerin ihrem Arbeitgeber, sie werde künftig ein Kopftuch tragen. Ihre religiösen Vorstellungen hätten sich gewandelt, ihr muslimischer Glaube verbiete es ihr, sich in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch zu zeigen. Zwei Gespräche mit der Personalleitung konnten sie nicht davon abbringen, obwohl man ihr mitgeteilt hatte, dass dann eine Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses unausweichlich sei. Gegen die Kündigung ging die Arbeitnehmerin vor. Sie unterlag in der zweiten Instanz. Ihre Revision vor dem BAG[1] hatte jedoch Erfolg. Das BAG wertete die Kündigung als sozial ungerechtfertigt nach § 1 Abs. 2 KSchG. Sie sei nicht durch einen verhaltensbedingten Grund (worauf sich der Arbeitnehmer hauptsächlich berufen hatte) und auch nicht durch einen personenbedingten Grund gerechtfertigt gewesen. Die Arbeitnehmerin könne ihrer vertraglichen Verpflichtung auch ein Kopftuch tragend nachkommen. Weder Verkaufsgespräche noch -vorgänge würden dadurch gestört. Wörtlich führten die Richter dann zur o.g. Thematik aus: „[…]sowohl bei der Ausübung ihres Weisungsrechts als auch bei der Ausgestaltung dieser vertraglichen Pflicht ist das spezifische, durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG grundrechtlich geschützte Anliegen der Klägerin, aus religiösen Gründen nicht mehr ohne ein Kopftuch zu arbeiten, zu beachten. Auf Grund der verfassungsrechtlich gewährleisteten, im Arbeitsverhältnis bei der Ausübung des Weisungsrechts oder der Ausgestaltung der vertraglichen Rücksichtnahmepflicht zu berücksichtigenden Glaubens- und Bekenntnisfreiheit der Klägerin kann deshalb die Beklagte nicht ohne weiteres die Einhaltung der in ihrem Betrieb allgemein üblichen Bekleidungsstandards verlangen und die Klägerin zur Arbeitsleistung ohne ein Kopftuch wirksam auffordern.“ Die in § 315 Abs. 1 BGB geforderte Billigkeit werde inhaltlich durch die Grundrechte, hier vor allem durch die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit des Art. 4 Abs. 1 GG und die Gewährleistung der ungestörten Religionsausübung des Art. 4 Abs. 2 GG, mitbestimmt: „Kollidiert das Recht des Arbeitgebers, im Rahmen seiner gleichfalls grundrechtlich geschützten unternehmerischen Betätigungsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG), die auch für die Beklagte als juristische Person nach Art. 19 Abs. 3 GG gewährleistet ist, den Inhalt der Arbeitsverpflichtung des Arbeitnehmers näher zu konkretisieren, mit grundrechtlich geschützten Positionen des Arbeitnehmers, so ist das Spannungsverhältnis im Rahmen der Konkretisierung und Anwendung der Generalklausel des § 315 BGB einem grundrechtskonformen Ausgleich der Rechtspositionen zuzuführen. Dabei sind die kollidierenden Grundrechte in ihrer Wechselwirkung zu sehen und so zu begrenzen, daß die geschützten Rechtspositionen für alle Beteiligten möglichst weitgehend wirksam werden („praktische Konkordanz“).“[2]
17
In der Klausur ist es wichtig, genau darauf zu achten, in welchem Bereich der betroffene Arbeitnehmer arbeitet. Die Abwägung der Grundrechte kann nämlich auch – sogar bei sonst sehr ähnlichem Sachverhalt – genau anders herum ausgehen:
Eine Erzieherin ist bei einer Stadt angestellt, die 34 Kindertagesstätten betreibt. Die Arbeitnehmerin hat türkische Wurzeln. Sie trägt aus religiösen Gründen auch bei der Arbeit ein Kopftuch. Es gilt das Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) Baden-Württemberg, das u.a. vorsieht, dass Erziehungspersonen „in Einrichtungen, auf die dieses Gesetz Anwendung findet und die in Trägerschaft des Landes, eines Landkreises, einer Gemeinde, einer Verwaltungsgemeinschaft, eines Zweck- oder Regionalverbandes stehen, keine politischen, religiösen, weltanschaulichen oder ähnliche äußeren Bekundungen abgeben, die geeignet sind, die Neutralität des Trägers gegenüber Kindern und Eltern oder dem politischen, religiösen oder weltanschaulichen Frieden in Einrichtungen, auf die dieser Absatz Anwendung findet, zu gefährden oder zu stören. Insbesondere ist ein äußeres Verhalten unzulässig, welches bei Kindern oder Eltern den Eindruck hervorrufen kann, dass eine Fachkraft oder eine andere Betreuungs- oder Erziehungsperson gegen die Menschenwürde, die Gleichberechtigung der Menschen nach Artikel 3 des Grundgesetzes, die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung auftritt.“ Die Stadt berief sich auf diese Vorschrift und forderte die Erzieherin auf, ihr Kopftuch während des Dienstes abzulegen. Dies verweigerte die Angesprochene. Daraufhin erhielt sie eine Abmahnung. Diese hielt einer Überprüfung durch das BAG[3] stand. Das BAG betonte, dass die o.g. Vorschrift nicht gegen höherrangiges Recht verstößt. Die Arbeitnehmerin habe das „Bekundungsverbot“ bewusst und dauerhaft verletzt, was abmahnfähig sei. Das Verhalten der Erzieherin sei geeignet, die Neutralität der Stadt gegenüber Kindern und Eltern und den religiösen „Einrichtungsfrieden“ zu gefährden. Eine Erzieherin nehme als Bezugs- und Autoritätsperson eine Mittelpunktfunktion ein und habe einen hohen Einfluss auf die Kinder. Dies, so urteilten die Richter unterm Strich, erlaube es der Stadt, auf ein Erscheinungsbild ohne „islamisches Kopftuch“ zu bestehen. Zwar stehe der Erzieherin natürlich das Recht aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG zu. Andererseits sei es den Kindern und Eltern aber zuzubilligen, „kultischen Handlungen eines nicht geteilten Glaubens fernzubleiben“. Gemeinsam mit Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG umfasse Art. 4 Abs. 1 GG das Recht der Eltern zur Kindererziehung in religiöser und weltanschaulicher Hinsicht, deswegen sei es deren Sache, ihren Kindern diejenigen Überzeugungen in Glaubens- und Weltanschauungsfragen zu vermitteln, die sie für richtig hielten. Dazu gehört nach Ansicht der BAG-Richter auch das Recht, die Kinder von Glaubensüberzeugungen fernzuhalten, die den Eltern falsch oder schädlich erscheinen.[4]
In der Prüfung ist also besonderes Augenmerk darauf zu legen, ob der Arbeitnehmer in einer privaten Organisation beschäftigt wird oder im öffentlich-rechtlichen Bereich. Das eben zweitgenannte Urteil des BAG aus dem Jahr 2010 verweist im Übrigen auch auf ein wichtiges Urteil des EGMR zum Thema „Kopftuch einer Lehrerin“. Sie sollten das Urteil aus Straßburg[5] kennen.
18
Auch der Arbeitgeber kann sich auf Grundrechte berufen. So ist dem Arbeitnehmer etwa mit Blick auf die Berufsfreiheit des Arbeitgebers aus Art. 12 GG zuzumuten, dass er eine unternehmerische Grundentscheidung wie etwa die Wegrationalisierung seines Arbeitsplatzes hinnimmt.
19
Art. 9 Abs. 3 GG enthält eine besondere Regelung, die auch ohne den eben beschriebenen „Umweg“ direkt auf das Arbeitsverhältnis Einfluss nimmt. Die Sätze 1 und 2 der Norm lauten:
Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig.
20
Der Verfassungsgeber hat also ausdrücklich klargestellt, dass zwischen den Arbeitsvertragsparteien keine Regelungen getroffen werden dürfen, die etwa die Zugehörigkeit des Arbeitnehmers zu einer Gewerkschaft untersagen. Solche Klauseln im Arbeitsvertrag sind ohne Weiteres nichtig, der Arbeitnehmer darf sie ignorieren.
3.Einfaches Recht
21
Eine der wichtigsten Quellen im normierten einfachen Recht ist das Bürgerliche Gesetzbuch. In den §§ 611 ff. des BGB sind Regelungen zum generellen Typus des Dienstvertrages und im mittlerweile neu eingeführten § 611a zum Arbeitsvertrag als speziellem Dienstvertrag enthalten. Begriffe wie „Arbeitnehmer“, „Arbeitgeber“ und „Arbeitsverhältnis“ deuten dabei auf Spezialnormen des Arbeitsrechts hin.[6]
22
Im BGB finden sich darüber hinaus im allgemeinen Teil Vorschriften, die direkt im Arbeitsrecht gelten (etwa die Regelungen zur Geschäftsfähigkeit, Anfechtung von Willenserklärungen, Sittenwidrigkeit[7]) oder deren Rechtsgedanke von der Rechtsprechung weiterentwickelt und angepasst wurde (zum Beispiel die Regelung des § 314 Abs. 2 BGB, die eine Abmahnung als milderes Mittel vor der Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses vorsieht).
23
Auf der Ebene des einfachen Rechts spielt weiterhin eine große Rolle das „Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge“ (TzBfG), welches die Teilzeitarbeit in Grundzügen regelt und unter bestimmten Voraussetzungen die Befristung und Bedingung von Arbeitsverhältnissen erlaubt.
Während der Durchführung des Arbeitsverhältnisses sind unter anderem das Arbeitszeitgesetz, das Bundesurlaubsgesetz und das Entgeltfortzahlungsgesetz wichtig, die neben vielen anderen Schutzgesetzen den Inhalt des Arbeitsverhältnisses maßgeblich mitbestimmen. Von enormer Bedeutung ist auch § 106 GewO, der das Weisungsrecht des Arbeitgebers regelt. Wenn es um die Beendigung der arbeitsvertraglichen Beziehungen geht, ist das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) von großer praktischer Bedeutung.
4.Sonstige Rechtsquellen
24
Weitere wichtige Regelungen können sich aus dem Arbeitsvertrag (§ 611a BGB), dem Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarungen ergeben. Nähere Erläuterungen dazu finden Sie weiter unten.[8]
Anmerkungen
BAG Urteil vom 10.10.2002, Az.: 2 AZR 472/01.
Nach BAGE 103, 111–123.
Nach BAG NZA-RR 2011, 162–166.
Nach BAG NZA-RR 2011, 162–166.
EGMR Urteil vom 10.11.2005, NVW 2006, 1389.
Vgl. §§ 611a, 612a, 613a, 619a, 622, 623 BGB.
Wiederholen Sie hierzu die Ausführungen in den Skripten „BGB AT I und II“.
Arbeitsvertrag: Rn. 26 ff.; Tarifvertrag: Rn. 373 ff.; Betriebsvereinbarung: Rn. 543 ff.
2. TeilIndividualarbeitsrecht
A.Grundbegriffe
B.Die Anbahnung und Begründung eines Arbeitsverhältnisses
C.Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
D.Der Betriebsübergang, § 613a BGB
2. Teil Individualarbeitsrecht › A. Grundbegriffe
A.Grundbegriffe
25
Bevor man in die arbeitsrechtliche Fallbearbeitung einsteigen kann, muss man die entsprechenden Fachtermini beherrschen. Gerade im Arbeitsrecht haben einige das Gefühl, sich bereits auszukennen, da viele Begriffe dieses Rechtsgebiets im täglichen Leben vorkommen. Die Annahme, dass dieses Kapitel übersprungen werden kann, ist aber falsch. Denn oft genug handelt es sich bei dem vermeintlichen Wissen um weitverbreitete Irrtümer, welche in einer arbeitsrechtlichen Klausur nichts zu suchen haben.
„Es besteht kein Arbeitsverhältnis, wenn kein schriftlicher Vertrag geschlossen wurde.“ (s. dazu Rn. 30)
„Wenn im Vertrag steht, dass der Mitarbeiter selbstständig beschäftigt wird, dann ist das halt so.“ (s. dazu Rn. 36)
2. Teil Individualarbeitsrecht › A. Grundbegriffe › I. Arbeitsvertrag
I.Arbeitsvertrag
26
Die wichtigste Voraussetzung für die Anwendung des Arbeitsrechts ist natürlich das Vorliegen eines Arbeitsvertrags. Dieser wird vom Gesetzgeber nunmehr in § 611a Abs. 1 S. 1 BGB wie folgt definiert:
Unter einem Arbeitsvertrag versteht man einen gegenseitigen Vertrag zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber, durch den sich der Arbeitnehmer zur Leistung der festgelegten Arbeit und der Arbeitgeber im Gegenzug zur Gewährung eines Arbeitsentgelts verpflichtet.
27
Für den Abschluss des Arbeitsvertrags gilt das im ganzen Zivilrecht gegebene Prinzip der Vertragsfreiheit.[1] Bekanntermaßen gewährleistet dieser Grundsatz die Freiheit der handelnden Personen, über den Abschluss eines Vertrags überhaupt und auch über den Inhalt dieses Vertrags zu entscheiden. Eine Ausnahme von der Abschlussfreiheit besteht zum Beispiel bei einem Beschäftigungsverbot für Kinder und Jugendliche.
28
Auch inhaltlich haben die Parteien grundsätzlich Gestaltungsfreiheit. Der Gestaltungsfreiraum findet jedoch dort seine Grenzen, wo zwingende Vorschriften bestehen, von denen nicht abgewichen werden darf.
29
Mindestwirksamkeitsvoraussetzung für den Arbeitsvertrag ist die Einigung der Parteien über die wesentlichen Vertragsbestandteile. Als essentialia negotii des Arbeitsvertrags sind die Parteien, die Tätigkeit und die Zahl der Arbeitsstunden zu werten. Alles andere kann (in den Grenzen zwingender gesetzlicher Vorgaben), muss aber nicht geregelt werden, vgl. § 105 GewO.
30
Entgegen einem weitverbreiteten Irrtum ist es nicht notwendig, den Arbeitsvertrag förmlich zu schließen. Es ist aber möglich, dass ein Formzwang zum Beispiel in einem Tarifvertrag enthalten ist. Bei Missachtung kann sich aus den §§ 125, 126 BGB die Nichtigkeit des Vertrages ergeben. Der Tarifvertrag ist als „Gesetz“ im Sinne dieser Vorschriften zu sehen. Allerdings bedarf es einer Auslegung der Bestimmung, ob der Tarifvertrag die Schriftform konstitutiv oder – wovon im Zweifel ausgegangen wird – nur deklaratorisch regeln will. Im letzteren Fall führt eine Nichtbeachtung nicht zur Nichtigkeit des Vertrages.
Auf eventuelle Formvorschriften muss in der Klausur nur dann eingegangen werden, wenn der Sachverhalt oder der Bearbeitervermerk einen Hinweis darauf enthalten! Andernfalls kann schon der kurze Hinweis auf die allgemeine Formfreiheit zu viel sein.
31
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 2 NachwG, der vorschreibt, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine schriftliche Dokumentation der wichtigsten Arbeitsbedingungen hat. Diese Dokumentation dient lediglich der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zwischen den Parteien.
32
Wie bei jedem zweiseitig verpflichtenden Vertrag lassen sich auch aus dem Arbeitsvertrag Rechte und Pflichten für beide Parteien herleiten. Beide Seiten treffen Haupt- und Nebenleistungspflichten, die gegenüber der anderen Partei einzuhalten sind.[2]
2. Teil Individualarbeitsrecht › A. Grundbegriffe › II. Arbeitnehmer
II.Arbeitnehmer
33
Die Bestimmung der Arbeitnehmereigenschaft gehört zu den schwierigeren Aufgaben des Arbeitsrechtlers. Erforderlich ist eine genaue Abgrenzung zu anderen in Frage kommenden Vertragsverhältnissen, etwa dem Dienst- und Werkvertrag. Die korrekte Einstufung des Betroffenen stellt sich in der Praxis als schwer anzustellen dar, obschon sie gleichzeitig wegen der großen Unterschiede zum Dienst- oder Werkvertragsrecht sehr wichtig ist.
Neben der Festlegung des anzuwendenden materiellen Rechts hat das Vorliegen der Arbeitnehmereigenschaft auch prozessrechtliche Folgen. Für Streitigkeiten eines Arbeitnehmers, die sein Arbeitsverhältnis betreffen, ist die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte gem. § 2 Abs. 1 Nrn. 3, 4, 5, 9 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) gegeben.
Das Arbeitsrecht wird gerne auch als Arbeitnehmerschutzrecht bezeichnet, da sehr viele Regelungen nur dazu geschaffen wurden, einen gerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Arbeitnehmers und denen des ihm übergeordnet anzusehenden Arbeitgeber zu gewährleisten. Die Eingrenzung eines Dienstschuldners als Arbeitnehmer und damit die Anwendbarkeit des Arbeitnehmerschutzrechts ist daher von enormer Bedeutung für die Betroffenen. Die Frage nach der Arbeitnehmereigenschaft ist immer dann in der Klausur anzusprechen, wenn eine Norm sie als Tatbestandsvoraussetzung vorsieht.
34
Der Begriff der Arbeitnehmereigenschaft ist mittlerweile explizit in § 611a BGB gesetzlich geregelt. In einigen weiteren Vorschriften wird er ebenfalls erwähnt, so etwa in § 5 Abs. 1 S. 1 ArbGG und § 5 Abs. 1 BetrVG. Dort wird wortgleich festgelegt, dass Arbeitnehmer im Sinne des jeweiligen Gesetzes „Arbeiter, Angestellte und zur Berufsausbildung Beschäftigte“ seien.
35
Im Laufe der Jahre und der Rechtsprechung hat sich nach allgemeiner Ansicht folgende Definition bewährt und nun Niederschlag im Gesetzeswortlaut gefunden:
Laut § 611a Abs. 1 S. 1 BGB ist Arbeitnehmer, wer sich auf Grund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste eines Anderen zu weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet.[3]
36
Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen steht fest, dass der Betroffene nicht im Rahmen eines unentgeltlichen Auftragsverhältnisses, freien Dienstverhältnisses (§ 611 BGB) oder eines Werkvertrages (§ 631 BGB) handelt.
Bei der Klausurbearbeitung muss man sich zuerst nach dem Wortlaut des Sachverhalts richten. Nur wenn dort nicht von Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, Arbeiter oder Angestelltem gesprochen wird, ist es nötig, mithilfe der Sachverhaltsangaben den Charakter des Vertrags zu ermitteln. Dazu müssen alle äußeren und inneren Merkmale herangezogen werden, die aus dem gegebenen Sachverhalt hervorgehen. Die konkrete Bezeichnung des Vertragsverhältnisses (z.B. Überschrift „Vertrag für freie Mitarbeiter“) kann nur als Indiz gewertet werden. Maßgeblich für die Qualifizierung des Rechtsverhältnisses ist nämlich seine tatsächliche Durchführung. Erscheint dieses nach Würdigung der äußeren Umstände als Arbeitsverhältnis, so sind die Parteien als Arbeitnehmer und Arbeitgeber einzuordnen und zu behandeln.
[Bild vergrößern]
37
Bei der Prüfung der Arbeitnehmereigenschaft eines Beteiligten können Sie sich an folgenden Fragen orientieren:
I.Ist der Vertrag dem Privatrecht zuzuordnen?
II.Ist der Schuldner verpflichtet, dem Gläubiger Dienste i.S.d. § 611a BGB zu erbringen?
III.Kann er dabei nicht selbstständig handeln?
WeisungsgebundenheitRn. 48
1.Privatrechtlicher Vertrag
38
Die Rechtsbeziehung zwischen den Parteien muss zunächst dem privaten Recht zuzuordnen sein. An dieser Stelle ist eine Abgrenzung zu öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen notwendig. Dem Anwendungsbereich des Arbeitsrechts unterfallen demnach etwa nicht Beamte, Soldaten und Richter. Diese Beziehungen basieren nämlich nicht auf einer „Einstellung“, also dem Abschluss eines Arbeitsvertrags. Rechtsgrundlage für die genannten Berufsbilder ist vielmehr die Ernennung, also die hoheitliche Indienststellung des Betroffenen durch einen Verwaltungsakt. Diese Rechtsbeziehungen ergeben sich also aus dem öffentlichen Recht.
Bitte nicht Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst verwechseln oder gleichstellen. Personen, die als Angestellte des öffentlichen Dienstes gelten, sind mit dem öffentlichen Träger der Staatsgewalt durch einen privatrechtlichen Vertrag verbunden. Diese Personen sind als privatrechtliche Arbeitnehmer zu qualifizieren.
39
Nicht auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen weiterhin Tätigkeiten, die eine Person ausschließlich aufgrund familiärer Bindungen erbringt, etwa im Rahmen des § 1360 BGB.
40
Strafgefangene, die während der Inhaftierung in der Haftanstalt Arbeit verrichten, sind ebenfalls keine Arbeitnehmer. Ihre Tätigkeit fußt allein auf einem staatlichen Zwangsverhältnis und gehört somit dem öffentlichen Recht an.[4]
An dieser Stelle rufen Sie sich bitte nochmals die im besonderen Schuldrecht gelernten Voraussetzungen der §§ 611, 631, 662, 705 BGB ins Gedächtnis.
2.Vertrag nach §§ 611a Abs. 1 S. 1 BGB
41
In der Prüfung muss zunächst ausgeschlossen werden, dass ein Werkvertrag vorliegt.
Hier hilft die aus dem allgemeinen Zivilrecht bekannte Faustregel „Beim Dienstvertrag wird die Tätigkeit, beim Werkvertrag der Erfolg geschuldet“ weiter.
42
Auszuschließen ist als Nächstes das Vorliegen eines Gesellschaftsvertrages gem. § 705 ff. BGB. Mit einem solchen Vertrag regeln die Vertragsparteien, dass sie zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks kooperieren und ihre Einsätze mit Blick auf diesen Zweck leisten wollen (§ 705 BGB). Ein solcher Einsatz kann auch in der Erbringung von Arbeitsleistung bestehen (§ 706 Abs. 3 BGB).
43
Die Dienste müssen gegen ein Entgelt erbracht werden. Wenn zwischen den Parteien Klarheit darüber herrscht, dass keine Vergütungsansprüche des Dienstleistenden bestehen, kann ein Auftrag i.S.d. §§ 662 ff. BGB vorliegen. Wenn hingegen die Parteien nicht über eine Vergütung gesprochen haben, aber Dienste wie die vereinbarten normalerweise nur gegen Geld erbracht werden, kann auch § 612 Abs. 1 BGB eingreifen. Diese Norm regelt die Höhe des Vergütungsanspruchs in diesen Fällen.
44
Steht danach fest, dass § 611a BGB einschlägig ist, ist nach Maßgabe des folgenden Kapitels „Unselbstständigkeit der Dienstleistung“ zu ermitteln, ob ein so genannter freier Dienstvertrag oder ein Arbeitsvertrag vorliegt.
3.Unselbstständigkeit der Dienstleistung
45
Auf dem Prüfungspunkt der Unselbstständigkeit der zu erbringenden Dienstleistung liegt in der Regel der bzw. ein Schwerpunkt der Klausur. An dieser Stelle sollte also der Sachverhalt genau ausgewertet und das Ergebnis im Gutachten umfangreich dargestellt werden. Wer hier lediglich eine halbe Seite schreibt, verschenkt in der Regel wertvolle Punkte!
Im Gegensatz zum Arbeitsvertrag wird die Dienstleistung im Rahmen eines freien Dienstvertrags in Selbstbestimmung und persönlicher Unabhängigkeit erbracht. Der Arbeitnehmer hingegen ist persönlich abhängig und fremdbestimmt durch den Arbeitgeber.
46
Die Rechtsprechung hat Beurteilungsgrundsätze entwickelt, die bei der Zuordnung eines Dienstleistenden zum abhängigen Arbeitnehmer helfen können. Es ist aber darauf zu achten, dass ein „Abhaken“ vorgegebener Prüfungspunkte nicht immer zur sachgerechten Lösung führt. Vielmehr ist im Einzelfall auf die einzelnen tatsächlichen und rechtlichen Umstände abzustellen. Hierbei hat in der Regel der tatsächlich gelebte Vertragsinhalt ein höheres Gewicht als die vertraglich festgeschriebenen Regelungen. Denn das tatsächliche Verhalten der Parteien bestimmt maßgeblich den Inhalt des Vertragsverhältnisses, nicht ihre eventuell nur auf dem Papier stehenden Vereinbarungen. Insgesamt sind also sämtliche Umstände des Einzelfalls zu beachten und in ihrer Gesamtheit zu würdigen.[5]
47
Eine entscheidende Hilfe bei der Einordnung eines Erwerbstätigen als Arbeitnehmer bietet § 84 Abs. 1 S. 2 HGB:
Selbstständig ist, wer im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann.
48
Daraus ist im Umkehrschluss zu folgern: Arbeitnehmer ist, wer seine Tätigkeit gerade nicht im Wesentlichen frei gestalten und auch seine Arbeitszeit nicht frei bestimmen kann, mit anderen Worten weisungsgebunden ist. Man spricht hier von einer persönlichen Abhängigkeit des Arbeitnehmers. Eine wirtschaftliche Abhängigkeit wird nicht gefordert.[6]
49
Entscheidende Indizien, die zur Bejahung der Arbeitnehmereigenschaft führen können, sind die Folgenden:
•
Weisungsgebundenheit des Dienstverpflichteten liegt dann vor, wenn er auf die Faktoren Zeit, Inhalt und Ort der Dienstleistung (vgl. § 106 GewO) keinen oder sehr wenig Einfluss hat.
•
Das Gleiche gilt, wenn der Betroffene in die Organisation des Betriebs des Dienstberechtigten eingegliedert ist. In der neueren Rechtsprechung des BAG tritt dieses Merkmal als eigener Prüfungspunkt etwas in den Hintergrund und geht im Begriff der Weisungsgebundenheit auf.[7] Das BAG geht demnach davon aus, dass der einem umfassenden Weisungsrecht unterliegende Dienstverpflichtete in die Organisation des Dienstberechtigten eingebunden sein muss.
•
Arbeitnehmer müssen ihre Dienste in der Regel in eigener Person, mithin höchstpersönlich, erbringen. Darf der Vertragspartner andere Personen mit der Erledigung seiner Aufgaben betrauen, spricht dies gegen eine Arbeitnehmereigenschaft.
50
Falls diese Prüfung kein eindeutiges Ergebnis ermöglicht, können weitere Kriterien zur Beurteilung herangezogen werden. Diese stellen im Gegensatz zu den bisher genannten Abgrenzungskriterien jedoch nur schwache Indizien dar:
•
Bezeichnung der Vertragsparteien im Vertrag (Arbeitnehmer, Arbeitgeber).
•
Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge werden abgeführt.
•
Der zur Leistung Verpflichtete erhält auch im Krankheitsfall Lohnfortzahlung.
•
Der zur Leistung Verpflichtete erhält bezahlten Urlaub.
In der Klausur wird in der Regel die Arbeitnehmereigenschaft zu bejahen sein, handelt es sich doch um eine Arbeitsrechtsklausur. Falls die Klausur im Rahmen einer Zivilklausur gestellt wird, müssen Sie im Zweifelsfall den Sachverhalt daraufhin untersuchen, bei welcher Lösung Sie sich mit der Entscheidung für oder gegen das Vorliegen eines Arbeitnehmers die wenigsten Probleme „abschneiden“. Diesen Weg sollten Sie dann wählen.
[Bild vergrößern]
Der Kläger war über einen Zeitraum von etwa 10 Jahren für die Beklagte als Fotograf tätig. Basis der Zusammenarbeit war eine schriftliche Vereinbarung, wonach der Kläger ein Unternehmen gründen sollte, um im hauseigenen Studio der Beklagten im Bereich „Möbeldekoration und Möbelfotografie“ Werbefotografie zu betreiben. Die Beklagte sollte neben den Räumlichkeiten auch Handwerker für den Auf- und Abbau der Werbeobjekte zur Verfügung stellen. § 2 der Vereinbarung sah vor, dass die Abrechnung der Fotoaufträge zu den üblichen Konditionen jeweils nach abgeschlossenem Auftrag erfolgen sollte. Die Parteien vereinbarten eine Laufzeit von zunächst 5 Jahren, in beiderseitigem Einvernehmen verlängerbar. Der Kläger brachte seine eigene Fotoausrichtung mit und engagierte auf eigene Rechnung Stylisten. Seine Aufträge bekam er per Fax, später E-Mail. Darin wurde ihm mitgeteilt, welches Möbelprogramm er in welchem Aufbau fotografieren sollte und wie lange und ab wann die Produktion laufen sollte. Die Handwerker bauten dann die Programme auf, die Stylisten dekorierten. Die fertigen Aufnahmen sandte der Kläger an die Beklagte, die ggf. Änderungswünsche mitteilte und erst nach deren Erledigung die Bilder abnahm. Der Kläger wurde nach Rechnungsstellung entlohnt. Im Januar 2009 bearbeitete der Kläger den letzten Auftrag für die Beklagte. Ende 2010 bot er seine Arbeitsleistung an, welche abgelehnt wurde. Anfang 2012 kündigte die Beklagte vorsorglich ein etwaig bestehendes Arbeitsverhältnis. Die Kündigungsschutzklage hatte keinen Erfolg. Die LAG-Richter urteilten, dass der Kläger nicht als Arbeitnehmer der Beklagten arbeitete. Weder die Auftragserteilung noch die zeitlichen Vorgaben (auch freie Mitarbeiter müssen sich oft an zeitlichen Gegebenheiten orientieren) sprachen für das Vorliegen einer Arbeitnehmereigenschaft. Weiterhin war auch die Vorgabe der Möbel (natürlich!) nicht ausreichend: „Zum Leistungsbestimmungsrecht der Beklagten gehörte ohne Weiteres die Vorgabe der zu fotografierenden Möbel. Geschuldete Tätigkeit des Klägers war das Fotografieren von ihm durch die Beklagte gestellten Möbeln und Möbeldekoration(en). Im Rahmen dieser Vorgabe besaß der Kläger in fotografischer Hinsicht gestalterische Freiheit und Selbstständigkeit. Einer Vorgabe, wie er technisch die Fotografien zu bewerkstelligen hatte, war er nicht ausgesetzt. Er war Fotograf; im Bereich der Technik der Fotografie arbeitete er weisungsfrei.“ Die Abnahme der Fotos durch die Beklagte war ebenfalls kein Grund für die Annahme einer arbeitnehmerschaftlichen Abhängigkeit. Denn auch freie Mitarbeiter seien nicht völlig frei in ihrer Leistungserbringung. Eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation war nach Ansicht der Richter ebenfalls nicht erkennbar, auch wenn die Tätigkeiten des Kläger „Hand in Hand“ mit Mitarbeitern der Beklagten stattfanden: „Auf- und Abbau der Möbel/der Dekorationen ergaben sich daher aus den sachlichen Erfordernissen der mit dem Kläger vereinbarten Fotoeinsätze, ohne dass der Kläger insoweit in die Arbeitsorganisation der Beklagten eingegliedert gewesen wäre.“[8]
2. Teil Individualarbeitsrecht › A. Grundbegriffe › III. Arbeitnehmerähnliche Personen
III.Arbeitnehmerähnliche Personen
51
Der Gesetzgeber hat erkannt, dass viele Dienstleistende zwar per definitionem schon mangels persönlicher Abhängigkeit keine Arbeitnehmer sind, aber einer gewissen wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Auftraggeber unterliegen und damit eines Mindestmaßes an Schutz bedürfen.
52
§ 12a Abs. 1 Nr. 1 des Tarifvertragsgesetzes (TVG) beinhaltet eine Legaldefinition dieser so genannten arbeitnehmerähnlichen Personen:
Personen, die wirtschaftlich abhängig und vergleichbar einem Arbeitnehmer sozial schutzbedürftig sind (arbeitnehmerähnliche Personen) […]
53
Erfüllen diese Personen darüber hinaus im § 12a Abs. 1 Nr. 1 näher bestimmte Voraussetzungen, findet auf diesen Personenkreis das TVG Anwendung:
[…] wenn sie aufgrund von Dienst- oder Werkverträgen für andere Personen tätig sind, die geschuldeten Leistungen persönlich und im Wesentlichen ohne Mitarbeit von Arbeitnehmern erbringen und
a) überwiegend für eine Person tätig sind oder
b) ihnen von einer Person im Durchschnitt mehr als die Hälfte des Entgelts zusteht, das ihnen für ihre Erwerbstätigkeit insgesamt zusteht; ist dies nicht voraussehbar, so sind für die Berechnung, soweit im Tarifvertrag nichts anderes vereinbart ist, jeweils die letzten sechs Monate, bei kürzerer Dauer der Tätigkeit dieser Zeitraum, maßgebend […]
54
Weitere Vorschriften mit Sonderregelungen für arbeitnehmerähnliche Personen finden sich in den §§ 2 S. 2 BUrlG, 11 EFZG, 5 Abs. 1 S. 2 ArbGG.
Der Gruppe der arbeitnehmerähnlichen Personen können beispielsweise Heimarbeiter (§ 2 Abs. 1 HAG) angehören.
2. Teil Individualarbeitsrecht › A. Grundbegriffe › IV. Scheinselbstständigkeit
IV.Scheinselbstständigkeit
55
Eine in der Praxis häufig vorkommende Form der Mitarbeit ist die so genannte „freie Mitarbeit“. Freie Mitarbeiter sind selbstständig Tätige, die im Rahmen eines Dienstvertrags für Auftraggeber handeln. Vorteile dieser Art der Zusammenarbeit bestehen hauptsächlich für den Auftraggeber, der für einen echten freien Mitarbeiter keine Arbeitgeberanteile an die Sozialversicherungsträger zahlen muss. Denn der freie Mitarbeiter ist sozialversicherungsrechtlich nicht als Beschäftigter zu sehen und unterliegt damit nicht der Versicherungspflicht nach oben genannten Normen, vgl. §§ 2, 7 Abs. 1 SGB IV.
56
Problematisch wird die freie Mitarbeit, wenn der Auftragnehmer nur für einen Auftraggeber arbeitet. In dem Fall wird regelmäßig eine „Scheinselbstständigkeit“ vorliegen, also eine verschleierte Arbeitnehmereigenschaft des Dienstleistenden. Ob dies der Fall ist, bestimmt sich nach den oben unter dem Punkt „Arbeitnehmer“ genannten Kriterien.
2. Teil Individualarbeitsrecht › A. Grundbegriffe › V. Übungsfall Nr. 1
V.Übungsfall Nr. 1
57
„Der Sportredakteur[9]“
A hat Journalismus studiert und ist seit mehreren Jahren bei dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender B in der Redaktion „Sport“ beschäftigt. Die Zusammenarbeit basiert auf mit „Honorarvertrag“ überschriebenen Vereinbarungen, nach denen der A als Reporter, Berichterstatter, Redakteur oder Moderator inhaltlich gestaltend am Programm der Beklagten mitwirken soll, indem er seine Fachkenntnisse, Informationen und journalistischen Arbeitsergebnisse, seine eigene Auffassung zu politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und anderen Sachfragen sowie seine individuelle künstlerische und journalistische Befähigung und Aussagekraft in die Sendungen einbringen soll.
Dazu übermittelt B dem A sechs Wochen vor Beginn des Planungszeitraums einen Vordruck, in den der A eintragen soll, wann und wie viel Zeit er für die B arbeiten will. A schreibt stets hinein, wann er für andere Auftraggeber arbeitet und folglich keine Zeit hat, andernfalls vermerkt er: „Keine besonderen Wünsche“. Daraufhin wird A hauptsächlich als Moderator des Sportteils einer überregionalen Nachrichtensendung eingesetzt, die montags bis freitags abends je drei Mal zu festen Zeiten ausgestrahlt wird. Am jeweiligen Sendungstag begibt sich A gegen 13 Uhr in die Redaktion, wo er zunächst eigene Themenvorschläge mit dem Redakteur vom Dienst bespricht. Nach einer Redaktionskonferenz, an der A nicht teilnimmt, bekommt er mitgeteilt, welche Themen er bringen soll. Daraufhin recherchiert A und bereitet seine Beiträge vor. Die Ergebnisse liest der Redakteur vom Dienst gegen und korrigiert und kürzt sie gegebenenfalls.
Für die Einsätze erhält A festgelegte Honorare. Von diesen werden Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Beiträge zu den Sozialkassen einbehalten und von der B an die zuständigen Behörden abgeführt.
Als A schwer erkrankt und vier Wochen arbeitsunfähig ist, verlangt er von B Entgeltfortzahlung. Hat er darauf einen Anspruch?
58
Lösung
Anspruch aus § 3 EFZG
A könnte gegen die B einen Anspruch auf Fortzahlung seiner Vergütung aus § 3 EFZG haben. Nach dieser Vorschrift hat der Arbeitnehmer, der aufgrund von Krankheit arbeitsunfähig unverschuldet erkrankt ist, einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung für einen Zeitraum von bis zu sechs Wochen.
Zu prüfen ist, ob A Arbeitnehmer i.S.d. § 3 EFZG ist. Arbeitnehmer ist nach der Rechtsprechung, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist.
1.Privatrechtlicher Vertrag
Zwischen A und B müsste zunächst ein privatrechtlicher Vertrag geschlossen worden sein. B ist zwar als öffentlich-rechtlicher Fernsehsender eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Es sind aber keine Hinweise auf ein Sonderverhältnis, etwa einen Beamtenstatus des A, erkennbar. Folglich basiert die zwischen A und B bestehende Vereinbarung auf privatem Recht.
2.Arbeitsvertrag, § 611a Abs. 1 S. 1 ff. BGB
Zu prüfen ist weiterhin, ob der Vertrag als Arbeitsvertrag i.S.d. § 611a Abs. 1 S. 1 ff. BGB anzusehen ist. Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass A und B ein Gesellschafts- oder Auftragsverhältnis verbinden könnte. Folglich ist lediglich eine Abgrenzung zum Werkvertrag i.S.d. §§ 631 ff. BGB vorzunehmen. Dies wäre dann zu bejahen, wenn der A dem B einen Erfolg schulden würde statt einer Tätigkeit. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn er als Journalist lediglich einen Zeitungsartikel oder Nachrichtentext abliefern müsste. Hier schuldet A aber nicht nur die Lieferung eines von ihm zu fertigenden Beitrages, sondern er muss Beitragsthemen vorschlagen, sie vorbereiten und anschließend auch im Fernsehen vortragen. Dies entspricht einer arbeitsvertraglichen Tätigkeit. Damit liegt ein Vertrag i.S.d. § 611a Abs. 1 S. 1 BGB vor.
3.Unselbstständigkeit der Dienstleistung
Fraglich ist jedoch, ob A seine Leistungen als freier Mitarbeiter oder als unselbstständiger Arbeitnehmer erbringt. Maßgebliches Unterscheidungskriterium ist hier der Grad der persönlichen Abhängigkeit des Dienstverpflichteten vom Dienstberechtigten. Hier kann auf die Regelung des § 84 Abs. 1 S. 2 HGB zurückgegriffen werden. Demnach ist Selbstständiger, wer im Wesentlichen seine Tätigkeit frei gestalten und die Arbeitszeit bestimmen kann.
Fraglich ist, ob diese Grundsätze auch bei dem B herangezogen werden können. Denn B genießt als Fernsehsender den besonderen Schutz des Art. 5 Abs. 1 GG, die Rundfunkfreiheit. Auf diese Besonderheit ist bei der Auswahl, Einstellung und Beschäftigung der Mitarbeiter, die bei der Gestaltung der Programme mitwirken, Rücksicht zu nehmen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Sender frei ihre Programme entwerfen und durchführen können und nicht unbillig an einzelne Mitarbeiter gebunden werden, die nicht in das aktuelle Konzept des Senders passen. Konkret wirkt sich das so aus, dass zwar grundsätzlich die allgemeinen Abgrenzungskriterien des Arbeitsrechts anwendbar sind. Dabei ist aber eine fallbezogene Abwägung zwischen der Bedeutung der Rundfunkfreiheit einerseits und dem Rang der von den Normen des Arbeitsrechts geschützten Rechtsgüter andererseits zu treffen. Hier ist wiederum zu unterscheiden, ob ein Programm gestaltender Mitarbeiter betroffen ist oder einer, der auf das Programm keinen Einfluss hat, somit die Rundfunkfreiheit des Senders nicht beeinträchtigen kann und daher als normaler Arbeitnehmer gewertet werden könnte.
Zu prüfen ist demnach, zu welcher Gruppe der A gehört. Zu seinen Aufgaben gehört die Einbringung eigener Ideen für die von ihm moderierte Sendung. In dieser muss er seine Kenntnisse und Fähigkeiten nutzen, um den Zuschauer von dem Programm zu überzeugen, sodass er auch künftig einschaltet. Daher steht fest, dass der A selbst sowohl inhaltlich als auch gestalterisch auf das Programm Einfluss nimmt. Fraglich ist, welche Rolle es spielt, dass die endgültige Themenwahl dem Redakteur vom Dienst oblag und A insofern keine Entscheidungsgewalt hatte. Maßgeblich muss hier aber sein, dass A überhaupt in der Position ist, eigene Ideen und Akzente zu setzen, zumal bei getroffener Themenwahl die Präsentation wieder allein in As Machtbereich lag. A war also Programm gestaltender Mitarbeiter des B. Bei diesen Mitarbeitern kann ein Arbeitsverhältnis gegeben sein, wenn ihnen nur ein geringes Maß an Selbstständigkeit und Gestaltungsfreiheit verbleibt und der Sender über die Arbeitsleistung des Mitarbeiters verfügen kann. Zu prüfen ist daher zunächst, ob A über ein gewisses Maß an Selbstständigkeit und Gestaltungsfreiheit verfügt. Wie gesagt, ist er insofern eingeschränkt, als der Redakteur vom Dienst über die Themen entscheidet und die Texte des A redigiert. Allerdings ist hier nach obigen Maßstäben i.S.d. Art. 5 Abs. 1 GG





























