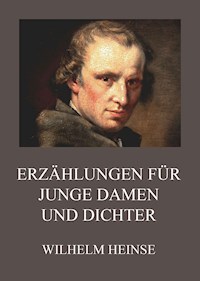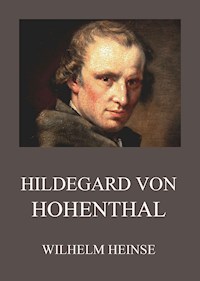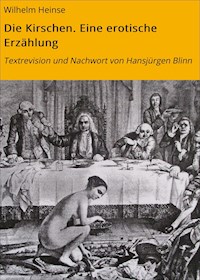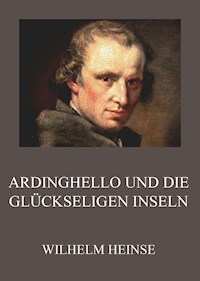
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Rom lernte Heinse Friedrich Müller, genannt Maler Müller kennen, der ihn mit der Kunst und der Geschichte der Stadt vertraut machte. Heinse verarbeitet seine Eindrücke in seinem Roman Ardinghello, den er 1786 veröffentlichte. Mit diesem Werk eröffnete er, 30 Jahre vor der Veröffentlichung von Goethes Italienischer Reise, deutschen Lesern einen neuen Blick auf Italien: der römischen Antike wurde die Renaissance als ebenbürtig gleichgestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ardinghello und die glückseligen Inseln
Wilhelm Heinse
Inhalt:
Wilhelm Heinse – Biografie und Bibliografie
Ardinghello und die glückseligen Inseln
Erster Band
Vorbericht zur ersten Auflage
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Zweiter Band
Vierter Teil
Fünfter Teil
Ardinghello und die glückseligen Inseln , W. Heinse
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849627515
www.jazzybee-verlag.de
Wilhelm Heinse – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 15. Febr. 1749 als Sohn eines Predigers zu Langewiesen in Thüringen, gest. 22. Juni 1803 in Aschaffenburg, besuchte das Gymnasium zu Schleusingen, widmete sich in Jena unter großen Entbehrungen dem Studium der Rechte, daneben besonders dem der alten und neuen Literatur, und begab sich dann nach Erfurt, wo er mit Wieland bekannt wurde, der auf seine poetische Richtung große Einwirkung gewann. Durch ein Bändchen »Sinngedichte« empfahl er sich Gleim, der den Mittellosen unterstützte und zu sich einlud. Von Erfurt nahm ihn 1771 ein abenteuernder Hauptmann, v. Liebenstein, der Heinses Talent vollends vergiftete, mit auf Reisen. Nachdem sich diese Verbindung gelöst hatte, lebte H. einige Zeit in der Heimat, erhielt 1772 durch Gleims Vermittelung eine Hauslehrerstelle in Quedlinburg und hielt sich seit 1773 bei Gleim in Halberstadt auf, den Namen Rost führend, bis ihn 1774 J. G. Jacobi als Mitarbeiter an der Zeitschrift »Iris« zu sich nach Düsseldorf berief. Hier war es, wo der Besuch der berühmten Bildergalerie seinen Kunstsinn weckte und er über seinen eigentlichen Beruf erst klar ward. Von unbezwinglicher Sehnsucht nach Italien erfüllt, trat er 1780, von Jacobi und Gleim unterstützt, die Reise dahin an, verweilte 8 Monate in Venedig und dann zumeist in Rom, wo er viel mit dem Maler Müller verkehrte, und kehrte Ende 1783 nach Düsseldorf zurück, wo er sein Hauptwerk: »Ardinghello«, schrieb. Im Oktober 1786 wurde er Lektor des Kurfürsten von Mainz und lebte hier bis 1792 in anregendem Verkehr mit J. v. Müller, G. Forster, Sömmering, Huber, verbrachte darauf ein Jahr in Düsseldorf, kehrte aber 1793 nach Mainz zurück, von wo er 1795 nach dem Baseler Frieden mit dem Kurfürsten nach Aschaffenburg übersiedelte. Auch unter Dalberg (seit 1802) blieb er hier als Hofrat und Bibliothekar tätig. Seine literarische Laufbahn hatte H. durch die Herausgabe der »Sinngedichte« (Halberst. 1771) eröffnet. Dann folgten die Übertragungen zweier obszöner Werke aus der ausländischen Literatur, die »Begebenheiten des Enkolp, aus dem Satyrikon des Petron übersetzt« (Schwabach 1773, 2 Bde.; ein Stück daraus: »Das Gastmahl des Trimalchio«, in Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 2616), »Die Kirschen«, nach Dorat (Berl. 1773), ferner »Laidion, oder die Eleusinischen Geheimnisse« (Lemgo 1774). In Rom übersetzte er in Prosa: »Das befreite Jerusalem« (Mannh. 1781, 4 Bde.) und Ariosts »Orlando« (Hannov. 1782, 4 Bde.). Darauf erschienen seine beiden Hauptromane: »Ardinghello, oder die glückseligen Inseln« (Lemgo 1787, 2 Bde.; 4. Aufl. 1838), worin er seine Ansichten über bildende Kunst und Malerei niederlegte (vgl. Jessen, Heinses Stellung zur bildenden Kunst und ihrer Ästhetik. Zugleich ein Beitrag zur Quellenkunde des »Ardinghello«, Berl. 1901) und »Hildegard von Hohenthal« (das. 1795–96, 2 Bde.; neue Aufl. 1838, 3 Bde.), seine Gedanken über musikalische Kunstwerke enthaltend. In »Anastasia und das Schachspiel« (Frankf. 1803, 2 Bde.; 3. Aufl. 1831) legte er in Briefform seine Gedanken über Schach- und Kriegsspiel nieder. Die H. häufig beigelegte Schrift »Fiormona, oder Briefe aus Italien« (Kreuznach 1803) ist nicht von ihm. Eine Sammlung seiner »Sämtlichen Schriften« veranstaltete H. Laube (Leipz. 1838, 10 Bde.); die neueste und beste ist die von Schüddekopf besorgte (»W. Heinses Sämtliche Werke«, Berl. 1902 ff., 10 Bde.). Als künstlerischen Kompositionen fehlt es Heinses Romanen an Geschlossenheit und Rundung, um so mehr zeichnen sie sich durch Macht und Glut der Darstellung aus. Die Reflexion über ästhetische Fragen überwiegt und beherrscht oft ganze Kapitel; aber diese Reflexion ist überraschend feinsinnig, wenn auch häufig allzu einseitig dem sinnlich Reizvollen zugekehrt. Die Handlung der Romane ist unübersichtlich, die Charakterzeichnung oberflächlich, insbes. die Frauengestalten nur sinnlich und ohne Gemüt. Heinses Kunstanschauungen gehen über Winckelmanns klassischen Idealismus hinaus und berücksichtigen im Sinne Herders die Bedingungen von Raum und Zeit. Das treueste Bild von ihm enthalten die »Briefe zwischen Gleim, H. und Johannes v. Müller« (hrsg. von Körte, Zürich 1806–08, 2 Bde.); der »Briefwechsel zwischen Gleim und H.« wurde besser von Schüddekopf herausgegeben (Weimar 1894–95, 2 Bde.). Vgl. Pröhle, Lessing, Wieland, H. (nach den handschriftlichen Quellen in Gleims Nachlaß, Berl. 1877); Hettner, Aus W. Heinses Nachlaß (»Archiv für Literaturgeschichte«, Bd. 10, Leipz. 1881); Schober, Johann Jakob Wilhelm H., sein Leben und seine Werke (Leipz. 1882); Sulger-Gebing, Wilhelm H., eine Charakteristik zu seinem 100. Todestage (Münch. 1903).
Ardinghello und die glückseligen Inseln
Erster Band
Vorbericht zur ersten Auflage
Es ist eine Lust, in den italienischen Bibliotheken herumzuwühlen: man spürt auch in den geringern zuweilen unbekannte Handschriften auf. Ob ich an dieser, von welcher ich hier die getreue Übersetzung liefre, einen guten oder schlechten Fund getan habe, mag jeder Leser für sich bestimmen. Ich entdeckte sie bei Cajeta in einer verfallnen Villa, die auf einer reizenden Anhöhe den zaubrischen Meerbusen beherrscht, unter alten Büchern und Papieren, als ich mit einem jungen Römer, während er die Verlassenschaft seines Oheims in Besitz nahm, einen glücklichen Herbst dort zubrachte.
Sollte verschiednen, wegen Ferne des Landes und der Zeit, einiges dunkel oder zu gelehrt vorkommen, so können sie solches bequem überschlagen und sich bloß an den Faden der Begebenheiten halten; in der Natur selbst müssen die Weisesten manches so vorbeigehn.
Vielleicht findet mein Freund noch anderswo das übrige der Geschichte; aus Familiennachrichten scheint hier Fiordimona, die man darin kennenlernen wird, ihre Tage beschlossen zu haben.
Der Verfasser setzt seiner Schrift folgende Fabel vor, um sinnlich zu machen, daß auch das Nützlichste unschuldigerweise schädlich sein kann:
›Ein wächserner Hausgötze, den man außer acht gelassen hatte, stand neben einem Feuer, worin edle campanische Gefäße gehärtet wurden, und fing an zu schmelzen.‹
Er beklagte sich bitterlich bei dem Elemente. ›Sieh,‹ sprach er, ›wie grausam du gegen mich verfährst! Jenen gibst du Dauer, und mich zerstörst du!‹
Das Feuer aber antwortete: ›Beklage dich vielmehr über deine Natur; denn ich, was mich betrifft, bin überall Feuer.‹‹
Geschrieben im Dezember 1785.
Bei der neuen Auflage dieses Werks ist zu erinnern, daß es 1785 fertig war. Einige Jahre nach Erscheinung desselben haben sich Begebenheiten zugetragen, die der Herausgeber, so plötzlich, nicht ahnden konnte. Man betrachte also manches nicht gegen ihn aus dem verrückten Gesichtspunkte. Auch hat er Gedanken, darin zerstreut, in spätern berühmten Schriften angetroffen; einen und den andern, seiner Meinung nach, zu weit getrieben.
Er will sich hiermit nur von dem vielleicht sonst künftigen Vorwurfe befreien, daß er sie daraus genommen habe; und weiß wohl, daß mehrere über gleiche Gegenstände ähnlich und gleich empfinden und urteilen können.
Eine Menge Druckfehler, die ein Nachdrucker häßlich vermehrte, sind ausgemerzt und einige Stellen ergänzt und berichtigt worden.
Und nun, Ardinghello, überlaß ich dich deinem Schicksal. Unter welschem Himmel erzeugt und in teutschem Wind und Wetter aufgewachsen, magst du darin bestehen oder vergehen.
Erster Teil
Wir fuhren an einem türkischen Schiffe vorbei, sie brannten ihre Kanonen los: die Gondel wankte, worin ich aufgerichtet stand; ich verlor das Gleichgewicht und stürzte in die See, verwickelte mich in meinen Mantel, arbeitete vergebens und sank unter.
Als ich wieder zu mir gekommen war, befand ich mich bei einem jungen Menschen, welcher mich gerettet hatte; seine Kleider lagen von Nässe an, und aus den Haaren troff das Wasser. »Wir haben uns nur ein wenig abgekühlt!« sprach er freundlich mir Mut ein; ich drückte ihm die Hände.
Das Fest war für uns verdorben. Meine vorigen Begleiter eilten nun von dannen. Wir ließen den Bucentoro zwischen tausend Fahrzeugen, unter dem Donner des Geschützes von allen Schiffen aus den Häfen, in die offne See stechen und den Dogen sich mit dem Meere vermählen; und er brachte mich mit seinem Führer nach meiner Wohnung.
Hier schied er von mir, ohne daß er mir weder sein Quartier noch seinen Namen sagen wollte; bloß aus der Mundart bemerkte ich, daß er ein Fremder war; jedoch versprach er, mich bald zu besuchen. Wir umarmten uns, und mir wallte das Herz, es regte sich eine Glut darinnen. Seine Jugend stand eben in schöner Blüte, um Mund und Kinn flog stark der liebliche Bart an; seine frischen Lippen bezauberten im Reden, und die Augen sprühten Licht und Feuer; groß und wohlgebildet am ganzen Körper, mit einer kühnen Wildheit, erschien er mir ein höheres Wesen.
Sein Bild wich den ganzen Tag nicht aus meiner Seele; ich konnte weder essen noch trinken und vor Ungeduld nicht bleiben.
Abends war Gondelrennen, das auf der See, was Wettlauf auf dem Lande; wodurch unsre Leute zu mutigen Schiffern sich bilden: ein Spiel, wo Stärke, Gewandtheit und Führung des Ruders den Preis davonträgt und welchem nur ein Pindar fehlt, es wie die olympischen zu verherrlichen. Der ganze Große Kanal schäumte und war Getümmel von schönem Leben; die Fenster der Paläste prangten mit ihren Tapeten, und die untergehende Sonne glänzte daraus wider in unzählbaren frohlockenden Gestalten.
Ich fuhr an den Markusplatz und ging darauf in Gedanken herum, bis die Nacht einsank und ihre Kühle verbreitete; die Erleuchtung der Buden mit den Kostbarkeiten der Messe gab eine neue Augenweide. Ich blickte in verschiedene Weinschenken unter den Hallen; in einer dünkte mich, den jungen Mann gesehen zu haben, der mich so großmütig der Gefahr entzog. Ich kehrte sogleich um und ging in meiner Maske hinein.
Es war der Versammlungsort der Künstler, und ich hatte recht gesehen. Sie schienen im Streite zu sein. Paul von Verona führte das Wort und sagte:
»Wer über ein Kunstwerk am richtigsten urteilen kann? Ich glaube, wer die Natur am besten kennt, die vorgestellt ist, und die Schranken der Kunst weiß. Ich verachte die Elenden, die von einem Manne von Geist und Welt verlangen, daß er ein Schmierer wie sie sein soll, eh er über ein Gemälde urteilen will. Das komische Approbatum sogar, welches die teutschen Roßtäuscher an die Pferde vor der Markuskirche mit ihren Namen schrieben, gilt mir zum Exempel mehr hier als jener ganze Troß; in Stutereien geboren und erzogen, fühlten sie die herrliche lebendige Pferdsnatur und wie jeder von den vier jungen mutigen Hengsten seinen eigenen Charakter hat. Die Vortrefflichkeit ihrer Köpfe und wie sie schnauben und ungeduldig sind, daß sie im Zügel gehalten werden, lernt man durch kein bloßes Gekritzel von Zeichnung. Selbst der größte Maler, der immer auf festem Lande lebte, kann über kein Seestück urteilen; und der erste beste Sultan, der liebt und noch Kraft in den Adern hat, darf eher sprechen aus seinem Serail über eine nackende Venus von unserm Alten als der fromme Fra Bartolommeo.«
»Wahr!« versetzte ein andrer, der deutlichen hellen und volltönigen Aussprache nach ein Römer; aber der Geschmack kömmt nicht von selbst. Man muß erst wissen, was Kunst ist, und den Vorrat der Kunstwerke mit naturerfahrnem Sinn geprüft haben, sonst geht man der Prozession mit der Madonna von Cimabue hinterdrein und bejubelt sie als das Non plus ultra. Die Leute glauben, es wäre nicht möglich, etwas Bessers zu machen, weil sie nichts Bessers gesehen haben; und denken, wie ihnen zumute wäre, wenn sie den Pinsel in die Hand nehmen sollten. Daher alle die albernen Urteile von sonst sehr gescheiten und gelehrten Männern über die Künstler der vorigen Zeit; sie schwatzten gleich vom Zeuxis und Apelles, weil sie platterdings von diesen Namen keinen sinnlichen Begriff hatten. Und so wird's bei den Ausländern, wo die Kunst anfängt und die Meisterstücke nicht vorhanden sind, mit euch und dem Tizian und Raffael ergehen; ihr werdet ebenso gemißbraucht werden.
Und dann muß man gewiß mehr als ein Werk und viel von einem Meister gesehn haben, ehe man nur ihn recht kennenlernt. So geht's auch mit den Menschen überhaupt; die trefflichen muß man studieren. Es ist nichts eitler und törichter als die Reisenden und Hofschranzen, die einen wichtigen Mann gleich beim ersten Besuch und Gespräch weghaben wollen.
Doch um nicht auszuschweifen: »Keiner kann einen Teil vollkommen verstehen, ohne vorher einen Begriff vom Ganzen zu haben, und so wieder umgekehrt. Jedes einzelne Gemälde zum Beispiel macht folglich einen Teil von der gesamten Malerei, so wie sie gegenwärtig in der Welt ist; und man muß wenigstens ihr Bestes überhaupt kennen, ehe man dem einzelnen seinen Rang anweisen will.«
Mein junger Mann erwiderte jetzt mit Feuer:
»Ich mag nicht bestimmen, inwiefern der Herr recht hat. Das Geräusch der Messe um uns erlaubt keine nüchterne Beratschlagung; ich glaube, Meister Paul hat das Seinige gesagt, damit, daß ein befugter Richter noch die Grenzen der Kunst kennen muß.
Allein, ihr Lieben, jede Form ist individuell, und es gibt keine abstrakte; eine bloß ideale Menschengestalt läßt sich weder von Mann noch Weib und Kind und Greis denken. Eine junge Aspasia, Phryne läßt sich bis zur Liebesgöttin oder Pallas erheben, wenn man die gehörigen Züge mit voller Phantasie in ihre Bildungen zaubert: aber ein abstraktes bloß vollkommnes Weib, das von keinem Klima, keiner Volkssitte etwas an sich hätte, ist und bleibt meiner Meinung nach ein Hirngespinst, ärger als die abenteuerlichste Romanheldin, die doch wenigstens irgendeine Sprache reden muß, deren Worte man versteht.
Und solche unerträglich leere Gesichter und Gestalten nennen die armseligen Schelme, die weiter nichts als ihr Handwerk nach Gipsen erlernt haben und treiben, wahre hohe Kunst; und wollen mit Verachtung auf die Kernmenschen herunterschauen, die die Schönheiten, welche in ihrem Jahrhundert aufblühten, mit lebendigen Herzen in sich erbeutet haben.
»Dies ist der wahre Weg«, beschloß der Römer. »Inzwischen kann man über nichts urteilen, wovon man kein Ideal hat; und dies entwirft der Verstand mit der Wahl aus vielem.«
Hier trennte sich die Gesellschaft; Paul ging weg und nahm den Jüngling in Arm. Ich folgte nach. Sie zogen den Platz ein paarmal herum und hörten da und dort der Musik und den Scherzen lustiger Truppen zu. Beim Eingang in die Merceria verließ ihn endlich Paul; ich nahm meine Maske ab und machte mich an ihn.
Er erkannte mich gleich und freute sich, daß mein Zufall keine schlimme Folgen gehabt hätte. Ich bezeugte ihm vom neuen meine Dankbarkeit und wünschte ihm irgendworin für seine edle Tat Dienste leisten zu können.
Dies setzte ihn in Verlegenheit. »Was hab ich getan,« erwiderte er, »das ich nicht bei jedem andern Erdensohn getan hätte? hätte tun müssen? Wie mancher Bube holt ein Stück Geld vom Sand aus der Tiefe und stürzt sich noch obendrein von Höhen in die Flut. Übertriebnes Lob für Schuldigkeit macht die Menschen feig und eitel. Das ist ein elendes Volk an Heldenmut und Verstand, wo bei jeder Kleinigkeit eine Ehrensäule muß aufgerichtet werden. Was geschehen ist, sei geschehen!«
»Groß auf Ihrer Seite,« verfügt ich, »und gewiß ist der Rettende schon in sich der Göttliche. Inzwischen glaub ich aber doch, daß die Dankbarkeit das festeste und sanfteste Band der Gesellschaft sei, und auch ein wenig Ausschweifung darin eine Nation immer liebenswürdig und den wackern Männern derselben das Leben froher mache.«
Er sah mich hierbei mit einem neuen seelenvollen Blick an, und wir faßten uns traulicher. Ich bat ihn inständig, diesen Abend bei mir zu bleiben; und wir ließen uns am Broglio über den Kanal setzen.
Wir aßen und tranken, und das Tischgespräch wurde immer lebendiger, sobald die Bedienten uns verlassen hatten. Der erste Vorwurf war der heutige Tag. Er rühmte die Klugheit unsers Senats, daß sie sich aus dem bitterbösen Kriege nach dem Bündnisse bei Cambrai und jetzt aus dem Überfalle der ganzen türkischen Macht so glorreich gezogen hätten und in der alten Würde noch mit dem Meere vermählen könnten. Nur tat es ihm leid, daß der Cypernwein in Italien nun seltner und teurer werden würde.
»Wir sind unter vier Augen«, erwidert ich, um ihm das etwanige Mißtrauen gegen einen Nobile zu benehmen; denn ich fühlte den Zug der Liebe unwiderstehlich. »Nach jenem unglückseligen Bunde war ein arger Staatsfehler nur einigermaßen wieder gutgemacht, den man vorher hätte vermeiden müssen. Und auch jetzt würden wir das süße Königreich, die Insel der Liebe, nicht eingebüßt haben, wenn man dem Sultan, als der Silen noch Statthalter in Cilicien gegenüber war, einige Fässer von ihrem Nektar wohlfeiler vergönnte; und die christlichen Freibeuter mit seinen weggekaperten schönen Knaben und Sklavinnen nicht allzu sicher zu Famaugusta in der Nachbarschaft einliefen.
Unsre Braut scheint uns übrigens nicht mehr so treu bleiben zu wollen, wenn man auf Vorbedeutungen gehen darf. Sie wissen, daß das Fest schon vorgestern sollte gehalten werden; aber die wilde Göttin weigerte sich, war Aufruhr und stürmte und warf ein Dutzend ertrunkner Schiffbrüchigen zum Großen Kanal herein bis an den Palast des alten Dogen. Papst Alexander der Dritte, der noch Gewalt über die Mutwillige hatte, ist leider längst gestorben; und Kolumb, der Held, dessen Genua nicht wert war, und andre welsche Piloten haben dem portugiesischen Heinrich und den kastilianischen Fürsten die wahre Amphitrite ausgekundschaftet, wogegen unsre nur eine Nymphe ist. Und überhaupt gibt sie sich nur den Tapfern und Klugen preis, wie alle freie Schönheit, und es hilft da keine Zeremonie. Wir hätten uns besser um unsre Braut bewerben sollen, anstatt uns um Steinhaufen viel zu plagen, nachdem sie uns einmal günstig war.«
»Vielleicht ist dies Schicksal«, antwortete er schalkhaft-bitter; »Ihr Doge vermählt sich vermutlich nicht umsonst so oft und trägt von jeher die phrygische Mütze mit Hörnern! und dann ist so eine Zeremonie gut fürs Volk und macht ihm Mut; und was einmal so prächtige Gewohnheit ist, läßt sich so leicht nicht abschaffen. Ihr Herrn tut vielleicht bald wieder einen andern Fang im Archipelagus und fischt ein neues Königreich. Es ist genug, daß man eins hundert Jahre lang ruhig besitzt. Dreimalhunderttausend Zechinen kann man hernach leicht für den Genuß bezahlen; dreitausend Zechinen fürs Jahr war die Residenz der Venus selbst wohl unter Brüdern wert. Dies hat euch eine Venezianerin vermacht, als ihr Gemahl, der König, starb und seine Kinder, eins nach dem andern, kurz darauf in eurer Stadt: nun ist die Reihe an euch Jünglingen, eine Königin in Osten zu heuraten.«1
Dieser Stachel schnitt ein und verwundete mein damals noch allzu parteiisch-vaterländisches Herz. Mir geschah, als ob ich vor der Zeit vernünftig gewesen wäre; doch gefiel mir überaus seine Freimütigkeit gegen mich. Er bemerkte mit scharfem Blicke gleich das Unheimliche und fuhr fort: »Aber wir sind doch immer in Venedig, und die Mauern haben da Ohren; sprechen wir von etwas anderm!«
Nach einer kleinen Stille fing er an: »Ich muß Ihnen doch etwas von mir sagen, damit Sie wissen, wer ich bin und wie ich mit andern zusammenhange.
Ich bin ein Maler aus Florenz; und halte mich hier auf, um nach den toskanischen Gerippen mich am venezianischen Fleische zu weiden. Tizian hat den wesentlichen Teil von der Malerei, ohne welchen alles andre nicht bestehen kann. Es ist freilich da, aber ungesund und siech; sei's noch so himmlisch und vortrefflich oder als Gaukelspiel ohne Wahrheit. Wer nicht wie Tizian zu Werke schreitet, wird auch nie ein wahrhaft großer Maler werden. Die allgemeine Stimme entscheidet hier, nicht die Künstler. Tizian ergreift alle, die keine Maler sind; und diese selbst im Hauptstücke der Malerei, welches platterdings die Wahrheit der Farbe ist, so wie die Zeichnung der wesentliche Teil der Zeichnung. Malen ist Malen: und Zeichnen Zeichnen. Ohne Wahrheit der Farbe kann keine Malerei bestehen, eher aber ohne Zeichnung.«
»Wenn ich als Laie bei Euch strengen Herrn ein Wort reden darf,« fiel ich ein, »so mag Ihnen das venezianische Fleisch nach den Knochen und Sehnen des Michelangelo desto besser schmecken und bekommen.«
»Dies ist lauter Sophisterei«, antwortete er. »Der Maler gibt sich mit der Oberfläche ab, und diese zeigt sich bloß durch Farbe; und er hat mit dem Wesentlichen der Dinge im eigentlichen Verstande wenig zu schaffen. Wer sich einmal in diese Grillen verliert, kann so leicht nicht wieder herauskommen. Das Zeichnen ist bloß ein notwendiges Übel, die Proportionen leicht zu finden: die Farbe das Ziel, Anfang und Ende der Kunst. Es versteht sich, daß ich hier vom Materiellen spreche. Dem Gerüste den Rang über das Gebäude geben zu wollen ist ja lächerlich; dem Zeichen, welches menschliche Schwachheit erfand, vor der Sache selbst, wenn ich so reden darf. Das Hohle und das Erhobne, Dunkle und Helle, das Harte und Weiche, und Junge und Alte, wie kann man es anders herausbringen als durch Farbe? Form und Ausdruck kann nicht ohne sie bestehen. Die schärfsten und strengsten Linien, selbst eines Michelangelo, sind Traum und Schatten gegen das hohe Leben eines Tizianischen Kopfs. Profile kann jeder Stümper abnehmen, da braucht sich der andre nur vors Licht zu setzen, richtiger als sie ein Raffael aus freier Hand zeichnet; aber das Lebendige mit allen den feinen Tinten in ihrer Vermischung und schwindenden Umrissen, die keine bloße Linie faßt: da gehört Auge und Gefühl dazu, das die Natur nur wenigen gab. Wer sich einmal an das Leichte gewöhnt, der kömmt mit dem Schweren gar selten fort.«2
»Sie mögen im Grunde recht haben«, versetzt ich darauf; »nur verfällt man bei Ihrer Art leicht in den Fehler, daß man sich allzusehr an das Materielle hält und das Geistige darüber außer acht läßt. Inzwischen möchte Ihnen der Römer – wahrscheinlich war es einer diesen Abend im Weinhause –, was Sie sagten, scharf bestreiten.«
»Der Vorurteile sind noch mehr in der Kunst, die ebenso hartnäckig verfochten werden«, sprach er ferner. »Was das Geistige betrifft, das lernt sich und verlernt sich nicht; da gehört guter Instinkt aus Mutterleibe dazu und vollkommne Gegenstände von außen herum. Deuten und hinführen kann man wohl; aber wo kein Zug, keine innere Richtung ist, kömmt lauter Manier hervor, dem Menschen, der seinen Durst löschen will, soviel als nichts und überdrein vergebliche Mühe; denn er hat sich an den leeren Schein hinbemühen und untersuchen müssen.
Der Römer hat viel Verstand; nur malen soll er nicht: er hätt ein Schriftsteller werden sollen; jetzt aber ist er einmal im Geleise und schwatzt sich durch. Dieser ahmt eine Natur nach, welche nur noch in Steinen existiert, eine Natur ohne Farbe mit Farbe: und will täuschen! eine feste starre Bewegung von den Millionen Lebendigen, die immer um uns herum entstehen! weil es freilich jedermann leichter und dem schachmatten Stubensitzer bequemer ist, einen bretternen Hirsch zu schießen als einen, der durch die Wälder streicht und über Büsche und Gräben setzt; zumal da wir heutiges Tages meist verbotene Jagd haben.
Er hat ein langes und breites an der Hochzeit zu San Giorgio Maggiore von unserm herrlichen Paul getadelt. Christus mit seinen Aposteln sitzt freilich im Mittelgrund am Tische ziemlich unbedeutend; und sie sind bloß deswegen da, weil sie dasein müssen, weil wir andern Menschenkinder uns keinen sinnlichen Begriff von den Gestalten dieser Wundermänner machen können.
Die Hauptsache aber bleibt immer der Schmaus, das Fest und der Wein über alle Weine; erste erfreuliche Bekräftigung unsrer Religion nach dem Johannes. Und in dieser Rücksicht ist das Stück voll Laune und die Begebenheit darin erzählt wie eine spanische romantische Novelle. Die Hauptfiguren sind ein Tisch mit Spielleuten, die auf lieblichen Instrumenten Musik machen. Paul selbst spielt eine Geige der Liebe; Tizian den Regenten der Harmonie, den Baß; Bassano, Tintorett andere Instrumente. Sie sind meisterhaft gemalt, haben treffliche Gestalten, passenden Ausdruck und sind schön gekleidet. Am Tische der Braut ist eine Sammlung der ersten Menschen dieser Zeit, alles voll Chronikwahrheit und Laune; sie müssen ihm das Drama aufführen. Die Luft im Hintergrunde ist gar leicht und heiter. Architektur, Gefäße und Speisen verzieren sehr gut. Die Beleuchtung breitet das Ganze auseinander und scheint vollkommen natürlich. Wer sieht so etwas nicht gern und weidet seine Augen daran!
Derselbe hat groß Ärgernis genommen an der Verletzung des Kostüms in der Familie des Darius beim Alexander mit seinen Helden, und bejammert, daß soviel Herrlichkeit dadurch gestört werde.
Sie kennen das Stück zu gut, da es bei Ihren Verwandten sich befindet. Man kann es den Triumph der Farben nennen; mehr Harmonie, mehr Pracht, mehr Lieblichkeit ist nicht möglich schier zu zeigen. Außerdem herrscht noch Wahrheit des Ausdrucks in allen Köpfen, die meistens Porträte sind. Wenn man nicht an die alte Geschichte denkt, und glaubt, es wäre der Sieg eines Helden der neuern Zeiten: so ist es ein wahrhaftes Meisterstück durchaus. Die Architektur im Hintergrunde gibt den Ton zum Ganzen; und es gehörte so tiefes Gefühl im Auge von Farbe, Pracht und Harmonie derselben dazu, wie Paul hatte, um auf einem solchen weißen Grunde die Gesichter und Stoffe so hervorgehen und leben zu lassen. Die Gruppe der vier weiblichen Figuren, die der Alte in eine Pyramide bringt, ist durchaus reizend, die Gesichter lebendig und von wunderbarer Frischheit. Alexander hat einen schönen Jünglingskopf, der freilich eher Weibern gefallen kann als die Welt bezwingen. Daß er ganz bis auf die Füße von oben herab in Purpur überein gekleidet ist, macht zwar einen großen roten Fleck bei längrer Betrachtung; doch hebt es ihn als Hauptfigur hervor. Sie sehen, daß im Wein die Wahrheit liegt! aber Paul kann sie vertragen. Parmenion hat einen herrlichen Kopf und ein zauberisches gelbes Gewand; die Prinzessinnen haben schön geflochten blondes Haar. Und welche Menge Figuren, wie auf der Hochzeit, fast alle in Lebensgröße! Man kann dies wohl das prächtigste und zauberischeste Gemälde nennen, was Farben betrifft; mit jedem Blicke quillt neuer Genuß daraus fürs Auge; nächst dem noch göttlichern und reichern Hingang zum Tempel der Madonna als Kind in der Scuola della Carità von Tizian, dem Triumph aller Malerei. Sie werden lange unübertroffen bleiben und einzeln in der Welt dasein.
Die Vernachlässigung des Kostüms ist eigentlich ein Fehler für die Antiquaren; denn der große Haufe weiß nichts davon und merkt's nicht. Freilich wär es besser, die Künstler wählten keine alte Geschichten, wenn sie Naturwahrheit und Farbenpracht in den Gewändern zeigen wollten; griechische Gestalt und leichte Kleidung ist uns ganz entrückt. O wie verlangt mein Herz, jene glückseligen Inseln und das feste Land auf beiden Seiten noch heutzutag zu sehen und wie das heitre milde Klima noch jetzt dort das Lebendige bildet! Ach, wir sind so weit von der Natur abgewichen und von der wahren Kunst zurück, daß wir fast insgesamt einen bekleideten Menschen für schöner halten als einen nackten! Das kostbarste, prächtigste, feinste und niedlichste Gewand ist für den echten Philosophen und das Wesen, das nach klarem frischen Genuß trachtet, ein Flecken, eine Schale, die ihn hemmt und hindert.«
»Hätt ich Sie doch damals schon gekannt,« sagt ich ihm hierauf, »als ich diesen Zug begann: so wär Ihr Wunsch erfüllt! So wie Sie mich hier sehen, hab ich dieses alles schon durchwandert; leider zu früh. Mein Vater nahm mich mit sich nach Griechenland, wohin er von der Republik abgeschickt wurde; und ich blieb mit ihm daselbst drei Jahr. Das Beste, was ich zurückgebracht habe, ist Kenntnis des Griechischen; ich lese das alte ziemlich geläufig und schreibe und spreche das neue.«
Hier sprang er auf vor Freuden, ganz außer sich, so daß die Gläser vom Tische flogen, und rief: »O glücklicher, seltner, wunderbarer Zufall! so jung und schön, und voll Verstand und Erfahrung! wir müssen ewig Freunde sein, und nichts soll uns trennen; du bist der Liebling meiner Seele.«
So fiel er mir um den Hals. Uns verging auf lange die Sprache, und wir waren zusammengeschmolzen durch Kuß und Blick und Umarmung.
Endlich nahm er wieder das Wort und sagte: »Hier ist nichts als wir! und alles andre in der Welt steht uns nur da zum Dienst.«
Ich war ganz erschüttert, durchbrannt von seinem Feuer, seiner Heftigkeit. Es wurde überhaupt wenig mehr gesprochen außer unzusammenhangende Reden im lyrischen Taumel, Akzente der Natur. Wir glühten beide von Wein und Leidenschaft: er riß sich los, schon spät in der Nacht, mit den Worten: »Morgen sind wir wieder beisammen.«
Ich legte mich zu Bette. Herz und Seele und alles in mir war wie ein Bienenschwarm, so sumsend, stechend heiß und ungeduldig; ich schlummerte wenig Stunden und fuhr oft dazwischen auf.
Den andern Morgen kam er bei guter Zeit. Mich überlief bei seinem Anblick ein leichter Schauder vor seinem gestrigen Ungestüm; aber er erschien mir von neuem so liebenswürdig, daß ich hingerissen wurde und dem unwiderstehlichen Zuge nachfolgte.
Ich hatte noch keinen Menschen gekannt, mit welchem ich so zusammenstimmte, in der Art zu empfinden und zu handeln; nur war er reicher und stärker an Natur als ich, seine Seele voller, aber auch unbändiger, und seine Geburt warf ihn in andre Umstände, unter andre Menschen, in eine andre Laufbahn. Wer einen Freund ohne Fehler finden will, der mache sich aus dieser Welt heraus oder geh in sich selbst zurück, die Vollkommenheit erscheint hienieden nur in Augenblicken, und diese allein sind unser Genuß. Ein großer Geist, ein edel Herz wiegt manches Laster auf, wohinein uns die Schlechtigkeit bürgerlicher Verfassungen stürzt.
»Wir schieden gestern voneinander wie im Rausche«, trat er ins Zimmer. »Glück ist die größte Gabe, die Sterblichen zuteil werden kann, nur muß man es mit Verstand brauchen.«
Nachdem wir einigemal stillschweigend auf und ab gegangen waren, fragte er mich: »Habt Ihr nie etwas von Kunst getrieben?« Ich antwortete ihm, daß ich nach der hiesigen Erziehung zeichnen gelernt hätte, Augen, Mäuler, Nasen, Ohren und Gesichter, und Hände und Füße nach Vorschriften; im Grunde soviel als nichts: denn bis zum eigentlichen Lebendigen wär ich nicht gekommen; welches mir herzlich leid tue! mich reize sie unendlich, und ich möcht es gern darin bis zu einer gewissen Fertigkeit für mein eigen Vergnügen gebracht haben. Jetzt mach ich nur noch zuweilen die Hauptumrisse schöner Gegenden, der Erinnerung wegen.
»Da ist noch nichts verloren«, fuhr er fort; »wir wollen einander helfen. Alle Künste sind verwandt; sie zusammen erhöhen und verstärken die Glückseligkeit des Menschen, bilden sein Gefühl, mehr als alles, für die Schönheiten der Natur und setzen ihn über das Tier. Wie fangen wir es am besten an, damit Ihr so geschwind als möglich Euch diese Fertigkeit erwerbt? Ich denke,« fügt' er scherzhaft hinzu, »Ihr braucht mich zum Modell, nach kurzen Wiederholungen von dem, was Ihr schon wißt; so wie ich Euch dann zuweilen bei meiner Arbeit.
Im Griechischen hab ich mich hauptsächlich nur mit den Dichtern beschäftigt, mit dem Homer, Pindar, Sophokles, Euripides, weil mein Lehrmeister selbst ein Dichter war; und dabei aus den Geschichtschreibern nur die Beschreibungen der glänzenden Siege über die Perser gelesen. Die Schätze der Weisheit im Aristoteles, Plato, Xenophon kenn ich meistens nur aus Gesprächen und vom Hörensagen und habe wenig von den Quellen selbst getrunken. Wir könnten damit manchen folgenden schönen Sommerabend uns himmlisch ergötzen, wenn Euch dazu Zeit übrigbliebe.
Mein eifrigstes Verlangen aber ist, daß Ihr mich in dem noch Lebendigen dieser Göttersprache, im Neugriechischen, unterrichten möchtet; damit ich bald mit Bequemlichkeit und größerm Nutzen und Vergnügen eine Wallfahrt beginnen könne nach dem echten klassischen Boden.
Ihr habt genug am Zeichnen, wie einer, der selbst kein Dichter werden, sondern nur die Meisterstücke der Alten und Neuen in ihrer ganzen Vollkommenheit fassen will, an der Poetik des Aristoteles. Jede Kunst, bis zum letzten Ziel erlangt, ist etwas anders und erfordert eines Menschen ganzes Leben. Für Euch soll's nur Spiel sein; Ihr seid zu Höherm bestimmt und müßt glänzen wie der Morgenstern in Eurer Republik. Dies wird immer neuen Reiz in unsre Freundschaft bringen, und wir werden leben in der Natur, soviel uns mit Sinnen, Phantasie und Verstand vergönnt ist.«
»Du erfüllst mich mit Hoffnung und Freude«, antwortet ich ihm. »Mein Vater ist jetzt in Dalmatien, und ich bin mit meiner Mutter allein. Sie zieht bald aufs Land, vielleicht noch diese Woche. Die Gegend ist eine der angenehmsten der ganzen Lombardei. Das Gut, wohin wir wollen, liegt am Lago di Garda, wo Catull, vor welchem Cäsar sich neigte, zuweilen vom römischen Taumel ausruhte. Er sang von dem Orte:
Peninsularum, Sirmio, insularumque
Ocelle,quascunque in liquentibus stagnis
Marique vasto fert uterque Neptunus.3
Willst du mich begleiten: so werden wir nach dem Pindar in die Burg des Kronos gelangen, umweht von kühlen Seelüften; wo in schattigen Gärten Goldblumen funkeln, diese der Erd entsprießen und anmutigen Bäumen, andre aber der klare Bach erzieht. Wir wollen mit ihren Angehängen und Kränzen uns die Arme umflechten und die Schläfe umwinden.
Vorher aber muß ich dich meiner Mutter vorstellen; jedoch du mußt hübsch gescheit sein. Sie ist eine gar gute Frau, die mich zärtlich liebt. Sie weiß schon, daß ein junger Mensch mich aus dem Kanale gerettet hat, und es wird ihr gefallen, daß du es bist. Sie hat große Freude an schönen Madonnen; und wenn du ihr eine in ihre Kapelle malst und fromm bist: so hält sie dich wie ein Kind.«
Es ging hierbei eine sonderbare Bewegung in ihm vor, die mir lange hernach erst erklärlich wurde; er sah mich an, neugierig mit heißen Blicken, und fragte: »Also nicht weit vom Ausflusse des Mincio ist Euer Landsitz?«
»Wenig davon«, versetzt ich. Darauf ging er nachdenkend einigemal mit mir auf und ab. Endlich sprach er: »Gut; ich reise mit euch und male deiner Mutter eine Madonna, wenn ich ihr anstehe. An Gescheitheit bei ihr soll's hoffentlich nicht ermangeln.«
Es wurde beschlossen, ihn den Abend noch ihr vorzustellen; bei Tische wollt ich alles einlenken.
Hier schied er von mir. Ich brachte die Sache vor; und meine Mutter war's gleich zufrieden, ohne ihn noch gesehen zu haben, aus Willfährigkeit gegen mich.
Mir schwellte aber die neue Bekanntschaft immer mehr das Herz; einen jungen Maler der Art hatte ich noch nicht gekannt. Ich war überrascht; es ging alles so schnell fort, und ich konnte keiner gehörigen Überlegung Raum geben.
Beim ersten Blick und Gespräche schon gefiel er meiner Mutter, wie ihr noch kein Fremder gefallen hatte. Hier erfuhr ich, daß er sich Ardinghello nannte; ich hatte, voll von ihm, nicht daran gedacht, ihn von neuem um seinen Namen zu befragen. Er gab sich hernach verschiedne andre; doch dieser soll ihm forthin bleiben.
Den folgenden Morgen sah ich einige angefangne Gemälde von ihm. Sein Lebendiges war frisch und meisterhaft in der Arbeit und kam dem Tizianischen ziemlich nahe; doch war es nicht Manier, sondern sein eigen und verschieden nach der Natur: wenig Gewand, das meiste nach dem Nackenden; Studien von Mädchenköpfen, voll Geist und Lieblichkeit, und Brüsten und Leibern, und Rücken, und Schenkeln und Beinen, nackten Buben im Baden, Laufen und Balgen. Für Bezahlung, sprach er, und nach andrer Belieben hab er noch nichts gemacht. »Das Weitre«, fügte er wie unbedeutend hinzu, »will ich dir einmal erzählen, wenn wir mehr in Ruhe sind.«
Er besuchte die Tage darauf den alten Greis Tizian noch einmal und seine Freunde, und zu Ende der Woche reisten wir ab. Meine Mutter fuhr mit ihren Leuten voraus und wir hinterdrein, weil wir zu Vicenza uns einen Tag wegen der Gebäude des Palladio aufzuhalten gedachten. Wegen des Griechischen nahm ich noch die Bücher mit, die nicht in der Bibliothek auf dem Gute sich befanden; und er das nötige Gerät zum Malen und Zeichnen.
Als wir eine Strecke vom Großen Kanal entfernt waren, setzte sich Ardinghello aufs Verdeck der Barke und blickte tief gerührt nach der Stadt mit unverwandten Augen; die Feuchtigkeit trat hinein, und sein Herz ward erweicht. Seine Seele schien zu ahnden, daß er sie nie wieder sehen sollte. So wälzen die Schicksale den Menschen fort wie die Fluten des Meers einen schwachen Trümmer! Die Sonne war eben aufgegangen, und die Türme, Kirchen, Paläste und Inseln lagen da im dünnen Nebel.
Mir war wohl, daß ich herauskam. Im Winter ist Venedig angenehm, weil die Menschen so enge beisammen sind und alles zur Ergötzlichkeit treibt, Lage und Regierung; aber im Sommer ist's ein ungesunder und gefährlicher Ort. Ein Eingeborner kann die Wahrheit besser wissen als ein Dichter aus Neapel. Es mag der Natur nach ein ganz andrer Unterschied sein zwischen Rom und Venedig, ob es gleich prächtig klingt:
Illam homines dices, hanc posuisse deos.4
Wenn einer die Geschichte kennt und da gelebt hat und es beim Ausflusse der Brenta vom Ufer betrachtet: so sieht es richtiger aus wie ein endlich sichrer Zufluchtsort von dem Lande weggeprügelter und weggescheuchter furchtsamer Hasen, die sich hernach groß und zu geflügelten Löwen gemacht haben, als ihnen die Feinde übers Wasser nicht nachkonnten und sie von fern sicher sehen mußten. Eine unüberwindliche Festung ist's gewiß, weil durch die Sümpfe vom Land aus nichts anders als kleine Barken anländen können und man von der See her in die Häfen den Faden der Ariadne braucht; und eben weil es unüberwindlich und unzukommbar ist außer Verräterei, trägt es, vom Meer umgeben, eine gewisse Majestät an sich. Götter aber flüchten sich nicht in Sümpfe. Inzwischen hat Sannazar der reizenden Dichtung wegen seine sechstausend Dukaten doch verdient. Die Wahrheit bezahlt man selten so teuer.
Der große Doge Peter Ziani hat sie gar wohl erkannt, als er den kühnen Entschluß faßte, noch zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts eine neue Völkerwanderung anzustellen. Konstantinopel ist ohne Streit ein glückseliger Plätzchen auf diesem Erdboden. Die Venezianer hatten es damals mit den Franken eingenommen, und wir besaßen mehr von Griechenland als jetzt. Er riet mit stärkern Gründen als je Demosthenes, diese Lagunen zu verlassen und dort uns anzupflanzen; und Dido und Äneas waren dagegen Luftgestalten. »Wenn der Mond mit seiner Ebbe und Flut unsern Kanälen das Wasser entzieht,« sprach er im Großen Rate, »der Schlamm sich zeigt und seinen Gestank ausdünstet: welche gute Nase kann da vor Ekel auf den Wegen bleiben? Sind nicht immer unsre Lazarette voll und die jahraus, jahrein nicht von dannen schiffen wie gefangen? Überdies haben wir Erdbeben, noch außerdem, daß das Meer oft hereinstürmt und unsre Zisternen und Warenlager verderbt. Und welch ein Wohnsitz, um auszuhalten, wo nichts als schlechte Fische Nahrung gibt, weder Korn noch Wein und Öl wächst, weder Baum hervorkömmt, noch trinkbar Wasser quillt, wo alle Elemente verdorben sind, Wasser, Luft und Erd und Feuer? und von allen Seiten Feindschaft um uns her? Dort sind wir gleich in unsern Besitzungen, und welche Aussichten in die Zukunft!« Jedoch überwand ihn der Prokurator von San Marco, der Greis Anzolo Falier, unter fünfhunderten mit einer Stimme, indem er nach dem Aristoteles behauptete: daß die Festigkeit, ohngeachtet aller Übel bei einer Hauptstadt, der glücklichen Lage, ohne dieselbe, vorzuziehen wäre; und daß gerade die Unfruchtbarkeit ein Volk zur Tapferkeit zwänge und über andre erhöbe.
Darin bestand unsre Unterhaltung bis nach Padua, und Ardinghello beschloß mit folgenden Worten: »Wo die Verständigen nicht herrschen, ist keine Staatsverfassung gut; jedoch mit dem Unterschiede, daß zum Exempel bei einer Million Bürgern in einer Demokratie fünfmalhunderttausend und etliche Narren über viermalhunderttausendundneunhundert gescheite Leute den Ausschlag geben: und in einer Monarchie ein Narr neunmalhunderttausendneunhundertundneunundneunzig Philosophen ins Verderben stürzen könnte, wenn sie nach dem auf Schulen gelehrten Staatsrechte keine Rebellen sein wollten.«
Als wir von Vicenza weggereist waren, sprachen wir viel über die Gebäude zu Venedig und den Palladio. Ardinghello hielt Venedig für einen der merkwürdigsten Örter in der Baukunst; und sagte: hier wäre nicht nur ein Stil, sondern man sähe darin die Geschichte derselben der neuern Jahrhunderte; und erkenne immer, daß ein Senat von vielen Personen da herrsche und nicht ein einzelner oft elender Mensch ohne Talent und Geschmack, weil man nichts ganz Schlechtes unter den öffentlichen Gebäuden fände wie in andern Residenzen.
Er liebte den Palladio vor allen neuern Baumeistern, nannte ihn eine heitre Seele voll des Vortrefflichsten aus dem Altertum, und daß er davon mitteile, und aus sich selbst, soviel sich für seine Zeitverwandten schicke.
In Vicenza wird leider von ihm nichts recht ausgebaut, und die Gebäude gleichen fast nur angefangnen Modellen von seinen Ideen; aber welch ein Wunderwerk ist der Palast Cornaro am Kanal! wie schön die Kirchen zu San Giorgio und al redemtore in Venedig! und die Brücke zu Vicenza über den Bacchilion, so leicht und reizend und sicher in ihrem Bogen wie ein beherzter Amazonensprung! Wie angenehm das durchbrochne Geländer, damit man das erfreuliche Wasser dadurch wegströmen sehe!
Jedoch gefiel Ardinghello das Rathaus nicht, obgleich es Palladio selbst unter die schönsten Werke neuerer Kunst setzt. Die Fassade, an und für sich richtig und schön, glich doch nur einer Schminke, die einer alten Matrone aufgetragen wäre; die Bogen derselben entsprächen nicht denen des gotischen Gebäudes, das überall schief durchguckte. Julio Romano hätte, damals schon älter und erfahrner, mehr Geschmack gezeigt, als er eine meisterhafte gotische dazu erfand. Es sei etwas anders, einen Riß auf dem Papier anschauen und ein Gebäude aufgemauert in der Luft; dies haben die Ratsherrn, die des Palladio seinen wählten, wie viele Große, die bauen lassen, nicht gewußt.
Unser Gespräch lenkte sich endlich auf die Architektur überhaupt; und er sagte, soviel ich mich erinnere:
»Von Schönheit in der Baukunst hab ich wenig Begriff, weil sie mir ganz außer der lebendigen Natur zu sein scheint. Höchstens entspringt ihr Reiz bloß aus der Metaphysik davon, wenn ich das Wort hier brauchen darf, und nicht aus Wirklichkeit; deswegen ihre Verschiedenheit bei allen Völkern, die sich einander nicht nachahmen. Eine strenge Theorie davon verliert sich in das Dunkel der Schöpfung. Schönheit ist, was Vergnügen wirkt; was bloß Schmerz stillen und verhüten soll, braucht eigentlich keine Schönheit an und für sich zu haben. So geht's mit den Gebäuden; sie halten bloß Ungemach ab. Sobald das Wetter gut ist, mag ich in keinem bleiben und will ins freie Feld. Alles muß auf Ungemach, Krankheit, Feindseligkeit und Bedürfnis von Zusammenkünften berechnet werden; dies bestimmt hernach ihre Vollkommenheit. Harmonie, Ebenmaß, Übereinstimmung mit jedes Zweck macht dessen Schönheit, wenn man das, was nichts Lebendiges nachahmt, so nennen will;5 was sollen uns alle die überflüssigen, unbedeutenden Zieraten? Ein Gebäude ist ein Kleid, das Menschen und Tiere vor bösem Wetter schützt, und muß darnach beurteilt werden.
Geht man in die Wildheit zurück: so findet man Grotten und Waldung, und durchgerißne Felsen, um über Abgründe von Strömen zu gelangen. Dies hat zwar der sittliche Mensch zuerst nachgebildet, und noch jetzt sind die Spuren da unter tausend gemachten Bedürfnissen; wir ahmen die ursprünglichen Formen nach, von Fels und Baum in demselben Gebäude durchaus von Stein. Dieser ist inzwischen ungelenk, und wer ihn allzusehr zu leichtem Holze schnitzelt, besonders am Boden, wo er gerade vor Augen liegt, wird abgeschmackt und lächerlich. Holz hat seine natürliche Form in Stamm und Zweigen: woher die Säulen und zum Teil die Gewölbe. Je weniger man von der natürlichen Form abnimmt: desto reiner ihre Schönheit; so übertrifft eine Säule immer einen Pilaster. Das meiste aber bezieht sich auf Zweck und hat mit Nachahmung der Natur wenig zu schaffen. Die Schönheit der Massen muß aus einem glücklichen geheimen Gefühl hervorkommen, das sich an der Harmonie der Teile des Menschen, des Großen in der Natur und überhaupt alles Lebendigen lange geweidet hat, und wieder mit einem solchen Sinn genossen werden. Hier lassen sich, was Erfindung betrifft, keine bestimmte Regeln geben; ein ganz anders ist, wenn man bloß nachahmt, was Griechen und Römern gefiel.«
»Und dies bleibt wohl immer das Zuversichtlichste,« fiel ich ein, »da sie ausgemacht die menschliche Natur mehr durchgearbeitet und zur höchsten Vollkommenheit gebildet haben, die wir kennen.«
»Wenn der Erdboden durchaus gleiches Klima hätte«, versetzte er darauf, »wie die Gegenden, welche sie bewohnten; die Menschen überall dieselben Bedürfnisse, dieselben Sitten und Gebräuche, die gleiche Idee von Glückseligkeit, dieselben Feste und Spiele! Und überhaupt will der Mensch Neues; er hat ohnedies zuviel vom Gesetz zu leiden, das er nicht abwerfen kann; warum von freien Stücken sich eins auf den Nacken legen, das ihm nicht gefällt?
Die Kunst wird, außer dem Reichtum an schönen Formen und Begebenheiten in der Natur, schon geweckt im Menschen durch vortreffliche Mittel zur Darstellung. Die Obelisken, Pyramiden, Tempel in Ägypten hatten ihre Entstehung schon den Marmor–, Granit–, Porphyr- und Jaspisgebirgen am Roten Meer zu verdanken. Der leichteste Gegenstand in der Natur reizte hernach; zum Beispiel zu Syene die Wendung der Sonne und die Anzahl der Tage im Jahr zu bestimmen. So gab der parische Marmor den Griechen Gelegenheit, die menschlichen Formen nachzuahmen; so ihre Sprache zu verschiednen Silbenmaßen und Gedichten. So werden wir von der unsrigen zum Gesange gelockt und zum Bauen vom Reichtum an Baumaterialien. Verschiedne Mittel, als Holz, Backstein und Marmor, veranlassen schon verschiedne Formen.
Ein Umstand allein verändert oft das Ganze. Bei den Griechen und Römern war ein Tempel meistens nur für einen ihrer vielen Götter; eine Wohnung, für denselben abgepaßt gewissermaßen, wenn er vom Olymp hernieder in die Gegend kam, wie ein König aus seiner Residenz in ein Schloß einer seiner Provinzen.
Die Form desselben war also nicht groß; und die Säulen richteten sich nach der Proportion. Jeder Bürger opferte entweder einzeln; oder war allgemeines Fest: so ging der Priester oder die Priesterin hinein, und das Volk stand innen und außen herum. Gleiche Bewandtnis hat es bei ihren Orakelsprüchen.
Unsre Kirchen hingegen sind große Versammlungsplätze, wo oft die Einwohner einer ganzen Stadt stundenlang sich aufhalten sollen. Ein feierlicher gotischer Dom mit seinem freien ungeheuern Raume, von vernünftigen Barbaren entworfen, wo die Stimme des Priesters Donner wird und der Choral des Volks ein Meersturm, der den Vater des Weltalls preist und den kühnsten Ungläubigen erschüttert, indes der Tyrann der Musik, die Orgel, wie ein Orkan dareinrast und tiefe Fluten wälzt: wird immer das kleinliche Gemächt im Großen, sei's nach dem niedlichsten Venustempel von dem geschmackvollsten Athenienser! bei einem Mann von unverfälschtem Sinn zuschanden machen.
Wir hätten dafür, deucht mich, eher ihre Theater zum Muster nehmen sollen, die natürlichste Form für eine große Menge, worin jede Person ihren Posten wie in einer Republik, einer Demokratie einzunehmen scheint und ein herrliches Ganzes bildet. Und sind wir nicht gegen das Wesen der Wesen alle gleich? König und Bettler, Philosoph und Bäuerlein arme blinde Würmer, die nichts wissen, die hieher gesetzt sind wie verraten und verkauft, in Nacht und Nebel, wo wir vergebens die Köpfe in die Höhe strecken?
Ich habe hier und da in Klostergärten doch gefunden, wie sich die liebe Natur auch in ihrer größten Einfalt selbst regt. Der Bruder Redner saß unten zwischen alten schattigen Bäumen, und vor ihm hatten sie an einem Hügel in hohler Rundung Sitze mit Rasen nacheinander in der Höhe rückwärts angelegt; und so saßen sie übereinander und hörten zu: und oben an beiden Seiten schlossen das Andachtsörtchen wieder Bäume, wo der Wind die zarten Zweige bewegte und die Blätter flisterten, als ob Engel darinnen spielten, sich ihrer Frömmigkeit freuten.
In unsern Kirchen mit langem gleichplatten Boden kann man nicht einmal das Meßamt gehörig verwalten; die hintersten sehen's nicht vor den vordern, was der Priester beginnt, und sie stehen und liegen ohne Ordnung untereinander, im eigentlichsten Verstande wie die Schafe.
Übrigens ist die Qual aller Baumeister, daß sie für Sommer und Winter dasselbe Gebäude machen müssen, einen Rock für die größte Hitze und die größte Kälte. Weil sie nun in Süden sich nach dem Sommer richten: so frieren sie im Winter am meisten; und in Norden nach dem Winter: so schwitzen sie dort im Sommer am meisten; ob's gleich nach der Natur ganz umgekehrt sein sollte.«
Die Gegend von Vicenza hatte ihm ungemein gefallen, besonders aber der herrliche Spazierplatz des Campo Marzo mit der neu herausempfundenen Triumphpforte vom Palladio zum Eingang. In der Tat lagern sich reizend die schön bewachsnen Hügel darum her, und die Tirolergebirge machen in blauer Ferne süße Augenweide.
Mehr aber gefiel ihm noch Verona wegen der Etsch, der Alpentochter, die wellenschlagend aus den Felsen sich mitten durch die Stadt in Schlangenkrümmungen reißt, worüber die Brücke der Skaliger sich in kühnen Bogen hebt, weiter, heroischer und kunstgebildeter als selbst die Brücke Rialto, das Wunder von Venedig, welche mit ihren sechzig Stufen herauf und hinunter mehr Treppe als fortgesetzter bequemer Weg ist.
Wir machten den letzten Strich in unvergleichlicher Nacht, wo der Mond, beinahe voll, immer mit uns ging und uns durch die schönen Ulmen begleitete, die ihre Kränze von dichtbelaubten Weinranken lieblich zusammenpaarten; und Blitze von einem fernen Gewitter flammten herüber in die heitre Luft. Mond und Abendstern und Sirius und Orion schienen wie Schutzgeister unsrer Sphäre näherzuschweben. »Ach, ihr Götter,« rief Ardinghello, »warum so einen kleinen Punkt uns zum Genuß zu geben und nach den unendlichen Welten uns schmachten zu lassen! Wir sind wie lebendig begraben.«
Schon regte sich ein leichter frischer Morgenwind und säuselte durch die Blätter; ein milder Lichtrauch stieg auf in Osten, von einzelnen Strahlen durchspielt, als wir bei unserm Landgut anlangten, wo der See sich ausbreitete und seine Ufer von Wellen rauschten. Sie brachen sich ergötzend übereinander und schäumten; und wir fanden die Beschreibung Virgils: Fluctibus et fremitu assurgens marino,6 ganz nach der Natur. Ich legte mich zu Bette, weil ich den vorigen Tag nicht geschlafen hatte. Ardinghello aber wollte nicht und machte Bekanntschaft mit der Gegend.
Die Zimmer für uns waren schon zubereitet; den Nachmittag richteten wir uns völlig ein. Ardinghello bekam eins gegen Norden zum Malen, wo er Licht und freien Himmel hatte, wie er wünschte, und überdies den Ausgang aufs Feld.
Wir beschifften die ersten Tage die Küsten, stiegen da und dort ans Land und schweiften herum an den schönen Hügeln bis nach Brescia. Ardinghello legte alsdenn gleich seine Madonna an für meine Mutter, damit er in den guten Stunden hernach daran arbeiten könnte.
Im Griechischen waren wir schon einig wegen Ton oder Akzent und Aussprache; wir richteten uns gänzlich hierin nach den, obgleich verwilderten, Abkömmlingen der Alten, zumal da wir doppelten Endzweck hatten. Wir gelangen zur Kenntnis toter Sprachen nicht allein durch Vernunftschlüsse und Vergleichungen, sondern noch durch Herkommen; und da hat doch das Volk, dessen Sprache die älteste Tochter ist von der abgestorbnen, oder vielmehr selbst noch Mutter, nur durch die Zeit verändert und verwandelt, das nächste Recht zur Erklärung. Kein auswärtiger Bücherheld wird mit seinem bloßen Buchstabieren auch je dem Runden und Lebendigen desselben bei Lesung der übriggebliebnen Denkmale gleichkommen.
Man kann wohl sagen, daß wir kein größer und vollkommner Ganzes vom menschlichen Leben haben als die griechische Sprache, wenn man sie vom Homer an zusammennimmt bis auf unsre Zeiten.
Im Homer steht sie schon als ein starker junger saftiger zweige- und laubvoller Baum da; in den tragischen und komischen Dichtern Athens, dessen Philosophen und Rednern in höchster Schönheit und Fruchtbarkeit, so wie noch nie etwas Menschliches erschienen ist: und bei den Neugriechen zusammengeschrumpft, verwachsen und ästezerbrochen, bepfropft mit mancherlei fremdartigen, und doch noch groß und reich; in einem Alter von dreitausend Jahren.
Die feinen Ausbildungen, die geschmeidigen Darstellungen aller Verschiedenheit der Natur sind, so wie die Wirklichkeit selbst, in den Zeiten der Barbarei verlorengegangen. Die Neugriechen haben keinen Dativum in ihren Deklinationen, und ihre Verba sind steif geworden. Das Futurum wird mit dem Hülfsworte wollen gemacht, das reiche Perfektum ist verschwunden und der erste Aorist darein verwandelt. Sie haben keinen Dual, kein Medium, keine Verba in mi, sogar keinen Infinitiv mehr. Die Partizipia sind verunstaltet; die Präpositionen ohne Regierung fast: ihrer bloß acht an und für sich, haben alle den platten Akkusativum hinter sich; und die Partikeln bringen wenig Geschmeidigkeit mehr hervor.
Und doch hat die Sprache noch Wohllaut und mannigfaltigen Klang; schöne ursprüngliche Form, aber wenig Beweglichkeit. Die italienische ist aus der römischen weit mehr von Leben und Geist gebildet; das Neugriechische aus dem alten lange nicht so bearbeitet. Vieles darin sieht aus wie zerschmettert und versetztes Bruchstück, und manches ist noch völlig so wie bei dem alten.
Ich brachte dem Ardinghello bald alles bei, was zum täglichen Leben gehört; obgleich die gemeinsten Dinge bei den Überfällen verschiedner Völkerschaften hauptsächlich ihre Benennungen verändert erhalten haben. So heißt zum Beispiel jetzt: Brot psomi, Wasser neron, Wein krasy, der Leib kormi, die Tür porta, der Weg strata, das Haus spiti; chrysaphi, asimi Gold und Silber.
Überhaupt lieben die Neugriechen das I; und man findet oft das alte Wort, wenn man es wegtut, als bei mati Auge, avti Ohr.
Die Evangelien und Episteln versteht man so ziemlich noch im Griechischen des Neuen Testaments, aber vom Xenophon und Plato wenig. Die Geistlichen, Vornehmern und Kaufleute reden, was man Schriftsprache nennen kann. Die größte Barbarei ist eigentlich auf den Inseln, weil diese mehr als das feste Land von den Fremden überschwemmt wurden; auch weichen die Sitten hier mehr von den alten ab.
Der Mundarten sind vielleicht mehr als bei den Alten; und so geht's mit der Aussprache. Die jetzigen Spartaner sprechen zum Beispiel ch aus wie die Franzosen.
Überhaupt war die Aussprache schon bei den Alten verschieden nach Ort und Zeit, wie bei uns und überall. Die ersten Pelasger sprachen vermutlich ihr Griechisch anders aus als die Athenienser unter dem Perikles, und so Homer und seine Zeitverwandten. Plato beklagt sich im Gespräche Kratylos, kurz nachher, als die zwei langen ionischen Vokalen zu Athen, unter dem Archon Euklid, im zweiten Jahre der vierundneunzigsten Olympiade in allgemeinen Gebrauch gekommen waren, daß man das Wort, welches den Tag ausdrückt, nicht mehr himera wie die Vorfahren ausspreche, sondern entweder hemera oder neuerdings hêmera, und dabei den schönen Ursprung nicht mehr fühle, daß es von himeros, das Verlangen, herkomme, weil man nämlich in der Nacht und Dunkelheit nach dem Licht und Aufgang der Sonne verlangt.
Aus diesem Beispiele dürfte man vielleicht schließen, daß die neuern Griechen in manchem zur Aussprache der ältern und selbst Homers wieder zurückkehrten, und daß auch hier, wie sonst in der Welt, alles im Kreise herumgeht.
Am besten ist es, man richtet sich nach der jedesmaligen lebendigen Aussprache und dem großen Haufen; und man muß es, wenn man verständlich sein will.7 Von den Alten lasen wir die Abende bald ein Stück aus dem Plato, bald aus dem Aristoteles oder Xenophon, kehrten aber von ihrem Scharfsinn und Adel, der reinsten Empfindung und ihren hohen Flügen oft zurück unter das atheniensische Volk zum Demosthenes und Aristophanes.
Ardinghello hatte den letztern nur dem Namen nach gekannt und weidete seine Seele nun an ihm leibhaftig mit Entzücken. Er brütete so recht über seinem Witze, seiner Laune, seinen kühnen Erdichtungen, und hielt seine Possenspiele für das allerhöchste Denkmal menschlicher Freiheit, welchem sich keins unter den Millionen andrer Schriften von weitem nähere. Wer mit den Griechen wetteifern wolle, müsse in beiden leben und weben. Hier erscheine der Mensch, wie er sei, mit allen seinen natürlichen Herrlichkeiten und Schlechtigkeiten. Hier entsprängen und rännen die lautersten Lebensbäche.
Mein Freund steckte mich mit seiner Meinung an, und Redner und Dichter wirkten mächtig auf uns: wir wurden selbst freier im Umgange, und unsre Sprachkenntnis wuchs wie eine üppige Pflanze. Wir hielten uns ganz an Athen vom Themistokles an bis zum Tod Alexanders; drangen immer tiefer ein in dessen Staatsverfassung, Gesetze, Gerichte; ruhten im Schatten an den bemoosten Wurzeln des schönen lebendigen Baums, der seine Zweige über ganz Griechenland verbreitete; und gingen aus diesem Kreise, und was sich damit verband, selten heraus.
Dabei beschrieb ich ihm den gegenwärtigen Zustand der Inseln und des festen Landes; Gesellschaften, Sitten und Gebräuche, Feste und Spiele, Klima, Jahrszeiten, Wind und Wetter, Gewächse und Früchte, und was von den Alten noch übrig ist.
Ohngeachtet seiner Lust an dem Aristophanes, der glänzenden Satire der Wolken gegen den Dämon des Philosophen und des bittern Angriffs der Lehre desselben, daß kindliche Liebe und Verehrung der Eltern und Verwandten dem Verstande nachstehen müsse: hielt er nichtsdestoweniger die Denkwürdigkeiten des Sokrates für das gediegenste Kleinod aller Weisheit und die Moral aller Moralen.
Übrigens kamen wir darin überein, daß man die Wolken nach ihrer und nicht nach unserer Zeit beurteilen müsse. Die Menschen waren damals gewohnt, einander nackend zu sehen, und scherzten zur Ergötzlichkeit für den Augenblick über ihre Mängel und Gebrechen und vergaßen es hernach bald wieder. Aristophanes war so wenig schuld an dem gewiß bis zum Vergessen seines Mutwillens lang hernach erfolgten Tode des Sokrates als an dem des Euripides; und beide wurden im Grunde nicht minder hochgeschätzt, trotz aller Lächerlichkeiten, die er auf sie warf. Welche possierliche Rolle läßt er nicht den Weisen letztern im Feste der Ceres und Proserpina spielen! Bei uns wäre freilich so etwas wie Mord und Totschlag. Und außerdem war man es gewohnt, daß Philosophen und Dichter, und von diesen wieder die tragischen und komischen, sich zur Kurzweil des Volks einander zum besten hatten. Wer weiß, wie hart Sokrates und Euripides vorher dem Aristophanes begegneten? Das beste Zeugnis für das, was ich sage, ist, daß Plato nicht aufhörte, den komischen Dichter hochzuschätzen.
Dieser hohe Genius schien uns überhaupt einen viel weitern Gesichtskreis als Xenophon zu haben und selbst über seinen Lehrmeister hinauszugehen. Wir meinten, nicht wenige seiner Gespräche müßten die Lieblingsschriften für jeden guten Kopf sein, der sie fertig in der bezaubernden Ursprache lesen kann; und dies zwar hauptsächlich deswegen, weil er selten seine Materie erschöpft, aber mit gewaltiger Hand in tiefe, reiche Fundgruben hineinführt. Wir bewunderten oft an ihm, diesen Tag, die allergewandteste attische Feinheit, die so edel kein Schriftsteller, unsers Wissens, weder seiner noch viel weniger irgendeiner andern Nation je erreicht hat; und den folgenden wieder die erhabensten Gedanken in der kühnsten Sprache.
Demosthenes ist freilich gegen ihn, wie der noch junge, zu strenge Dionys von Halikarnaß wahr spricht, Held im Streite, wo es das Leben gilt, und jeder Hieb und Stoß Wunde. Aber ein andres ist Schlachtfeld, ein andres Akademie! wo unter kühlen Lauben auch zuweilen bloß angenehmes Geschwätz ergötzt, und lyrische Verzückungen süßer Trunkenheit bei sternenheller Nacht am seligsten machen.
Mitten unter dieser Seelenweide legt ich mich eifrig auf die Zeichnung. Ich fing vom neuen damit an, allerlei mathematische Figuren aus freier Hand bis zur Vollkommenheit zu entwerfen, um sie zur Sicherheit im Zuge zu bringen. Alsdenn plagte mich Ardinghello nur kurze Zeit mit menschlichen Gerippen und ging gleich über auf den Umriß der Teile und ihre Verhältnisse zueinander; und endlich gelangt ich zum Lebendigen, wie aus einer trocknen Wüste zu schattichten frischen Quellen. Wir waren schon aus der ruhigen Schönheit am Leidenschaftlichen: als eine schreckliche Begebenheit erfolgte, die uns auf lange trennte.
Über die Verhältnisse des menschlichen Körpers gingen wir, außer den Vorschriften der beiden großen Florentiner, noch ein Werk durch von dem Teutschen Albrecht Dürer. Er sagte, wenige hätten die Theorie ihrer Kunst wohl so innegehabt unter allen neuern Malern und Bildhauern als dieser; man fände bei ihm ein erstaunliches Studium: aber zum Hohen und Schönen derselben sei er nicht gelangt, weil niemand aus seiner Nation und seinem Zeitalter könne. Dies hange außer dem Innern noch gar zuviel von Glück und Zufall ab. Wir könnten das Lebendige nicht anders nachbilden, als bis wir es entweder selbst gelebt oder mit unsern Sinnen in ergreifender Wirklichkeit empfunden hätten. Ohne Perikles und Aspasia, Alkibiaden, Phrynen und ihresgleichen alt und jung: kein Phidias, Praxiteles und Apelles. Albrecht Dürer habe den Nürnberger Goldschmiedsjungen nie völlig aus sich bringen können; in seinen Arbeiten sei ein Fleiß bis zur Angst, der ihm nie weiten Gesichtskreis und Erhabenheit habe gewinnen lassen: und bloß deswegen hätte ihn Michelangelo so sehr gehaßt. Seine meisten Kompositionen wären Passionsgeschichten und Hexen und Teufel. Er als verlorner Sohn am Troge bei Schweinen, die Trebern fressen; Proserpina, wie sie Pluto auf einem Bocke holt; Diana, wie sie eine Nymphe mit dem Knittel bei einem Satyr prügelt: zeigten genug seine mißleitete Phantasie. Sonst sei er ein wackrer Meister, habe Kraft und Stärke; und ein guter Kopf von richtigem Geschmack könne viel von ihm lernen.
Wir hatten bei unserm Leben auf dem Lande uns zum Gesetz gemacht, daß keiner den andern in seinem Tun und Lassen stören sollte; und alles Beisammensein war freier Wille von beiden Seiten. Wenn also einer allein sein wollte: so sagte er es dem andern oder schloß die Tür ab. Zuweilen gingen wir miteinander, zuweilen zog einer allein aus: und Ardinghello kam manchen Tag und manche Nacht nicht nach Hause, ohne mir vorher zu sagen, wenn er fortging, und ohne daß es mich befremdete. Die immer grünen, mit hohen Bäumen eingefaßten Wiesen und die vielen klaren Flüsse, von den Seen reingewaschen, erfreuten ihn unendlich in der Lombardei; solche Natur war dem Toskaner fremd. Er nistete sich in den schönsten Dörfern überall ein und machte Bekanntschaft mit den Landleuten.