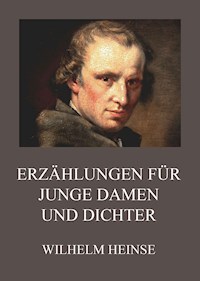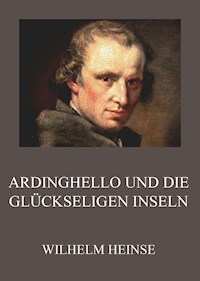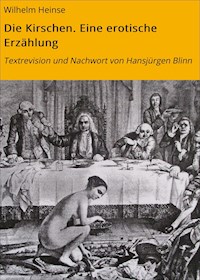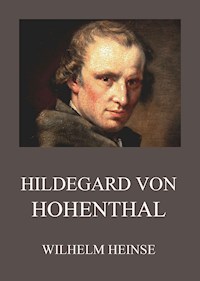
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heinses höfischer Roman um die Sängerin Hildegard enthält neben einer Liebesgeschichte, in der die Protagonistin am Ende einen englischen Lord heiratet, auch eine Geschichte der italienischen Oper.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 666
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hildegard von Hohenthal
Wilhelm Heinse
Inhalt:
Wilhelm Heinse – Biografie und Bibliografie
Hildegard von Hohenthal
Vorrede.
Erster Theil
Zweyter Theil
Dritter Theil
Hildegard von Hohenthal, W. Heinse
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849627539
www.jazzybee-verlag.de
Wilhelm Heinse – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 15. Febr. 1749 als Sohn eines Predigers zu Langewiesen in Thüringen, gest. 22. Juni 1803 in Aschaffenburg, besuchte das Gymnasium zu Schleusingen, widmete sich in Jena unter großen Entbehrungen dem Studium der Rechte, daneben besonders dem der alten und neuen Literatur, und begab sich dann nach Erfurt, wo er mit Wieland bekannt wurde, der auf seine poetische Richtung große Einwirkung gewann. Durch ein Bändchen »Sinngedichte« empfahl er sich Gleim, der den Mittellosen unterstützte und zu sich einlud. Von Erfurt nahm ihn 1771 ein abenteuernder Hauptmann, v. Liebenstein, der Heinses Talent vollends vergiftete, mit auf Reisen. Nachdem sich diese Verbindung gelöst hatte, lebte H. einige Zeit in der Heimat, erhielt 1772 durch Gleims Vermittelung eine Hauslehrerstelle in Quedlinburg und hielt sich seit 1773 bei Gleim in Halberstadt auf, den Namen Rost führend, bis ihn 1774 J. G. Jacobi als Mitarbeiter an der Zeitschrift »Iris« zu sich nach Düsseldorf berief. Hier war es, wo der Besuch der berühmten Bildergalerie seinen Kunstsinn weckte und er über seinen eigentlichen Beruf erst klar ward. Von unbezwinglicher Sehnsucht nach Italien erfüllt, trat er 1780, von Jacobi und Gleim unterstützt, die Reise dahin an, verweilte 8 Monate in Venedig und dann zumeist in Rom, wo er viel mit dem Maler Müller verkehrte, und kehrte Ende 1783 nach Düsseldorf zurück, wo er sein Hauptwerk: »Ardinghello«, schrieb. Im Oktober 1786 wurde er Lektor des Kurfürsten von Mainz und lebte hier bis 1792 in anregendem Verkehr mit J. v. Müller, G. Forster, Sömmering, Huber, verbrachte darauf ein Jahr in Düsseldorf, kehrte aber 1793 nach Mainz zurück, von wo er 1795 nach dem Baseler Frieden mit dem Kurfürsten nach Aschaffenburg übersiedelte. Auch unter Dalberg (seit 1802) blieb er hier als Hofrat und Bibliothekar tätig. Seine literarische Laufbahn hatte H. durch die Herausgabe der »Sinngedichte« (Halberst. 1771) eröffnet. Dann folgten die Übertragungen zweier obszöner Werke aus der ausländischen Literatur, die »Begebenheiten des Enkolp, aus dem Satyrikon des Petron übersetzt« (Schwabach 1773, 2 Bde.; ein Stück daraus: »Das Gastmahl des Trimalchio«, in Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 2616), »Die Kirschen«, nach Dorat (Berl. 1773), ferner »Laidion, oder die Eleusinischen Geheimnisse« (Lemgo 1774). In Rom übersetzte er in Prosa: »Das befreite Jerusalem« (Mannh. 1781, 4 Bde.) und Ariosts »Orlando« (Hannov. 1782, 4 Bde.). Darauf erschienen seine beiden Hauptromane: »Ardinghello, oder die glückseligen Inseln« (Lemgo 1787, 2 Bde.; 4. Aufl. 1838), worin er seine Ansichten über bildende Kunst und Malerei niederlegte (vgl. Jessen, Heinses Stellung zur bildenden Kunst und ihrer Ästhetik. Zugleich ein Beitrag zur Quellenkunde des »Ardinghello«, Berl. 1901) und »Hildegard von Hohenthal« (das. 1795–96, 2 Bde.; neue Aufl. 1838, 3 Bde.), seine Gedanken über musikalische Kunstwerke enthaltend. In »Anastasia und das Schachspiel« (Frankf. 1803, 2 Bde.; 3. Aufl. 1831) legte er in Briefform seine Gedanken über Schach- und Kriegsspiel nieder. Die H. häufig beigelegte Schrift »Fiormona, oder Briefe aus Italien« (Kreuznach 1803) ist nicht von ihm. Eine Sammlung seiner »Sämtlichen Schriften« veranstaltete H. Laube (Leipz. 1838, 10 Bde.); die neueste und beste ist die von Schüddekopf besorgte (»W. Heinses Sämtliche Werke«, Berl. 1902 ff., 10 Bde.). Als künstlerischen Kompositionen fehlt es Heinses Romanen an Geschlossenheit und Rundung, um so mehr zeichnen sie sich durch Macht und Glut der Darstellung aus. Die Reflexion über ästhetische Fragen überwiegt und beherrscht oft ganze Kapitel; aber diese Reflexion ist überraschend feinsinnig, wenn auch häufig allzu einseitig dem sinnlich Reizvollen zugekehrt. Die Handlung der Romane ist unübersichtlich, die Charakterzeichnung oberflächlich, insbes. die Frauengestalten nur sinnlich und ohne Gemüt. Heinses Kunstanschauungen gehen über Winckelmanns klassischen Idealismus hinaus und berücksichtigen im Sinne Herders die Bedingungen von Raum und Zeit. Das treueste Bild von ihm enthalten die »Briefe zwischen Gleim, H. und Johannes v. Müller« (hrsg. von Körte, Zürich 1806–08, 2 Bde.); der »Briefwechsel zwischen Gleim und H.« wurde besser von Schüddekopf herausgegeben (Weimar 1894–95, 2 Bde.). Vgl. Pröhle, Lessing, Wieland, H. (nach den handschriftlichen Quellen in Gleims Nachlaß, Berl. 1877); Hettner, Aus W. Heinses Nachlaß (»Archiv für Literaturgeschichte«, Bd. 10, Leipz. 1881); Schober, Johann Jakob Wilhelm H., sein Leben und seine Werke (Leipz. 1882); Sulger-Gebing, Wilhelm H., eine Charakteristik zu seinem 100. Todestage (Münch. 1903).
Die Personen der folgenden Geschichte leben zum Theil noch; und selbst die Begebenheit hat sich in Rom wirklich zugetragen, ob man es gleich dort, aus begreiflichen Ursachen, nicht eingestehen will. Der Verfasser sah sich deßwegen genöthigt, den mehrsten andre Namen beyzulegen. Der Prinz befindet sich nun im Auslande, und ist ein berühmter Held, welcher schwerlich mehr an das leichtsinnige, gewöhnliche Unternehmen rascher Jugend denkt. Hohenthal führt, geliebt und wegen seiner kühnen und klugen Thaten bewundert, ein Geschwader Reiterey an.
Die vortreflichen Scenen einiger beschriebenen Opern, die jetzt wenig oder gar nicht mehr bekannt sind, können, so wie die andre Musik in dem nämlichen Fall, wenn sich eine hinlängliche Zahl Liebhaber dazu findet, leicht in Partitur herausgegeben werden. Die Nachwelt würde die kleine Anthologie wohl gern haben, wenn die großen Werke selbst, wie zu befürchten steht, bald ganz verschwunden sind.
Erster Theil
»Die Sonne löscht alle Freuden der Nacht aus! wie die schönen Sterne, so die süßen Melodien und Harmonien der Phantasie, und die stärksten Gefühle der Vergangenheit und Zukunft. Die Nacht hat etwas Zauberisches, was kein Tag hat; so etwas Grenzenloses, Inniges, Seliges. Das Mechanische der Zeitlichkeit, das einen spannt und festhält, weicht so sanft zurück, und man schwimmt und schwebt, ohne Anstoß, auf Momente im ewigen Leben.«
Mit diesen Worten erhob sich Lockmann von seinem Lager, und sprang aus dem Bette. Sein Wesen war noch Widerhall der Musik zur Oper Achill in Skyros, von welcher er die Nacht den Plan geträumt, und wachend gegen Morgen ausempfunden hatte.
Er war vor wenig Wochen von Neapel zurückgekommen, und gestern mit seinem Fürsten aufs Land gezogen.
Die jungen Strahlen der Sonne über das Gebirge blitzten ihn von seinem Fortepiano weg, auf dem er einige Lustgriffe that. Er ging aus Fenster, betrachtete mit Entzücken, wie die Sonne im dünnen blendenden Purpur der leichten Streifwölkchen empor stieg; und weidete seine Augen, auch nach drey Jahren in Italien, aufs neue an der schönen Gegend.
Ueberhaupt ist der Frühling in Deutschland bey seiner kurzen Zeit viel üppiger, und eben dadurch, und wegen des Kontrastes mit dem Winter, viel erfreulicher als in Italien. Die ganze Flur stand in stolzer Fruchtbarkeit von Kornsaaten und andern Feldfrüchten, die in der Ferne das Gebirg' in herrlicher Pyramidenform begrenzte, um dessen Rücken sich Eichen und Buchenwälder zogen, und an dessen Fuß und Seiten die köstliche Rebe sproßte.
Um und in dem Orte prangten Gärten, durch welche von verschiedenen Seiten zwey volle krystallhelle Bäche rauschten, die sich am Ende in einen Kanal für Mühlen vereinigten, und hernach mehrere aufnahmen, die zu einem ansehnlichen Fluß anschwollen, und dem Vater Rhein ihren Tribut brachten.
Das Schloß, worin Lockmann zwey schöne Zimmer bewohnte, war in edler Bauart zu Anfang des Jahrhunderts auf einen festen Felsen gegründet. Vorher stand eine Gothische Burg darauf, von welcher man die frischen geräumigen Keller der Vorfahren zu großen Weinlagern beybehielt. Es beherrschte mit seinen Aussichten die ganze Gegend, worin mehrere vom ältesten Adel ihre Rittersitze hatten.
Mildester Strich, Krone von Deutschland, bist du auch zu rauh für den Oelbaum und die noch zartere Zitrone und Pomeranze, und der Allgegenwart des göttlichen Meers von Neapel und Lissabon beraubt; so wirst du doch vom schönsten Strom in Europa, und vielleicht der Welt, getränkt, und er wallt langsam wie im Genusse durch dich, als seine anmuthigsten Ufer, wo doch auch in günstigen Jahren ein Nektar reist, der an Gesundheit, eigentlichem Mark und geselligem Wesen die zu heißen flüssigen Feuer vom Kap, von den Kanarischen Inseln, Griechenland und Spanien noch übertrift.
Lockmann hatte vor seiner Reise nach Italien die Gegend nur ein paarmal in Gesellschaft zur Kurzweil durchzogen, und sich noch niemals in eigentlichen Besitz davon gesetzt; welches er sich nun fest vornahm. Er dachte einmal für allemal sich hier eine Hütte anzubauen, und in Muße bey einer lieben Gattin, wenn er eine für Herz und Geist finden könnte, der Vollkommenheit seiner Kunst für Deutschland nachzuhängen.
Indem er so sein künftiges Leben ausspähete, nahm er, in Gedanken verloren, ein Fernrohr in die Hand, das auf einem Tische liegen geblieben war; fand es vortreflich für sein Auge, richtete es nach dem Gebirge, durchstreifte damit Wald und Flur, und suchte wie ein Feldmesser die Hauptpunkte zu seinen Pfaden aus.
Unvermerkt drangen seine Blicke unter die Schatten des Lindengewölbes in einem Garten, etwa fünf bis sechs hundert Schritt entfernt, wo ein Frauenzimmer sein Morgengewand ablegte, nackend, göttlich schön wie eine Venus, da stand, die Arme frey und muthig in die Luft ausschlug, und, mit dem Kopf voran in fliegenden Haaren, sich in eine große Wasservertiefung stürzte, darin verschwand, wieder hervorkam, das nasse Köpfchen schüttelte, herumgaukelte, den Oberleib weit empor hielt, auf dem Rücken schwamm, sich auf die Seite legte, geschickt und gewandt mit dem Kopf sich wieder untertauchte, daß das himmlische Kolorit der gewölbten Hüften und Schenkel wie ein Blitz auf der Oberfläche hervor leuchtete, verschwand; dann die ganze zauberische Mädchengestalt wie ein Delphin sich wieder empor warf, und Wasserstrahlen und Schaum von sich schleuderte.
Eine Viertelstunde, die wie eine Minute vorüberflog, mochte dieses Schauspiel gedauert haben, als sie aus dem geschmeidigen Element, das stolzer von einer solchen Schönheit schimmerte, wieder unter die heilige Lindendämmerung trat, in der warmen Luft – es war ein heißer Tag gegen Ende des May – auf dem grünen Schmelze sich trocken wandelte, sich ankleidete, und verlor.
Lockmann stand die ganze Zeit wie eine Bildsäule mit seinem Fernrohr, verwandte nicht einen Blick, und schaute, noch lange nachher das reizende Schauspiel im Auge, wie einer geblendet noch lange nachher die aufgehende Sonne hat, in die er zu lüstern hineinschaute. Die Nachtigallen im Schloßgarten, welche mit einander wetteiferten, immer stärker schlugen, und welche er bisher wie taub nicht gehört hatte, weckten ihn endlich von seinem Staunen. Er rief nicht mehr: »Die Sonne löscht alle Freuden der Nacht aus;« sondern: »Wie ist mir? wo bin ich?« taumelte in seinem Zimmer auf und ab, und sah oft wieder nach dem schönsten Plätzchen des weiten Paradieses.
Darauf strömte er seine Gefühle in die Saiten, und die höchst lebendige Scene ging von selbst in eine einzige Melodie von dem süßesten Charakter über, die er mit der schmeichelhaftesten Begleitung gleichsam durch alle Irrsale des menschlichen Lebens führte.
Er frühstückte, kleidete sich an, ging aus, und nahm den kürzesten Weg, den ihm die hohen alten Linden zeigten. Sie bildeten einen kleinen Hayn auf einer Anhöhe am Ende des Gartens, hinter welchem ein wohlangelegter Weinberg sich ferner fortstreckte.
Den Garten umschlossen hohe Mauern, über welche die gesundesten Fruchtbäume mit laubvollen Zweigen schatteten. Voran stand ein geräumiges Landhaus, so schön und schon dem Aeußern nach so zweckmäßig, wie irgend eins von Vignola. Er erfuhr bald von einem Bedienten, der ihm begegnete: es gehöre der Familie von Hohenthal; der Herr sey mehrere Jahre ***scher Gesandter zu London gewesen, und im vorigen Jahre dort gestorben; die Wittwe wohne seit dem Merz hier mit einem Sohn, der bald auf Universitäten ziehen werde, und einer erwachsnen Tochter.
Diese Nachricht fiel ihm gewaltig aufs Herz; er wollte nichts weiter hören, ging hastig zurück, und suchte sich die ganze Morgenscene mit dem Fernrohr aus dem Sinne zu schlagen. Er kannte durch den Ruf und aus Handlungen den Herrn von Hohenthal als einen der geschmackvollsten und vortreflichsten Männer seines Standes, und hatte manches unpartheyische Lob von seinem Eifer für alles Schöne und Gute selbst zu Rom und Neapel gehört.
Den Nachmittag hielt er die erste Probe des berühmten Miserere von Gregorio Allegri, der im Jahre 1629 in die päpstliche Kapelle kam.
Der Fürst liebte die alte Musik, besonders Kirchenmusik, und konnte die Künsteleyen, das Bunte und Verzierte der neuern nicht vertragen. Auch mocht' es ihm an Gelegenheit gefehlt haben, die Meisterstücke der letztern in ihrer höchsten Vollkommenheit zu hören; oder er hatte, von weit wichtigern Geschäften abgehalten, nicht den gehörigen Fleiß darauf wenden können, die Fortschritte und den Wachsthum der Kunst bis zur höchsten Höhe zu verfolgen; und haftete, wie die Alten pflegen, bey diesen Nebendingen an dem Zeitvertreib und den Freuden seiner Jugend.
Er war ein Herr an die sechzig; klug, leutselig, gerecht, freygebig, standhaft, und voll Menschenkenntniß. Als Prinz war er Inhaber eines kaiserlichen Regiments, machte den siebenjährigen Krieg mit, und that sich hervor in der Schlacht bey Collin. Bald darauf kam er zur Regierung, und legte seine Stelle nieder; widmete sich ganz der Wohlfahrt seines Landes, strebte, die beste Kultur der Produkte und des Fleißes zu befördern, seine Unterthanen in jeder Klasse zu treflichen Menschen zu bilden, und ihnen, eben dadurch aber auch sich, den angenehmsten Genuß des Lebens zu verschaffen. Auch waren sie stolz auf ihn, und man hörte keine Klage. Er suchte alle Talente hervor, unterstützte, und belohnte sie hernach, indem er jedes an seinen Posten stellte.
Sein Kriegswesen bestand nur aus zwey Regimentern; aber es waren die ausgesuchtesten Leute, und die Offiziere eine Pflanzschule für große Armeen: jeder in den kriegerischen Leibesübungen, in der Geographie, Mathematik, Geschichte für sein Fach, Behandlung der Untergebnen wohl unterrichtet. Sie wurden immer, so wie die Reihe an sie kam, zu den Musterungen nach Berlin und Wien geschickt, um die Bewegungen großer Massen zu studiren, und sich nicht ans Kleinliche, Unwesentliche, das bloß zur Parade dient, zu gewöhnen. Sein Grundsatz war, jeder Fürst müsse geübte Stärke nach Verhältniß seiner Volksmasse haben, und diese die Grundlage von allem andern seyn.
Er erkannte inzwischen wohl, daß der Kaiser und der König von Preußen mit ihren geübten stehenden Heeren fast allein die Stärke und den Stolz von Deutschland gegen die Fremden ausmachen, und deren Unterthanen die Kosten für die Unterthanen der übrigen Stande tragen, die wenig Truppen halten, folglich auch nicht so viel bezahlen, und sich in großem Vortheil dabey befinden.
Der Erbprinz, sein einziger Sohn, – ältere und jüngre Prinzen und Prinzessinnen starben meistens in zarter Jugend – war wieder als General bey der kaiserlichen Armee, und hielt sich mit seiner Gemahlin gewöhnlich in Prag auf, kam aber oft nach Wien.
Es war Gebrauch, daß der Fürst und die Fürstin, so oft sie im Frühling aufs Land zogen (es mochte früher oder später geschehen), und die von den Hofleuten, welche das Bedürfniß fühlten, gleich anfangs beichteten, sich der Sünden der Hauptstadt entledigten, das Abendmahl empfingen, und dem Volke so ein gutes Beyspiel gaben. Lockmann hatte die Musik zu der feyerlichen Handlung schon vorbereitet, und suchte sie nun so gut wie möglich aufzuführen.
Bisher hatte der Kapelle ein alter Meister Sebastian Stahl vorgestanden, welcher nun zur Ruhe gesetzt werden sollte. Dieser war noch aus der Bachischen Schule, und machte sich eine Ehre daraus, den Vornahmen ihres großen Stifters zu führen; übrigens ein herzensguter Mann, gründlich zwar, aber ohne viel Geschmack und besondern Erfindungsgeist in seiner Kunst.
Der Fürst hatte den jungen Lockmann auf einer Reise, in Erfurt, dessen Heimath, bey einem Fest kennen lernen, wo er in der Kirche auf dem Petersberge gerade die Orgel spielte, und alsdann eine Messe von seiner Komposizion aufführte. In einer glücklichen Stimmung, am Grabe und über die Geschichte des Ritters von Gleichen mit seinen zwey Weibern, ward er von dieser Musik bis ins innerste bewegt, so wie noch niemals von einer andern. Er erkundigte sich, wer das heilige gewaltige Instrument so zweckmäßig nach seinem Sinn gespielt, und die Messe so voll Andacht und Salbung gesetzt, und so meisterlich aufgeführt habe; ließ den Künstler vor sich kommen, unterredete sich mit ihm, und Person und Wesen und alles gefiel. Er nahm ihn mit sich, schickte ihn bald darauf nach Italien, mit dem besondern Auftrag, die größten Meisterstücke der Kunst dort zu sammeln und zurück zu bringen.
Bey der Kapelle waren brauchbare, dienstwillige Leute, die mehrsten aus dem Lande selbst, und darunter einige, besonders für blasende Instrumente, von der entschiedensten Anlage zu den größten Virtuosen; und in dem engen Kreise, worin sie lebten, dachten sie glücklicher Weise über ihren wirklichen Werth noch bescheiden. Lockmann suchte die vorzüglichen sogleich durch die größte Aufmerksamkeit, gefälligen Unterricht und treffendes Lob bey Gelegenheiten, wo es sie am mehrsten freuen, und zum Wetteifer anspornen mußte, für sich einzunehmen; und machte jedem in der Stille, mit ihm allein, seine Fehler und bösen Angewohnheiten gutherzig, aber doch streng, begreiflich.
Er hatte sich vorgenommen, bey jeder Musik, die er aufführen würde, sie allemal vorher mit dem Geiste des Ganzen, und dann mit dem vorzüglichen Ausdruck einzelner Stellen recht vertraut zu machen, damit sie in Masse auf einen Zweck wirken, und er so endlich nach und nach das Ziel des Dichters sowohl, als des Tonkünstlers erreichen möchte. Daß die von langsamen Begriffen es mit Muße überlegen könnten, wollt' er das Wesentliche bisweilen zu Papier bringen, und es ihnen zum Abschreiben auch für die Zukunft mit nach Hause geben. Er machte also mit dem Miserere1 von Allegri sogleich den Anfang.
»Diese Musik ist, nebst den Werken des Palestrina, vielleicht die älteste, die heutiges Tages noch aufgeführt wird; und, sonderbar! es macht ihr wohl, was Wirkung betrift, keine andre Musik ihrer Art den Rang streitig.«
»Sie ist abwechselnd für zwey Chöre, in fünf und vier Stimmen, geschrieben: zwey Sopranen, Alt, Tenor, und Baß; bey den vier Stimmen bleibt der Tenor weg. Dieses lautet etwas jugendlicher, und bringt Kontrast hervor.«
»Bey dem letzten Vers: Tunc imponent super Altare tuum vitulos, kommt der erste und zweyte Chor zusammen, und die Harmonie wird neunstimmig. Dieser letzte Vers wird langsam und leise gesungen; die Töne schmelzen in einander, und verlieren sich gleichsam nach und nach.«
»Die Stimmen haben gar keine Begleitung von Instrumenten, nicht einmal der Orgel. Die bloße Vocalmusik ist eigentlich, was in den bildenden Künsten das Nackende ist.«
»Ich habe dieses Miserere zweymal in der Sixtinischen Kapelle zu Rom mit den besten Stimmen aufführen hören; und es hat so tiefen zerschmelzenden Eindruck auf mich gemacht, daß ich bis zu Thränen gerührt worden bin.«
»Dieß wird bewirkt durch die Einfachheit der Harmonie, den breiten Umfang derselben bis zu drittehalb Oktaven, und die Verwickelung und Auflösung der Stimmen; auch dadurch, daß meistens bloß die Länge und Kürze der Sylben, und der Sinn der Worte den Takt ausmacht; oder vielmehr, daß man das, was wir Takt nennen, fast gar nicht merkt.«
»Noch ein Umstand, keine Kleinigkeit, mag zur Wirkung beytragen, nämlich daß diese Musik alle Jahr nur einmal aufgeführt wird, und also immer neu und heilig bleibt.«
»Dieselben Strophen von Musik werden fünfmal wiederhohlt; und noch das sechstemal, jedoch mit Auslassung eines Gliedes.«
»Das erste Glied des Gesangs ist fünfstimmig, geht aus dem G moll in B dur, F dur; und kommt durch mancherley Windungen in die Quinte D mit der großen Terz.«
»Dann das zweyte Glied vierstimmig, wieder aus G moll, geht ebenfalls aus in D dur.«
»Dann das dritte Glied vierstimmig aus C moll, welches in G dur schließt.«
»Und so wird dieselbe Strophe noch viermal wiederhohlt.«
»Die sechste Wiederholung läßt, wegen Mangel an Worten, das zweite G moll aus, und geht gleich in C moll über.«
»Da die Worte keine Verse sind, und keine gleiche Sylben haben, und dieselbe Musik doch fünfmal wiederhohlt werden soll: so werden sie bloß nach der Aussprache untergelegt. Darum müssen sich denn die Sänger mit einander dazu einstudirt haben, daß sie überein ihre Stimmen zur ganzen Harmonie passen.«
»Und aus diesem allen zusammen entspringt die höchste Wirkung, welche Musik leisten kann; nämlich der Sinn der Worte geht in die Zuhörer mit seiner ganzen Stärke und Fülle über, ohne daß man die Musik, ja so gar die Worte nicht merkt, und in lauter reine Empfindung versenkt ist.«
»Schauder der Reue, Auf- und Niederwallen beklommner Zärtlichkeit, Hofnung und Schwermuth, Seufzer und Klagen einer liebenden Seele. Das Zusammenschmelzen und Verfließen der reinen Töne offenbart das innre Gefühl eines himmlischen Wesens, welches sich mit der ursprünglichen Schönheit wieder vereinigen möchte, von der es Schulden trennen.«
»Der letzte Vers ist mit großer Kunst gemacht; jeder von den zwey Chören bildet für sich ein Ganzes, und beyde begatten sich gleichsam auf das innigste; und das Adagio, piano und smorzando, macht den Triumph der Kunst vollkommen.«
»Zwischen den Strophen des Gesanges werden immer Verse im bloßen Einklang von den Bässen und Tenoren declamirt; welches die ganze Gemeinde vorstellt.«
»Dieses möchte wohl die schicklichste Musik für Hebräische Poesie seyn, die aus kurzen lyrischen fast gleichförmigen Sätzen bestand, welche meistens Chöre wechselten, und noch keine Verse von gezählten Sylben hatte.«
Darauf declamirte Lockmann ihnen den ganzen Text des Psalms in einer getreuen und kräftigen Uebersetzung; gab ihnen diese von Wort zu Wort dem Text untergelegt; und sang mit der vollen Harmonie des Fortepiano die erste Strophe vor, um ihnen die Art des Zeitmaaßes und die Natur des Ausdrucks bekannt zu machen; ließ dann zusammensingen, erst unter Begleitung des Instruments; und es ging das nächstemal ohne Begleitung gut über sein Erwarten.
Er fuhr nun fort durch alle Strophen bis zu Ende. Alle beeiferten sich, es recht nach seinem Sinn zu machen; kein Blick, kein Ohr, kein Herz ward von dem Ganzen verwendet, und es fing schon an gediegen und zu einem Gusse zu werden. Es freute Alle, und noch mehr ihn, inniglich.
Er sagte ihnen zur Aufmunterung, es sey ihm, als ob er in der Sixtinischen Kapelle wäre; wiederhohlte es einmal, zweymal und zum drittenmal, zeigte dazwischen dieser und jener Stimme Verbesserungen, machte sie ihnen vor, ließ sie einzeln nachsingen; und zum fünftenmal glückte es fast zur Vollkommenheit.
Er gab ihnen Lehren unter Lobsprüchen mit nach Hause, und morgen um dieselbe Zeit sollte die zweyte Probe seyn.
Was er jedoch für sein Ohr vermißte, waren die vortreflichen Römischen Kastratenstimmen. Dafür hatte er zwey Baßstimmen, Zorn und Damm, von so großem Umfang, solcher Stärke, Tiefe und Reinheit fast durch alle Töne, daß die besten, die er in Italien hörte, neben diesen hätten verschwinden müssen; mehrere gute, jedoch nicht ausgebildete, Tenore; und so drey bis vier brauchbare Altstimmen. Mit den Sopranstimmen allein war er nicht zufrieden; keine hatte genug gebildeten Ton, Reinheit, Empfindung, und Charakter. Vier Buben hatten zwar Süßigkeit der Kehle, aber gar zu wenig Umfang, und ihr Ton sagte wenig; jedoch ließ sich aus diesen etwas machen. Drey Weiber waren die besten: die schöne junge Frau des Virtuosen auf dem Horn, Ewald, hatte nur einige reine silberne ausgebildete Töne, die auch rührten und entzückten, wenn Melodien dazu vorkamen; aber von wenig Geschmeidigkeit für Schwäche und Stärke. Die zwey andern, Töchter von geschickten Geigenspielern, hatten die Manieren und Läufe ihrer Herren Väter erlernt, nie die einzelnen Töne gehörig geübt, und verzierten alles, um ihre Kunst zu zeigen. Lockmanns Bitten und Ermahnungen, und der Eifer, ihm zu gefallen, brachten sie inzwischen dahin, daß sie sich nach seinem Willen fügten.
Das Gebirge leuchtete glänzend vom Widerschein der letzten Strahlen, der untergehenden Sonne. Er ging hinunter in den Schloßgarten, und gesellte sich auf einer Anhöhe, wo man die ganze Gegend übersah, zu dem alten Baumeister Reinhold, welcher lange in Rom gewesen, und ein eigner Denker war. Dieser liebte die Musik mit Leidenschaft, ohne selbst sie auszuüben, hatte die größten Meister persönlich gekannt, die vortreflichsten Werke aufführen hören und war dem jungen Lockmann von Herzen gewogen. Das Gespräch kam gleich auf dessen Probe und die Sopranstimmen. Nach einem angenehmen Wortwechsel fuhr endlich der Alte fort und behauptete:
»Eine schöne jugendliche völlig ausgebildete Kastratenstimme geht über alles in der Musik. Kein Frauenzimmer hat die Festigkeit, Stärke und Süßigkeit des Tons, und so aushaltende Lungen. Bey den Kastraten kann man recht sehen, daß es darauf ankommt, was gesagt wird, und nicht, in welchem Ton es gesagt wird. Die beste Musik an und für sich ist weiter nichts, als die höchste Gefälligkeit und der bezauberndste Reiz des Ausdrucks.«
Lockmann ging in seinen Sinn ein: »Viel Wahres, besonders für die neuere Musik; doch nicht so ganz richtig. Gewiß, ich ward überrascht zu Venedig, als Pacchiarotti den Helden Giulio Sabino bey Weib und Kindern in der Sopranstimme so täuschend machte, daß alles, wie in der Stille der Mitternacht, helle Thränen vergoß.«
»Die Diskantstimme bleibt immer die passendste für Melodie; die Stimme der Melodie soll vor allen andern herrschen, und die hohen Töne herrschen über die niedrigen. Man vergißt deßwegen gar bald das Unnatürliche.«
»Inzwischen war es doch ein äußerst glücklicher Gedanke, daß Gluck in seinem berühmten Chor der unterirdischen Götter einmal den Grundton der Harmonie durchschneidend herrschen, und die Melodie diesen in allerley Sträubungen und Beugungen begleiten ließ. Ein ächter Zug des Genies. Nichts konnte die eiserne unerbittliche Gewalt dieser Dämonen besser ausdrücken.«
Reinhold fügte hinzu: »Was Rousseau in seinem moralischen Eifer gegen die Kastraten einwendet, ist höchst übertrieben. Ihre Stimme dauert freylich nicht so lange, wie Tenorstimmen, wegen der Stärke der Töne durch die kleine Oefnung der Kehle; aber immer lange genug, um auf allen Theatern von Europa zu entzücken. Daß sie unförmliche Bäuche bekommen, geschieht nicht immer, und auch andern Männern. Daß sie den Buchstaben R nicht aussprechen können, ist ganz falsch; eben so, daß sie ohne Feuer und Leidenschaft sängen. Daß Männer, die auch noch so mannbar sind, keine Kinder hinterlassen, ist bey unsern Regierungsverfassungen und zu starken Bevölkerungen etwas Gewöhnliches.«
Lockmann erwiederte: »Ihr Hauptfehler bey lyrischen theatralischen Vorstellungen ist wohl der Mangel des Kontrastes zwischen Mann und Weib, und auch der Stufen des Alters; und daß die Vocalmusik überhaupt dadurch ärmlich wird: besonders auf den Römischen Theatern, wo lauter Mannspersonen spielen. Und diejenigen, deren Stimmen nicht gerathen, welches nicht selten der Fall ist, sind gewiß recht elende Geschöpfe.«
Reinhold zuckte die Achseln, lächelte und antwortete: »Die Vollkommenheit ist überall eine seltne Erscheinung. Und ist sie hier da, so denkt gewiß jeder für das allgemeine Vergnügen Empfindliche, wenn er es auch nicht, wie jener lebhafte Italiäner, öffentlich ausruft: Benedetto il coltello, u.s.w.«
Die Sonne war eben voll Pracht untergegangen, und der westliche Himmel schwebte mit Strahlenstreifen glühend in Brand und Segen, als eine andre schönere für Männeraugen und Herzen aufging. Hildegard von Hohenthal trat aus einem Park von Buchen und Eichen mit dem Fürsten hervor, leicht in Schritt und Gang, und stolzem Wuchs, voll Geschmack gekleidet, wie eine junge Königin der Amazonen. Ihnen folgte Hildegards Mutter mit dem jungen Herrn von Hohenthal, und die Fürstin.
Das Blut schoß Lockmannen ins Gesicht, und sein Herz wallte, wie sie den Blick ihrer schönen blauen Augen auf ihn lenkte.
Der Fürst ging mit ihr gerade auf ihn und Reinholden zu, und sagte lächelnd: »Ich mache Sie hier mit meinem jungen Kapellmeister bekannt, der die Sirenen von Neapel bezwungen, und so eben in unsre Gegend gebracht hat. Wenn sie nur kein Unheil da anfangen!«
Lockmann antwortete: »Unter der Regierung eines so weisen Ulysses, neben welchem Pallas steht, würde dieß nicht zu besorgen seyn. Mein Bestreben war nur, einige von den guten Musen des Leo, Pergolesi, Traetta, Majo, Jomelli zu Begleiterinnen zu haben, und sie mit den Musen unsrer Händel, Bache, Graun und Gluck in Gesellschaft zu bringen.«
Hildegard faßte ihn so ganz mit ihrem seelenvollen Blick, und sagte: »Schon nach diesen wenigen Worten werden Sie mir ein treflicher Ersatz für London seyn.«
Inzwischen gingen sie auf den Wink des Fürsten zusammen weiter. Rosen und Schaßminen düfteten frischer und stärker umher, und die Nachtigallen thaten lebhaftere Liebesschläge; ein sanfter Wind wiegte sich auf den zarten Zweigen, und flisterte durch die Blätter, und der lichte Himmel spiegelte sich in den Brunnenbecken zwischen den braunen Schatten. Die Morgenscene lebte gewaltig in Lockmanns Einbildungskraft, und das Gewand der göttlichen Schönheit war ihm kaum ein dünner Schleyer.
Er selbst war einer der wohlgebildetsten jungen Männer; und wenn von den zehn Kreisen in Deutschland jeder den auserwähltesten zu einem Wettstreit der Schönheit auf eine Künstlerakademie unter dem Vorsitz eines Mengs abgesendet hätte: so würd' er vielleicht den Preis davon getragen haben. Füger machte aus Lust für sich sein Porträt zu Neapel in Miniatur, ein Meisterstück; und Battoni mahlte ihn zu Rom in Lebensgröße, unbezahlt, zu einem Kunstwerk, jedermann lieblich anzuschauen mit dem edlen Geniuskopf in seinen schwarzen natürlich herum und herabfallenden Locken, den grauen Mantel über die Schulter geworfen, im Schritt vom Winde verweht, zwischen Gesträuch auf neue Melodien und Harmonien sinnend, nachdem Lockmann einige Abende am Klavier ihn ergötzt, und ein leichtes rasches entzückendes Spiel wie mit Bällen zwischen der süßen fertigen Kehle seiner Tochter, und seiner rührenden Tenorstimme in himmlischen Melodien getrieben worden war.
Hildegard und er weideten ihre Blicke an einander in den hellen Augen, an den reinen Stirnen, dem edlen geraden Zug der Nasen, dem lieblichen Suadamund, blühenden Oval der Wangen, und hohen üppigen Wuchse, so gut es unbemerkt geschehen konnte, voll Bewunderung und nie gefühlter Regungen.
Lockmann betrachtete nun auch die Mutter: eine schlanke Gestalt an die vierzig, und noch schöner Kopf in edlen Formen.
Der junge Herr von Hohenthal sah fast wie ein Zwillingsbruder seiner Schwester aus; doch war er an Alter etwas jünger: voll Lebhaftigkeit, Geist und Anstand.
Die Fürstin, eine gute Matrone, hatte vorzüglich ihr Geschlecht im Lande zum Augenmerk, und sorgte für alles, was dieses betraf. Sie unterhielt sich mit der Mutter, und wandelte langsamer mit dieser einen Seitengang hinter drein.
Der Fürst wendete sich wieder an Reinhold und Lockmann, und sagte: »Ihr zwey Italiäner wart im Gespräch begriffen. Fahrt fort, wenn es nichts Geheimes ist; vielleicht finden wir auch etwas dabey zu erinnern.«
Reinhold versetzte: »Wir sprachen von der Menschenstimme, vorzüglich vom Sopran; und bemerkten, daß in Deutschland nicht so viel Sorgfalt darauf verwendet wird, als in Venedig, Rom und Neapel.«
Hildegard nahm darauf bey einiger Stille das Wort, und sagte: »Alle gestehen ein, daß das Blühen der Künste in einem Lande dessen schönste Zierde sey; aber fast überall geht man damit verkehrt zu Werke. Man giebt viel Geld aus, ohne Plan und Zusammenhang. Man kauft alte Gemählde auf, bezahlt theuer Porträte und Virtuosen; an Pflanzung, an das Lebendige und Volksmäßige wird wenig gedacht.«
»Musik ist unter den Künsten die allgemeinste; sie wirkt am mehrsten auf das Volk, und sieht oben an bey jeder Feyerlichkeit und Freude. Wenn die Regenten ihre Unterthanen glücklich machen wollen: so ist sie gewiß die vorzüglichste unter allen Künsten, und zugleich die wohlfeilste.«
»Die Menschenstimme ist unstreitig das Wesentlichste bey der ganzen Musik; und an vortreflichen Menschenstimmen fehlt es überall, auf dem Theater, in Kirchen, und im gemeinen Leben. In Städten von vielen tausend Einwohnern sind drey oder vier schöne reine nur einigermaaßen ausgebildete Menschenstimmen in Deutschland, und noch mehr in England und dem Norden, eine wahre Seltenheit.«
»Die mehrsten schönen Menschenstimmen findet man in Gegenden, wo reine heitre Luft und gutes Wasser ist; gewöhnlich gar keine, wo Kröpfe einheimisch sind. Man sollte einen Kenner ordentlich in Besoldung nehmen, und darauf herumreisen lassen. Ein Fürst, fuhr sie lächelnd fort, könnte sich allein mit dieser Anstalt verewigen. Und dieser Ruhm kostete ihm des Jahrs vielleicht nicht mehr, als er fremden Virtuosen für ihre Konzerte bezahlt. In seinem Lande dürfte ihm schlechterdings keine gute Stimme verloren gehen, und hätte sie ein Junker oder Fräulein vom ältesten Adel und größten Reichthum.«
Der Fürst hörte aufmerksam zu; er liebte, welches wohl bekannt war, bis auf den Grad, wo die gehörige Würde nichts leidet, freymüthige +++Reden, besonders vom Frauenzimmer, und haßte Heuchler und Schmeichler. Hildegard gab Lockmannen mit Hand und Blick ein Zeichen fortzufahren. Dieser war erstaunt, entzückt sie so reden zu hören, und schon dadurch überzeugt, daß sie wenigstens Kennerin seyn müsse. Er benutzte die gute Stimmung und Gelegenheit, und fuhr so freymüthig fort, wie sie angefangen hatte.
»Da wir keine Kastraten machen, so sind alle unsre Sopranstimmen weiblich. Buben, auch mit den reinsten Kehlen, haben noch keinen Charakter, und sind von zu kurzer Dauer; ihr Uebergang in die Tenor-oder Baßstimme ist immer sehr mißlich. Doch könnte man sie auf Gerathewohl vortreflich in Kirchen und auf dem Theater bey Chören brauchen; und, so bald bey der Mannbarkeit die schöne tiefere Stimme entschieden wäre, ihnen die völlige musikalische Erziehung geben. So hat der Kurfürst Clemens von Bonn aus einem Bauerbuben den großen Raaf gebildet, zur Bewunderung auf den ersten Bühnen von Europa.«
»Die Stimmen von weitem Umfang und wichtigem Gehalt sind niemals gleich von Natur da; sie werden nur durch unaufhörliche Uebung gestärkt und gebildet. Zum Beweise kann einer der jetzigen größten Sänger, und eine der ersten größten Sängerinnen in Europa dienen, Marchesi und die Todi, welche nach ihrem eignen Geständniß anfangs sehr unbedeutend waren, und nach langer Uebung erst das wurden, was sie jetzt sind.«
»Die Hofnungen schlagen auch hier manchmal fehl; doch nicht so häufig, wie beym Genie. Mancher Knabe verspricht einen großen Mahler, Dichter, General, Staatsmann; und es wird hernach doch nichts aus ihm. Manches kleine Mädchen verspricht eine himmlische Schönheit, und verwächst sich hernach zu einem ganz gewöhnlichen Dinge. Man darf bey einigen fehlgeschlagenen Versuchen den Muth nicht sinken lassen. So bald nur einmal ein verständiger Plan ins Werk gesetzt worden ist, geht alles leichter. Die Schulen sind ja überall schon da; man hat nur das Aussuchen, und das Mißlingen verursacht keinen großen Aufwand.«
»Bey Auswahl der Stimmen muß man hauptsächlich auf den Charakter sehen, ob Empfindung im Ton ist, Zärtlichkeit, Adel, heroisches Wesen; man kann solche auch mit wenig Umfang vortreflich brauchen.«
»Es ist erstaunlich, wie unendlich mannigfaltig der Mensch die wenige Luft verändert, die er mit einem Zug einathmet! Man muß zugleich die Geschmeidigkeit und Gewalt des Elements und der Werkzeuge, womit er es bildet, bewundern. Welche Menge von Stimmen, Tönen, Worten, Sprachen!«
»Die Werkzeuge sind der Thorax, oder Brustkasten, die Lungen, die Luftröhre, der Kehlkopf, vorzüglich dessen Stimmritze, die Zunge, der Gaumen, die Nasenhöhlen, die Zähne, der Mund, und die Lippen.«
»Bloß aus Ton und Wort kann ein feines und erfahrnes Ohr die Beschaffenheit aller dieser Werkzeuge an einem Menschen erkennen, und Gefühl und Verstand nicht wenig an ihm empfinden und über ihn urtheilen.«
»Das Auge ist ein reicher Sinn im Geben und Nehmen; aber gewiß sind es auch das Ohr und die Sprachwerkzeuge. Das Auge hat nur den Vorzug, daß Geben und Nehmen unmittelbar in demselben Sinne vereinigt sind. Dafür aber haben Ohren und Sprachwerkzeuge mehr Masse vom Lebendigen am Menschen, und lassen mit weit mehr Gewalt auf sich wirken.«
»Der Brustkasten und die Lungen machen den Blasebalg; die Luftröhre mit ihrem Kehlkopf ist gewissermaaßen, nämlich was Höhe und Tiefe betrift, Orgelpfeife; der Kehlkopf und seine Stimmritze geben den Ton, wie ein zusammengesetztes Blas- und Saiteninstrument, indem sie durch Erzitterung ihrer vermittelst der Nerven und Muskeln gespannten Bänder und Knorpel die Luft in gleichförmige Bewegung setzen; das Gewölbe des Gaumens und die Nasenhöhlen verstärken denselben, wie die Röhren von Trompeten, Hörnern und Flöten, wie die Gewölbe von Geigen und Bässen; die Zunge bildet ihn am Gaumen, mit den Zähnen und Lippen, auf unendliche Weise zu Buchstaben, Sylben und Wörtern.«
»Meßbar und erklärbar wirken die Töne an und für sich durch ihre Höhe und Tiefe, Stärke und Schwäche; und dann durch ihre Dauer, Folge und Verbindung. Man könnte dieß die reine Musik nennen. Sie greift die Nerven und alle Theile des Gehörs an, und verändert dadurch das innre Gefühl außer allen andern Vorstellungen der Phantasie. Schon das Wasser pflanzt den Schall mehr als doppelt stärker und weiter fort, als die Luft; noch besser die festen Theile unsers Körpers. Der ganze Mensch erklingt gleichsam, und es entstehen Empfindungen nach dem Verhältnisse der Töne und der Beschaffenheit der Massen, wodurch sie hervorgebracht werden.«
»Unser Gefühl selbst ist nichts anders, als eine innre Musik, immerwährende Schwingung der Lebensnerven. Alles, was uns umgiebt, was wir Neues denken und empfinden, vermehrt oder vermindert, verstärkt oder schwächt den Grad ihrer vorigen Bewegung. Die Musik rührt sie so, daß es ein eignes Spiel, eine ganz besondre Mittheilung ist, die alle Beschreibung von Worten übersteigt. Sie stellt das innre Gefühl von außen in der Luft dar, und drückt aus, was aller Sprache vorhergeht, sie begleitet, oder ihr folgt.«
»Göttliche Kunst, welche die Existenz fühlender Wesen so unmittelbar unter ihrem gewaltigen Scepter hat!«
»Bey dem gesungnen vollen Tone sind gleichsam alle Segel der Sprachwerkzeuge aufgezogen: alles ist gespannt, und der Thorax preßt mit Gewalt die Luft der Lungen durch die Röhre dahinein; der Kehlkopf schwebt und erzittert und bewegt sich alsdann nach den Leidenschaften des Herzens, dem Willen der Seele in beliebigen Graden, und übertrift mit den Melodien seiner kleinen Stimmritze aus dem Mund eines Farinelli, einer Faustina, die Wirkungen ungeheurer Orchester.«
»Bey der Fistel oder Falsetstimme wird der Kehlkopf mehr oder weniger überspannt hinaufgezogen, die Stimmritze mit Gewalt verengt, und nur ein Theil des Ganzen in der Höhe gebraucht. Dasselbe geschieht bey den zu tiefen Tönen durch gewaltsame Herunterziehung des Kehlkopfs und Erweiterung der Stimmritze.«
»Und so braucht man nur einen Theil der Tonwerkzeuge, wenn man spricht und nicht singt. So kann ein Redner eine schöne Aussprache haben, und ein schlechtes Organ zum Singen, weil er bloß die Theile übt, die zur Sprache gehören, vielleicht auch von Natur nur diese fest und rein hat: und so kann ein vortreflicher Sänger unangenehm sprechen, weil die Werkzeuge, die dazu gehören, bey ihm nur einen Theil zum Ganzen ausmachen, und an und für sich selbst mangelhaft zu einem für sich bestehenden Ganzen sind.«
»Unter allen Thieren hat der Mensch das vollkommenste Stimmorgan; die Nachtigall unter den Vögeln das einfachste.«
»Die Methode, die Stimme zum Gesang zu bilden und zu üben, ist in Neapel, Rom, Venedig, Mailand, Turin so bekannt, wie bey den Preußen das Marschiren und Exerziren; jeder musikalische Korporal weiß sie.«
»Wer singen lernen will, muß fürs erste eine Anzahl Töne rein in der strengsten Bestimmung, und rund in höchster Stärke und leisester Schwäche, wie ein Despot in seine Gewalt zu bekommen suchen. Er fängt an mit dem Tone, der ihm am natürlichsten ist, woraus, wenn ich mich so ausdrücken darf, sein ganzes Wesen geht, und worin er gewöhnlich spricht. Wenn er diesen rein und voll hat: so geht er einen tiefer, und ebenso zwey und drey und vier tiefer; und dann einen, zwey, und drey in die Höhe, bis er eine Oktave richtig und rund hat, ohne bey irgend einem Tone Hinderniß und Schwierigkeit zu finden, zu straucheln und zu wanken.«
»Dann sucht er sie zu verbinden, zu verschmelzen.«
»Dann geht er immer weiter in die Tiefe und die Höhe; in die Fistel über; und sucht die ganz vollen Töne mit den Tönen dieser, so unmerklich wie möglich, zu vereinbaren.«
»Alles dieses geschieht mit dem bloßen Vokal A ohne Konsonanten.«
»Ein voller Ton mehr in der Höhe oder Tiefe, und sollte dessen Besitz Monate kosten, ist so wichtig, wie ein Zoll mehr beym Maaße der Menschenlänge.«
»Hat man einmal eine hinlängliche Anzahl von Tönen: so fängt man damit allerley einfache Uebungen an. Fürs erste schwellt man jeden vom Leisen bis zur höchsten Stärke, und läßt ihn so wieder bis zum Leisen sinken; steigt dann die ganze diatonische Leiter hinauf und hinunter; übt nun die Sprünge in Terzen, Quarten, Quinten, Sexten, und so weiter, hinauf und herunter, haarscharf abgemessen, bis zur größten Richtigkeit und Fertigkeit, Verbindung und Gleichheit. Endlich steigt man die Leiter durch die halben Töne hinauf und herunter, welches das Schwerste ist, aber bis zur Richtigkeit erlernt werden muß.«
»Dabey darf keine Ungeduld und Uebereilung statt finden; mehrere Jahre gehören zu dieser himmlischen Reifheit der Kehle. Und dann erst kommen Triller, Verbindung der Töne mit den Sylben, Aussprache, Declamazion, Manieren, Läufe; Seele, Geist und Leben.«
»Die Hauptsache ist das Mundstück, der Kehlkopf und dessen Stimmritze, bey einem zarten und reinen Gehör. Wenn die Natur diese Mündung nicht überein geschmeidig und festsehnicht gebildet hat, der Ton wankend und falsch daraus hervorkommt: so ist alle Mühe und Uebung vergeblich. Und gutes Ohr und vortreflicher Kehlkopf sind nach der Erfahrung so selten, wie ächtes Genie und hohe Schönheit2.«
»Bey blasenden Instrumenten kommt es hauptsächlich auf die Lungen, Zunge und Lippen an; und bey den andern auf Arm und Hand. Gutes Gehör und Herz und Geist muß übrigens allezeit im Menschen seyn, sonst wird nie etwas Großes. Neapel und Venedig haben in Besorgung der musikalischen Erziehung den Vorzug vor allen Städten der Welt. Bey ihnen geht so leicht keine gute Stimme verloren. In Neapel sind drey Stiftungen, wo an die vierhundert Zöglinge aufgenommen werden, denen immer die besten Meister vorstehen. Auch sind beyde vorzüglich dadurch glücklich.«
»Doch vergeben Ew. Durchlaucht, und Sie reizende junge Dame. Die Aufmerksamkeit, deren Sie mich würdigten, hat mich über die gehörige Grenze, und vielleicht bis zum Pedantischen verleitet.«
Hierbey waren sie bis zum Eingang des Schlosses gekommen. Hildegard schöpfte frischen Athem, so voll Lust hatte sie zugehört. Sie sagte mit leiser süßer Stimme, wie für sich: »Vortreflich!« und konnte sich nicht enthalten, mit unbeschreiblicher Grazie ihm flüchtig die Hand zu berühren; welches wie ein elektrischer Schlag ihm durch sein Wesen drang.
Der Fürst blickte heiter und freundlich auf ihn, und gab zur Antwort: »Es scheint, daß die Natur zu gewissen Zeiten für die Ersprießlichkeit und den raschen Wachsthum der Künste schöpferische Geister hervor und durch mancherley Umstände zur Reife bringen müsse, die hernach dem Ganzen Stoß und Richtung geben. Wenn man diese nicht hat, entsteht bey dem besten Willen nur ein ekelhaftes Nachäffen. Wahr aber ist es, der Verstand und die Pflegung eines mächtigen August und Ludwig, und Städte wie Neapel, Rom, Venedig, Paris, London, Wien, Berlin sind alsdann dafür gedeihliches Wetter, Sonne, Mond und Sterne.«
Die Fürstin und die Mutter, und andre Herren und Damen, theils vom Hofe, theils aus dem Orte, die da schöne Häuser und Gärten besaßen, und sich den Sommer über auch da aufhielten, hatten sich inzwischen eingefunden. Die Gesellschaft ging in den Speisesaal. Reinhold umarmte herzlich seinen jungen Freund, und Beyde schieden, jeder nach seiner Wohnung.
Lockmann ging auf seinem Zimmer, voll unaussprechlicher Empfindungen, langsam und oft stille stehend, auf und ab; aß ein wenig, trank aber desto mehr von einem alten wohlthätigen Hochheimer, und legte sich mit folgendem Stoßseufzer zu Bette: »Soll unsre hochgepriesene Vernunft die Staatsverfassungen nie dahin bringen, daß zwischen Menschen, die für einander geboren und erzogen sind, keine so ungeheure Kluft mehr seyn muß!«
Hildegard sprach sehr wenig an der Tafel; doch was sie sagte, war voll Sinn und Verstand, und aller Augen waren auf ihre blühende Schönheit gerichtet. Der Fürst schätzte sich glücklich, einen solchen Meister, wie Lockmann, für seine Musik gefunden zu haben; er erzählte die Geschichte mit ihm auf dem Petersberge zu Erfurt, und beschrieb die schönen Knochen des Grafen von Gleichen und seiner zwey Weiber. Neben Hildegarden saß Herr von Wolfseck, Sohn des Ministers, welcher sie mit allerley Tand und Aberwitz zu unterhalten suchte; er war ein geschickter Rechtsgelehrter, aber widrig von Gestalt in seiner langen Figur, und hatte keinen Funken Geschmack und Gefühl für alle Kunst. Sie sahen einander bey ihrer Ankunft, wo er gerad' in Geschäften auf dem Schloß ihnen einige Höflichkeitsbesuche abstattete.
Der junge Tag und das Schwalbengezwitscher weckten Lockmannen von lieblichen Träumen. Er sprang auf, und betrachtete die Morgenröthe, eine wahre Glorie der Sonne, wie sie kein Tizian und Correggio mit Farben darzustellen vermag. Sie nähert sich selbst; und ein glühendes Roth durchdringt die Pforten des Aufgangs, wie die Wangen eines unerfahrnen Mädchens. Schon ist sie da, und wollüstig gleitet der Blick von ihrer feurigen Majestät ab, bis sie ganz in schöne Rundung sich erhoben hat, und das geblendete Aug' ihre Strahlen nicht mehr aushält. Frische Kühle mit dem Duft der Blumen durch das offne Fenster vom Garten stärkten alle Glieder aus dem warmen Bette bis zum lebendigsten Bewußtseyn.
Lockmann ergriff das vortrefliche Fernrohr von Ramsden; legte es aber schnell wieder hin, als ob er sich die Finger daran verbrannt hätte; und nahm den festen Entschluß, sich von der Zauberin entfernt zu halten, und seine Neigungen gleich anfangs zu unterdrücken, damit sie nicht zur Leidenschaft anwüchsen, die nicht anders als unglücklich seyn könnte.
Um sich sogleich zu beschäftigten, und seinem Geist eine ganz andre Richtung zu geben, legte er die Stimmen des Messias von Händel für die erste Probe zurecht; nahm die Partitur, setzte sich ans Klavier, und schrieb Folgendes zum Unterricht für seine Leute auf, die um neun Uhr dazu bestellt waren.
Messias; ein Oratorium von Händel.
»Es enthält in drey Theilen die ganze Geschichte Jesu.«
»I. Verkündigung, Geburt. II. Leiden und Tod. III. Auferstehung, und Unsterblichkeit. Die Worte sind meistens aus den Evangelien genommen; sie haben viel Großes und Feyerliches, besonders für Chöre; und überhaupt für Musik vortrefliche Stellen.«
»Händels Melodie und Darstellung hat fast immer den herzlichen Deutschen Charakter; es ist etwas Kräftiges und Unschuldiges darin. Die neuere Neapolitanische Schönheit hat er nicht; damals war die Fertigkeit in Kehlen und auf Instrumenten noch nicht so weit getrieben. Gewiß aber gehört er unter die vortreflichsten Tonkünstler seines Zeitalters.«
»Darstellung, wenn man so sagen darf, wird merklich bey: blick auf, Nacht bedecket das Erdreich; stärker in der Arie: das Volk, das im Dunkeln wandelt.«
»Es waren Hirten beysammen auf dem Felde; hat ein schönes Schäfervorspiel.«
»Und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie: ist treflich durch die Begleitung ausgedrückt, die ein sanftes Licht wallt; nicht loderndes Siriuslicht, wie das Lux perpetua bey Jomellis Requiem. Die Glorie ist in dem Tone fort schön: die Menge der himmlischen Heere. Der Chor vortreflich: Ehre sey Gott.«
»Der Wechselgesang: er weidet seine Heerde, im Zwölfachteltakt und B dur, ist ein Meisterstück, durchaus voll Sanftmuth, Liebe und Zärtlichkeit. Solche Musik dauert ewig; sie ist gerade so natürlich, daß man sie nicht merkt, sondern nur der Sinn der Worte übergeht. Es ist ganz Glucks Art; und dieser mag nicht wenig von Händeln in seine neue Bahn getrieben worden seyn.«
»Nur in der Begleitung kommen zuweilen die langen Manschetten, das Gedehnte, Schlotternde seiner Zeit vor.«
Zweyter Theil.
»Er ward verschmähet; ganz vortreflich ausgedrückt, in eben der Art, wie er weidet seine Heerde. Man merkt die Musik auch wieder nicht, so natürlich ist sie; und so wenig unterbricht die Begleitung.«
»Die Chöre sind fast immer meisterhaft. Und der Ewige legt auf ihn unser aller Missethat. Dieser kleine ist von der allerstärksten Wirkung; wie Glucks vortrefliche.«
»Die Schmach bricht ihm das Herz. Dieses begleitete Recitativ zeigt Händels Darstellungskraft am allerstärksten; und nur ein großes musikalisches Genie kann Melodie und Begleitung so tief und rein gefühlt erfunden haben. Die verkleinerte Sext, und der verminderte Septimenaccord spielen darin die Hauptrolle. Man kann dieß Recitativ unter das allervortreflichste stellen.«
»Die kurze Arie: schau hin und sieh, wer kennet solche Qualen! ist wieder Glucks Art.«
»Lieblich ist der Boten Schritt, sie kündigen Frieden uns an; im Zwölfachteltakt, fast durchaus nur mit einer Geige und dem Basse begleitet; ganz vortreflich. Schöne Stelle: ihr Schall ging aus in alle Welt.«
»Der Chor: Halleluja, mit Trompeten und Pauken, ist durchaus vortreflich; und beschließt den zweyten Theil mit einer prächtigen Fuge: und er regiert ewig; in einem reizenden Sextengange das einfache Thema.«
Dritter Theil.
»Ich weiß, daß mein Erlöser lebt; aus dem E dur. Eine erstaunliche Zuversicht in der Melodie; bloß wieder mit einer Geige und dem Basse begleitet.«
»Göttlich, der Chor: Wie durch Einen der Tod, grave; so kam durch Einen die Auferstehung, allegro.«
»Denn wie durch Adam alle sterben, grave. Dieses ist beydemal bloß vierstimmig, ohne alle Begleitung, von großer Wirkung. Also wird wer starb durch Christum auferweckt, allegro.«
»Merkt auf, ich kündig' ein Geheimniß an; Recitativ mit Begleitung, von der Baßstimme vortreflich declamirt. Schöne Arie dazu, mit der Trompete Solo: sie schallt die Posaune. Der zweyte Theil ist ganz unbegleitet. Sie macht mit den andern guten Kontrast.«
»Die letzten Chöre sind vollendete große Meisterstücke. Würdig ist das Lamm, das da starb, Largo; und die Fuge: Preis und Anbetung und Ehre und Macht sey ihm, der da sitzet auf seinem Thron; im schönsten natürlichsten Thema zur Declamazion, Larghetto; sie zeigt recht die allerstärkste Gewandtheit in dieser Form. So wie gleich darauf die Fuge: Amen, allegro; welches einen muthigen wilden stürmischen Beschluß macht.«
»Die wahre Musik ist nur Eine, so lange der Mensch seine Natur, und die Accorde, Konsonanzen und Dissonanzen ihr ewiges Verhältniß behalten. Sie ist dieselbe bey dem Miserere von Allegri, und bey Leo, Pergolesi, bey Hasse, Traetta, Jomelli, Majo; Händel, Gluck; nur bey den letztern von mindrer Schönheit und Mannigfaltigkeit, als bey den Neapolitanern. Sie geht überall auf den Zweck los, den Sinn der Worte und die Empfindung in die Zuhörer überzutragen, so leicht und angenehm, daß man sie selbst nicht merkt; und das Ohr, wo möglich, dabey zu bezaubern.«
Um neun Uhr ging er in den Konzertsaal. Alle waren schon da versammelt. Wie ward er aber überrascht, als Hildegard, ganz zur Andacht weiß gekleidet, nur eine kaum aufgeblühte Rose in den schönen blonden Locken, unter den Sängerinnen hervortrat und ihn mit diesen Worten anredete: »Auch ich bin gekommen, mich in die hohe Kunst, als eine gehorsame Schülerin von einem so vortreflichen Meister einweihen zu lassen, wenn er meine Stimme und geringen Fähigkeiten würdig genug dazu findet.«
Lockmann antwortete ernsthaft darauf: »Gehorsamst bitten wir vielmehr um Ihren guten Unterricht, gnädiges Fräulein, bey der Aufführung des Meisterstücks von unserm großen Landsmann, der die himmlische Kunst so entzückend unter die Britten verpflanzte, daß noch jetzt seine Melodien und Harmonien ihm wie einem Heiligen in ihren Tempeln widerhallen. Von den Jubelorkanen, Donnerwettern, Niagarakatarakten in Westminster können Sie hier freilich nur einen äußerst schwachen Nachlaut hören.«
»O, ich glaube nicht, versetzte sie eben so ernsthaft, daß der Instrumentensturm, der die Menschenstimmen, immer doch die Seele des Ganzen, so überrauscht, dem Unsterblichen gefallen könne, der die rührendsten Melodien, die er ihr gegeben hat, meistens nur, wenn ich mich so ausdrücken darf, gleichsam in ein zartes Griechisches Gewand hüllte; und hoffe bey Ihrer Aufführung mehr wahre Nahrung für Herzen und Religionsgefühle zu finden. Doch war die Begleitung auch in Westminster nicht so stark, als man auswärts sich vorstellt; die Stimme steht weit voran, und alles gleichsam nach der Ohrenperspektiv.«
Beyder Blicke glänzten in einander bey diesen Reden, wie von einem gemeinschaftlichen Geistesquell.
Er ließ sich inzwischen nicht stören, theilte die Stimmen aus, und überreichte ihr die Sopranstimme; sie nahm diese gefällig an, und stellte sich an den gehörigen Posten.
Darauf machte er Alle nach seinem flüchtigen kurzen Aufsatze mit dem Ganzen bekannt, zeigte jedem, wie die Hauptstellen vorzutragen wären; setzte sich an den Flügel, und fing an. Die Gegenwart und Mitwirkung der Schönheit selbst, von der Themse herüber, brachte die gespannteste Aufmerksamkeit zuwege. Er führte wie ein junger Apoll an, und die Probe war in der That ein reizendes Schauspiel.
Sie gelang auch sogleich zum Verwundern. Niemand unter ihnen, und selbst Lockmann hatte noch je so reine, volle, süße, Ohr und Herz schmeichelnd ergreifende Töne gehört, als bey den Worten: er weidet seine Heerde; und: lieblich ist der Boten Schritt, sie kündigen Frieden uns an; aus der gewaltigen Kehle und von den holdseligen Lippen der Hildegard, wie der Cäcilia selbst aus dem Himmel auf Erden, hervorströmten, in Bescheidenheit und Unschuld, ohne die allergeringste Künsteley, nur mit den Accenten hoher Grazie und den netten Läufen rascher Jugend und Fertigkeit da und dort verziert und geschmückt.
So wie sie ihn, entzückte er sie; er sang mit ihr den zweyten Sopran, anstatt der Sängerin, die ihn singen sollte, zuweilen im Tenor, mit der Entschuldigung, ihr für die nächste Probe nur den gehörigen Ausdruck zeigen zu wollen. Beyde hatten solche Vollkommenheit von einander nicht erwartet; er nur viel weniger von ihr. Nach ihren ersten Arien sprang er vom Flügel, fiel vor ihr nieder voll Gluth des Enthusiasmus, faßte ihre zarten Hände, küßte sie inbrünstig, und stammelte: »Wunderwesen, ich bete Sie und Ihre Kunst an. O, die Italiäner haben Recht, daß sie einer Gabrieli, einem Pacchiarotti, Marchesi fünf- und zehnmal mehr dafür geben in einer Oper zu singen, als einem Sarti, Paesiello, die ganze Musik dafür zu setzen. Die vortreflichsten Noten sind dürres Geripp, wenn ihre Melodien nicht durch solche Stimmen schön und reizend und jugendlich lebendig in die Seelen gezaubert werden.«
Sie ergriff ihn bey der Hand, zog ihn in die Höhe, und sagte lächelnd: »Zu viel, zu viel Lob für eine Anfängerin! ich werde sonst Nichts lernen.«
»Nichts lernen? Muthwillige!«
Dieser Vorfall kam allen so natürlich vor, daß er fast nicht bemerkt wurde. Mann und Jüngling und so gar die Weiber sagten wie aus Einem Munde: solche göttliche Stimme hätten sie noch nie gehört, mit so viel Fertigkeit und Ausdruck.
Darauf ging die Probe fort, von ihrer Seite immer mit neuer Schönheit überraschend bis zu Ende.
Sie hielt sich nicht lange mehr auf, bat nur, daß man nichts von ihrer Anwesenheit sagen möchte; verneigte sich vor Lockmann und der Gesellschaft, und verschwand wie eine Gottheit. Ein freudiges Murmeln entstand im Saal, wie von den Wogen an den Ufern des Meers, wenn die Weste nicht mehr in den Lüften gehört werden.
Lockmann bestellte Sänger und Sängerinnen zur zweyten Probe des Miserere auf den Nachmittag; und zugleich zu einer neuen für ein kleines Werk von dem Patriarchen der Kirchenmusik, Palestrina. Und die Gesellschaft ging höchst vergnügt aus einander.
»Das ist wieder ganz etwas anders!« sagt' er laut für sich, als er nach seinem Zimmer ging. »Aber was will daraus werden!« endigte er mit einem tiefen Seufzer.
Er dachte schon auf Plane; aber es war ihm, wie einem Wandrer, der in ein reizendes Thal sich verirrt, voll Bäche, Quellen, und Wasserstürze und anmuthiger Waldung, wo er aber lauter unersteigliche Gebirge vor sich sieht, und keinen andern Ausweg findet, als wieder zurück zu kehren. Sie dachte auch auf Plane, mit viel erfreulichern Aussichten.
Kurz vor der Probe schrieb er die wenigen Worte nieder:
»Fratres, ego enim accepi a Domino. Di Palestrina.«
»Der Text sind die Einsetzungsworte beym Abendmal.«
»Fratres, ego enim accepi a Domino, quod et tradidi vobis; quoniam Dominus Jesus, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et gratias agens fregit et dixit: Accipite et manducate, hoc est corpus meum.Hoc facite in meam commemorationem.«
»Vortrefliche Musik. Der Anfang besteht aus den reinsten Konsonanzen, zweystimmig; Quinten, Oktaven, Quarten, Terzen, Sexten. Darauf imitirt der Alt und Baß.«
»Es wechseln immer zwey Chöre ab, und verflechten sich zuweilen bey den Hauptstellen. Sie bestehen beyde aus zwey Sopranen, Alt und Baß. Die Harmonie geht nur zweymal drittehalb Oktaven auf dem tiefen B im Basse aus einander, bey ›gratias agens‹ und ›in meam commemorationem.‹«
»Der Hauptton ist G moll.«
»Der Name Jesus wird durch die Harmonie meisterlich herausgehoben; Dominus ist im Accord C dur, Je in B dur und fällt durch eine Kadenz in F dur. Und im ersten Chor sogleich von Dominus in F dur, Je in Es dur, und die Sylbe sus in B dur. Dieß scheint Kleinigkeit, ist aber bey der Aufführung von der größten Wirkung, und stellt das Gefühl der Gläubigen dar. Es ist gerade dasselbe, als wenn der Prediger auf der Kanzel bey dem Namen sein Käppchen abnimmt.«
»Bey Accepit panem, et gratias agens, winden sich beyde Chöre wie im Taumel achtstimmig voll Kunst durch einander. Accipite et manducate: hoc est corpus meum; ist am öftesten wiederhohlt, und vortreflich ausgeführt durch die schönsten Verflechtungen.«
»Hoc facite in meam commemorationem, wird mit aller Pracht ausgeführt in C dur, F dur, B dur, F dur, C dur, G moll, D dur, und G dur.«
»Ich habe diese Musik in der Peterskirche zu Rom aufführen hören. Die Kapelle saß in einem Gegitter, und man konnte keinen Sänger sehen. Die Harmonie ward dadurch noch mehr zu einem Ganzen; welches in seinen Windungen und gleichsam verwirrtem Dialog von Chören das Geheimnißvolle der Handlung, und die Gefühle gläubiger Christen dabey vortreflich darstellt. Jeder Chor scheint ein Ganzes für sich zu machen; das Zusammenpassen und Schmelzen ist eben die große Kunst bey so vielstimmigen Sachen.«
Die Probe des Miserere ging gut genug, so daß keine mehr nöthig war; und in das kleine Werk von Palestrina studirten sie sich bald ein. Freytag Morgens, es war Mittewoch, sollte noch einmal eine Probe von allem gehalten werden.
Darauf machte Lockmann einen Strich ins Feld hinein, ergötzte sich an der Fruchtbarkeit und Schönheit des Landes, sah auf den Höhen von fern den Vater Rhein wie einen breiten Lichtstrom prächtig vom Himmel hernieder blinken; und pries sich glücklich, in dieser herrlichen Gegend zu leben. Dazwischen war aber immer sein geheimes heftiges Verlangen Hildegard; doch konnt' er noch nichts Klares darüber in seinem Kopf hervorbringen. Er hatte den Tag Bewegung genug gehabt, und ging, als schon die Lyra über ihm durch das blaue Heiter der Luft glänzte, nach Hause, um gut zu essen, zu trinken und zu schlafen.
Den folgenden Morgen war die Sonne so eben über das Gebirg' empor, als ihn ihr starkes Licht weckte. Das Fernrohr fiel ihm ins Auge, und mit einem Sprung hatte er es in der Hand, das Fenster offen, und schaute. Er konnte an den Linden Stamm und Zweig und jedes Blatt unterscheiden, als ob er sie auf wenig Schritte vor sich hätte; sah ein klares und helles Bächlein zwischen Blumen auf grünem Rasen darunter weg in die Wasservertiefung rinnen, und entdeckte endlich hinten in der Dämmerung erhoben eine Quelle, in schöner Rundung eingefaßt. Der Garten war lauter Frühling, Paradies und Reiz; aber das Schönste darin erschien nicht. Hildegard hatte vorgestern, als sie sich wieder ankleidete, zu spät mit ihrem scharfen Blick in die Ferne, ihn wie etwas Weißes und Buntes noch im Fenster des hohen Schlosses gesehen; wußte aber nicht, wer und was es war; und, wenn es ein Mann war, ob er sie vielleicht mochte beobachtet haben; und wählte nun, wenn sie sich zuweilen baden wollte, die Stunden der Nacht. Gestern, um dieselbe Zeit, ging sie deßwegen im Garten spaziren, und betrachtete mit einem kleinen Fernglas die Fenster dieser Seite im dritten Stocke des Schlosses, von welchem allein die Wasservertiefung über die hohe Mauer und zwischen den Bäumen konnte gesehen werden. Da sie nichts bemerkte, so war sie ohne Sorge, blieb aber doch bey ihrem Entschluß.
Einige Stunden darauf kam ein Bedienter, und lud ihn, im Namen der Mutter, des Sohns, und der Tochter von Hohenthal, zum Mittagsessen ein. Er wollte um drey Uhr, die bestimmte Zeit, gehorsamst aufwarten. Dieses setzte sein ganzes Innres und seine Einbildungskraft heftig in Bewegung, und er ging hastig in seinem Zimmer auf und nieder.
Hildegard herrschte zu Hause, und that, was sie wollte; obgleich voll kindlicher Ehrerbietung und des zärtlichsten Gehorsams gegen ihre Mutter. Diese folgte ihr in allem; sie war aus einer Menge Proben überzeugt von der klugen Aufführung, Einsicht und Menschenkenntniß ihrer Tochter. Hildegard hatte schon manchem jungen Herrn in London und zu Spaa den Kopf verrückt, sich selbst aber nie bethören lassen; und war jederzeit den gefährlichen Gelegenheiten schlau und fein ausgewichen. Sie trieb ihr obgleich muthwilliges doch unschuldiges Spiel immer nur bis auf einen gewissen Punkt, über dessen Grenze sie bisher nichts verleiten konnte. Die Wörter, Phrasen und Dithyramben von ihrer Schönheit, ihren Talenten und Vollkommenheiten, von Grausamkeit, Kälte, Eis, Flüchtigkeit der Jugend hörte sie bald nur zum bloßen Zeitvertreib. Da sie London überstanden hatte, so konnte bey der Deutschen Redlichkeit fast keine Verführung mehr für sie möglich seyn.
Sie war der Augapfel ihres vortreflichen Vaters, seine Hauptfreude und Sorge gewesen, und ihre Erziehung in allen Punkten reiflich überlegt worden; was sie jedoch unnöthig machte, da sie, gerade so wie er wollte und wünschte, sich fast gänzlich aus sich selbst bildete, und nur die besten Meister zum Unterricht, und die vorzüglichsten Personen besonders ihres Geschlechts zum Umgang erfordert wurden.
Das Glück begünstigte sie in allem. Schon als Kind war sie über Falschheit, Verstellung, Verrätherey, Neid und Bosheit bey den Menschenpflanzen, ihren Gespielinnen und Gespielen, ohne großen Schaden klug geworden; und hatte an die ersten aller Tugenden: Schweigen, und für sich zu bestehen, Bescheidenheit und gerechte Würdigung eines Jeden; und was auf die Dauer gefallen und mißfallen muß, ihr Herz, ihre lebhaften Sinnen und immer klare heitre Seele früh gewöhnt.