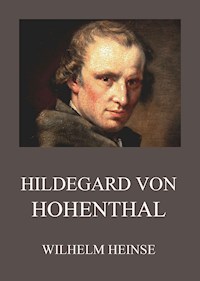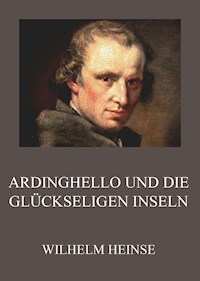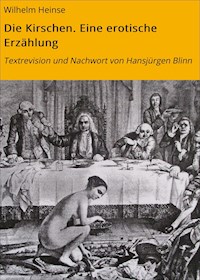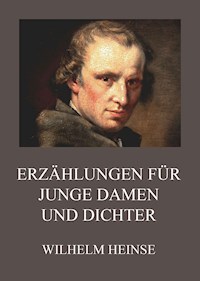
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Anthologie der besten Kurzgeschichte des deutschen Schriftstellers. Aus dem Inhalt: Aurora und Cephalus. Endymion. Laurette. Der Schiffer. Die gründliche Betrübniß. Die seltsamen Menschen. Der Adel. Der Bluhmenkranz. Dionysius der Tyrann und Aristipp der Weise. Die eilfertige Schäferinn. Die Haushaltung. Das junge Mädchen. Die Zauberinn. Circe. Die Undankbarkeit des männlichen Geschlechts. Melson. Drey Taube. Der betrübte Wittwer. Der Mohr und der Weiße. Der blöde Schäfer. Faustin. Der Kanonikus und seine Köchinn. Aurelius und Beelzebub. Das Diebsgeschlechte. ... u.v.m. ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erzählungen für junge Damen und Dichter
Wilhelm Heinse
Inhalt:
Wilhelm Heinse – Biografie und Bibliografie
Erster Band - Komische Erzählungen
Aurora und Cephalus.
Endymion.
Laurette.
Der Schiffer.
Die gründliche Betrübniß.
Die seltsamen Menschen.
Der Adel.
Zweyter Band - Komische Erzählungen
Der Bluhmenkranz.
Dionysius der Tyrann und Aristipp der Weise.
Die eilfertige Schäferinn.
Die Haushaltung.
Das junge Mädchen.
Die Zauberinn.
Circe.
Die Undankbarkeit des männlichen Geschlechts.
Melson.
Drey Taube.
Der betrübte Wittwer.
Der Mohr und der Weiße.
Der blöde Schäfer.
Faustin.
Der Kanonikus und seine Köchinn.
Aurelius und Beelzebub.
Das Diebsgeschlechte.
Damon und Pythias.
Die Nachbarn.
Der Patient.
Das Wunderbild.
Der Hänfling des Pabstes Johannes XXIII.
Europa.
Die schlauen Mädchen.
Gellerts Tod.
Der kleine Töffel.
Nigrinens Tod.
Liebe und Gegenliebe.
Die Küsse.
Die Schäferstunde.
Axiochus und Alcibiades.
Sokrates und der Wittwer.
Der neue Pygmalion.
Das Zeichen in den Augen.
Philemon und Baucis.
Der zärtliche Liebhaber.
Der Falke.
Die Grazien.
Fragment einer Geschichte des Apollo.
Nadine.
Der erste Kritikus.
Erzählungen für junge Damen und Dichter, W. Heinse
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849627522
www.jazzybee-verlag.de
Wilhelm Heinse – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 15. Febr. 1749 als Sohn eines Predigers zu Langewiesen in Thüringen, gest. 22. Juni 1803 in Aschaffenburg, besuchte das Gymnasium zu Schleusingen, widmete sich in Jena unter großen Entbehrungen dem Studium der Rechte, daneben besonders dem der alten und neuen Literatur, und begab sich dann nach Erfurt, wo er mit Wieland bekannt wurde, der auf seine poetische Richtung große Einwirkung gewann. Durch ein Bändchen »Sinngedichte« empfahl er sich Gleim, der den Mittellosen unterstützte und zu sich einlud. Von Erfurt nahm ihn 1771 ein abenteuernder Hauptmann, v. Liebenstein, der Heinses Talent vollends vergiftete, mit auf Reisen. Nachdem sich diese Verbindung gelöst hatte, lebte H. einige Zeit in der Heimat, erhielt 1772 durch Gleims Vermittelung eine Hauslehrerstelle in Quedlinburg und hielt sich seit 1773 bei Gleim in Halberstadt auf, den Namen Rost führend, bis ihn 1774 J. G. Jacobi als Mitarbeiter an der Zeitschrift »Iris« zu sich nach Düsseldorf berief. Hier war es, wo der Besuch der berühmten Bildergalerie seinen Kunstsinn weckte und er über seinen eigentlichen Beruf erst klar ward. Von unbezwinglicher Sehnsucht nach Italien erfüllt, trat er 1780, von Jacobi und Gleim unterstützt, die Reise dahin an, verweilte 8 Monate in Venedig und dann zumeist in Rom, wo er viel mit dem Maler Müller verkehrte, und kehrte Ende 1783 nach Düsseldorf zurück, wo er sein Hauptwerk: »Ardinghello«, schrieb. Im Oktober 1786 wurde er Lektor des Kurfürsten von Mainz und lebte hier bis 1792 in anregendem Verkehr mit J. v. Müller, G. Forster, Sömmering, Huber, verbrachte darauf ein Jahr in Düsseldorf, kehrte aber 1793 nach Mainz zurück, von wo er 1795 nach dem Baseler Frieden mit dem Kurfürsten nach Aschaffenburg übersiedelte. Auch unter Dalberg (seit 1802) blieb er hier als Hofrat und Bibliothekar tätig. Seine literarische Laufbahn hatte H. durch die Herausgabe der »Sinngedichte« (Halberst. 1771) eröffnet. Dann folgten die Übertragungen zweier obszöner Werke aus der ausländischen Literatur, die »Begebenheiten des Enkolp, aus dem Satyrikon des Petron übersetzt« (Schwabach 1773, 2 Bde.; ein Stück daraus: »Das Gastmahl des Trimalchio«, in Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 2616), »Die Kirschen«, nach Dorat (Berl. 1773), ferner »Laidion, oder die Eleusinischen Geheimnisse« (Lemgo 1774). In Rom übersetzte er in Prosa: »Das befreite Jerusalem« (Mannh. 1781, 4 Bde.) und Ariosts »Orlando« (Hannov. 1782, 4 Bde.). Darauf erschienen seine beiden Hauptromane: »Ardinghello, oder die glückseligen Inseln« (Lemgo 1787, 2 Bde.; 4. Aufl. 1838), worin er seine Ansichten über bildende Kunst und Malerei niederlegte (vgl. Jessen, Heinses Stellung zur bildenden Kunst und ihrer Ästhetik. Zugleich ein Beitrag zur Quellenkunde des »Ardinghello«, Berl. 1901) und »Hildegard von Hohenthal« (das. 1795–96, 2 Bde.; neue Aufl. 1838, 3 Bde.), seine Gedanken über musikalische Kunstwerke enthaltend. In »Anastasia und das Schachspiel« (Frankf. 1803, 2 Bde.; 3. Aufl. 1831) legte er in Briefform seine Gedanken über Schach- und Kriegsspiel nieder. Die H. häufig beigelegte Schrift »Fiormona, oder Briefe aus Italien« (Kreuznach 1803) ist nicht von ihm. Eine Sammlung seiner »Sämtlichen Schriften« veranstaltete H. Laube (Leipz. 1838, 10 Bde.); die neueste und beste ist die von Schüddekopf besorgte (»W. Heinses Sämtliche Werke«, Berl. 1902 ff., 10 Bde.). Als künstlerischen Kompositionen fehlt es Heinses Romanen an Geschlossenheit und Rundung, um so mehr zeichnen sie sich durch Macht und Glut der Darstellung aus. Die Reflexion über ästhetische Fragen überwiegt und beherrscht oft ganze Kapitel; aber diese Reflexion ist überraschend feinsinnig, wenn auch häufig allzu einseitig dem sinnlich Reizvollen zugekehrt. Die Handlung der Romane ist unübersichtlich, die Charakterzeichnung oberflächlich, insbes. die Frauengestalten nur sinnlich und ohne Gemüt. Heinses Kunstanschauungen gehen über Winckelmanns klassischen Idealismus hinaus und berücksichtigen im Sinne Herders die Bedingungen von Raum und Zeit. Das treueste Bild von ihm enthalten die »Briefe zwischen Gleim, H. und Johannes v. Müller« (hrsg. von Körte, Zürich 1806–08, 2 Bde.); der »Briefwechsel zwischen Gleim und H.« wurde besser von Schüddekopf herausgegeben (Weimar 1894–95, 2 Bde.). Vgl. Pröhle, Lessing, Wieland, H. (nach den handschriftlichen Quellen in Gleims Nachlaß, Berl. 1877); Hettner, Aus W. Heinses Nachlaß (»Archiv für Literaturgeschichte«, Bd. 10, Leipz. 1881); Schober, Johann Jakob Wilhelm H., sein Leben und seine Werke (Leipz. 1882); Sulger-Gebing, Wilhelm H., eine Charakteristik zu seinem 100. Todestage (Münch. 1903).
Erster Band - Komische Erzählungen
Vadano a volo i canti. Anima pura
Sempre è sicura.
Chiabrera.
I.
Aurora und Cephalus.
Se della moglie sua vuol l' uomo
Tutto saper, quanto ella fece, e disse;
Cade dall' allegrezze in pianti, e in guai;
Onde non può più rilevarsi mai.
Ariosto.
Aurora und Cephalus.
Noch lag, umhüllt vom braunen Schleyer
Der Mitternacht, die halbe Welt;
Es ruht' in ungestörter Feyer
Das stille Thal, das öde Feld,
Der Nymphen-Chor an ihren Krügen,
Der trunkne Faun auf seinem Schlauch;
Vielleicht fügts Nacht und Zufall auch,
Daß Manche noch bequemer liegen;
Der Elfen schöne Königinn
Hatt' ihren Ringel-Tanz beschlossen,
Und sanft auf Blumen hingegossen
Schlief jede kleine Tänzerinn;
Und kurz, es war zur Zeit der Mette,
Als sich Auror zum erstenmal
Aus ihrem Rosen-Bette
Von Tithons Seite stahl.
Die Schlafsucht, die sie ihrem Gatten
Sonst öfters vorzurücken pflag,
Kam diesesmal ihr wohl zu statten.
Sie zieht die Brust, an der er schnarchend lag,
Sanft unter ihm hinweg, verschiebt mit Zephyr-Händen
Die Decke, glitscht heraus, deckt leis' ihn wieder zu,
Wirft einen Schlafrock um die Lenden,
Und wünscht ihm eine sanfte Ruh.
Sie fand im Vorgemach die Stunden,
Die ihre Zofen sind, vom Schlummer noch gebunden,
Nur eine ward, indem die Göttinn sich
Mit leisem Fuß bey ihr vorüber schlich,
Aus einem Traum, den Mädchen gerne träumen,
Halb aufgeschreckt; sie schrie, wie Nymphen schreyn,
Um feuriger geküßt, nicht um gehört zu seyn;
Auror' erschrickt und flieht; allein,
Das Mädchen legt sich, ruhig auszuträumen,
Auf's andre Ohr, und schlummert wieder ein.
Die Göttinn eilt, spannt (was sie nie gethan)
Mit eigner schöner Hand vor ihren Silber-Wagen
Drey rosenfarbe Stuten an,
Und läßt sich nach Hymettus tragen.
Dort steigt sie ab, läßt Pferd und Wagen
In einer Grotte stehn, und sucht mit zartem Fuß,
Aus dessen Tritten Rosen sprossen,
Den schönen Cephalus.
Aurora? Wie? – das Muster weiser Frauen,
Auf deren Treu, die schon Homer uns pries,
Ein jeder alter Mann sein junges Weibchen schauen
Und sie zum Vorbild nehmen hieß?
Sie, die nur ihrem Tithon lachte,
Und, ob er gleich bey silbergrauem Haar
Und taubem Ohr kaum noch ergötzbar war,
Doch Tag und Nacht auf sein Ergötzen dachte;
Die ihre schöne Brust zu seinem Pfülben machte,
Und wenn, nach alter Männer Art,
Die schöne Brust von ihm begeifert ward,
Sich's doch nicht eckeln ließ, ihm ganze Nächte wachte,
Ihm oft die Füße rieb, ihm oft den Puls befühlt',
Erwärmend ihn in ihren Armen hielt,
Ihn immer fragt', ob ihm was fehlte,
Und bis er schlief ihm Mährchen vorerzählte –
Aurora, die so viele Proben gab,
Wie zärtlich sie den alten Tithon liebe;
Sie fiele nun auf einmal ab,
Und hegte fremde Triebe?
Mir ist es leid, daß ich's gestehen muß,
Ihr mögt nun, was ihr wollt, von ihrer Tugend halten,
Allein, so war's! Sie schlich von ihrem Alten
Sich heimlich weg, und sucht den jüngern Kuß
Des schönen Cephalus.
Helvetius und Büffon werden sagen,
Das dieses nicht so unnatürlich sey;
Allein, wie fromme Leute klagen,
So denken beide ziemlich frey.
Doch selbst Sanct Thomas will vorlängst gesehen haben,
Daß junger Mädchen Aug' auf schönen jungen Knaben
Sich gern verweilt; und an Gestalt,
An Neigungen und Reizbarkeit der Sinnen,
Sind, wie man weiß, die ältesten Göttinnen
Stets sechszehn Jahre alt.
Dis war Aurorens Fall, als auf Hymettus Höhen,
Zur Jagd geschürzt, mit Bogen, Pfeil und Spieß,
Der schone Jäger ihr zum erstenmal sich wies.
Verbeut die strengste Pflicht, was sichtbar ist, zu sehen?
Sie sah in Unschuld hin, und blieb, ihm nachzusehen,
Uneingedenk der laurenden Gefahr,
Auf einer Silber-Wolke stehen.
War's ihre Schuld, daß er so reizend war?
Es bleibt hiebey. Doch, da sie, wider Hoffen,
Zum zweytenmal ihn schlafend angetroffen,
Wie sollte sie dem Einfall widerstehn,
Von ihrem Wagen abzusteigen
Um ihn genauer anzusehn?
Die Dämmrung macht oft Manche schön,
Die sich im Sonnenschein mit schlechtem Vortheil zeigen,
Sie muß doch sehn, ob's hier nicht auch so sey.
Er flog letzthin zu schnell vorbey;
Was schadet's näher hinzugehen?
Sie thut's. Allein, wie angenehm erblaßt,
Da sie ihn recht in's Auge faßt,
Ihr Rosen-Mund – den Tithon selbst zu sehen!
Den Tithon? – Ja, doch wie er damals war,
Als er, in auserlesner Schaar
Der schönsten Phrygier, vor Allen
Der Schönste war, vor Allen ihr gefallen,
Mit langem dunkelbraunen Haar,
Mit blühendem Gesicht und Lippen von Corallen.
Je mehr sie ihn beschaut, je stärkre Farben leiht
Ihr gern betrognes Herz der seltnen Aehnlichkeit.
Sie überläßt sich nun mit Ruh den neuen Trieben,
Und findt, ich weiß nicht was für eine Süßigkeit,
Den werthen Greis im Cephalus zu lieben.
Mit welcher Lust, mit welcher Zärtlichkeit
Sie auf das Ebenbild von Tithons schöner Zeit
Die gern betrognen Blicke heftet!
So war er einst mit jedem Reiz geschmückt,
So ward er oft, eh ihn der Jahre Last entkräftet,
Im Taumel süßer Lust an ihre Brust gedrückt!
So sieht und liebt, nach Platons Lehren,
Der junge Kallias in seiner Tänzerinn
Das höchste Gut, womit sich unsre Geister nähren,
Eh' sie, Gott weiß warum, in diese Leiber ziehn.
Singt ihm, den Grazien zu Ehren,
Ihr süßer Mund ein tejisch Liedchen vor,
So glaubt euch der entzückte Thor,
Er höre den Gesang der Sphären:
Ein Druck von ihrer weichen Hand,
Ein Kuß der buhlerischen Zungen,
Erweckt von seinem Götter-Stand
Die schlummernden Erinnerungen;
Auf einmal ist's, ob um ihn her
Der blaue Himmel offen wär',
Er sieht die Sterne doppelt blinken;
Er steigt, verliert sich in den Schwarm
Der Geister, welche Nektar trinken,
Glaubt in den Quell des Lichts zu sinken,
Und sinkt in – Phrynens Arm.
Daß oft dergleichen Aehnlichkeiten
Zu süßen Irrungen verleiten,
Ist ein Erfahrungsatz, den Niemand läugnen wird.
Aurora sah, durch sie verführt,
Im schönen Cephalus den Tithon sich verjüngen,
Und sah es kaum, so faßt sie schon den Schluß,
Die Stunden, welche sie, nicht ohne Ueberdruß,
Bey Diesem nur verträumen muß,
Mit Jenem muntrer zuzubringen.
Mit welcher Lust verschlingt ihr lauschend Ohr
Der raschen Stöber Laut, die ins Gehölze dringen!
Sonst hörte sie der Lerchen frühes Chor
Gern neben ihrem Wagen singen:
Allein ihr däucht in diesem Augenblick
Hylaktors Jagd-Geheul die lieblichste Musik.
Sie sieht die muntern Jäger ziehen,
Das Hift-Horn tönt, der Wald erwacht,
Die Hunde schlagen an, die scheuhen Rehe fliehen;
Doch plötzlich fühlt von einer fremden Macht
Der Jüngling sich ergriffen, fortgezogen,
Und schneller als ein Pfeil vom Bogen
Durch Luft und Wolken weg, wer weiß wohin, gebracht.
Betäubt von seinem Abentheuer
Begriff er nicht, wie ihm geschah.
Er sieht aus Furcht, die stets Gespenster sah,
Bey zugeschloßnem Aug, ein gräßlich Ungeheuer
Mit offnem Schlund ihm dräun und glaubt sein Letztes nah.
Doch Düfte von Ambrosia,
Die ihm, mit süßerm Schwall, als von den Zimmet-Hügeln
An Ceylans Strand, entgegenwehn,
Ermuntern ihn zuletzt, die Augen aufzuriegeln;
Und o! wer wünschte nicht, was er itzt sah zu sehn!
Der Perlenmutter-Saal mit Säulen von Rubinen,
Den unsre Göttinn sich zum Schauplatz auserkohr,
Hat einem Kenner nicht romantisch gnug geschienen.
So stellt euch dann umwölbet mit Schasminen
Auf weichem Moos ein Blumen-Bette vor,
Mit reichem Sammt bedeckt; auf diesem Blumen-Bette,
Was Jupiter sich selbst gewünschet hätte:
Die schönste Fee, so schön und jung, als man
An einem Sommer-Tag sie immer sehen kann;
Und diese Fee in einer Lage
Wie Titian der Liebes-Göttinn giebt,
Und in dem halbgebrochnen Tage,
Worinn die blöde Schaam sich williger ergiebt;
Verhüllt, doch so, daß jede kleine Regung
Das neidische Gewand verschiebt,
Und unter seidnem Flor die steigende Bewegung
Des schönsten Busens sichtbar wird –
Den Anblick stellt euch vor, und werdet nicht gerührt!
Der Jüngling ward's, der in dem Augenblicke,
Worinn der schöne Gegenstand
Ihn überrascht, zu gutem Glücke
Sich selbst zu ihren Füßen fand.
Die Göttinn wundert, wie natürlich,
Sich ungemein, ihn hier zu sehn;
Und er giebt ihr, doch nur figürlich,
Den ganzen Eindruck zu verstehn,
Den so viel reizungsvolle Sachen
Auf sein geblendtes Auge machen.
Die Freyheit, die er nimmt, fällt billig
Dem Schicksal, nach Gebrauch, zur Last;
Und wenn Auror' ihn nur nicht haßt,
Ist er zu jeder Strafe willig.
Aurora will ihm gern gestehn,
Daß Leute, die ihm ähnlich sehn,
Nicht sehr gehaßt zu werden pflegen:
Es sey ihr auch nicht sehr entgegen,
(Sie hält, indem sie dieses spricht,
Die Rosen-Finger vor's Gesicht)
Von einem hübschen Mann sich hochgeschätzt zu wissen –
Wie weit ihr eignes Herz hiebey
Vielleicht zu gehen fähig sey,
Das werde mit der Zeit sich erst entwickeln müssen –
Man komme mit Beständigkeit
Und vielem Muth im Lieben weit;
Doch, was sie seiner Zärtlichkeit
Für diesesmal gestatten wollte –
(Und dieses selbst vielleicht noch nicht gestatten sollte)
Sey, nebst dem Recht, sie ungescheut
Auf seinen Knieen anzuschauen,
Ein ungezweifeltes Vertrauen
In seine Ehrerbietigkeit.
Mein Mann verspricht mit vielen Schwüren,
Indem er ihre Knie aus Dankbarkeit umfaßt,
Sich sehr bescheiden aufzuführen;
Doch Dankbarkeit ist eine schwere Last!
Aus Dankbarkeit, von der er glühet,
Wird ihre schöne Hand, wer weiß wie oft, geküßt,
Und da man sie zerstreut zurücke ziehet,
Indem er noch im Küssen ist,
Verirrt sein Mund – da seht mir doch die Musen!1
Die kleinen Spröden schämen sich
Und halten plötzlich ein – doch ich bekenn' es, ich,
(Und Cicero an Pätum spricht für mich)
Verirrt – wie leicht verirrt man sich! –
Verirrt sein Mund auf ihren Busen.
»Wer einmal, (spricht Marx Tullius,
Doch nicht im Buche von den Sitten)
Und wär's nur mit dem linken Fuß,
Des Wohlstands Gränzen überschritten,
Dem rath' ich, statt aus Blödigkeit
Auf halbem Wege stehn zu bleiben,
Vielmehr die Unbescheidenheit,
So weit sie gehen kann, zu treiben.«
Dies Axioma mag sehr oft nach Ort und Zeit
Ein Körnchen Salz in praxi nöthig haben;
Vermessne, unbescheidne Knaben,
Mit Bart und ohne Bart, gehn leicht hierinn zu weit.
Doch Cephalus (man muß eins wie das andre sagen)
Befand sich wohl bey dem, was Marcus schrieb:
Er wagts von Grad zu Grad, bis ihm vor lauter Wagen
Nichts mehr zu wagen übrig blieb.
Wenn seinem Ungestüm die Göttinn endlich wich,
So that sie freylich nichts, als was sie längst beschlossen.
Mit Cephalus verhielt es sich
Nicht so. Ihm war ein Glück, das ihn den Göttern glich,
Durch bloßen Zufall aufgestoßen,
Und diese Zauberey, die süße Trunkenheit,
Die sein Gehirn auf ziemlich lange Zeit
Der Stimme seiner Pflicht verschlossen,
Ward gradweis aufgelöst, uno endlich ganz zerstreut.
Ihm hatte, da sein Mund (wie schon gesagt) verirrte,
Die Phantasie den gleichen Streich gespielt,
Wodurch die Göttinn ihn für ihren Tithon hielt.
Es stellt' im Feuer der Begierde
Ihm in Auror' sich seine Procris dar:
Wie ähnlich, Götter! Ja, fürwahr!
Sie ist's, Sie ist's! An Stirn und Brust und Haar
Kann in der Welt sich nichts vollkommner gleichen!
Wen muß dies Lächeln nicht erweichen?
So lächelt Procris nur! So schön
Sah er in ihren blauen Augen,
Vor Uebermaaß der Wonne, Thränen flehn,
Und war entzückt sie aufzusaugen!
So dacht' er und Auror, in diesem Stück mehr klug
Als zärtlich, sieht und nährt den nützlichen Betrug.
Nehmt noch dazu die zärtlichste der Farben,
Die dieser Göttinn eigen ist,
Das süße Rosenroth, das ihren Leib umfließt,
Und einen Mund der Griechisch küßt,
Und Augen, die vor Wollust starben:
So wird bey Leuten, die verzeihn,
Sein Selbstbetrug vielleicht verzeihlich seyn.
Doch, wie die stärksten Zauberey'n
Der Wahrheit endlich weichen müssen,
So däucht auch ihm, nach wiederholten Küssen,
Die Aehnlichkeit nicht mehr so groß zu seyn.
Der Dunst zerfließt, der sein Gesicht geblendet,
Er staunt, er fühlt sich träg' und lau,
Und zürnt schon auf sich selbst, daß er an Tithons Frau
So viel Entzückungen verschwendet.
Vergebens sucht ihr feuervoller Blick
Die Flamme wieder anzufachen,
Ihm winkt umsonst ein neues Glück
In ihrem offnen Arm; die Scherze fliehn zurück,
Und Reu' und Ueberdruß erwachen.
Bald kommt es, wie man denken kann,
Zu Fragen und Erläuterungen,
Und Cephalus, von Schaam und Schmerz bezwungen,
Fängt stotternd diese Beichte an:
Zu wahr ist's nur, o Göttinn, mein Betragen
Beleidigt deinen Reiz, und läßt mir weiter nichts,
Als tiefbeschämt mich selber anzuklagen.
Nicht halb so sehr verwirrt von deinen Klagen,
Als meiner eignen Schuld, weiß ich, beym Gott des Lichts!
Nicht was ich sagen soll – Mein Herr, das thut hier nichts,
Fällt ihm Aurora ein, ihr braucht euch nicht zu plagen;
Der Eingang will, so viel ich merke, sagen,
Ihr liebt mich nicht, und habt mich nie geliebt?
Ach, allzuwahr! (ruft Cephalus betrübt,
Indem Auror, doch nur mit halbem Munde,
Bey seinem Ach ihm an die Nase lacht)
Ja, ich gesteh's, daß diese Morgen-Stunde
Mich doppelt ungetreu, mich doppelt strafbar macht.
Unwürdig so beglückt zu werden,
Liebt' ich, o Göttin, dich – die, ohne Schmeicheley,
So sehr verdient, daß ihr ein Herz sich weih –
Dich liebt' ich nie; und ihr – der einzigen auf Erden,
Für die ich zärtlich bin – ihr ward ich ungetreu!
Das Compliment, versetzt die Dame,
Ist minder schmeichelhaft als neu;
Doch, wenn man bitten darf, der Name
Der Schönen, die das hohe Glück genießt,
Daß solch ein Herz für sie nur zärtlich ist?
Der Schein, ich fühl's und sag's mit Schmerzen,
Ist wider mich, spricht Cephalus;
Und doch – vergieb, daß ich so deutlich reden muß!
Du hattest nichts als meinen Kuß,
Und Procris war in meinem Herzen.
Wir waren schon vom Führband an
Die unzertrennlichsten Gespielen,
Und lieben uns, seitdem wir fühlen,
So zärtlich als man lieben kann.
Als Kind schon kannt' ich keine Lust
Als meiner Procris liebzukosen,
Lag gerne mit ihr unter Rosen,
Und spielte mit der jungen Brust.
Wie ward sie oft im Sommerschatten
Am kühlen Bach von mir belauscht!
Wir wußten nicht warum, und hatten
Schon unsre Herzen ausgetauscht.
So wurden wir bey Scherz und Küssen
Eins in des andern Armen groß,
Und unwillkommne Pflichten rissen
Mich weinend itzt aus ihrem Schooß.
Nun folgten kriegerische Spiele
Dem Gänsepiel, der blinden Kuh;
Es floh vorm lermenden Gewühle
Der Kindheit sorgenlose Ruh.
Allein das Bild der holden Schönen
Schwebt mir, wohin ich gehe, nach;
Ein banges wehmuthsvolles Sehnen
Ertränkt mein Aug in stillen Thränen,
Und hält in oder Nacht mich wach.
Itzt deucht der Tag mich nicht mehr helle,
Die Luft nicht blau, der Frühling todt;
Nichts reizt mich mehr, kein Abendroth,
Kein Hayn, kein Schlummer an der Quelle.
Allein sobald ein Götter-Fest
Die Mädchen sichtbar werden läßt,
Und Procris, weiß und frisch-umkränzet,
Mit offner Brust und freyem Haar,
Die Schönste in der bunten Schaar,
Wie Hebe mir entgegenglänzet;
Dann ist mir – nein! der Götter Glück
Kann keinen höhern Grad erschwingen!
Mein offnes Aug, mein starrer Blick
Scheint ihre Reize zu verschlingen:
Sie sieht im gleichen Augenblick
Nach mir sich um, und unsre Blicke
Begegnen sich; sie seufzt, und zieht,
Da sie mein Auge schmachten sieht,
Verschämt die ihrigen zurücke;
Doch bald von Amorn übermogt,
Der ihr im jungen Busen pocht,
Kann sie sich länger nicht erwehren,
Sich zärtlich nach mir hin zu kehren;
Sie füht – »Sehr wohl, mein Herr! Sie fühlt,
Was alle junge Mädchen fühlen.
Sagt mir, ihr, der so vieles fühlt,
Was soll die Elegie erzielen,
Womit ihr mich hier abgekühlt?
Man dächte, wenn man euch so reden hört, es hätte
Noch Niemand es, wie ihr gemacht;
Fangt lieber den Roman von hinten an, ich wette
Er endet doch in einer Hochzeit-Nacht.«
Um kurz zu seyn, so sind es nun drey Jahre,
Fuhr Cephal fort, daß Hymen uns beglückt,
Und ich in Procris Arm erfahre,
Daß After-Liebe nur von Sättigung erstickt.
Mir ist, ob jede Nacht die allererste wäre,
Man sagt sonst der Genuß verzehre
Der stärksten Liebe Glut; bey uns ist's umgekehrt,
Die unsre wird dadurch genährt,
Und wächst, dem Phönix gleich, aus ihrer eignen Asche.
Der Herr (fällt hier die Göttinn ein)
Hat, wahrlich! aus der Purpur-Flasche
Bescheid gethan, er liebt ja ungemein!
Wer hätte sich bey so gestellten Sachen
Des Glücks versehn, ihn ungetreu zu machen?
So widersinnisch als es klingt,
Versetzt er mit gesenkten Blicken,
So wahr ist's doch: was mir ihr Bild vor Augen bringt,
Ein Zug von ihr, ein Blick, ein Augen-Nicken,
Wie Procris nickt, das setzt mich in Entzücken;
Und reizend, Göttinn, wie du bist,
Konnt' Amorn diese Hinterlist
Nur gar zu leicht, zumal im Dunkeln, glücken.
Allein bey kälterm Blut und hellerm Sonnenschein
Soll Venus selbst nicht fähig seyn,
Noch einmal mich so zu berücken.
Die Göttinn wendet lächelnd ein:
Was einst geschehen sey, das könne mehr geschehen.
Sie hofft umsonst! Er schwört ihr Stein und Bein,
Sie niemals mehr für Procris anzusehen.
Und meynst du, fragt Auror, daß ihre Gegentreu
Der seltnen Großmuth würdig sey,
Ihr einer Göttinn Gunst zum Opfer darzubringen?
Die Herzen, glaube mir, sind rar,
Die man versuchen darf, du kennest Amor's Schlingen!
Ein zärtlich Weib ist immer in Gefahr.
Und wäre sie in Danae's Verwahr,
Wohin kann nicht ein goldner Regen dringen?
Seyd unbesorgt, erwiedert unser Held,
Ihr würde selbst vom Zevs vergebens nachgestellt.
Ich kenne sie; sie würd' in ihrem Leben
Auf einen andern Mann, und wär' es ein Adon,
Sich keinen Seiten-Blick vergeben.
Der Götter Fürst regiert auf seinem Thron
Nicht ruhiger, als ich in ihrem Herzen.
Du bist beglückt, versetzt Tithonia,
Und ferne sey's von mir, sie bey dir anzuschwärzen.
Allein, erinnre dich, was kaum dir selbst geschah.
Gelegenheit, mein guter Freund, und Jugend
Sind immer ihrem Falle nah.
Wie oft, daß sich die strengste Tugend
Zu schwach zum Widerstande sah?
Zu allem Glück war kein Versucher da;
Allein man spielt nicht allezeit im Glücke,
Und Unschuld, die nichts Böses denkt noch scheut,
Fällt manchmal bloß aus Sicherheit
In Amors unsichtbare Stricke.
Aurora, die mit Kenntniß sprechen kann,
Spricht so beredt vom süßen Gift der Sünde,
Und unsrer Fehlbarkeit, giebt ihm so viele Gründe,
Und führt so manches Beyspiel an,
Daß ihr die List gelingt. Der Mann fällt in Gedanken,
Und staunt mit unterstütztem Haupt,
Und staunt so lang, bis er Frau Procris fähig glaubt,
Wo nicht zu fallen, doch zu wanken.
Die Eifersucht, ein Uebel, daß er nie