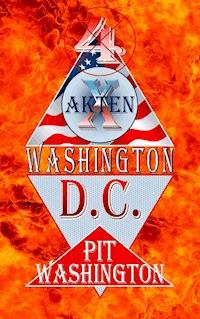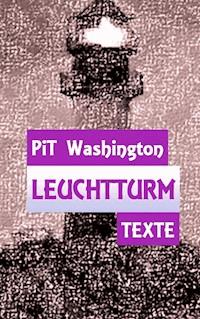Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die unglaublichsten Geschichten ranken sich um einen Ort, von dem möglicherweise jeder schon einmal gehört hat: AREA 51! Von Außerirdischen, die man dort gesehen haben will, bis zu unbekannten Flugobjekten [UFOS], die nachts über das steppenartige Gelände driften sollen, reicht das Arsenal des Grauens. Dabei scheint wirklich nichts unmöglich zu sein. Aber sind die Geschichten wahr? Ist irgendetwas dran an all den Mythen? In diesem Buch geht es nicht nur um die „AREA 51“. Es geht um viele unglaubliche Begebenheiten, die Menschen ganz plötzlich erlebten. Es beleuchtet Situationen, mit denen Menschen umgehen müssen, auch, wenn sie vor wenigen Sekunden noch keine Ahnung davon hatten. Am Ende bleibt jedoch eine Frage, die sich nur jeder selbst beantworten kann: Sind solche Dinge wirklich möglich?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das leuchtende Ding schwebte genau über
mir – ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Aber dann verschwand es in
der Dunkelheit der Nacht!
[Aussage eines Reisenden nahe der „AREA 51“]
Inhaltsverzeichnis
Umweg zur AREA 51
Lia
Der Sprung
Schwarzer Rauch
Babyklappe
Auf der Reise
Die Zigeunerin
Glücksengel
Wiedersehen
Koma
Böse Schwester
Spiegel
Ende einer Reise
Sein größter Kampf
Stille Nacht
Die Gitarre
Engelsträne
Mystischer Zauber
Flachmann
Klassentreffen
Der letzte Gast
Der Schneider
Hoffnungsengel
Die Kamera
Harley
Ausgebrannt
Eine Liebe
Spukhaus
Das schönste Geschenk
Lottogewinn
Das alte Auto
Das alte Ehepaar
Auftritt des Lebens
Gedenktafel
Schornsteinfeger
Zeit unseres Lebens
Der alte Ring
Das Wunder
Edelstein
Besuch
Heilung
Der Fremde
Das Amulett
Die Schreibmaschine
Das Beste im Leben
Mutters Licht
Nach dem Regen
Verfolgt
Geisterschiff
Der Geist
Waldspaziergang
Träume
Stich im Herz
Traumengel
Die Harfenistin
Seltsamer Unfall
Winchester
Die weiße Kapelle
Umweg zur „Area 51“
Es war ein schwüler Tag, als Jenny mit ihrem Wagen irgendwo in der Wüste von Nevada steckenblieb. Das Ding bewegte sich keinen Meter mehr vorwärts und es sah ganz so aus, dass die junge Frau einen Notdienst rufen musste, um weiter zu kommen. Die drückende Hitze kroch durch den engen Wagen und breitete sich rasant auf Jennys Haut aus.
Um sich ein wenig zu erfrischen, sprang sie aus dem Auto, doch da war es auch nicht viel besser. Entnervt und total k.o. setzte sich Jenny neben den Wagen in den heißen Sand unter einem knochigen Busch. Wenigstens spendete der ein wenig Schatten. Als sie ihr Handy aus der Tasche holte, stellte sie entsetzt fest, dass es kein Netz hatte. Ein wenig panisch hielt sie es in alle Himmelsrichtungen, doch es half nichts.
Außerdem bemerkte sie, dass sie einfach so losgefahren war – nicht einmal etwas zu trinken hatte sie dabei. Es war wie verhext – sie hatte ja angenommen, dass sie schnell wieder daheim in Las Vegas sein würde. Dass so etwas passierte, konnte sie nicht ahnen. Was sollte nun werden?
Plötzlich tippte sie jemand von hinten an. Erschrocken fuhr sie herum und starrte in das Gesicht eines gutaussehenden jungen Mannes.
Seine Augen funkelten irgendwie seltsam, doch das konnte auch an der intensiven Sonneneinstrahlung liegen.
Was der fremde Mann dann aber sagte, verschlug der jungen Frau regelrecht die Sprache: „Ich komme von der Area 51, gleich in der Nähe. Komm mit, dann gebe ich dir etwas zu trinken und du kannst dich stärken.“
Jenny wusste, was diese sonderbare „Area 51“ war, zumindest glaubte sie, es zu wissen – es war ein gruseliges Geheimnis, welches sich mit diesem Stützpunkt verband. Aber an Außerirdische oder irgendeinen anderen Zauber glaubte sie nicht. Sie stand mit beiden Beinen fest auf der Erde und willigte ein, mit dem Fremden mitzugehen.
Als sie in den Wagen steigen wollte, hielt sie der Fremde zurück. Er meinte, dass er eine andere Möglichkeit habe. Und als er das sagte, bückte er sich und legte eine kleine metallene Schachtel, die nicht größer war als eine Streichholzschachtel, auf den sandigen Boden. Die vermeintliche Schachtel fluktuierte und schillerte im gleißend hellen Sonnenlicht und plötzlich formte sich ein Wirbel um sie herum. Schnell wurde er größer und hüllte alsbald die beiden jungen Leute in sich ein. Ehe Jenny noch nachdenken konnte, überkam sie das Gefühl, dass sie irgendetwas kraftvoll in die Luft erhob. Schließlich schwebte sie neben dem Fremden einher – und der schaute lächelnd zu ihr herüber.
Doch kaum hatte der sonderbare Zauber begonnen, endete er auch schon wieder und es wurde ziemlich düster. Es war jedoch sehr angenehm geworden, nicht mehr so heiß, wie eben noch.
Jenny schaute sich um. Der fremde junge Mann war verschwunden, dafür breitete sich um sie herum eine große, leere, düstere Halle aus. Irgendetwas schwebte unmittelbar vor ihr – und als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte sie, was es war: ein riesiger metallisch schimmernder Diskus!
Das musste eine fliegende Untertasse sein – so schoss es ihr in den Sinn. Aber da erschien der Fremde mit einer großen Wasserflasche und einem Tablett, auf dem einige belegte Brote waren. Der Fremde stellte alles auf einen kleinen Steinsockel, der neben ihnen war und sagte dann: „Lass es dir schmecken. Ach so, ich bin Bob. Ich arbeite auf diesem Stützpunkt. Und ehe du weiterfragst – ja, das ist ein Raumschiff, aber kein außerirdisches. Es ist zwar noch geheim, aber in Kürze werden wir der Öffentlichkeit darüber berichten. Denn schon bald beginnt eine neue Ära. Wir haben das Geheimnis der Gravitation geknackt! Das bedeutet, dass wir endlich keine altmodischen Flugzeuge mehr brauchen, die mit brennbaren Flüssigkeiten betankt werden müssen. Wir fliegen mit diesen Scheiben, die wir lange erproben mussten, ehe sie funktionierten, um die ganze Welt und verbrauchen lediglich einen Stoff, der noch geheim ist, der aber nicht brennbar ist. So wird alles sicher und viel bequemer. Keiner muss mehr Angst vorm Fliegen haben.“
Misstrauisch schaute Jenny zu dem sonderbaren Diskus und dann in das beruhigende Gesicht des jungen Mannes, dieses merkwürdigen Bob. Hatte er das wirklich alles ernst gemeint, und warum sagte er ihr das? Wollte er sich interessant machen – und – war das dieses sagenumwobene Geheimnis von „Area 51“?
Sie konnte sich das alles nicht vorstellen und nahm sich die Wasserflasche, um einen ordentlichen Schluck daraus zu trinken. Sie hatte großen Durst und erst allmählich kehrte ihre Ruhe und ihre Ausgeglichenheit zurück.
Irgendwie schien ja alles ziemlich logisch, doch sollte wirklich alles so kommen? Und waren wirklich die Menschen an diesen unfassbaren Erfindungen beteiligt? Steckte da nicht doch etwas ganz Anderes dahinter? Was war das für ein seltsamer Wirbel, mit dem sie hierher geflogen waren?
Wohl gab es mehr Fragen als Antworten und sie wollte sie Bob stellen. Der jedoch meinte auf einmal, dass er nur noch wenig Zeit habe und sie wieder zurückbringen müsste.
Jenny sah das natürlich ein – und so flogen die beiden, die sich ziemlich sympathisch fanden, in dem merkwürdigen Wirbel wieder zu Jennys Wagen in der Wüste zurück. Und es war ganz seltsam, denn das Auto ließ sich ohne Schwierigkeiten starten und fuhr schließlich ohne Probleme los.
Beim Abschied schenkte ihr Bob das metallene Kästchen und meinte dabei ein wenig traurig: „Schade, dass wir uns wieder trennen müssen, aber es muss sein. Nimm diesen Transporter, er ist voll funktionstüchtig. Und wenn du doch noch einmal liegenbleibst, dann lege das Kästchen auf den Boden und rufe meinen Namen. Dann bin ich da und helfe dir. Abgemacht!“
Jenny hatte Tränen in ihren Augen – und als sie ihren Wagen startete und langsam losfuhr sah sie nur noch, wie Bob in einem Wirbel aus Sand verschwand.
Sie hatte keinerlei Probleme mehr mit dem Wagen – ohne Beanstandungen schaffte sie es bis nach Las Vegas. Natürlich wollte sie wissen, was es mit diesem merkwürdigen Kästchen auf sich hatte und fuhr zu einem namhaften Institut. Dort kannte sie einen Wissenschaftler, dem sie von ihrem seltsamen Erlebnis berichtete.
Jim, so sein Name, schaute die junge Frau ungläubig an und betrachtete sich dann das sonderbare Relikt.
Als er das Material testete, stellte er fest, dass es sich um eine vollkommen unbekannte Legierung handelte. So ließ sich das Ding auch nicht öffnen und schon gar nicht durchleuchten.
Irgendwie hatte Jenny aber das Gefühl, Jim glaubte ihr nicht und so fuhr sie wieder heim, um über ihre Erlebnisse nachzudenken.
Was sie nicht wissen konnte – Jim hatte sich, kurz nachdem sie gegangen war, mit der Regierung in Verbindung gesetzt, wo man die Testergebnisse nachdenklich betrachtete. Bei der darauffolgenden geheimen Videokonferenz wurde Jim unmissverständlich klargemacht, dass er die Testergebnisse niemandem mehr zeigen durfte, denn sie wären angeblich gefälscht.
Als Jim nach dem Werkstoff fragte, aus welchem das Kästchen bestand, runzelte der hochrangige Regierungsbeamte die Stirn, beugte sich vor die winzige Kamera und sagte dann leise: „Ja, das ist schon interessant. So etwas ist auf der Erde nicht bekannt. So etwas gibt es nicht einmal in unseren geheimsten Laboren.“
Jenny lag seitdem oft in der Sonne und erinnerte sich immer wieder an ihr wundervolles Erlebnis. Diesen Bob fand sie wirklich sehr nett und irgendwie spürte sie ein bislang unbekanntes Stechen in ihrem Herzen.
Und als sie sehnsüchtig in den Himmel schaute, der sich blitzblank wie ein azurblaues Geheimnis über ihr wölbte, hüllte sie ein nebliger Wirbel ein und eine ihr wohlbekannte Stimme flüsterte: „Komm mit mir in meine Welt am Rande des Universums …“
Lia
Toni war schwer an Krebs erkrankt. Er wusste, dass er nicht mehr sehr lange zu leben hatte. So sann er jeden Tag darüber nach, wie es wohl sein würde, wenn er sterben müsste. Doch so oft er auch darüber nachdachte, er konnte es sich einfach nicht vorstellen. Obwohl er große Angst vorm Sterben und vor dem Tod hatte, fand er sich irgendwann mehr oder weniger mit seinem unverrückbaren Schicksal ab.
Er wollte noch einmal leben und brach sogar die wenig aussichtsreiche Chemotherapie ab, bei welcher er das Gefühl nicht loswurde, dass diese ihn immer mehr schwächte. Und er krempelte sein Leben, das ihm noch blieb, vollkommen um. Alles, was er nicht unmittelbar brauchte, verkaufte er und behielt am Ende nur noch sein kleines Auto und seine Kleidung, die er auf dem Leibe trug. Leuten, mit denen er sich unterwegs unterhielt, sagte er nur, dass er sich auf dem Weg befände. Und er fühlte sich gut dabei. Es gab nichts mehr, dass er regeln musste und es gab auch nichts mehr, dass ihn an irgendeinen Ort fesselte. Er war frei wie ein Vogel, nur der Tod lauerte überall, wo er sich befand.
Toni wusste sehr genau, dass der Tod nur auf seine schwächste Sekunde wartete, um dann gnadenlos zuzuschlagen. Doch bevor es soweit war, wollte er all das kennenlernen, was er damals in seinem alten Leben, als er sich noch so vielen Zwängen und Ängsten aussetzte, versäumt hatte.
Weit kam er herum und eines Abends traf er in einem kleinen Restaurant in einem noch kleineren Ort eine wunderschöne junge Frau. Sie war so makellos, dass es ihm Spaß machte, sie zu erobern. Er wollte sich noch einmal beweisen, dass er solch eine wunderschöne Frau für sich gewinnen konnte. Und es schien, als würden sich all seine Bemühungen, dieser Frau den Hof zu machen, lohnen – sie setzte sich zu ihm an den Tisch.
Die folgende Unterhaltung jedoch verlief recht merkwürdig. Obwohl Toni alles gab, um die junge Schöne zu unterhalten, schien es ihm doch, als würde sie ihm nicht zuhören. Sie lächelte zwar, doch es war, als umgäbe eine seltsame Kühle diese rätselhafte Frau. Irgendwann gab er es auf, ihr mit seinen coolen Sprüchen imponieren zu wollen. Vielmehr hatte er das Bedürfnis, ihr die Wahrheit zu sagen. Und es war ganz seltsam, als er begann, ihr seine Geschichte zu erzählen, wich ihre Kühle einem starken Interesse. Sie sprach nun auch über sich und die beiden verlebten einen wunderschönen Abend. Er erfuhr sogar, dass sie Lia hieß und angeblich weit draußen in der Einsamkeit lebte.
Als das Lokal schloss, wollte Lia noch ein wenig spazieren gehen. Stundenlang liefen die beiden durch die wunderschöne Gegend. Schließlich setzten sie sich auf eine Bank im Park, um ein wenig zu träumen. Toni holte eine Kerze aus der Jackentasche und zündete sie an. Lia fand das schön und sie gab ihm einen sanften Kuss auf die Wange.
Als die nahe Kirchturmuhr Zwölf schlug meinte Lia plötzlich, dass es nun Zeit wäre zu gehen. Doch sie wollte, dass sie Toni noch ein wenig begleitete. Gern erfüllte er ihren Wunsch und lief einige Schritte mit ihr mit. Doch er wunderte sich sehr, denn offenbar lebte sie nicht am Rande des kleinen Ortes, wie er es anfangs vermutete. Zielgerichtet und geradewegs lief sie auf ein angrenzendes Waldstück zu. Hatte sie sich verlaufen oder wollte sie doch noch ein Stück spazieren gehen? Aber wieso dann im Wald? Toni, der nicht so recht wusste, ob er sie danach fragen sollte, begleitete sie und ihre Spuren verloren sich irgendwo zwischen den dichten Bäumen.
Tage später wurde der Wagen, den Toni auf einem Parkplatz vor dem Restaurant abgestellt hatte, von der Polizei sichergestellt. Tonis Schwester, zu welcher er eigentlich kein so gutes Verhältnis pflegte, hatte nach ihm fahnden lassen. Sie war wohl der Annahme, dass Toni irgendwo ein Konto besäße, welches sie eventuell leerräumen könnte. Denn als er sich lange Zeit nicht mehr gemeldet hatte, wollte sie wissen, was mit ihm war. Doch obwohl man den Wagen und seine darin befindlichen Sachen fand, fehlte von Toni weiterhin jede Spur.
Eines Tages meldete sich eine junge schöne Frau bei der Polizei, die vorgab, zu wissen, wo sich Toni befand. Sie sagte: „Sie brauchen nicht mehr weiter nach ihm zu suchen. Toni ist jetzt am Ziel seines Lebens angekommen. Es geht ihm gut und er bat mich, Ihnen diesen Brief zu übergeben.“
Mit diesen Worten verschwand die Schöne und konnte nicht mehr gefunden werden. Sie ließ einen Brief auf dem Tisch des Polizeibeamten, der sie verhörte, zurück. Handschriftlich stand da geschrieben, dass er nun dort wäre, wo er über kurz oder lang ohnehin hingekommen wäre. Man sollte nicht mehr nach ihm suchen. Er sei jetzt am Ort seiner schönsten Träume und er sei endlich glücklich.
Die spätere Untersuchung des Briefes ergab, dass es sich um Tonis Handschrift handelte. Irgendwann wurde auch die Suche nach ihm abgebrochen. Die junge schöne Frau, die sich Lia nannte, lief auf den Wald zu, in welchem sie einst mit Toni verschwand. Und ihre Spur verlor sich in einer leuchtenden Nebelwolke, irgendwo im Nirgendwo …
Der Sprung
Willi liebte es mit einem Fallschirm abzuspringen. Wenn sich das Flugzeug in die Lüfte erhob und er von dort oben in die gähnende Tiefe hinunterschaute, spürte er in seinem Inneren ein merkwürdiges Hochgefühl. Er musste sich dann einfach in diese endlose Weite, diese unfassbare Leere fallenlassen. Dabei schien es ihm, als ob alles, was ihn sonst so sehr belastete, von ihm abfiel. Er ließ sich einfach nur fallen und fiel und fiel und fiel. Das war es, was er sich immer gewünscht hatte, einfach ins Bodenlose zu fallen.
Und er konnte es nicht mehr lassen. Es schien wie eine Sucht. Zu jeder freien Stunde begab er sich auf den kleinen, nicht weit entfernten Flugplatz, um zusammen mit seinem besten Freund, der Pilot eines Motorflugzeuges war, in den schier unendlichen Himmel abzuheben. Es kam sogar soweit, dass er an kleinen Wettbewerben teilnahm. Weil er so gut dabei abschnitt, wurde er ein erfolgreicher Fallschirmspringer.
Bis zu jenem Tag, an dem er glaubte, sein Leben würde ein jähes Ende nehmen. Das Wetter an diesem warmen Julitag des Jahres 1986 war wunderbar. Schon am Vormittag hatte es dutzende Trainingssprünge gegeben, die allesamt gut verliefen. Viele Leute waren zum Flugplatz gekommen und warteten auf das Schauspiel, welches gleich beginnen sollte. Sie warteten auf den Moment, wenn sich das dickbauchige Flugzeug in die Luft erheben würde, um die Fallschirmspringer in die Luft zu bringen, welche dann mit bunten Fallschirmen zurück zur Erde glitten.
Auch Willi spürte diese Anspannung. Es war wie Lampenfieber, die Aufregung vor dem großen Auftritt, welches er in seinem Herzen fühlte. Und er konnte es kaum erwarten, endlich zu starten, um sich dann in diese Unendlichkeit fallen zu lassen. Dabei verschwammen für ihn die Grenzen, die er auf der Erde an jedem Platz, an welchem er sich aufhielt, spürte. Denn dort oben gab es keine Grenzen.
Der Wettkampf begann und das Flugzeug erhob sich in die Lüfte. Zehn Fallschirmspringer befanden sich an Bord und warteten auf ihre große Stunde, auf ihren Absprung in die Tiefe. Auch die Zuschauer hielten den Atem an. Sie sahen zum Himmel, zu der Maschine, die sicher schon bald ihre Last freigeben würde. Gleich würde man sie sehen, die mutigen Springer, die an ihren bunten Schirmen gen Erde trieben. Einige Leute unterhielten sich und so mancher hatte einen Angehörigen im Flugzeug, der sich alsbald als kühner Fallschirmspringer aus der Maschine stürzte.
Als die erforderliche Flughöhe erreicht war, begann das einzigartige Schauspiel. Ein Fallschirmspringer nach dem anderen wurde ausgesetzt und auch Willi befand sich unter den winzigen Punkten am Himmel. Er tauchte ein in dieses Meer aus Luft und aus grenzenlosem Abenteuer. Und wieder spürte er diese Macht, die die Natur auf ihn ausübte, diese Ergebenheit, die er als Mensch dieser Schöpfung entgegenzubringen vermochte. Hier oben war er nur ein kleiner Mensch, der mit seinen Träumen und Sehnsüchten, seiner Hoffnung und seinem unbändigen Willen diesen Mächten ausgeliefert war. So wach wie in diesem einen Moment fühlte er sich nur dort oben. Und er genoss diesen einzigartigen Blick auf alles Irdische dort unten.
Als er den Auslösegriff zog, wartete er schon auf den magischen Ruck, der ihn davon abhielt, wie ein Stein auf die Erde zu stürzen. Doch er kam nicht. Mehrmals zog er am Griff, doch der Schirm öffnete sich nicht. Auch der Reserveschirm schien blockiert zu sein. Nichts funktionierte mehr. Hatte er seine Ausrüstung vielleicht nicht richtig kontrolliert? Aber unten war ihm doch nichts aufgefallen. Alles schien in Ordnung. Was war nur geschehen? Er wusste, wenn sich die Schirme nicht öffneten, würde er auf dem Boden dort unten zerschellen. Es wäre wohl sein letzter Sprung.
Und plötzlich verwandelte sich die Erde dort unten in einen riesigen Friedhofsacker. Plötzlich verwandelte sich sein Mut, seine Entschlossenheit in lähmende, unabwendbare Angst. Er spürte, wie die Kälte der Luft in ihn eindrang und drohte, ihn zu erfrieren. Er schnappte nach Luft, und alles tanzte vor seinen Augen hin und her.
Auch am Boden hatte man den Vorgang verfolgen können. Seine Frau Anne hielt sich die Hand vors Gesicht. Sie rechnete bereits mit dem Schlimmsten. Schützend hielt sie mit der anderen Hand ihren kleinen Sohn Peter fest. Sie sagte ihm jedoch nicht, dass irgendetwas nicht stimmte.
Sie wollte Peter nicht verängstigen. Doch Peter hatte längst selbst bemerkt, dass sein Vater dort oben am Himmel in Not zu sein schien. Er hielt die Hand seiner Mutter ganz fest und hoffte, dass nichts Böses geschehen möge.
Willi hatte es unterdessen aufgegeben, irgendetwas zu unternehmen, was den Fallschirm doch noch öffnen konnte. Vor seinem inneren Auge lief sein Leben in kurzen Bildern ab. Er sah Anne und er sah seinen geliebten Sohn Peter, der wohl den Tod des Vaters nie verwinden würde. Und wie von selbst entwichen die Worte eines Gebetes aus seinem Munde.
Doch er kam nicht mehr dazu, das „Amen“ am Schluss zu sprechen, als es plötzlich einen heftigen Ruck gab. Schon glaubte Willi, er sei auf dem harten Boden aufgekommen und müsste gleich sterben, als er ein letztes Mal nach oben zum Himmel blickte. Da sah er, wie ein Fallschirmspringer dicht hinter ihm war und irgendetwas an seinem defekten Schirm tat. Der Springer trug die Nummer „7“ und lächelte ihn an. Wie gut, dass doch noch jemandem gelungen war, bis zu ihm vorzudringen.
Der Fremde winkte Willi aufmunternd zu und trennte sich schließlich wieder von ihm. Er verschwand im Nichts und Willi bemerkte, dass sich plötzlich sein Fallschirm laut rumorend öffnete. Auch die Zuschauer sahen, wie sich der knallrote Schirm über Willi ausbreitete und er selbst sicher zur Erde schwebte.
Anne hatte Tränen in den Augen, denn ihr Mann war gerettet. Als er gelandet war, rannten sie und Peter zu ihm und umarmten ihn erleichtert. Weinend lagen sich die Drei in den Armen. Als Willi schließlich erfuhr, dass er immerhin dritter geworden war, freute er sich riesig. Voller Freude berichtete er den anderen Springern, wie es ihm dort oben, als sich der Schirm nicht öffnen wollte, ergangen war. Zwar wunderte sich Willi, dass keiner am Boden diesen Springer hinter ihm gesehen hatte, doch die Freude darüber, dass er ihm den Fallschirm in der Luft reparierte, war so groß, dass nur einer der Schiedsrichter der Veranstaltung nachfragte, wer das war.
Als Willi berichtete, dass der Springer die Nummer „7“ auf dem Dress trug, wurde der Schiedsrichter sehr nachdenklich. Mit ernster Miene sagte er dann: „Die Nummer 7 wird bei unseren Wettkämpfen nicht mehr vergeben. Denn vor zwanzig Jahren hatten wir einen sehr erfolgreichen Springer, der diese Nummer trug. Es war Johnny Hanson. Er kam ums Leben, nachdem sich sein Fallschirm bei einem Wettkampf nicht öffnete …“
Schwarzer Rauch
Agatha Higgins hatte gerade erst ihren geliebten Ehemann zu Grabe getragen. Es war ein schwerer Abschied und sie ging danach sehr oft auf den Friedhof.
Eines Tages aber machte sie eine seltsame Beobachtung. Aus einem der Gräber trat dunkler Rauch hervor. Zunächst glaubte sie, irgendetwas auf dem Grab sei in Brand geraten und trat näher an den Stein. Doch dieser stechende Qualm musste aus der Erde kommen. Sie wusste sich einfach nicht anders zu helfen, als einem Friedhofsmitarbeiter Bescheid zu sagen. Als sie in der kleinen Kapelle, nicht weit vom Grab, einen Mitarbeiter fand, schilderte sie ihm ihre äußerst merkwürdige Beobachtung.
Der Mann zog ein beängstigendes Gesicht und sagte dann mit düsterer Stimme: „Das ist das Böse. Es sucht neuerdings unseren Friedhof heim. Schon mehrere Besucher haben von solch einer Beobachtung berichtet. Leider konnten wir nicht herausfinden, woher der Qualm wirklich kam. Eine alte Dame meinte schließlich, dass sie eine schwarze Gestalt in dem Rauch gesehen hätte. Doch sie war die einzige, die diese Erscheinung hatte.“
Agatha gab sich vorerst mit dieser Erklärung zufrieden. Doch in der darauffolgenden Nacht konnte sie einfach nicht einschlafen. Immerzu musste sie an die gespenstische Erscheinung denken. Was, wenn es sich tatsächlich um das Böse handelte? Und was ist, wenn es irgendwann auch die Grabstelle ihres geliebten Mannes heimsuchte? Irgendetwas musste sie tun, nur was? Todmüde schlief sie schließlich doch noch ein.
Am nächsten Tag regnete es in Strömen. Doch das hielt sie nicht ab, wieder zum Friedhof zu gehen. Diesmal jedoch lief sie nicht geradewegs zum Grab ihres Mannes, sondern lief über das ganze Friedhofsgelände. Sie lief bis zur hinteren Friedhofsmauer, wo sich mehrere eingeebnete Grabstellen befanden, auf denen nur noch Reste alter Grabsteine herumlagen. Vielleicht fand sie ja irgendwo einen Hinweis auf den merkwürdigen schwarzen Rauch?
Aus der Ferne vernahm sie die vertrauten Stimmen der Friedhofsarbeiter. Das gab ihr die Sicherheit, dass trotz des schlechten Wetters irgendjemand in der Nähe war.
Vorsichtig schlich sie sich durchs Unterholz und betrachtete sämtliche Grabstellen. Doch so sehr sie sich auch mühte, sie konnte einfach keine beunruhigenden Hinweise auf die seltsame Raucherscheinung finden.
Aber plötzlich, wie schon einmal, glaubte sie, dass aus einem Grab, welches sich unmittelbar vor ihr befand, dunkler Nebel hervortrat.
Schnell versteckte sie sich hinter einer dicken Eiche und beobachtete das Geschehen. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals und die Luft wurde ihr knapp. Was, wenn es ein bösartiger Geist war oder sogar noch etwas viel Schlimmeres? Der Nebel, der aus Erde auf der Grabstelle trat wurde immer stärker.
Plötzlich wurde der pechschwarze Rauch so stark, dass er den Grabstein vollständig einhüllte. Agatha traute kaum, sich zu rühren, stand wie versteinert hinter dem rettenden Baum. Auch der Regen wurde immer heftiger, und obwohl es so stark regnete, hielt sich der schwarze Rauch und schwebte über dem Grab wie ein böses Omen. Agatha verfluchte ihr Alter, weswegen sie sich nie ein Handy zugelegt hatte. Sie meinte, dass das nur jüngeren Leuten vorbehalten sei und bereute nun ihren Irrglauben zutiefst. Zu gern hätte sie in diesem Augenblick jemand von der Friedhofsverwaltung dabeigehabt, dem sie all das zeigen könnte.
Unterdessen hatte sich der schwarze Rauch wie eine Säule über der Grabstelle aufgerichtet. Agatha, die von Natur aus sehr forsch und kein Mensch langer Worte war, musste handeln. Sie war der Ansicht, dass man nicht auf andere warten sollte, wenn man etwas ändern wollte. Und so fasste sie sich ein Herz und trat mutig und entschlossen aus ihrem Versteck hinter der Eiche hervor. Laut rief sie: „Zeig Dich, böser Geist oder was immer Du auch sein willst, los!“
Doch es geschah genau das, womit sie eigentlich gar nicht rechnete: urplötzlich und wie eine erschrockene Schnecke zog sich der Nebel zusammen und verschwand in der Erde. Nichts blieb mehr von dem Rauch zurück und Agatha starrte hilflos auf die Grabstelle. Wirre Gedanken gingen ihr durch den Kopf und Fragen drängten sich ihr auf. Sollte sie noch einmal einen Friedhofsmitarbeiter ansprechen? Sollte sie ihn vielleicht sogar ans Grab holen? Doch was war, wenn sich der Rauch nicht mehr zeigte? Sie konnte doch nichts beweisen. Man würde sie sicher verlachen und als „wirre Alte“ abstempeln.
Nein, sie musste sich etwas Besseres einfallen lassen. Da die Grabstelle nicht weit entfernt von jener lag, an welcher sie den Qualm zum ersten Mal gesehen hatte, nahm sie an, dass irgendetwas in der Erde liegen musste, welches das Böse magisch anzog. Aber was konnte das sein, und vor allem, wo war die richtige Stelle? Um das herauszubekommen, begab sie sich doch noch einmal auf die Suche nach einem Friedhofsmitarbeiter. Als sie ihn gefunden hatte, tat sie sehr interessiert und fragte ihn schließlich unter einem Vorwand, ob die Grabstellen an der Friedhofsmauer immer schon bestanden haben. Der Mitvierziger zuckte mit den Schultern und bat sie dann, mit ihm ins Bürogebäude zu kommen. Dort lag ein alter Plan des gesamten Friedhofsgeländes.
Interessiert betrachtete sich Agatha das Gelände auf dem Plan – und zunächst fand sie nichts. Doch dann, als sie noch einmal ganz genau die einzelnen Abschnitte der damaligen Grabstelleneinteilung betrachtete, fiel ihr auf, dass dort, wo sie den Rauch gesehen hatte, einmal eine alte Kapelle stand. Neugierig fragte sie den Mitarbeiter, ob sich noch Trümmer der alten Kapelle unter den Grabstellen befänden. Der Mitarbeiter wusste es nicht und schüttelte ratlos mit dem Kopf. Er meinte, dass man damals die Kapelle einfach plattgewalzt und dann Erde und Sand aufgebracht habe.
Agatha hatte genug gehört! In ihr rumorte eine schwache Ahnung und entschlossenen Schrittes lief sie zurück zu den Grabstellen, welche auf der alten Kapelle eingerichtet wurden. Und tatsächlich, als sie im strömenden Regen vor einem der zahlreichen Gräber stand, bemerkte sie wieder diesen Rauch. Wie ein Geist trat er aus dem Boden der Grabstelle hervor und bäumte sich bedrohlich über dem Grabstein des Verstorbenen auf.
Plötzlich erkannte Agatha eine mysteriöse Gestalt, die in diesem unheimlichen Nebel zu schweben schien. Die Gestalt war in lange schwarze Kleider gehüllt und hatte die Kapuze tief in ihr Gesicht gezogen. In einer Hand hielt die Gestalt irgendetwas – Agatha erschrak – es war eine Sense! Sollte etwa der Teufel schon hier sein? Sie wusste, dass nun guter Rat teuer war und hatte eine Idee. Um ihren Hals trug sie seit vielen Jahren eine goldene Kette, an welcher ein großes goldenes Kreuz hing. Sie zog das Kreuz aus dem Ausschnitt ihres Kleides und hielt es dem vermeintlichen Teufel kurzerhand entgegen. Im selben Moment vernahm sie ein lautes Rauschen, dann knisterte es, beinahe so, als würde ein hölzerner Gegenstand in Flammen stehen und schließlich fiel der Nebel mit einem lauten gespenstischen Schrei in sich zusammen.
Agatha ging zu dem Friedhofsmitarbeiter und bat ihn um ein Gespräch, an welchem auch der Friedhofsverwalter teilnehmen sollte. Der Mitarbeiter schaute Agatha verständnislos an und sagte dann, dass er selbst der Verwalter sei. Dann bat er sie, ihm zu erzählen, was sie auf dem Herzen hatte. Nachdem Agatha von ihren beängstigenden Beobachtungen und von ihrem mehr als gewagten Verdacht berichtete, schien der Verwalter interessiert. Er war nun selbst neugierig geworden und fand den Vorschlag, die Friedhofswege aufzugraben, um nach diversen Relikten zu suchen, gar nicht so verkehrt. Doch alles musste nach der Dienstzeit geschehen, damit die Besucher nichts davon mitbekämen. Agatha war einverstanden und der Verwalter holte noch zwei weitere Mitarbeiter.
Gemeinsam begannen sie nun, die Wege an der Friedhofsmauer aufzugraben. Erst fanden sie nichts. Doch plötzlich entdeckten sie mehrere mannshohe Kreuze, die beim Einebnen der alten Kapelle umgefallen sein mussten. Die Kreuze mussten so gefallen sein, dass sie verkehrt herum im Boden steckenblieben. Auch mehrere Totenköpfe kamen ans Licht.
Agatha hatte sich nicht geirrt und ihre Meinung stand felsenfest: die umgedrehten Kreuze hatten den Teufel, den Satan magisch angezogen. Überall hatte er sich nun breitgemacht und musste unbedingt vertrieben werden.
Die Kreuze wurden ausgegraben und gesäubert. Der Verwalter stellte sie in der neu erbauten Kapelle, die sich an einem anderen Platz befand, auf und schob große Blumenkübel davor. Daraufhin wurde der schwarze Rauch nicht mehr gesehen.
Als die Wege jedoch wieder zugeschüttet und befestigt wurden, hatte einer der Mitarbeiter des Friedhofes erneut eine Erscheinung. Er sah, wie dunkler Rauch aus der Erde trat. Diesmal jedoch kam der Rauch nicht aus einer Grabstelle, sondern aus dem gerade erst zugeschütteten Weg. Was konnte das nur sein? Auch Agatha wusste sich diese neuerliche Sichtung nun wirklich nicht mehr zu erklären. Immer wieder lief sie über die Wege und konnte nichts entdecken.
Weil es schon ziemlich kalt geworden war und sie an einer Halsentzündung litt, hatte sie sich einen warmen Schal um den Hals gewickelt. Wegen der neuerlichen Aufregung wurde es ihr recht warm und sie zog sich den Schal vom Hals. Dabei tastete sie nach ihrem goldenen Kreuz, welches sie immer trug. Doch was war das … entsetzt musste sie feststellen, dass das Kreuz nicht mehr da war. Zwar lag die goldene Kette noch um ihren Hals, doch das Kreuz daran war verschwunden.
Sie erinnerte sich, als sie es dieser seltsamen schwarzen Gestalt entgegengehalten hatte. War ihr in diesem Moment das Kreuz vielleicht aus der Hand gefallen? Oder hatte sie es an anderer Stelle verloren? Sie wusste, dass eine Suche nach diesem Kreuz nahezu aussichtslos wäre.
Noch einmal ging sie zu der Stelle, an welcher sie der Gestalt das Kreuz entgegenhielt. Doch der Weg an diesem Ort war bereits erneuert und sie konnte unmöglich den Verwalter bitten, den Weg noch einmal aufzureißen. Außerdem war nicht klar, ob sich das Kreuz auch wirklich dort befand. Dennoch musste sie noch einmal mit dem Verwalter sprechen.
Auf dem Weg zur Friedhofsverwaltung bemerkte sie, wie ganz plötzlich und unvermittelt aus mehreren Grabstellen am Weg schwarzer Rauch austrat. Das konnte doch gar nicht möglich sein! Sollten alle Versuche, das Böse vom Friedhof zu verjagen, vergeblich gewesen sein? War alle Mühe, die Wege an der Friedhofsmauer aufzureißen und wieder zuzuschütten, vollkommen umsonst?
Irritiert blieb sie vor der Eingangstür des kleinen Verwaltungsgebäudes stehen und wartete erst einmal ab. Von drinnen drang eine seltsame Stimme an ihre Ohren. Vorsichtig schlich sie sich unter das Fenster, welches einen winzigen Spalt offenstand. Sollte sie in das Innere des Raumes schauen? Schließlich siegte ihre Neugierde und sie streckte sich dem Spalt entgegen, durch welchen die Stimme drang. Was sie dann im Inneren des Zimmers erblickte, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren.
Im spärlichen Licht einer Kerze, die auf einem runden Tisch inmitten des Raumes stand, kniete der Verwalter. Er trug schwarze Kleidung und flüsterte mit furchterregender Stimme irgendwelche merkwürdigen Sprüche. Doch was war das da vor ihm? Agatha konnte es nicht richtig erkennen. Erst als sie sich noch ein wenig streckte, sah sie es. In einem Blumentopf steckte ihr goldenes Kreuz, welches sie immer am Halse trug. Es steckte verkehrtherum in der Erde.
Noch glaubte Agatha, Opfer einer Halluzination zu sein. Doch dann packte sie eiskalte Wut! Was fiel diesem verrückten Kerl eigentlich ein! Ihr schönes Kreuz, welches sie einst von ihrem nun verstorbenen Mann zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte, verkehrtherum in die Erde zu stecken!
Eisernen Schrittes und zu allem entschlossen lief sie vor die Tür des Veraltungsbüros. Dort zupfte sie sich ihre Kleider zurecht und richtete ihren Hut, den sie stets auf dem Kopfe trug. Polternd stürmte sie ins Innere des Büros und rief dabei mit energischer Stimme: „Schluss mit diesem Affentheater, mit diesem albernen Satanskult! Was soll denn dieser Blödsinn!“
Vor lauter Schreck sprang der ertappte Verwalter auf und wollte den Blumentopf mit dem Kreuz hinter seinem Rücken verbergen. Aber es war bereits zu spät. Agatha, die geladen wie eine Kanone war, entriss ihm wütend den Blumentopf und zog zornig ihr Kreuz aus der Erde. Dann warf sie den Blumentopf derart kraftvoll auf den Fußboden, dass er laut polternd zerschellte. Der entsetzte Verwalter rannte laut schreiend aus dem Gebäude und wurde nie mehr gesehen.
Endlich zog Ruhe auf dem Friedhof ein und der Spuk mit dem schwarzen Rauch trat nie wieder auf. Agatha trug ihr goldenes Kreuz mit Würde und streckte es niemals mehr einem vermeintlichen Teufel entgegen.
Als sie Wochen später in ihr Haus auf dem Lande fuhr, machte sie eine seltsame Beobachtung. Die Straße führte an einem berüchtigten Staatsgefängnis vorüber. Aber was war das? Aus einem der vergitterten Fenster trat plötzlich pechschwarzer Rauch, der sich zu einem drohenden Gesicht verformte. Agatha erschrak, denn es war das Gesicht des bösen Friedhofsverwalters …
Babyklappe
Sonja Blue hatte vor wenigen Tagen einen Sohn zur Welt gebracht. Sie nannte ihn Timmi. Aber sie hatte große Angst, denn der Vater hatte sich aus dem Staub gemacht und den Kontakt zu ihr abgebrochen. Und nun wusste sie nicht, wie es weitergehen sollte. Seit Jahren war sie schon arbeitslos und hatte mit diesem Kind nun erst recht keinerlei Aussichten auf eine Arbeit – überall wurde sie nur abgewiesen. Nicht einmal in ihrer Familie fand sie den nötigen Halt, denn ihre Eltern hatten selbst kein Geld, um sie zu unterstützen.
Eines Abends saß sie in ihrer kleinen Wohnung in einem heruntergekommenen, viel zu lauten Mietshaus und schaute traurig und sehnsuchtsvoll aus dem Fenster. Der Regen perlte an den Scheiben herab und dicke Tränen rannen ihr übers Gesicht. Was sollte sie nur tun? Sie sah keinen Ausweg mehr aus ihrer schwierigen Lage und wollte das Kind in eine Babyklappe bringen. Sie wusste, dass es gar nicht weit von ihrem Hause eine solche Klappe gab. Aber wie sollte sie es bewerkstelligen, ungesehen dort ihr Kind abzulegen? Wurde man dort beobachtet? Oder war es wirklich so anonym, wie man sich erzählte. Und könnte sie sich überhaupt von diesem kleinen unschuldigen Wesen trennen, welches sie unter so großen Schmerzen auf diese Welt gebracht hatte?
Weinend starrte auf die regennasse Straße dort unten und spürte, wie die Hoffnungslosigkeit in ihre angekratzte Seele eindrang. War da Schuld in ihrem verklärten Blick? Sie sah, wie Menschen mit aufgespannten Regenschirmen durch den Regen hasteten. Unzählige Autos fuhren zu irgendeinem unbekannten Ziel. Und sie? Hatte sie etwa keine Ziele mehr? Hatte sie wirklich keine Träume mehr vom großen Glück, und mit Tim? Sollte sie nicht doch versuchen, Timmi aufzuziehen? Sie liebte ihn doch so sehr. Und wenn er sie mit seinen großen braunen Augen hilfesuchend anschaute, war ihr, als würde auch sie noch einmal ganz neu beginnen. Welch ein Wunder, dies kleine Kindelein auf dem Arme zu tragen und ihm alles das zu geben, was es brauchte, um zu leben. Und es war doch gar nicht so viel, außer nur einem bisschen Liebe und Zuwendung. Hatte sie nicht einmal mehr das?
Ein wenig kraftlos hielt sie sich am Fenstergriff fest und dachte an Andy, ihren Freund. Warum musste er so plötzlich verschwinden? Hatte er vielleicht zu große Angst vor der Verantwortung oder wollte er nichts mehr von ihr wissen? Hatte er sie überhaupt je geliebt? Sie wusste keine Antwort auf all diese Fragen.
Leise ging sie zu Timmi. Er lag in seinem kleinen Bettchen und schlief so friedlich. Diese kleine Nase, dieser kleine Mund – vorsichtig und sacht streichelte sie ihm über sein winziges Köpfchen. Und es schien, als würde Timmi sie verstehen. Mit seinen kleinen Händchen wischte er sich übers Gesicht. Sonja lächelte – wie zerbrechlich doch dieses neue Leben war. Sie hatte die Verantwortung dafür – ja, und sie wusste es ganz genau! Aber die Angst war stärker und sie legte sich weinend auf das Sofa neben dem Kinderbettchen. Sie war doch Mutter und fühlte sich doch so fremd vor ihrem eigenen Kind. Es würde eine andere Mutter geben, die mehr Geld hatte und die Timmi ein schöneres Leben ermöglichen könnte, als sie es je hätte tun können. Ja, morgen würde sie zur Babyklappe gehen und Timmi dort abstellen.
Ruhelos stand sie noch einmal auf und setzte sich an den Tisch, um einen Brief zu schreiben. Sie wollte diesen letzten Brief in Timmis Korb legen, den sie morgen bei der Babyklappe abstellte. Doch was sollte sie schreiben? Dass sie zu arm sei, um dieses kleine Kind, ihr kleines Kind aufzuziehen? War das nicht zu billig? War das nicht zu schäbig? War nicht jedes Wort, welches sie schrieb, eine Lüge, eine Flucht vor der Verantwortung? Aber sie musste doch etwas schreiben, irgendwas! Verdammt … was?!
Sie schrieb drei Zeilen und eine vierte noch dazu. Dann faltete sie den Bogen schnell zusammen und legte ihn in den Korb, in welchem sie morgen früh Timmi zur Klappe bringen würde. Schließlich legte sie sich wieder müde und erschöpft aufs Sofa und konnte doch nicht einschlafen. Immer wieder wälzte sie sich hin und wieder her, doch ihre Gedanken ließen sie einfach nicht zur Ruhe kommen. Manchmal hörte sie Timmi, ihren Sohn, wie er schmatzte. Dann weinte sie wieder in das weiche Kissen hinein.
Am nächsten Morgen wusch sie sich ihr Gesicht – mit reichlich Schaum wusch sie sich ab den schönen Kindertraum und all die Tränen, die sie geweint in der sternenlosen Nacht. Keiner sollte ihre Tränen sehen. Doch ihr Gesicht war so aufgedunsen, dass jegliche Schminke umsonst war. Sie starrte sich an und sie fühlte sich so schuldig und so einsam, ja, einsam auch. Dann nahm sie Timmi, legte ihn in seine schönste Decke und zog ihm die besten Sachen an. Wie ein abgerissenes Stück ihres Herzens legte sie ihn ins Körbchen und lief los.
Es war nicht weit bis zur Babyklappe. Die Tränen versteckt und ein künstliches Lächeln im Gesicht lief sie dreimal an der Klappe vorbei. Sollte sie es tatsächlich tun? Jetzt? Nur nicht mehr zu Timmi schauen, oder … doch? Da lag er schlafend in seinem Körbchen. Ob er schon träumen konnte? Sie hatte einige Flaschen Milch danebengelegt. Und auch noch andere Dinge … und diesen Brief. Diesen albernen dummen Brief – diese Entschuldigung vor ihrem eigenen Versagen. Und wieder kroch die Angst in ihr hoch und lähmte ihren Schritt und ihre Gedanken. Sie konnte einfach nicht hineingehen und ihr eigenes Kind dort abstellen. Würde sie nicht ihr eigenes Leben abstellen, dort drinnen, irgendwo im Nirgendwo? Konnte sie überhaupt so weiterleben, danach, nach dieser Tat? War´s ein Verbrechen, das eigene Kind wie einen alten Schuh auszusetzen, abzulegen, wegzugeben, einfach so? Noch hatte sie die Wahl! Doch was war das für eine Wahl? Eine Wahl zwischen Hoffnung und Verdammnis! Eine Wahl zwischen Leben und dem sicheren Seelentod! Eine Mutter, die keine Mutter mehr war? Wirklich keine Mutter? Sie liebte doch auch, wie jede andere Mutter! Sie hatte nur kein Geld und keinen Job! Und keinen Mann. Sie brauchte noch eine letzte Minute Bedenkzeit, eine allerletzte Sekunde noch. Dann würde sie hineingehen. Ganz bestimmt würde sie das tun! Aber nicht jetzt!
Sie lief zum Stadtpark, der gleich gegenüber begann und setzte sich weinend auf eine Bank. So hatte sie wenigstens eine gute Sicht geradewegs hinüber zur Babyklappe.
Da bemerkte sie eine fremde junge Frau, die mit einem Körbchen, so wie ihres war, vor der Babyklappe stand. Und sie sah, dass diese Frau sich die Augen wischte – mehrmals – immerzu. Vorsichtig und behutsam griff sie in das Körbchen, ein allerletztes Mal. Was für ein Anblick. Gleich würde sie hineingehen und … sterben!
Da erschrak Sonja plötzlich und sie spürte einen heftigen Stich im Herzen und in ihrer Seele, die nicht erfroren schien. Sie nahm ihr eigenes Körbchen mit Timmi und rannte hinüber zur Babyklappe. Mit einem Ruck riss sie die Tür auf und schrie: „Nein! Tun Sies nicht! Sie werden es bereuen! Sie werden sterben! Es ist doch Ihr Kind! Es ist doch Ihres! Es braucht doch seine Mutter!“
Die Frau stand an einem Tresen und hatte das Körbchen bereits daraufgestellt. Gerade wollte sie auf einen Knopf drücken, der an der Wand war, vermutlich die Klingel, doch sie hielt inne. Sie drückte nicht. Ein Augenblick der Angst – was würde wohl geschehen? Der Atem beider Frauen stockte. Die Zeit stand still und die Erde drehte sich nicht mehr in jenem schicksalhaften Moment. Die fremde Frau ließ ihren Arm sinken und taumelte. Sonja stand dicht hinter ihr und konnte ihren Herzschlag hören. Ganz instinktiv hielt sie ihre Arme auf und fing die taumelnde Frau darin auf. Nicht ein Wort fiel, es war so still wie niemals je zuvor – in jenem Moment der Ewigkeit schien nichts mehr zu zählen, nur noch das Leben. Das einfache Leben!
Als die Frau wieder zu sich kam, drehte sie sich langsam um und Sonja konnte ihr Gesicht erkennen. Sie erschrak – die fremde Frau da vor ihr, diese Frau war sie selbst! Wie konnte das nur möglich sein? War sie am Ende schon verrückt geworden? Hatte sie das alles derart mitgenommen, dass sie nun schon Gespenster sah? Sie nahm ihr Körbchen und rannte aus der Klappe hinaus auf die Straße.
Und plötzlich wusste sie genau, was sie wollte! Alles schien so klar! Sie wollte es allein schaffen! Und sie wusste, dass sie es schaffen würde. Sie schaute zu ihrem kleinen Sohn, der noch immer friedlich schlief. Er hatte nichts von alledem mitbekommen. Er lag nur da und schlief. Welch ein Friede zog da in ihr Herz und in ihre Seele. Und sie sang leise ein Lied:
Mein lieber kleiner süßer Tim,
Wir schaffen es durch diese Zeit
Und ist der Weg auch schwer und weit,
wir haben uns, wir sind zu zweit
Du bist mein Glück, mein Lebenssinn!
Gerade wollte sie noch einmal in die Babyklappe schauen, wie es der seltsamen Frau ging, da bemerkte sie, dass die Tür verschlossen war. Und nun sah sie auch das kleine Schild, welches an der Tür hing. Dort stand: „Diese Babyklappe ist geschlossen!“
Auf der Reise
Wieder einmal waren die beiden Brüder Ron und Rick unterwegs. Sie waren ständig auf Reisen und sie konnten es sich auch leisten. Ihre Eltern waren längst tot und hatten den beiden ein großzügiges Erbe hinterlassen. Damals, als sie noch in ihrem großen Haus in New Jersey lebten, hatten sie sich sehr wohlgefühlt. Sie liebten ihre Eltern und als diese dann bei einem schweren Autounfall auf dem Highway ums Leben kamen, schien es beinahe so, als würden sie diesen unfassbaren Verlust niemals verkraften.
Doch Mutter hatte Tage vor ihrem Tod immer gesagt: „Egal, was auch kommt. Ihr müsst wissen, dass wir immer bei Euch sind. Und wenn Ihr mal in Not seid, dann denkt ganz fest an unsere kleine Familie. Dann werden wir, Eure Mutter und Euer Vater da sein. Und dann wird alles gut werden.“
Oft waren die beiden Brüder nach dem entsetzlichen Unfall noch auf dem Friedhof. Doch irgendwann verkauften sie das alte Haus und zogen in die Ferne. Sie versprachen sich jedoch, stets gemeinsam unterwegs zu sein und den anderen niemals allein zu lassen. Und so war es dann auch. Die beiden verstanden sich großartig und sie hatten zusammen die schönsten und spannendsten Erlebnisse. Die halbe Welt bereisten sie und fühlten sich dabei wunderbar.
Eines Tages, die beiden weilten gerade in einer kleinen Pension am Stadtrand von Hongkong, wollten sie wieder nach Hause zurückkehren. Sie zahlten ihr Zimmer und wollten aufbrechen, doch draußen tobte ein furchtbarer Sturm. So konnten sie nicht zum Flughafen fahren und mussten warten.
Da das Unwetter zu lange anhielt, beschlossen sie, noch eine Nacht in der Stadt zu bleiben. Sie zahlten für eine weitere Nacht und machten es sich in ihren Betten bequem. Weil sie tagsüber immer viel unterwegs waren, um die Orte, an denen sie sich befanden, zu erkunden, waren sie auch diesmal wieder sehr schnell müde geworden. Wegen des nicht enden wollenden Unwetters konnten sie an diesem Abend etwas eher ins Bett als sonst. Und sie schliefen wirklich tief und fest.