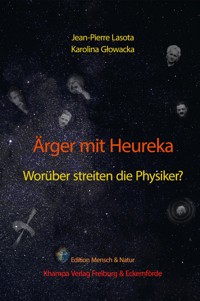
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der bekannte Astrophysiker Jean-Pierre Lasota und die Wissenschaftsjournalistin Karolina Głowacka führen einen Dialog über die verschiedenen Entwicklungen der modernen Physik, insbesondere der Astrophysik und Kosmologie. Ohne in trockene Erörterungen zu verfallen, schaffen sie es, den Leserinnen und Lesern spannende und umstrittene Gebiete und Fragestellungen nahezubringen. Dabei fehlt es auch nicht an geschichtlichem und anekdotischem Material, das Fachkundigen wie Laien neue Einsichten in den Prozess der Wissensfindung vermittelt. Es ist ein Blick aus dem Innen des Wissenschaftsbetriebs, der die Außenstehenden nicht aus dem Auge verliert, und humorvoll auch die allzu-menschlichen Seiten der Erkenntnisgewinnung der Physik nicht auslässt. Und das Ganze auch mit Tatsachenmaterial unterfüttert, das auch Fachleuten, die auf anderen Gebieten der Physik tätig sind, durchaus neue Informationen bieten kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Pierre Lasota
Karolina Głowacka
Ärger mit Heureka.Worüber streiten die Physiker?
Danksagung
Die Autoren danken
Professor Michał Różyczka herzlichst
für die gründliche Lektüre der ersten Version des Buches
und für seine unschätzbaren Korrekturen,
Kommentare und klugen Vorschläge.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Übersetzers
Erstes Gespräch
Zweites Gespräch
Drittes Gespräch
Viertes Gespräch
Fünftes Gespräch
Sechstes Gespräch
Siebentes Gespräch
Achtes Gespräch
Neuntes Gespräch
Zehntes Gespräch
Elftes Gespräch
Zwölftes Gespräch
Dreizehntes Gespräch
Namens- und Sachregister
Vorwort des Übersetzers
Inhaltsverzeichnis
Spätestens nach der Lektüre des Buchs Ob der Urknall laut war?* von Karolina Głowacka und Jean-Pierre Lasota ist den naturwissenschaftlich interessierten Lesern klar, das anspruchsvoller Stoff verständlich und mit Humor dargebracht werden kann, ohne in übermäßige Didaktisierung oder Trivialisierung zu verfallen.
Auch wenn es zum Zeitgeist gehört, wissenschaftliche Erkenntnisse als eine der vielen „möglichen“ Meinungen zu relativieren und in manchen Zirkeln rundweg als des Teufels zu diffamieren – natürlich unter Nutzung aller Medienkanäle, die ja ohne die wissenschaftlichen Erkenntnisse, insbesondere der Physik, nicht denkbar wären –, ist vielen Menschen doch klar, dass sie ohne ein grundlegendes Verständnis sowohl des wissenschaftlichen Denkens an sich als auch der wichtigsten Erkenntnisse der Wissenschaft von der mitgestaltenden Teilhabe an der modernen Gesellschaft praktisch ausgeschlossen wären.
Viele dieser Lücken wurden bereits im Ob der Urknall laut war? geschlossen. Der nun vorliegende Band Ärger mit Heureka. Worüber streiten die Physiker? – der eine Fortsetzung dieses aufklärenden Dialogs zwischen Jean-Pierre Lasota und Karolina Głowacka darstellt –, bringt eine bedeutenden Vertiefung und Erweiterung unseres Verständnisses, besonders in Hinsicht auf die Fragen: Wie funktioniert die Wissenschaft, vor allem die Physik? Was ist wissenschaftliche Redlichkeit? Warum sind wissenschaftliche Erkenntnisse nicht einfach „eine mögliche Meinung“? Wie wird aus einer Vermutung so etwas wie eine einigermaßen gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis? Und was muss passieren, um diese für gesichert gehaltenen Erkenntnisse wieder infrage zu stellen? Wie werden sie durch „bessere“ Erkenntnisse ersetzt? Werden sie überhaupt ersetzt, oder was passiert eigentlich mit dem bereits erprobten Wissen?
Als ich dieses Buch wieder, wie das letzte, bei meinem inzwischen erblindeten Vater vorfand, der es vom Verfasser selbst in Freundschaft erhalten hatte, habe ich es verschlungen, und sehr schnell stand mein Entschluss fest, es ebenfalls dem deutschen Leser verfügbar zu machen.
Die praktischen, mit den Rechten verbundenen Probleme waren sehr schnell und unbürokratisch gelöst, wofür ich den beiden Verfassern und dem Verlag des Copernicus Center Kraków herzlich danke. Besonderer Dank geht wieder an Jean-Pierre, der meine Fragen stets unermüdlich und geduldig beantwortete.
Nicht zuletzt geht auch mein Dank an die beiden Korrektoren, Reinhardt Meierhöfer und Dr. Walther Hofherr, die mich schon bei den Korrekturen des Urknall-Buches so gut unterstützt hatten. Auch danke ich Lorenz Dobrot für die freundliche Genehmigung, das Buch wieder unter dem Schirm des Khampa Verlages in der Reihe Mensch und Natur veröffentlichen zu dürfen.
Es bleibt mir jetzt nur noch, den Lesern viel Freude und Erhellung zu wünschen!
*Ebenfalls in meiner Übersetzung in der Edition Mensch & Natur im Khampa Verlag 2023 erschienen (ISBN: 978-3-758411-67-0)
Erstes Gespräch
Inhaltsverzeichnis
Woher wissen sie, was sie wissen?
Also, wie Physiker zu dem Schluss kommen, dass etwas ein Naturgesetz ist, ob sie dabei argumentieren und ob sie ehrlich mitteilen können, was sie festgestellt haben
Karolina: Kann man mit Physik alles beschreiben?
Jean-Pierre: Das ist die alte Frage des Reduktionismus. Lassen sich alle chemischen und biologischen Phänomene mit den Mitteln der Physik beschreiben? Ich habe mich nie beruflich mit dieser Frage beschäftigt, aber ich habe eine Meinung, und zwar eine ziemlich entschiedene. Ich glaube nicht an den totalen Reduktionismus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unser Denken, unser Bewusstsein, vollständig auf Prozesse reduziert werden kann, die Elementarteilchen beherrschen, oder auch nur auf physikalische Prozesse1. Andererseits ist es wahr, dass sich die Physik mit den kleinsten und grundlegendsten Elementen der Welt beschäftigt und der Realität auf den letzten Grund geht.
1 In dieser Frage teilt Jean-Pierre die Ansicht von Thomas Nagel in seinem berühmten Essay „Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?“ (T. Nagel, Letzte Fragen, Wien: Philo, 1996).
Und das bewegt euch? Dieses Berühren der Grundlagen?
Es spielt sicherlich eine Rolle bei der Wahl des Lebensweges eines Physikers. Aber so im Alltag? Um ehrlich zu sein, es gibt keine „Achs“ und „Ohs“, dass wir gerade die Geheimnisse des Universums entdeckt haben. Wir reden ganz normal miteinander, und unsere Diskussionen ähneln eher Gesprächen über ein Küchenrezept als wissenschaftlichen Diskussionen.
Und wenn etwas Besonderes passiert, wie etwa die Registrierung des Higgs-Teilchens oder von Gravitationswellen? Auch keine „Achs“?
Stimmt, das ist etwas anderes. Als ich die erste Entdeckung einer Gravitationswelle sah, war ich bewegt und gerührt. Was haben wohl die Erbauer der Instrumente gefühlt, die dies möglich gemacht haben? Was haben die gefühlt, die die Existenz von Gravitationswellen vorhergesagt haben? Obwohl... Nein, eigentlich war es anders. Andrzej Trautman zum Beispiel2 wurde nach seinen Gefühlen gefragt und er sagte, dass er nichts Besonderes fühlte – er wusste, dass diese Wellen sowieso existierten. Physiker haben, wie alle Menschen, unterschiedliche Charaktere, nicht jedem ist es wichtig.
2 Polnischer Physiker, einer derjenigen, die verstanden haben, was Gravitationswellen sind. Der Betreuer von Jean-Pierres Doktorarbeit.
Einerseits erforscht die Physik also die eigentlichen Grundlagen, was manchmal das Gefühl vermittelt, an etwas Sinnvollem teilzuhaben. Physik ist wichtig, obwohl ich persönlich die Arbeit eines Arztes oder Pharmazeuten für wichtiger halte. Wenn ich einen Fehler mache, passiert nicht viel, aber wenn sie einen Fehler machen, kann das ernste Folgen haben.
Und doch ist es deine Branche, die große Aufregung hervorruft. Amateure kreieren eben gerne „physikalische Theorien“, am liebsten „Theorien von Allem“ oder Konzepte über die Ursprünge des Universums. Die Widerlegung von Einstein scheint verlockend, die schwarzen Löcher regen die Fantasie an.
Wahrscheinlich, weil sie ganz elementare Dinge berührt: die Frage, woher wir kommen und welche Mechanismen dahinter stehen. Es ist schade, dass es nicht den gleichen Enthusiasmus für die Genetik gibt, die Fragen danach stellt, was Leben ist, woher Krankheiten kommen. Das ist viel wichtiger als die Frage, ob das Universum am Anfang so oder anders beschaffen war.
Denkst du das wirklich?
Ja, aber ich meine nicht, dass die Medizin wichtiger ist als die Physik oder dass die Genetik wichtiger ist als die Kosmologie, – denn solche Aussagen würden keinen Sinn ergeben –, sondern nur, dass sich das Interesse der Öffentlichkeit und der Medien nicht nur auf schwarze Löcher und den Urknall konzentrieren sollte. Auch andere Wissenschaften und ihre Ergebnisse können faszinierend sein, und ich spreche hier nicht von der Entdeckung des ultimativen Heilmittels gegen Krebs, die mit einem Trompetenstoß verkündet wird.
Die Biowissenschaften befassen sich im Allgemeinen mit Systemen, die komplexer sind als die, die von der Physik untersucht werden, so dass sie scheinbar komplizierter sind. Es ist leichter, Einsteins Theorie zu „widerlegen“, indem man die Bewegung eines Körpers im Raum beschreibt, als die Vererbungstheorie zu kritisieren, indem man die Expression von Genen beschreibt, aber das ist nur ein Vorwand, denn Einsteins Theorie beschreibt, abgesehen von der Bewegung von Körpern, Phänomene, von denen die „Widerleger“ nicht einmal geträumt haben. Mein Punkt ist, dass es keine besseren oder schlechteren Wissenschaften gibt. Und es stimmt, dass die Physik das beste Modell dafür ist, was Wissenschaft ist, denn sie beschäftigt sich mit den einfachsten – wenn auch unglaublich komplexen – Systemen im Universum.
Dann lasst uns darüber sprechen, worum es bei der Arbeit eines Physikers wirklich geht. Ihr seid auf der Suche nach den Naturgesetzen, ja?
Diejenigen, die tatsächlich nach den Gesetzen der Natur suchen, sind sehr seltene Exemplare. Naturgesetze gibt es wenige, Physiker dagegen ganze Scharen. Physiker befassen sich hauptsächlich nicht mit der Entdeckung, sondern mit der Anwendung der Naturgesetze, um die Erscheinungen, die wir beobachten, zu beschreiben und zu erklären. Mit Hilfe dieser Gesetze schaffen sie auch neue Entitäten, die entweder dem besseren Verständnis der Natur dienen oder in der Industrie, im Verkehr, in der Medizin und im täglichen Leben Anwendung finden. Und auch, um dies alles zu zerstören und zu vernichten. Mit einem Wort, die Physik ist in modernen Gesellschaften ein wesentliches und sogar fundamentales Element dieser Gesellschaften. Ohne Physik gäbe es kein Radio oder Fernsehen, kein Internet oder Smartphones, keine Laser, Radare, GPS und so weiter, keine Kernkraftwerke, aber auch keine thermonuklearen Bomben. Mit den letzteren haben wir es zum Glück nicht zu tun, wohl aber mit dem Rest. Und obwohl wir in einer Welt leben, die von der modernen Technologie beherrscht wird, denken wir nicht daran, dass das Verständnis für die Gesetze der Physik ihre Grundlage darstellt.
Also wirklich, lass die Leute doch in Ruhe leben! Technologie ist Alltag. Wir könnten ja genauso gut bei jedem Sonnenuntergang über die physikalische Grundlage der Drehung der Erde um ihre Achse nachdenken.
Zum Glück macht das niemand, denn es könnte das romantischste Rendezvous verderben. Aber auch diese Drehung unterliegt selbstverständlich den Naturgesetzen – ein Gegenstand, der für Physiker von Interesse ist und nach dem du selbst einmal nachgefragt hast.
Richtig. Aber was genau sind eigentlich die Naturgesetze?
Ein Naturgesetz in der Physik ist eine bestimmte mathematisch formulierte Beziehung zwischen Größen, mit der wir die physikalische Welt beschreiben. In der Praxis wird ein Naturgesetz oft in Form einer Differentialgleichung* formuliert. Nicht alle, aber einige ihrer Lösungen beschreiben bestimmte universelle – und das ist sehr wichtig – Eigenschaften von Objekten, Systemen und Untersystemen im Universum.
* Eine Differentialgleichung ist eine Gleichungen, in der nicht nur die den physikalischen Zustand beschreibende Funktion vorkommt, sondern auch deren Änderungsrate (genauer, Ableitung) und deren Änderungsrate usw. Sie werden seit Newton und Leibniz in der Physik verwendet. RJ
Universell?
Das bedeutet, dass sie immer und überall Anwendung finden. Wäre dies nicht der Fall, wären sie keine Naturgesetze.
Allerdings ist es auch wieder nicht so einfach. Diese Gesetze sind in der Tat universell, aber sie sind nur annähernd gültig. Sie gelten für Situationen, die schwer zu beobachten sind. Ein Naturgesetz ist zum Beispiel das erste Newtonsche Gesetz: Ein Körper, auf den keine Kraft einwirkt, befindet sich in Ruhe oder in gleichförmiger Bewegung. Aber es gibt in unserer Umgebung keine Körper, auf die keine Kraft wirkt. Und hier zeigt sich die Genialität der Wissenschaftler, die dies verstanden haben und über unsere Erfahrung hinausblicken konnten. Galilei, Newton. Für Aristoteles war es nicht so einfach, aber er dachte wahrscheinlich, dass die Gesetze der Mathematik nur für ideale „Himmelssphären“ gelten können. Es ist interessant, dass die Ansicht des aus Stagira stammenden Aristoteles fast zweitausend Jahre lang vorherrschte, aber ich möchte nicht tiefer in die Materie einsteigen, da ich mich damit nicht auskenne.
Es scheint, dass die Idee, über die Grenzen unserer unmittelbaren Erfahrung hinauszugehen, ein Schlüsselaspekt ist. Schließlich funktioniert die gesamte moderne Physik auf diese Weise, richtig?
Richtig. Vielleicht überrascht es, dass die Physik nicht die Realität beschreibt, sondern in Form eines Modells eine vereinfachte Version von ihr. Aus bestimmten Phänomenen werden die wichtigen Prozesse herausgelöst, die anderen werden vernachlässigt. Diese relevanten Prozesse beschreiben Physiker mit Hilfe der Mathematik und erstellen Modelle, aus denen bestimmte Vorhersagen folgen. Wir vergleichen sie mit der Realität und selbst wenn sie passen, dann tun sie das nur mit einer gewissen Genauigkeit.
Aus diesem Grund sprechen wir von einem „Modell des Universums“. Weil wir das Universum nicht wirklich beschreiben. Das wäre zu kompliziert und unpraktisch. Wir verwenden zum Beispiel ein Modell, in dem das Universum homogen und isotrop ist. Aber wenn wir uns umsehen, können wir sehen, dass dies doch nicht der Fall ist. Dieses Merkmal ist erst in bestimmten Größenordnungen erkennbar.
Und so ist es mit allem. Die Elektrodynamik, die sich mit der Strahlung eines Elektrons beschäftigt, beschreibt ein einzelnes Elektron. Dies ist eine ziemlich abstrakte Situation. Schließlich gibt es kein „einzelnes (einsames) Elektron“. Wenn wir aber dann die Strahlung von realen Elektronen beschreiben, verhalten sich diese mit sehr hoher Genauigkeit so, wie es die Gesetze für „einsame“ Elektronen vorhersagen.
Aber lasst uns weitergehen, denn dies ist ein gutes Beispiel dafür, was ein Modell in der Physik ist. Ein völlig einsames Elektron strahlt nicht, es muss eine beschleunigende oder abbremsende Kraft auf es einwirken, wie zum Beispiel das elektrische Feld eines Protons. Im einfachsten Fall, wenn das Elektron einfach mit geringer Geschwindigkeit am Proton vorbeifliegt, haben wir es mit der so genannten Bremsstrahlung zu tun. Die Formel, die diese Strahlung beschreibt, wird in der Astrophysik häufig verwendet. Aber bei Geschwindigkeiten des Elektrons nahe der Lichtgeschwindigkeit ist auch diese Formel nicht mehr gültig, weil sie die Auswirkungen der speziellen Relativitätstheorie nicht berücksichtigt. Es wird also die Formel für die relativistische Bremsstrahlung aufgestellt.
Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Die fraglichen Formeln gehen davon aus, dass sich das Elektron im Vakuum bewegt. Nun, wenn man sich das Vakuum genauer ansieht, stellt sich heraus, dass es nicht leer ist, sondern gemäß der relativistischen Quantenelektrodynamik mit schnell auftauchenden und ebenso schnell wieder verschwindenden Teilchen-Antiteilchen-Paaren gefüllt ist, die die Anwesenheit eines Protons spüren und die sogenannte Polarisation des Vakuums verursachen3. Dieser und andere ähnliche Effekte tragen auch zum Strahlungsmuster des „einsamen“ Elektrons bei. Aber in vielen Anwendungen können relativistische Effekte, wie wir sagen, vernachlässigt werden, und eine nichtrelativistische Näherung kann erfolgreich verwendet werden. Der unterschiedliche Grad der Vereinfachung der Realität ist hier deutlich zu sehen. In der Praxis wird diejenige Formel verwendet, die für die Situation genügt.
3 Mehr im Gespräch 11: „Irren sich Physiker?“
Und basierte die Entstehung des Universums auf den Naturgesetzen oder wurden diese durch sie erst hervorgerufen? Sofern dies überhaupt eine gut gestellte Frage ist.
Die Frage ist gut gestellt, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie sich beantworten lässt. Jene, die besser sind als ich, sind nicht in der Lage, sie zu beantworten. Der hervorragende Physiker Paul Steinhardt4 wurde von einem Journalisten des Wochenmagazins „Politik“ gefragt, ob Zeit und Raum emergent sein könnten. Mit anderen Worten, ob sie bei der Erschaffung des Universums „entstanden“, „aufgetaucht“ sein könnten. Was den Raum betrifft, so hat Steinhardt keine Probleme damit, aber die Zeit, die „emergiert“ wäre? Das ist zu viel. Er erklärte sogar, dass er die Frage nicht verstehe, dass er nicht wisse, wie diese beiden Worte – „Emergenz“ und „Zeit“ – nebeneinander gestellt werden könnten.5
4 Der amerikanische Physiker Paul Steinhardt erscheint wieder in Gespräch 5 zurück: „Die Streitigkeiten über den Ursprung des Universums II“
5 Karol Jałochowski: Interview mit Paul Steinhardt, Dezember 2010, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1511508,1,wszechswiat-powstajacy-iginacy-od-zawsze.read?page=1&moduleId=4793.
Es ist also sicherlich eine wichtige Frage, wenn auch eine, die in der Praxis keine Rolle spielt. Man kann auch eine andere Frage stellen, eine sehr gefährliche Frage: Gab es die Naturgesetze schon vor dem Universum?
Natürlich. Denn wenn ja, wie lange haben sie existiert... Was haben sie gesteuert, wenn das Universum nicht existierte? Und war es ihre Existenz, die dessen Entstehung erzwungen hat?
Die Fragen mehren sich. Die sicherste Antwort lautet daher: Das Universum ist nie entstanden. Es ist ewig, zyklisch. Ein Verfechter einer solchen Antwort ist – ausgerechnet – Steinhardt, und ein anderer – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen – Roger Penrose. Das Fehlen eines Anfangs ist recht bequem, denn für viele Physiker war die Existenz eines solchen Anfangs geradezu abstoßend – wie Arthur Eddington es ausdrückte. Aber auch Einstein, und sogar Friedman, der Autor des ersten mathematischen Modells eines expandierenden Universums und – wahrscheinlich – der erste, der an ein zyklisches Universum dachte, wollten die Existenz einer Art von Anfang nicht akzeptieren.
Und denkst du, dass das Universum zyklisch ist?
Ob ich das denke? Als Physiker äußere ich meine Meinung nur auf Gebieten, auf denen ich gearbeitet habe. In dieser Angelegenheit kann ich mich nur auf meine persönlichen Vorlieben berufen, aber das wird keine Aussage eines Experten sein. Also, ich würde es vorziehen, wenn das Universum zyklisch wäre. Das würde eine Menge Probleme lösen. Seit ich – nicht aus der Heiligen Schrift, sondern aus einem populärwissenschaftlichen Text – erfahren habe, dass es einen Anfang des Universums gibt, hat mich das immer geplagt. So wie wahrscheinlich jeden. Wie auch immer, das Ringen um diese Frage ist ein interessantes Beispiel für Auseinandersetzungen unter Physikern. Ich bin sicher, wir werden noch mehr darüber sprechen.6
6 Mehr dazu in den Gesprächen 4 und 5: „Streitigkeiten über den Beginn von Universum I“ und „Streitigkeiten über den Beginn von Universum II“.
Dieses Ringen der Physiker führt früher oder später in der Regel zu irgendeiner Art von Schlussfolgerungen. Wie kommen sie zustande? Wie wird eine Behauptung zu einem Naturgesetz?
So wie es eben in der Wissenschaft üblich ist: auf der Grundlage von Experimenten, Messungen und Beobachtungen. Im Allgemeinen sind die Naturgesetze Teil einer Theorie und werden – seit der Entstehung der modernen Wissenschaft, d.h. seit Newton – in Form von Gleichungen formuliert. Entscheidend ist, dass diese Gleichungen etwas vorhersagen: Phänomene oder Werte bestimmter physikalischer Größen. Und das kann überprüft werden, wodurch eine Hypothese getestet und zu einem Naturgesetz erklärt wird.
Die Maxwellschen Gleichungen sind ein solches Schulbeispiel. Im Allgemeinen ist das Testen von Kandidaten für Naturgesetze nicht so einfach, es ist mühsam und mit Ungewissheiten behaftet. Aber in diesem Fall war die Sache einfach: Gleichungen, Lösung und ihre Folgen, Erfahrung und Bestätigung. Spiel, Satz und Sieg, wie man im Tennis sagt. Maxwells Gleichungen implizierten die Existenz von elektromagnetischen Wellen. Heinrich Hertz führte einfach ein Experiment durch, indem er solche (Radio-)Wellen erzeugte und sie aufzeichnete7. Eine ähnliche Geschichte betrifft die Beobachtung einer Sonnenfinsternis im Jahr 1919, die die allgemeine Relativitätstheorie spektakulär bestätigte. Und das war zu einer Zeit, als diese Theorie noch in den Kinderschuhen steckte. Gleichwohl bedeutet dies nicht, dass die Relativitätstheorie nicht mehr getestet wird. Im Gegenteil, sie wird heute noch sehr gründlich getestet, weil sie, wie ihr Schöpfer bereits behauptete, eine Annäherung an eine andere, „tiefere“ Theorie sein kann.
7 Wobei er eine der witzigsten Vorhersagen der Geschichte machte, dass seine Entdeckung keine Anwendung finden würde.
Die Elektrodynamik hingegen wird derzeit nicht mehr getestet, weil wir bereits wissen, dass sie auf der Quantenebene nicht anwendbar ist. Die Erkenntnis, dass sich die Welt auf der Mikroebene anders verhält, war eine Revolution.
Und wie steht es mit der Universalität?
Theorien sind universell, aber im Allgemeinen nur auf einer Skala: entweder makroskopisch oder mikroskopisch.
Maxwells Theorie wurde also nicht verworfen.
Nein, natürlich nicht. Man begann sich zu fragen, was auf atomarer Ebene neu war, dass Maxwells Theorie dort „nicht funktionierte“. Wenn etwas als Theorie anerkannt ist, bedeutet das, dass es die Tests bestanden hat, die es zu diesem Namen berechtigen, und dass es nicht mehr abgelehnt werden kann. Man kann nur noch die Grenzen der Anwendbarkeit dieser Theorie finden. Schließlich verwenden wir ja die Newtonsche Theorie die ganze Zeit. Entgegen einer weit verbreiteten, aber irrtümlichen Meinung hat die Relativitätstheorie die Newtonsche Theorie nicht widerlegt, sondern lediglich festgestellt, dass diese nur auf Bewegungen mit im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit geringen Geschwindigkeiten anwendbar ist.
In unseren Gesprächen soll es darum gehen, wie Wissenschaft geschmiedet wird, und worüber man in der Physik streiten kann. Es könnte scheinen, als gäbe es keinen Raum für Diskussionen. Alles basiert auf der Mathematik, mit der man nur schwer streiten kann. Die zweite Säule ist die Beobachtung, das ist das Experiment. Wo ist da Platz für Streit, Emotionen, Wortgefechte, Aufteilung in Fraktionen? Auf der Grundlage von was kann man in der Physik streiten?
Ha! Sogar Mathematiker streiten sich, allerdings nur über die Prinzipien oder Methoden des Beweisens von Theoremen. Aber zumindest gibt es in der Mathematik keinen Zweifel daran, dass ein Theorem mit idealer Genauigkeit eine mathematische „Realität“ beschreibt. Mathematische Theoreme werden nicht durch Messungen getestet. Aber mathematische Theoreme, die auf die physikalische Realität angewendet werden, schon. In der Mathematik wird der Satz des Pythagoras nicht getestet, weil dies keinen Sinn ergeben würde, während in der Physik der bereits erwähnte Test der allgemeinen Relativitätstheorie bei der Beobachtung einer Sonnenfinsternis genau eine solche Messung war, um zu überprüfen, ob der Satz des Pythagoras erfüllt wird. Es stellte sich heraus, dass dies nicht der Fall war, was Einsteins Theorie bestätigte, dass die Schwerkraft der Sonne nicht zulässt, dass der Raum flach ist. Denn nur in diesem Fall eines flachen Raumes ist der Satz des Pythagoras erfüllt. Erschwerend kommt hinzu, dass jede Messung mit Ungenauigkeiten behaftet ist, die als Messfehler bezeichnet werden, obwohl sie im Allgemeinen nicht auf einen Irrtum zurückzuführen sind. Und schon Eddingtons Team, das die bahnbrechende Beobachtung der Sonnenfinsternis durchführte, wurde beschuldigt, die Ergebnisse zu dehnen, damit sie mit Einsteins Vorhersagen übereinstimmen. Zu Unrecht, wie sich herausstellte, aber dies ist ein Beispiel für einen möglichen Streitpunkt. Bis heute gibt es einen Streit über den Wert der Hubble-Konstante, über den wir noch sprechen werden8.
8 Im Gespräch 5: „Streitigkeiten über den Ursprung des Universums II“.
Man kann sicherlich auch über Interpretationen streiten. Ein klassisches Beispiel ist die Quantenmechanik. Niemand, der bei Verstand ist, stellt die Quantenmechanik in Frage, denn sie ist eine der am besten bestätigten Theorien. Ihre Interpretation hingegen ... das ist etwas, was die Menschen nicht akzeptieren. Und die meisten ziehen es vor, darüber nicht nachzudenken. Es gibt allerdings auch einige, die die Konsequenzen der Standardinterpretation der Quantenmechanik rundheraus ablehnen und versuchen, alternative Interpretationen zu schaffen. Zuweilen ruft die Quantenmechanik sogar immer noch Emotionen hervor. Denn es ist in der Tat schwer zu akzeptieren, dass etwas, das wir hier und jetzt messen, vor der Messung weder „irgendwo“ noch „irgendwann“ war. Die Quantenmechanik beschreibt Atome, aber bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts haben die meisten Physiker ihre Existenz – aus hauptsächlich philosophischen Gründen – nicht akzeptiert, worüber wir das nächste Mal sprechen werden. Andererseits war die Existenz des Äthers unumstritten und wurde doch mit ein paar Federstrichen eines jungen Patentbeamten in Bern aus der Physik gefegt. Nicht immer sind die Gegenstände von Streitigkeiten also gut gewählt – was post factum festgestellt wird.
Ein weiteres typisches Streitthema ist der Beginn des Universums, wie bereits erwähnt wurde. Denn wenn wir zu wenig Informationen haben, wird die Physik fragwürdig.
Schließlich können Streitigkeiten durch Phänomene ausgelöst werden, deren Natur uns immer noch ein Rätsel bleibt. Und manchmal kommt es vor, dass ein Forscher auf einem Modell beharrt, vorzugsweise seinem eigenen, und neue Fakten nicht anerkennen will.
Und es kommt vor, dass Physiker von ihrem Geschmack in die Irre geführt werden? Von ihrem Sinn für Ästhetik?
Ja, bei der Bewertung von Theorien gibt es so etwas wie ein Gefühl des Widerwillen – wie im Fall der Auseinandersetzung mit dem Anfang des Universums – oder der Schönheit oder Eleganz. Dirac zum Beispiel war ein Verfechter dieses Ansatzes. Er glaubte, dass Schönheit das Wichtigste sei. Bis heute werden bei der Bewertung neuer Theorien ästhetische Kriterien herangezogen: dass nämlich diese Theorie mathematisch schön sei.
Aber wie lässt sich Schönheit in der Mathematik definieren?
Ja, genau. Was mir schön erscheint, findest du vielleicht ganz gewöhnlich. Die Physikerin und Bloggerin Sabine Hossenfelder hat sogar ein Buch zu diesem Thema geschrieben, Lost in Math.9 Darin fragt sie, woher die Natur wissen soll, dass wir etwas mögen. Aber die Menschen denken wirklich so, und zwar nicht nur irgendwelche Menschen. Meiner Meinung nach ist das illusorisch, aber wer bin ich schließlich neben Dirac? Ich bin eher für den Ansatz von Boltzmann, der sagte, man solle die Eleganz lieber den Schuhmachern und Schneidern überlassen.
9 Deutsche Ausgabe S. Hossenfelder, Das hässliche Universum: Warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt. S. Fischer, 2018
Du fragst nach Streitigkeiten. Ich sehe aber, dass die Leute heutzutage kaum noch wirklich miteinander streiten. Man hat Angst, jemanden zu beleidigen, jemanden zu verärgern. Die andere Sache ist, dass wenn es zu heftigeren Emotionen kommt, diese in der Regel vorübergehend sind: solange die Theorie oder das Modell noch nicht ausgereift ist oder einen Fehler enthält. Oder bei den Beobachtungen ist etwas schief gelaufen.
Denn oft ist die Ursache der Verwirrung Ehrgeiz, menschliches Irren, Eile.
Ja, Ehrgeiz, Eile, besonders im heutigen Zeitalter der sozialen Medien...
...und im Kampf um Zuschüsse.
Ja, natürlich! Und um die enormen Geldbeträge, die für den Bau von Instrumenten benötigt werden. Manchmal sind dies nicht einmal Streitigkeiten, sondern vielmehr Kompromittierungen – worüber wir noch sprechen werden.
Auf Streitigkeiten sollte ein Konsens folgen. Gibt es einen wissenschaftlichen Konsens?
So etwas gibt es nicht.
Immerhin wird dieser Begriff verwendet.
Es wird der Begriff „Konsens unter Wissenschaftlern“ verwendet, und das ist nicht dasselbe. Die Wissenschaft arbeitet nicht auf der Grundlage eines Konsenses, obwohl dieser manchmal von Bedeutung sein kann. Aber es kommt darauf an, ob eine Theorie oder ein Modell durch Erfahrung, durch Beobachtungen, bestätigt wird oder nicht. Ein Beispiel: Bis 1905 herrschte unter Wissenschaftlern ein starker Konsens darüber, dass es einen Äther gibt. Das hat dem Äther überhaupt nicht geholfen. Es gibt keinen Äther. Er wurde, zusammen mit dem Konsens, von einem Physiker hinweggefegt. Und, wie ich bereits erwähnt habe, hat vorher niemand über den Äther diskutiert. Weißt du, dass der Begründer der Relativitätstheorie auf die Nachricht von der Publikation des Buches „Hundert Autoren gegen Einstein“ in Deutschland gesagt haben soll: „Warum so viele? Wenn ich mich irren würde, würde einer ausreichen“?
Aber jetzt können wir sagen: Es besteht ein Konsens darüber, dass die allgemeine Relativitätstheorie richtig ist.
Es geht hier nicht um einen Konsens. Die Richtigkeit der allgemeinen Relativitätstheorie beruht auf ihrer sehr genauen Überprüfung. Der Konsens ist nur das Ergebnis hiervon. Und außerdem betrifft der Konsens die Tatsache, dass es sich um eine Theorie handelt, die mit einer gewissen Genauigkeit korrekt ist und die weiterhin getestet werden wird. Kürzlich hat der französische Satellit MICROSCOPE seine Untersuchungen abgeschlossen, die auf vierzehn Dezimalstellen genau die Gleichheit von träger und schwerer Masse bestätigten, welche Gleichheit – in Form des Äquivalenzprinzips – die Grundlage der Einsteinschen Theorie ist. Aber weitere Tests sind vorgesehen.
Demnach sollte von einem Konsens überhaupt nicht die Rede sein?
Vielleicht in den nicht-exakten Wissenschaften, obwohl ich nicht weiß, was daraus folgen würde. In der Physik gibt es einige Bereiche, in denen es bisher keine Lösung gibt. Im Fall der dunklen Materie ist der Konsens im Moment, dass sie existiert, aber daraus folgt nichts! Solange es keinen Beweis für ihre Existenz gibt, ist dieser „Konsens“ eine Beschreibung der wissenschaftlichen Gemeinschaft, aber keine Beschreibung der Natur.
Dann frage ich mal anders, bezüglich der „Werkstatt“ eines Physikers. Versteht jeder Physiker nach seinem Abschluss alles in der Physik?
Oh nein, natürlich nicht.
Was heißt hier „natürlich“?
Weil die Physik zu groß geworden ist. Einmal, zu Beginn des letzten Jahrhunderts, haben Physiker morgens die frisch eingetroffenen Fachzeitschriften von der ersten bis zur letzten Seite gelesen. Heute wäre das, nomen est omen, physisch unmöglich. Die amerikanische Fachzeitschrift „Physical Review“ zum Beispiel erschien früher in einem einzigen Band; heute gibt es mindestens sechs Versionen, die jeweils auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert sind. Heutzutage gibt es keine Physiker mehr, die einfach nur einen Artikel über die Superstringtheorie, dann über Graphen-Probleme und schließlich über die Turbulenzsättigung in Akkretionsscheiben lesen und verstehen können. Im Prinzip sollte ein Physiker in der Lage sein zu verstehen, was vor sich geht, aber beispielsweise Artikel über Superstrings sind in einer mathematischen Sprache geschrieben, die die große Mehrheit einfach nicht kennt.
Außerdem ist die große Mehrheit der Physiker nicht einmal mit der allgemeinen Relativitätstheorie vertraut, die schließlich vor über hundert Jahren entstanden ist.
Nicht möglich!
Aber wahr. Das liegt daran, dass es sich lange Zeit um eine Theorie handelte, die nur auf einige wenige Phänomene angewandt wurde. Eine schöne Theorie, aber fast ohne Anwendungen, und die sich einer mathematischen Sprache bedient, die in anderen Zweigen der Physik kaum verwendet wird. Das hat sich in den letzten Jahren geändert, und sei es nur durch die Entdeckung von Gravitationswellen und das sich dadurch entwickelnde neue Gebiet in der Astronomie.
Hingegen wird die Mathematik, die in der allgemeinen Relativitätstheorie verwendet wird, nicht an der Universität gelehrt. Dies ist und war schon immer so. Einstein musste sie erst noch lernen, um seine Theorie zu entwickeln.
Warum eigentlich? Angesichts ihrer Berühmtheit könnte man meinen, dass es sich um eine ganz grundlegende Theorie der Physik handelt. Die im zweiten, vielleicht dritten Studienjahr unterrichtet würde.
Und doch wird sie überhaupt nicht gelehrt, weil sie in den meisten Bereichen der Physik einfach unnötig ist. Man benötigt klassische Mechanik, Quantenmechanik, Elektrodynamik, Hydrodynamik, statistische Physik und Festkörperphysik.
Wobei natürlich nicht alle alles wissen. Die erste Unterteilung ist die zwischen Experimentatoren und Theoretikern. Es gibt einige Forscher, die beides tun, aber das sind nur wenige. Die Physik ist ein sehr weites Feld. Ich weiß z.B. nicht, wie viel ein Festkörperphysiker über die Theorie der Elementarteilchen weiß. Und andersherum.
Ist das eine gute Idee?
Dies ist eine gewisse Schwäche, denn viele originelle und wichtige Ideen in der Physik sind durch die Anwendung von Wissen aus einem Bereich auf einen anderen entstanden. Die Idee der Inflation in der Kosmologie stammt von Phasenübergängen, einem Konzept aus der Thermodynamik. Aber dazu sind nur die Größten fähig, die einfach „alles“ wissen. Richard Feynman war ein solcher Physiker. Sie sind eine Seltenheit, aber sie sind die wichtigsten.
Und was bedeutet es, die Quantenphysik zu „verstehen“? Du hast mir einmal gesagt, dass es Menschen gibt, die sie nutzen, aber nicht verstehen.
Ich würde sogar sagen, es ist die Mehrheit. Nun, die Quantentheorie kann zur Beschreibung der Welt verwendet werden, ohne dass man sich über ihre scheinbaren Paradoxien Gedanken machen muss. Du kannst mit größtmöglicher Genauigkeit die Verteilung der Elektronen in einem Wasserstoffatom berechnen, völlig unbekümmert um die Tatsache, dass du eine Theorie verwendest, aus der folgt, dass dieses Teilchen hier und dort und eigentlich nirgendwo sein kann; eine Theorie, die diese arme Schrödinger-Katze dazu verdammt, gleichzeitig lebendig und tot zu sein.
Die Katze hält also nicht die vielen Physiker nachts wach?
Diese hier nicht. Dies sind eher philosophische Probleme. Einstein schrieb einmal irgendwo, dass die Grundlagen der Physik für die Priester von größerem Interesse sind als für die Physiker selbst. Ich glaube, es war Feynman, der sagte, dass man die Quantenmechanik nicht wirklich verstehen kann, man kann sich nur an sie gewöhnen. Es gibt keinen anderen Ausweg: Sie ist die beste, mit größter Genauigkeit bewiesene physikalische Theorie.
Und ist die arme Katze nun lebendig oder tot?
Es ist unmöglich, dies zu wissen, bevor man die Schachtel öffnet. Natürlich ist das faszinierend. Man produziert nun „Katzen“, die weder tot noch lebendig sind, aber es sind keine echten Tiere, sondern Systeme, die ein Zwischending zwischen einem Quantenzustand und einem makroskopischen Zustand sind – dem „unseren“. Denn es scheint, dass wir hier einen Dualismus haben. Es gibt die mikroskopische Welt, in der die Quantenmechanik vorherrscht, und die makroskopische Welt, in der die klassische Mechanik vorherrscht. Schließlich verwendet niemand die Quantenmechanik, um die Bewegung der Planeten um die Sonne zu beschreiben. Die ungelöste Frage ist, wo diese Grenze zwischen der klassischen und der Quantenwelt verläuft.10
10 Mehr dazu im Gespräch 3: „Wellen oder Teilchen?“
À propos Grenzen. Wo beginnt und wo endet die Wissenschaft?
Ich würde sagen, dass die Wissenschaft dort endet, wo die Erfahrung oder Beobachtung endet.
Dies kann vorübergehend sein. Es könnten sich in Zukunft technische Möglichkeiten ergeben, wie im Fall des EPR-Paradoxons .11
Ja, natürlich. Es kann vorkommen, dass eine wissenschaftliche Theorie Vorhersagen enthält, die zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht getestet werden können. Dies war der Fall bei der Hypothese der Existenz zweier verschmelzender schwarzer Löcher, die Gravitationswellen aussenden. Erst mit dem Bau des Gravitationswellendetektors hat sich das geändert. Auf der anderen Seite hört die Wissenschaft dort auf, wo es keine Vorhersagen gibt. Und genau hier gibt es ein Problem. Bis vor kurzem hätte jeder dem zugestimmt, aber dann kam die Superstringtheorie auf.
11 Ein von Einstein, Podolsky und Rosen entwickeltes Gedanken-Experiment, das durch seine scheinbar paradoxe Natur die Inkohärenz der Quantenmechanik demonstrieren sollte. Jahre später, als die technischen Möglichkeiten zur Verfügung standen, wurde das Experiment erfolgreich durchgeführt.
„Die Theorie von allem“, wie manche sagen.
Ich denke ironisch. Sie kann keine Theorie von „allem“ sein, sondern ist eine fundamentale Theorie in dem Sinne, dass sie die Welt auf der elementarsten Ebene beschreibt. Es ist eine unglaublich schöne, ausgefeilte und komplexe mathematische Theorie. Viel mehr als die Differentialgeometrie, die für die Relativitätstheorie benötigt wird. Es gibt nur ein Problem: Es gibt keine Vorhersagen. Es gibt und wird keine Methode geben, um experimentell zu prüfen, ob diese Theorie der Realität entspricht.
Trotz der technischen Entwicklungen?
Das Problem liegt in der Theorie selbst. Sie beschreibt Phänomene in einem unglaublich kleinen Maßstab. Je kleiner die Skala, desto größer die Energie, die benötigt wird, um sie zu erreichen. Die Stringtheorie beschreibt Entitäten auf einer so kleinen Skala, dass die Menschheit niemals in der Lage sein wird, die nötige Energie aufzubringen. Aus einem einfachen Grund: Solche Energien gab es nur beim Urknall. Die Superstring-Theorie kann nicht verifiziert werden.
Das ist alles ein bisschen seltsam.
Nicht wahr? Ein Philosoph hat sogar den Begriff „postexperimentelle Wissenschaft“ geprägt. Zu meiner Verwunderung ist der Begriff sogar unter prominenten Physikern populär geworden!
Wahrscheinlich bei jenen, die sich auf die Superstringtheorie spezialisiert haben.
Ja, natürlich. Einige sind Nobelpreisträger, extrem kluge Leute. Sie argumentieren, dass die Theorie so schön, so offensichtlich ist, dass die Unmöglichkeit, sie experimentell zu bestätigen, kein Problem darstellt. Meiner Meinung nach begeben wir uns an diesem Punkt auf ein äußerst gefährliches Terrain. Das Kriterium soll Schönheit sein? „Offensichtlichkeit“? Wer entscheidet das? Das klingt schon eher nach Ideologie oder Religion, nicht nach Wissenschaft. Für mich endet die Wissenschaft hier.
Aber das ist wiederum deine Meinung.
Nicht nur meine. Ich denke, dass sogar die meisten Physiker dieser Meinung sind. Es gab zum Beispiel einen Artikel in Nature gegen diese „post-experimentelle Wissenschaft“, geschrieben von meinen beiden herausragenden Kollegen, George Ellis und Joseph Silk. Das hat natürlich einen Sturm ausgelöst. Denke darüber nach, auf welche Weise die Struktur der Welt von unseren Geschmäckern abhängen würde? Das hat einen Beigeschmack von Teleologie, die von Galileo Galilei bekämpft wurde, der schrieb, dass „die Natur sich nicht darum kümmert, ob ihre Gesetze und Methoden für uns verständlich sind oder nicht“.
Ich sehe hier ein großes Problem. Einige Forscher betrachten die Stringtheorie daher als Nicht-Wissenschaft, während sich viele prominente Physiker mit ihr beschäftigen. Ausnehmend sonderbar.
Das ist genau der Punkt. Aber wenn wir über andere Kriterien als Experiment oder Beobachtung sprechen, entfernen wir uns von der Wissenschaft. Weder Schönheit noch Eleganz noch der sogenannte Konsens können ein Argument sein.
Und wann wurde das letzte Mal ein Naturgesetz entdeckt? Etwas Grundlegendes?
Ich habe den Eindruck, dass die Entdeckung der Quarks und die Formulierung der Theorie der Quantenchromodynamik eine solche grundlegende Entdeckung war. Danach gab es keine weitere Entdeckung, die ein neues Naturgesetz beschrieben hätte. Neuere Entdeckungen sind Bestätigungen, Abschlüsse. Oder vielleicht Eröffnungen, wie im Fall der Entdeckung der Neutrino-Oszillationen12.
12 Siehe Gespräch 10: „Die Zitternde Sonne“.
Die Quantenchromodynamik war also etwas Letztes, Grundlegendes, Einzigartiges. Es hat in der Geschichte nicht viele solcher Entdeckungen gegeben, nicht viele solcher Physiker. Der Schöpfer dieser Theorie, Murray Gell-Mann, ist 2019 gestorben, und diese Nachricht hat nicht die Schlagzeilen gemacht wie der Tod von Stephen Hawking. Letzterer hat zwar einen großen Beitrag zur Physik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geleistet, aber Gell-Mann hat noch viel mehr beigetragen. Aber irgendwie sind die Menschen nicht so sehr an Quarks interessiert, es ist schwer zu sagen, warum.
Gibt es eine Verlangsamung in der Physik? Schweigt die Natur und ist nicht bereit, unsere weiteren Fragen zu beantworten?
Die Natur kann nicht sprechen, es sind wir, die die Fragen beantworten, die wir stellen – wir sind diejenigen, die die Physik bauen. Ob wir diese Antworten finden können, ist eine andere Sache. In diesem Zusammenhang habe ich Bedenken bezüglich der Teilchenphysik. Hier kann es schwierig werden.
Stimmst du also der Aussage zu, dass die Physik in einer Krise steckt?
Da bin ich anderer Meinung. Wenn das so gesagt wird, meint man die fundamentale Physik, die Teilchenphysik. Diese steckt in der Tat in der Krise, aber anderen Gebieten geht es sehr gut.
Und warum ist gerade diese in der Krise?
Wir haben ein Standardmodell, das sehr gut funktioniert. Allerdings gibt es ein paar Wölkchen am fast klaren Himmel, wie Lord Kelvin sagen würde.
Ja... Sein berühmter Satz an der Wende zum 20. Jahrhundert, dass im Grunde schon alles bekannt sei und es nur noch zwei kleine Wolken am Horizont der Physik gäbe. Aus diesen Wolken erwuchsen dann die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik, die das Denken über Physik umkrempelten. Welche Wölkchen haben wir jetzt?
Eben! Die Wolken in der Standardtheorie beziehen sich auf die Masse der Neutrinos, die gleich Null sein „sollte“, und es gibt einige Experimente mit Neutronen und Protonen, die den Verdacht erwecken, dass da vielleicht etwas nicht stimmt. Aber vielleicht ist an diesen Experimenten etwas falsch.
Das Modell wurde kürzlich durch den Nachweis des Higgs-Brout-Englert-Bosons gekrönt und bestätigt. Wir haben also ein unvollkommenes, aber sehr gutes Modell. Wie geht es weiter? Niemand weiß es. Am CERN wurde ein Plan für einen zukünftigen Beschleuniger vorgestellt, der um ein Vielfaches leistungsfähiger sein soll als der LHC.
Die bereits erwähnte Sabine Hossenfelder hat darauf sehr kritisch reagiert. Warum, fragt sie, geben wir Milliarden aus, wenn keine Theorie etwas Neues bei diesen Energien vorhersagt; es macht keinen Sinn. Meiner Meinung nach hat sie recht. Die Doktrin, dass man, wenn man die Energie erhöht, zwangsläufig etwas sehen wird, hat sich als unwahr erwiesen und der LHC selbst hat dies bewiesen.
Darüber hinaus glauben einige, dass das Standardmodell die im Universum beobachtete Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie erklären und auch Fragen zur dunklen Materie und dunklen Energie beantworten sollte.
Wenn es um die dunkle Materie geht … Nun, es könnte sich herausstellen, dass es tatsächlich irgendwelche Axionen oder andere Teilchen gibt, die die dunkle Materie ausmachen. Das wäre etwas banal, aber dennoch sehr wichtig. Es könnte sogar superwichtig sein, denn es könnte sich als eine Bestätigung der Supersymmetrie erweisen13 – wenn sich herausstellt, dass die dunkle Materie ein supersymmetrischer Partner „unserer“ Materie ist. Aber die Hoffnungen darauf werden immer schwächer und schwächer. Eigentlich sollte der Large Hadron Collider supersymmetrische Teilchen finden – und noch immer herrscht Schweigen in der Sache.
Wenn sich andererseits herausstellt, dass wir nirgendwo mehr anders nach dunkler Materie suchen können – weil ihre Nichtexistenz nicht nachgewiesen werden kann – und wir einfach aufgeben und sie akzeptieren, dann könnten sich die Tore zu einer Revolution in der Physik öffnen.
13 Die unbewiesene Hypothese, dass jedes Fermion seinen eigenen Bosonen-“Partner“ hat – und umgekehrt: jedem Boson entspricht ein Partner, der ein Fermion ist.
Das Problem der dunklen Energie ist ein weiteres, noch größeres Rätsel. Es heißt: Vakuumenergie, die kosmologische Konstante… Aber was bedeutet das? In der sogenannten dunklen Energie könnte eine ganz neue Physik verborgen sein. Wenn wir das Problem lösen können. Und eine Garantie dafür haben wir nicht. Vielleicht haben wir eine Grenze erreicht und stehen vor einem Problem, das in zweihundert Jahren oder nie gelöst werden wird. Es fehlt uns eindeutig etwas.
Ein Genie, vielleicht? Oder ist ihre Zeit in der Ära der großen Forschungseinrichtungen und Teams von Hunderten von Physikern vorbei?
Diese riesigen Teams sind natürlich notwendig, aber andererseits haben sie einen sehr schlechten Einfluss auf die Wissenschaft. Denn wenn jemand sehr begabt ist – ich weiß noch nicht, ob er ein Genie ist, aber sehr begabt – wird er darin zu einer anonymen Ameise. Ich habe den Eindruck, dass einige sehr talentierte Menschen davon abgestoßen werden. Ich kenne einige, die aus diesem Grund weggegangen sind. Ob heute noch Genies gebraucht werden? Ich denke schon, gerade wegen der Krise in der Teilchenphysik. In einer solchen Situation wartet man auf ein Genie, so wie man auf den Messias wartet.
Vielleicht verstecken sich diese Genies irgendwo?
Im Prinzip wird Edward Witten weithin als Genie angesehen, aber gleichzeitig hat dieses Genie auch Dinge hervorgebracht, die manche Leute für sehr schädlich halten.
Warum?
Witten ist sicherlich ein außergewöhnlicher Geist, der Großes leistet. Die Sache ist die, dass sie mathematisch bleiben. Witten beschäftigt sich hauptsächlich mit der Stringtheorie, die in unserem Gespräch immer wieder auftaucht. Viele glauben, dass die Konzentration auf diese Theorie von der wirklichen Physik abgelenkt hat.
Vor etwa zwanzig Jahren habe ich am Institut für Theoretische Physik an der Universität von Kalifornien in Santa Barbara zusammen mit Kollegen ein Programm über astrophysikalische schwarze Löcher durchgeführt. Parallel dazu gab es ein Programm über Superstrings. Ich besuchte ihre Kurse, weil ich die Theorie besser verstehen wollte. An einem Punkt fragte ich einen der String-Wissenschaftler: Nun, stellen wir uns vor, Sie finden die Gleichung dieser ultimativen Theorie, und gleichzeitig beweist ein Mathematiker, dass diese Gleichung keine Lösungen hat; was dann?
Dieser String-Theoretiker, einer der ganz Großen, lächelte und sagte: Nun, ja, das ist im Prinzip möglich. Das sollte eigentlich ein Scherz sein, aber wir haben wirklich nicht die Sicherheit, dass wir alles im Universum mit Hilfe der Mathematik verstehen können. Bislang ist ihre Wirksamkeit – in den Worten von Eugene Wigner, einem dieser großen Physiker, von denen die Öffentlichkeit noch nie etwas gehört hat – „unverständlich“ und ein „wunderbares Geschenk“.14.
14 E. Wigner, The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences, „Communications in Pure and Applied Mathematics” 1960, Vol. 13, No. 1.
Es ist interessant, was du sagst. Es wirkte so, als sei die Möglichkeit, alles mit Mathematik zu beschreiben, für Physiker ein Dogma.
Die Physik ist nicht die katholische Kirche, und es gibt in ihr kein Dogma. Andererseits ist die Physik ohne Mathematik kaum vorstellbar, denn sie ist seit Galileo Galilei mathematisch. Aber wie Wigner schon sagte, ist die mathematische Welt eine perfekte Welt, in der jeder Satz mit unendlicher Genauigkeit wahr ist. In der physikalischen Welt ist das nicht der Fall, und es ist ein Rätsel, wie es kommt, dass diese perfekte Welt so gut zur unvollkommenen realen Welt passt. Vielleicht gibt es in der Physik keine Rettung jenseits der Mathematik, aber die Wirksamkeit dieser Rettung bleibt ein Rätsel. Es ist nicht klar, wo die Grenzen dieser Wirksamkeit liegen. Nach der Superstring-Theorie hat das Universum zehn Dimensionen, aber diese zusätzlichen sechs Dimensionen sind auf eine Größe von 10-37m zusammengerollt – sie bilden eine unglaublich komplizierte mathematische Kreation, die Calabi-Yau-Mannigfaltigkeit, für die es eine zweidimensionale Darstellung gibt, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:
Abbildung 1. Variante von Calabi-Yau (https://en.wikipedia.org/wiki/Image: Calabi-Yau.png)
Aber wie können wir überprüfen, ob dies in Wirklichkeit der Fall ist?
Ich bin neugierig auf ein anderes Thema. Wenn es schon gelingt, verschiedene Dinge einigermaßen festzustellen, wird es dann überhaupt möglich sein, sie dem Publikum zu erklären? Ist es möglich, die Physik ehrlich zu popularisieren?
Wir beide haben sogar ein Buch geschrieben, um diese Wissenschaft populär zu machen, und soweit ich mich erinnere, waren wir dabei sehr ehrlich. Worin sollte die Unehrlichkeit bestehen?
Ich sage es frei heraus: Ich habe meine Zweifel an Autoren populärer Publikationen, insbesondere astrophysikalischer Publikationen, die fantastische Visionen spinnen – über Zeitreisen, über zusätzliche Universen, die gleich um die Ecke warten.
Das ist nicht unbedingt unehrlich. Ich würde es eher so sehen, dass man den bequemsten Weg wählt. Es hängt viel davon ab, was man unter Popularisierung der Wissenschaft versteht. Man kann den Ehrgeiz haben, einem Laien Physik zu vermitteln, ohne mathematische Formeln und Begriffe zu verwenden. Dazu können wir im Voraus sagen: Das ist unmöglich. Du kannst nicht fünf Jahre Studium durch einen Artikel oder ein populärwissenschaftliches Buch ersetzen. Was man tun kann, ist zu erklären, wie Wissenschaftler arbeiten: was wissenschaftliches Arbeiten ist, wie man argumentiert, was die Kriterien für die Akzeptanz eines Modells oder einer Theorie sind.
Ich fürchte, dass die meisten Menschen, selbst die wissenschaftlich Interessierten, nicht so neugierig darauf sind wie auf das Konkrete, also auf die populärsten Dinge: schwarze Löcher, Raum-Zeit-Krümmung, Zeitreisen. Populäre Science-Fiction-Filme zeigen keine Wissenschaftler auf Konferenzen, sondern Astronauten, die mit einem veränderten Ablauf der Zeit zu kämpfen haben.
Ich glaube nicht, dass es so schlimm steht, wie du sagst. Schließlich schlägst du ja nicht vor, dass die Popularisierung der Wissenschaft Filme imitieren sollte. Bei ihnen geht es um Kunst, wie bei Odyssee 2000, oder schlimmstenfalls um bloße Unterhaltung, wie zum Beispiel bei „Gravity“, mit einer Art Käfig in der Schwerelosigkeit, mit einer Frau in der Hauptrolle. Bei der Popularisierung geht es darum, der Öffentlichkeit die Wissenschaft näher zu bringen. Und das ist nicht dasselbe. Natürlich wäre es keine gute Popularisierung, einen Vortrag darüber zu halten, wie Physiker denken. Aber schon, wenn man am Beispiel eines schwarzen Lochs oder der Expansion des Universums darüber spricht, ist das in Ordnung. Außerdem ist es sehr wichtig.
Warum sollten wir uns für den Denkprozess interessieren und nicht nur für das Ergebnis dieses Prozesses?
Denn darin liegt ein gewisser grundlegender Wert. Das Unglück ist, dass die Öffentlichkeit nicht weiß, was wissenschaftliches Denken ist; dass sie nicht weiß, warum ein seriöser Wissenschaftler, wenn ihm eine Frage gestellt wird, selten eindeutig antwortet, sondern eher mit: „Unter bestimmten Bedingungen...“.
Die Menschen wollen Gewissheit, keine Verwässerung.
Das ist keine Verwässerung, sondern eben Präzision und Ehrlichkeit. In der Wissenschaft muss alles getestet werden, und wenn neue Erkenntnisse auftauchen, müssen alte Behauptungen überprüft werden. Meiner Meinung nach ist es sogar das wichtigste Ziel der Popularisierung, der breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen, worum es beim wissenschaftlichen Denken geht.
Das heißt, Popularisierung soll die Geschichte erzählen, wie wahre Wissenschaft gemacht wird.
Entschuldige, aber ich mag den Begriff „wahre Wissenschaft“ nicht. Entweder ist es Wissenschaft, oder es ist keine. Es gibt keine „unwahre“ Wissenschaft.
OK, die Popularisierung soll also in deinem Verständnis die Öffentlichkeit mit dem Wissen ausstatten, wie Wissenschaft funktioniert, und sie dadurch immun gegen alle Arten von Manipulation machen.
Ja, das wäre die ideale Situation. Obwohl ich weiß, dass es den meisten Menschen leider egal ist. Es ist viel bequemer, an Horoskope oder Numerologie zu glauben.
Jetzt bist du derjenige, der es sich zu bequem macht. Wir sprechen nicht über Einzelpersonen, die an solche Dinge glauben, sondern über das Publikum von populärwissenschaftlichen Inhalten. Selbst wenn es eine Überschneidung zwischen diesen Personengruppen gibt, ist sie eher gering. Es geht darum, ehrlich zu sein und gleichzeitig dieses wertvolle Publikum nicht zu langweilen.
Deshalb müssen die beliebtesten Themen: Schwarze Löcher, Urknall und so weiter, als Vorwand herhalten. Indem wir ehrlich erklären, was ein schwarzes Loch ist, versuchen wir durchzuschmuggeln, worum es beim wissenschaftlichen Denken überhaupt geht.
Vielleicht wird sich das, was ich sage, ernst anhören, aber ich glaube, dass Popularisierung erziehen soll.
Also doch ein professoraler Ansatz.
Seit wann ist „Professor“ in deinem Mund eine Beleidigung? Es ist nichts Falsches daran, ein Professor zu sein. Selbst viele Leute, die diesen Titel nicht tragen, schreiben ihn sich zu, um ihre Aussagen seriöser klingen zu lassen.
Keine Beleidigung. Professoral, d.h. von oben herab. Da du ja die Öffentlichkeit erziehen willst.
Aber woher denn! Ich behandle weder die Öffentlichkeit noch die Studenten von oben herab. Ich versuche, Wissen zu vermitteln. Nur weil ich über ein Thema mehr weiß, bin ich nicht besser. Statistisch gesehen gibt es unter den Professoren genauso viele Dummköpfe wie unter den Studenten.
So hat sich das Wort angehört: „erziehen“.
Daran ist nichts Schlechtes. Ich verstehe, dass die Schule heutzutage nicht mehr erziehen oder lehren soll, sondern die Selbstverwirklichung der Schüler fördern soll, was auch immer das bedeutet. Und gleichzeitig nimmt aber die Häufigkeit von Masern durch den Rückgang der Impfungen zu – was wiederum auf ein falsches Verständnis der Eltern dieser Schüler davon zurückzuführen ist, was Wissenschaft ist. Die Tatsache, dass sich diese Situation ausweitet, ist genau auf einen Mangel an Erziehung zurückzuführen. Dies ist ein drastisches Beispiel.
Glücklicherweise ist es nicht schlimm, wenn jemand fantastische Ideen über ein schwarzes Loch hat. Aber wie dem auch sei, ich werde nicht erziehen, sondern mein Wissen auf eine Weise weitergeben, die zugänglich ist und die es gleichzeitig ermöglicht zu verstehen, wie ich zu diesem Wissen gekommen bin und worauf es beruht.
Bei der Popularisierung werden mathematische Formeln gemieden wie das Feuer. Ist es möglich, über Physik nur mit Worten zu sprechen? Ohne Mathematik?
Natürlich geht das. Es gibt nur eine Bedingung: die Anstrengung beider Seiten. Wenn ich im Rahmen der Popularisierung schreibe oder Vorträge halte, unternehme ich auch eine gewisse Anstrengung, eben um die Essenz des physikalischen Prozesses in Worten und Bildern zu vermitteln, ohne dabei Abkürzungen zu nehmen. Diese Anstrengung ist auch bei den Zuhörern erforderlich. In Zeiten der hastigen Kommunikation ist das schwierig. Viele Menschen wollen nicht erst kauen müssen, sie wollen sofort einen fertigen Brei erhalten. Aber das ist nicht möglich. Aber ich weiß, wir leben im Zeitalter von Twitter… obwohl ich es selbst nicht benutze.
Einmal sagte eine der Lektorinnen eines kleinen populärwissenschaftlichen Buches, das ich geschrieben hatte, dass es kein guter Text sei, weil sie einige Passagen zweimal lesen musste. Ich antwortete ihr, dass wir wohl nicht die gleiche Vorstellung davon haben, was Popularisierung ist. Es geht nicht ohne Anstrengung; um zu verstehen, muss man sich konzentrieren und denken. Das Buch wurde nie veröffentlicht.
Glaubst du, dass es derzeit eine Krise des Vertrauens in die Wissenschaft gibt? Oder gab es nie ein weit verbreitetes Vertrauen?
Darüber müsste man mit Historikern und Soziologen sprechen. Aber wenn du nach meinem Gefühl fragst, denke ich, dass es nie ein allgemeines Vertrauen in die Wissenschaft gegeben hat. Heute hingegen hängt unsere Zivilisation, unser Alltag, wie nie zuvor in der Geschichte, sehr stark von der Wissenschaft ab. Es kommt also darauf an, ob die Gesellschaft ihre Prinzipien versteht und ihnen vertraut.
Meine persönliche Erfahrung deutet nicht auf eine Krise hin – wenn jemand erfährt, dass ich Physiker bin und über schwarze Löcher arbeite, ist er in der Regel sehr begeistert. Es ist sogar ein bisschen peinlich.
Und warum das?
Denn wenn ich zum Beispiel zu Abend esse und einen guten Wein trinke, muss ich aufhören und einen Vortrag halten. Wenn mich also jemand nicht kennt, sage ich manchmal, dass ich Buchhalter bin.
Andererseits lese ich in der Öffentlichkeit gerade über den Anstieg der Masernfälle, über Anti-Impf-Demonstrationen.... Es gibt also wahrscheinlich eine Vertrauenskrise.
Leider werden viele Skandale von unehrlichen Wissenschaftlern verursacht. In meinem Fachgebiet ist das zwar eher selten, aber in den Biowissenschaften zum Beispiel ist es häufiger der Fall. Das bringt die Wissenschaft in Verruf. Hinzu kommt, dass einige Wissenschaftler, einige von ihnen sehr bekannt und zugleich sehr groß, Aussagen zu Themen machen, von denen sie keine Kenntnis haben. Nur weil jemand einen Nobelpreis in Physik gewonnen hat, heißt das nicht, dass er kompetente Aussagen über künstliche Intelligenz oder andere Dinge machen kann. Leider gibt es Menschen, die ihren Ruhm und ihre Titel nutzen, um sich zu jedem Thema zu äußern. Sie lenken die Aufmerksamkeit auf sich selbst und reden völligen Unsinn.
Man kann einem Nobelpreisträger wohl kaum vorwerfen, Unsinn zu reden.
Und das ist das ganze Problem. Schlimmer noch – einige von ihnen denken wirklich, dass sie, wenn sie berühmt und auf einem Gebiet groß sind, alles wissen. Ich kann das ein wenig nachvollziehen, denn obwohl ich weder großartig noch berühmt bin, habe ich manchmal dazu geneigt, in der Öffentlichkeit über Dinge zu sprechen, von denen ich nicht viel wusste. Nicht umsonst ist Stolz eine Hauptsünde. Jetzt tue ich das nicht mehr.
Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass das Vertrauen in die Wissenschaft im Allgemeinen eher zunimmt als abnimmt. Trotz allem.
Diese Kategorie des Vertrauens ist problematisch. Heutzutage ist es unmöglich, die Wissenschaft in ihrer Gesamtheit zu begreifen. Deshalb wird Leuten wie mir – einer populären Wissenschaftsjournalistin – vorgeworfen, nicht zu wissen, sondern den Wissenschaftlern zu „glauben“. In gewisser Weise ist das zutreffend. Ich kann nicht jedes Gebiet kennen, ich muss den Spezialisten vertrauen. Ich reagiere dann auch so darauf: Ich habe gelernt, was die typischen Signale sind, die darauf hindeuten, dass die Behauptung einer Person verdächtig ist. Das ermöglicht es, den Unsinn herauszufiltern und ist, so denke ich, für eine Vielzahl von Menschen handhabbar.
Das ist genau das, was ich mit Erziehung meine. Es gibt natürlich auch diejenigen, die glauben, dass wir es mit einer Verschwörung der Wissenschaftler zu tun haben. Man kann natürlich davon überzeugt sein, dass die allgemeine Relativitätstheorie eine Art Erfindung ist, was sogar verständlich ist, denn es handelt sich um eine Theorie, die schwer zu begreifen ist. Aber um sich vor solchem Denken zu schützen, genügt es zu wissen, dass es sich um eine Theorie handelt, die hervorragend bestätigt worden ist. Das sehen wir zum Beispiel an der Präzision des GPS, das wir jeden Tag benutzen. Auch die Quantenmechanik, die viel schwieriger zu begreifen ist als die Relativitätstheorie, begleitet uns jeden Tag. Unsere Zivilisation basiert auf dem Betrieb der Atomuhr, die das Maß für Zeit und Länge definiert und ein reines Quantengerät ist.
Die Menschen sind sich oft dessen nicht gewahr, dass selbst die scheinbar abstraktesten Theorien überprüft werden können und dass sie auch im Alltag funktionieren. Es kann also keine Rede von „Glauben“ sein, wenn wir konkrete Anwendungen sehen. Du glaubst nicht an die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik? Warum hast du dann keine Angst, in ein Flugzeug zu steigen?
OK, erzähl mir mehr: Wie stellst du dir die Physik in fünfzig Jahren vor?
Ich habe keine Ahnung.
Komm schon, es gibt doch einige wachsende Gebiete. Du hast ja selbst gesagt, dass es die Teilchenphysik ist, die in der Krise steckt, während es anderen Zweigen gut geht.
Ja, aber du weißt ja, wie das mit Vorhersagen ist. Da du jedoch darauf drängst: Ich sehe ein großes Potenzial in der Quantenoptik. Ich glaube auch, dass in einigen Jahrzehnten Quantencomputer im Einsatz sein werden. Obwohl ich kürzlich einen gelehrten Artikel darüber gelesen habe, dass dies doch nicht möglich sein wird. Aber ich erinnere mich an einen ebenso gelehrten Artikel von vor Jahren, in dem es darum ging, dass die Herstellung von Spiegeln mit den für den Nachweis von Gravitationswellen erforderlichen Eigenschaften aus fundamentalen Gründen unmöglich ist – und heute wurden damit bereits Dutzende von Quellen nachgewiesen. Ich bin sehr optimistisch, was Festkörperphysik, Hydrodynamik und Magnetohydrodynamik angeht. Ich habe viel Hoffnung – denn hier stecken wir ein wenig fest – was die Erzeugung von Energie aus Fusionsquellen angeht. Die Physik hat sicherlich eine wunderbare Zukunft vor sich. wenn auch wahrscheinlich nicht so sehr wie die Biowissenschaften. Die Genetik steckt noch in den Kinderschuhen.
Denkst du, dass sich unser Verständnis der Welt so sehr verändern kann wie nach der Revolution des frühen 20. Jahrhunderts, seit der Zeit der Quantenmechanik?
Ich kann eine solche Änderung im Denken nicht ausschließen, aber ich weiß nicht, wann eine solche Änderung eintreten wird. Mit solchen Veränderungen ist es wie mit der Spanischen Inquisition in Monty Python-Sketchen: Niemand erwartet sie. Ich weiß nicht, vielleicht wird es in zweihundert Jahren passieren, wie der sechsundneunzigjährige Freeman Dyson15 zu sagen pflegte. Ich denke, es wird immer noch eine mathematische Wissenschaft sein, die von Menschen betrieben wird, nicht von künstlichen Intelligenzen. Und es wird immer noch eine experimentelle Wissenschaft sein. Sonst wird sie keine Wissenschaft sein.
15 Freeman Dyson verstarb am 28. Februar 2020.
Zweites Gespräch
Inhaltsverzeichnis
Existieren Atome überhaupt?
Oder der Kampf um die Erforschung des Unsichtbaren
Hast du jemals ein Atom gesehen?
Ja. Natürlich nicht mit meinen eigenen Augen, aber ich habe Bilder gesehen, die mit verschiedenen Geräten aufgenommen wurden, auf denen man Atome sehen kann, manchmal sogar nur ein einzelnes Atom. Jetzt ist es ganz einfach, ein solches Bild zu erhalten.
Wem ist dieses Kunststück zuerst gelungen?
Atome wurden erstmals 1912 mit Hilfe von Röntgenstrahlen gesehen. Dies geschah durch den Deutschen Max von Laue und seine Mitarbeiter. Hier siehst du, was sie sahen, als sie Röntgenstrahlen mit einem Kristall aus Zinkblende streuten:
Abbildung 2. Röntgenfilm, der Atome in einem Kristall zeigt (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laue-Cubic-Disoriented.PNG)
Es sieht nicht wirklich beeindruckend aus. Was sehe ich mir da eigentlich an?
Das ist wahr, aber es hat Max Planck und Albert Einstein begeistert. Denn das Bild zeigt zwei Dinge auf einmal. Erstens beweist es, dass Kristalle aus einem Gitter aus Atomen bestehen, und zweitens, dass Röntgenstrahlen Wellen sind.
Und wo ist das zu sehen?
Das Bild – das wurde schnell, wenn auch nicht sofort, verstanden – entsteht durch die Beugung (Diffraktion) elektromagnetischer Wellen an den Atomen des Kristalls. Die Punkte auf diesem Bild sind tatsächlich Atome.*
* Oder genauer, ihre Spuren. Noch direkter kann man die Atome in einem Feldionenmikroskop betrachten; siehe z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Feldionenmikroskop#/media/Datei:FIM-ImageW_11kV.jpg
OK, aber Atome werden erst seit kurzer Zeit beobachtet. Immerhin wurde ihre Existenz lange Zeit angezweifelt. Ich kann mir vorstellen, dass das Argument des Heiligen Thomas mehr als einmal vorgebracht wurde. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe.
Der heilige Thomas hatte anfangs einen höheren Anspruch: Er wollte nicht nur sehen, sondern auch berühren. Später, als es darauf ankam, begnügte er sich mit dem Sehen, hörte aber: „Selig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben.“ Nur geht es in der Wissenschaft nicht um den Glauben. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Wissenschaft eine Unternehmung ist, die auf Erfahrung beruht; ihre Behauptungen werden durch Experimente geprüft.
Klar. Aber es gibt so etwas wie Überzeugungen. Dass eine bestimmte Idee, die Natur zu erklären, besser oder schlechter ist. Atome sind eine uralte Idee1, so dass es keine technische Möglichkeit gab, zu überprüfen, ob sie richtig ist. Sowohl damals als auch in den kommenden Jahrhunderten. Die Idee der Existenz eines Grundbausteins war interessant und inspirierend, aber gleichzeitig wurde sie stark angezweifelt, nicht wahr?
1 Im antiken Griechenland wurde der Atomismus in der Mitte des fünften Jahrhunderts v. Chr. von Leukippos eingeführt und wurde von seinem Schüler Demokrit weiterentwickelt.
Ja, das ist wahr, wobei wir nicht den Fehler machen sollten, den Gelehrten der Vergangenheit unsere heutige Einstellung zur Wissenschaft zuzuschreiben. Es wird oft vergessen, dass die Physik als experimentelle Wissenschaft, wie wir sie heute kennen – d.h. ein Gebiet, das präzisen, quantitativen Tests unterzogen wird – erst in der zweiten Hälfte des 19. Jh. entstanden ist. Davor begnügte man sich mit qualitativen Tests. Die Gründe dafür waren nicht philosophischer, sondern praktischer Natur: Es gab einfach keine Messinstrumente oder Versuchsanlagen, die dies ermöglicht hätten.
Selbst in der Astronomie wurde die erste präzise Messung 1729 von James Bradley vorgenommen, der den Winkel zwischen der Position eines Sterns und der lokalen vertikalen Richtung auf sechs Dezimalstellen genau maß. Dabei entdeckte er die Aberration des Lichts, d.h. die scheinbare Veränderung der Position eines Sterns, die durch die jährliche Bewegung des Sterns um die Sonne verursacht wird.2 Laut Freeman Dyson begründete Bradley mit dieser Messung die moderne Wissenschaft; es dauerte weitere zweihundert Jahre, bis eine ähnliche Präzision in der Experimentalphysik erreicht wurde. Es überrascht nicht, dass man lange Zeit nicht einmal daran dachte, die Existenz von Atomen zu testen.
2 Dies war der erste direkte Beweis für die Bewegung der Erde um die Sonne: 186 Jahre nach der Veröffentlichung von De Revolutionibus [Kopernikus; RJ], 120 Jahre nach den Beobachtungen der Jupitermonde durch Galileis Teleskop und 2 Jahre nach Newtons Tod.
Die Gelehrten der Vergangenheit mussten also akzeptieren, dass sie über Dinge entschieden, die sie mit ihren eigenen Augen nie sehen würden?
Ja. Einige störte das nicht, während es bei anderen eine unerhörte Empörung auslöste, die heute nur schwer zu begreifen ist.
Dies ist eine interessante Geschichte aus der Sicht der Entstehung von Wissenschaft und Denkweisen. Aber war die Idee der Existenz von Atomen nicht letztlich doch eine philosophische Frage? Bestandteil der Antwort auf die Frage, ob die Materie kontinuierlich ist oder ob sie Grundbausteine haben muss? Andererseits ist es wahrscheinlich typisch für Physiker, nach etwas Fundamentalem zu suchen?
Du hast zwei Fragen gestellt und eine davon teilweise beantwortet, aber ich werde beide beantworten. Die Frage nach der Existenz von Atomen war bis zum 19. Jahrhundert eine philosophische Frage, denn es gab nicht nur keinen Gedanken an eine experimentelle Methode, um ihre Existenz zu überprüfen, sondern auch keine physikalischen Theorien, die sich auf ihre Existenz beriefen. Die Frage war zudem nicht nur eine philosophische, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt auch eine theologische. Und das konnte für Gesundheit und Leben bereits gefährlich sein.
Ha, so war das früher, als die Wissenschaft in Gebiete vordrang, die von der Religion besetzt waren. Aber warum genau sollte gerade die Frage der Atome Eifersucht in der Kirche hervorrufen?
Es ging um die Interpretation der Transsubstantiation. Was geschieht physikalisch, wenn, wie das Konzil von Trient es ausdrückte, „durch die Konsekration von Brot und Wein die Verwandlung der ganzen Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi, unseres Herrn, und der ganzen Substanz des Weines in die Substanz seines Blutes stattfindet.“3 Wenn die Verwandlung stattgefunden hat, wie erklären wir dann, dass das Brot immer noch wie Brot schmeckt? Und der Wein wie Wein?
3 Diese Formel gilt auch im zeitgenössischen Katechismus der katholischen Kirche (KKK 1376).
Gute Frage.





























