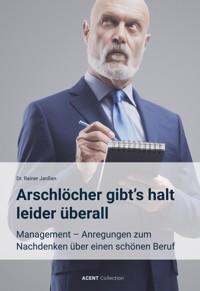
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Manager sind inkompetente, machtversessene und geldgeile Egomanen. Als Nieten in Nadelstreifen versenken sie fröhlich eine Unternehmenstitanic nach der anderen, als Heuschrecken und Globalisierungsstrategen vernichten sie absichtlich – und aus reiner Profitgier – wertvolle Unternehmen und treiben deren Mitarbeiter in den Abgrund. Als bonusversessene Zocker verursachen sie die Finanzkrise und den Absturz ganzer Volkswirtschaften, und Mitarbeiter sind für sie nur Rohstoff. Sie mögen von Unternehmenswerten, den Shareholdern, Stakeholdern und sozialer Verantwortung faseln, aber was zählt ist: Ich, ich, ich – mein Dienstwagen, mein Büro und mein Spesenkonto. Es gibt wohl wenige Berufe, die in deutschen Medien und der breiteren öffentlichen Diskussion ausschließlich und flächendeckend mit negativen Eigenschaften belegt sind wie der des Managers. Wenn im Tatort ein Manager auftaucht, ist er meist entweder der Mörder oder das – verdiente – Opfer. Warum ruiniert das moralische Fehlverhalten einzelner Manager eigentlich den Ruf eines ganzen Berufsstandes? Reicht "Management by Kennzahlen" oder zählt der Mensch? Sind variable Vergütungssysteme und Bonifikationen bei Zielerreichung der Stein des Weisen? Multi-Kulti und Diversität, Teamwork und Individualisten, der Hype der Innovation, Hierarchien sind von gestern, es lebe die Hierarchie bis hin zu dem Wertesystem des ehrbaren Kaufmanns - Stationen einer Reise durch die Welt des Managers. Fragen über Fragen und Buchläden mit Regalen voller Antworten. Und jetzt noch ein Versuch, alle Fragen zu beantworten? Nein, Rainer Janßen hat nicht den Anspruch, die abschließende Antwort (die ja bekanntlich 42 lautet) zu besitzen. Nach erfolgreichen Jahrzehnten als CIO eines großen Rückversicherers lässt er uns in seiner launigen wie treffsicheren Sprache in seinen Aufsätzen an den Irrungen und Wirrungen der Management-Laufbahn teilhaben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arschlöcher gibt’s halt leider überall
Management — Anregungen zum Nachdenken über einen schönen Beruf
von
Dr. Rainer Janßen
Danksagung
Ohne Axel Stockmann gäbe es dies Buch nicht. Wir haben immer wieder über diese Themen diskutiert und bei jedem Treffen nach meiner Pensionierung hat er hartnäckig nachgefragt, ob ich daran arbeite. Axel, sicher ist es nicht das Buch, das du dir gewünscht hast, aber ein richtiges Lehrbuch liegt mir nicht.
Ich danke Robby Wirth und Olaf Röper für die Unterstützung seitens der ACENT AG und die Motivation, sowie Claus-Peter Gutt für kritische Kommentierung und Korrektur. Carola Jacobs hat ebenfalls sehr zur Verbesserung des Textes beigetragen und ganz wesentlich die technische Aufbereitung und Gestaltung für den ACENT-Blog, aber auch für dieses Buch übernommen.
Und nicht zuletzt danke ich meiner Frau Beate, die geduldet hat, dass ich mich wieder in mein Arbeitszimmer verziehe, um darüber nachzudenken, wie man Mitarbeitern zuhört und sie richtig lobt, statt meiner Frau zuzuhören und sie richtig zu loben für all das, was sie für mich und unsere Kinder getan hat und immer noch tut.
Impressum
Arschlöcher gibt’s halt leider überall
Management – Anregungen zum Nachdenken über einen schönen Beruf
© 2023 by Dr. Rainer Janßen
Texte: © 2023 Copyright by Dr. Rainer Janßen
Umschlag: © 2023 Copyright by ACENT AG
Verantwortlich für den Inhalt:
Rainer Janßen / ACENT AG
Friedrichstr. 171
10117 Berlin
Über den Autor
Dr. Rainer Janßen studierte Mathematik und Informatik in Kiel und Kaiserslautern.
Ab 1984 arbeitete er im IBM Science Center in Heidelberg, wo er die Forschungsgebiete Wissenschaftliches Rechnen und Supercomputing aufbaute, im Jahre 1993 arbeitete er als Direktor des IBM European Networking Center in Heidelberg, wo er sich auf die Forschung und Entwicklung sowie auf Pilotprojekte mit Kunden rund um die Datenautobahn fokussierte.
Ab 1997 wechselte er zur Munich Re, wo er den Zentralbereich Informatik leitete und als Group Information Executive verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung der globalen Informationsstrategie war. Zuletzt leitete er dort die gesamte globale IT-Organisation der Rückversicherungsgruppe, die zum damaligen Zeitpunkt weltweit etwa 2000 Mitarbeiter (intern und extern) umfasste.
Von 2004 bis 2009 war Dr. Janßen Mitglied des Aufsichtsrats der Munich Re als Vertreter der Mitarbeiter; von 2004 bis 2010 agierte er als Mitglied des Boards von ACORD, einer Non-Profit-Organisation für die Entwicklung und Verbreitung von Datenstandards für die weltweite Versicherungsindustrie.
Er wurde in dem Wettbewerb von Computerwoche und CIO Magazin zum „CIO des Jahres 2008“ und „CIO der Dekade 2001-2011“ gewählt, und gewann den „Global Exchange Award 2014“. Im gleichen Jahr wurde er zudem Zweiter im Wettbewerb „CIO des Jahres“, und wurde von der Computerwoche zum Mitglied der deutschen „IT Hall of Fame“ nominiert.
Papa, was machst du eigentlich auf der Arbeit
Einleitung
1. Um wen geht es hier eigentlich?
2. Management – die mechanistische Sicht
3. If you can‘t measure it, you can‘t manage it
4. Es geht um Menschen
5. Menschen sind, wie sie sind
6. Mogeln? Machen wir doch alle!
7. Die Härte weicher Faktoren
8. Reden ist Gold. Zuhören auch!
9. Verschiedenheit oder Diversity?
10. Multi-Kulti
11. Der Mythos Team
12. Vergiss die Stillen nicht
13. Der problematische Bonus
14. Loben, aber richtig
15. Die Kunst, rechtzeitig weh zu tun
16. Change-Management
17. Die Mechanismen kollektiver Verdrängung
18. Vertrauen – ein scheues Wesen
19. Vom Leben auf der Exponentialkurve
20. Vom Umgang mit Hype
21. Das Problem mit der Innovation
22. Zeit für Strategie
23. Fehler sind O.K., Wiederholungen nicht!
24. Unternehmensarchitektur statt Prozessoptimierung
25. Nicht denken lassen, sondern selber denken!
26. Nicht reden, sondern machen!
27. Entscheidungen
28. Die Kunst, Recht zu behalten
29. Die Logik der Unvernunft
30. Machiavelli, Macht und Feinde
31. Win/Win oder No Business
32. Vom Ende der Alleskönner
33. Vom ehrbaren Kaufmann
34. Und was ist mit Leadership gewesen?
35. Weise Ratschläge
Literaturliste
Papa, was machst du eigentlich auf der Arbeit
Ja, was machen Mama oder Papa denn, wenn sie von morgens bis in den Abend und häufig auch am Wochenende ins Büro fahren? Dachdecker, Maler, Mechatroniker, sie alle können das leicht beantworten. Aber was antwortet die Managerin, der Manager? Und wenn man das schon seinen Kindern nicht erklären kann, kann man das zumindest den Mitarbeitern verständlich machen.
Teile der Antwort liefert Rainer Janßen in seinen Beiträgen zum „Management“, die wir über viele Wochen auf www.acent.de veröffentlicht haben.
Dabei geht es nicht nur um die Antworten auf kindliche Neugier, sondern natürlich auch um substanzielle Fragen.
Warum ruiniert das moralische Fehlverhalten einzelner Manager eigentlich den Ruf eines ganzen Berufsstandes? Reicht „Management by Kennzahlen“ oder zählt der Mensch? Sind variable Vergütungssysteme und Bonifikationen bei Zielerreichung der Stein des Weisen? Multi-Kulti und Diversität, Teamwork und Individualisten, der Hype der Innovation, Hierarchien sind von gestern, es lebe die Hierarchie bis hin zu dem Wertesystem des ehrbaren Kaufmanns - Stationen einer Reise durch die Welt des Managers.
Fragen über Fragen und Buchläden mit Regalen voller Antworten. Und jetzt noch ein Versuch, alle Fragen zu beantworten?
Nein, Rainer Janßen hat nicht den Anspruch, die abschließende Antwort (die ja bekanntlich 42 lautet) zu besitzen. Nach erfolgreichen Jahrzehnten als CIO eines großen Rückversicherers lässt er uns in seiner launigen wie treffsicheren Sprache in seinen Aufsätzen an den Irrungen und Wirrungen der Management-Laufbahn teilhaben.
Viel Vergnügen dabei wünscht Ihnen
Robby Wirth Vorstand der ACENT AG
Einleitung
Manager sind inkompetente, machtversessene und geldgeile Egomanen. Als Nieten in Nadelstreifen versenken sie fröhlich eine Unternehmenstitanic nach der anderen, als Heuschrecken und Globalisierungsstrategen vernichten sie absichtlich – und aus reiner Profitgier – wertvolle Unternehmen und treiben deren Mitarbeiter in den Abgrund. Als bonusversessene Zocker verursachen sie die Finanzkrise und den Absturz ganzer Volkswirtschaften, und Mitarbeiter sind für sie nur Rohstoff (Human Resources). Sie mögen von Unternehmenswerten, den Shareholdern, Stakeholdern und sozialer Verantwortung faseln, aber was zählt ist: Ich, ich, ich – mein Dienstwagen, mein Büro und mein Spesenkonto.
Es gibt wohl wenige Berufe, die in deutschen Medien und der breiteren öffentlichen Diskussion ausschließlich und flächendeckend mit negativen Eigenschaften belegt sind wie der des Managers. Wenn im Tatort ein Manager auftaucht, ist er meist entweder der Mörder oder das – verdiente – Opfer. Bei Rosamunde Pilcher will der gefühlskalte Manager aus finanziellen Gründen die Schöne betören und dem edlen, verarmten Edelmann entwenden; und in Comedys dienen Manager meist nur als Lieferanten menschenverachtender Witze und Sketche, die man sich sonst nicht zu erzählen traute. Nur ab und an darf ein Recke von altem Schrot und Korn – meist gespielt von Mario Adorf oder Götz George (Gott hab ihn selig) – noch aus der Rente zurückkehren, um die missratene Brut der Jungmanager in die Flucht zu schlagen.
Wenn über Management und Manager geschrieben wird, dann meistens von Menschen, die keine Manager sind. Journalisten, Schriftstellern, Drehbuchautoren und ähnlichen Autoren nehme ich das nicht übel. Ich erwarte ja von einem Krimiautor auch nicht, dass er mindestens zehn Leute ermordet hat, bevor er seinen ersten Krimi schreibt.
Aber bei den angeblichen Fachbuchautoren ist es vielleicht doch ein wenig anders. Wer dem praktisch Handelnden erklären will, wie er seine Aufgabe durchzuführen hat, sollte diese doch auch einmal selbst erledigt haben. Ein Fußballtrainer muss nicht unbedingt Weltmeister geworden sein, aber es hilft doch, wenn er den Sport einmal selbst ernsthaft betrieben hat.
Bücher über Management werden aber meistens von Professoren oder Beratern geschrieben, die selbst nie signifikante Managementaufgaben ausgefüllt haben. Die wenigen Bücher über das Thema, die von ehemaligen Managern geschrieben wurden, stammen von den großen Helden der Wirtschaft wie Welch, Gerstner oder Jobs. Sie haben aber – wie viele CEOs und Vorstände – nach eigenem Verständnis den Status „Manager“ schon längst hinter sich gelassen. Manager und Management sind für sie eher die Lehmschicht, die ihre neuartigen Ansätze verzögert oder gar verhindert haben. Deren Bücher dienen also mehr der Legendenbildung. Und vergleicht man den Inhalt altersweiser Vorträge dieser Herren mit ihrem realen Verhalten, kann einem oft nur schlecht werden.
Dieses Buch ist dagegen vollständig aus der Sicht eines Handelnden geschrieben. Ich war mehr als dreißig Jahre Manager. Ich habe meinen Beruf überwiegend gerne ausgeübt, und vor allem sah ich meine Aufgabe nicht nur als Job, der gut bezahlt wird, sondern als Beruf, als Profession, als etwas, das man mehr oder minder gut kann, was einem Identität gibt. Ein Schreiner will gute Möbel machen, die gut aussehen, im praktischen Leben funktionieren und handwerklich in der Auswahl und Verarbeitung des Materials überzeugen. Ein Musiker will nicht nur die Noten sauber vom Notenblatt abspielen, sondern durch seine Auswahl und Interpretation die Herzen der Zuhörer anrühren. Was will ein Manager? Was ist eigentlich mein Beruf?
Man muss leider feststellen, dass Manager selbst darüber selten nachdenken. Oder gar darüber schreiben. Man liest die Bücher der Gurus in der Hoffnung auf ein Patentrezept, das einem zu Ruhm und Reichtum verhelfen möge. Aber selten setzt man sich ernsthaft mit dem eigenen Beruf auseinander, versucht ihn zu beschreiben und zu unterscheiden und so letztlich seine Schönheit und seinen Wert darzustellen.
Ich kann dem Leser dieses Buches leider nicht die Antwort auf die Frage aller Fragen versprechen. Auch keine allgemeingültigen und endgültigen Weisheiten, Methoden oder auch nur Definitionen. Management arbeitet mit Menschen und für Menschen und ist allein deshalb immer von diesen Menschen, ihrer Person, dem Kontext und den Gegenständen der gemeinsamen Arbeit abhängig. Es gibt sehr viele Bücher, in denen immer wieder neue Patentrezepte verkündet werden, wie man die richtige Unternehmensstrategie findet, wie man den geschäftlichen Nutzen von Projekten misst, wie man durch Implementierung mechanistischer Methoden die Welt rettet. Viele dieser Arbeiten verwenden dabei immer wieder einen falschen methodischen Ansatz: Wenn man bei aktuell erfolgreichen Unternehmen nach übereinstimmenden Verhaltensmerkmalen sucht, fehlen einem in der Stichprobe die vielen Unternehmen, die Gleiches getan haben, aber mittlerweile pleite sind. Das ist ein bisschen so, wie eine Umfrage unter Lottogewinnern nach der besten Kapitalinvestition zu machen: Da kommt raus, dass jeder mehr Lotto spielen sollte! Auch ist der prognostische Wert all dieser Untersuchungen denkbar gering: Von den Firmen, die etwa der berühmte Tom Peters in seinem Buch „In Search of Excellence“ anpries, waren nach einigen Jahren nur ein Drittel noch wirklich „excellent“. Dabei sind die Konzepte und Werkzeuge oft nicht wirklich schlecht. Es lohnt sich, sich mit ihnen zu befassen. Aber man sollte sich immer an den alten Spruch erinnern: „Wenn du einem Kind einen Hammer gibst, sieht hinfort alles wie ein Nagel aus.“
Wer den Heiligen Gral – den Stein der Weisen des Managements – sucht, sollte hier aufhören zu lesen und andere Lektüre suchen. Dieses Buch ist von der Überzeugung getragen, dass die Sozialpsychologie und die Philosophie viel hilfreichere Instrumente liefern, über die Probleme eines Managers nachzudenken, als BWL- oder MBA-Kurse. Und dass Thesen, nur weil sie von vielen zitiert und wiederholt werden, trotzdem nicht richtig sein müssen.
Vielleicht kann man ja mal etwas anders über Management reden als nur in Business Cases und BWL-Jargon. Ich bin überzeugt, dass es einen Kern unseres Tuns gibt, der es wert ist, getan zu werden, und der es auch verdient, dass man sich als Ausübender dieses Berufes mit ihm beschäftigt – und so letztlich vielleicht auch irgendwann diesem Beruf zu einem professionellen Selbstverständnis verhilft, das dann auch die öffentliche Wahrnehmung unseres Standes verändern kann.
Zum Schluss erlauben Sie mir noch eine persönliche Anmerkung. Vielleicht haben Sie sich nämlich schon gefragt, was Ihnen denn der alte weiße Mann über Führung erzählen will: Die neuen Generationen X, Y, Z sind doch so ganz anders als alles vorher, wollen anders arbeiten, mehr Work-Life-Balance haben, dank neuer Technologien weniger ortsgebunden sein etc. Das einzig Überraschende an diesen Aussagen ist, dass es so seit etwa 20 Jahren immer häufiger Aussagen von Älteren gibt, dass es die nächste Generation „besser kann mit der Führung“. Bis dahin gab es über Jahrtausende – von den alten Kulturen in Mesopotamien und Ägypten, über Aristoteles und Kant zu den moderneren Autoren – drastische Kommentare über die Unfähigkeit und Faulheit der nächsten Generation. Beides hat nie gestimmt. Natürlich haben sich gesetzliche Rahmenbedingungen geändert, sowie Werkzeuge zur Kommunikation etc., aber die Grundprobleme der Zusammenarbeit bleiben gleich. Auch die Führungstypen sind sehr ähnlich. Als ich begann, sagte man über die strikten Hierarchen, dass diese nur ein biologisches Problem seien, welches sich mit der nächsten Generation herauswachsen würde. Das stimmte leider nicht. Auch in der nächsten Generation waren die rigiden Chef-Typen immer noch da. Sie nutzten vielleicht andere Mittel zur Kontrolle, aber ansonsten? Same procedure as every year. Und umIhnen gleich alle utopischen Hoffnungen auf die gänzlich bessere Welt in der Zukunft zu nehmen, lassen Sie es mich einmal drastisch ausdrücken: Der Anteil der Arschlöcher auf jeder Hierarchieebene von Organisationen scheint eine Naturkonstante zu sein und sich trotz aller Bemühungen der Personalabteilungen nicht zu verändern!
Grundsätzliche Aussagen zum Umgang mit Menschen überdauern die Zeit. Lesen Sie einmal den wirklichen Klassiker zu diesem Thema von Adolph Freiherr Knigge. Nicht das, was heutige Benimmbücher daraus gemacht haben, sondern wirklich das Original. Es ist immer noch erstaunlich frisch und lesenswert. Denn da geht es nicht darum, welche Gabel man für welchen Gang benutzt, sondern um den achtsamen und respektvollen Umgang mit den Mitmenschen. Und solche die Zeit überdauernden Fragen – so wenigstens meine Überzeugung – behandeln auch die Beiträge in diesem Buch.
1. Um wen geht es hier eigentlich?
Das Wort Manager ist ein recht inflationär verwendeter Begriff. Seine Wurzeln liegen wohl im Lateinischen: Manus (Hand) und agere (tun, treiben), und es bildete sich irgendwann das italienische Wort maneggiari für: das Pferd in der Manege (sic!) mit der Hand führen. Die ersten Manager tauchten deshalb wohl auch im Umfeld von Zirkus und Shows als Manager von Künstlern auf. Aus dem italienischen Wort entstand irgendwann das englische manage, dass ein „Handhaben“ von irgendetwas bezeichnet.
Gehandhabt wird am Ende irgendwie alles, deshalb gibt es mittlerweile unheimlich viele Manager oder Managementfunktionen. Da gibt es den „Facility Manager“ (früher Hausmeister) oder den „Client Manager“ (Kundenbetreuer), den „Task Manager“ auf ihrem PC, den „Project Manager“, den „Risk oder Compliance Manager“, den „Business Process Manager“, den „Manager Stakeholder Intelligence“, den „Service Manager“ und den „Product Manager“ und viele andere mehr. Manchmal stehen sie großen Organisationen vor, manchmal sind sie Einzelkämpfer, manchmal auch nur einfache Angestellte mit einem bombastischen Titel, der wohl trösten soll, dass das Gehalt nicht so bedeutend ist wie der Titel.
Wenn ich hier von einem Manager rede, meine ich die Führungskraft in einem meist eher größeren Wirtschaftsunternehmen oder anderen Organisationen, der eine Gruppe von Menschen als Teil der Aufbau- und Ablauforganisation direkt oder über weitere ihm untergeordnete Managerführt. Ich klammere dabei bewusst den Vorstand oder die oberste Führungsebene, vielleicht auch Eigentümer des Unternehmens, aus. Diese Menschen entwickeln oft ein anderes Verständnis von sich selbst und ihrer Aufgabe. Sie sind oft auch tatsächlich mehr in der „Außenpolitik“ tätig als in der Führung der eigenen Organisation. Management ist für sie eher die Problemschicht in der Hierarchie des Unternehmens, eben die Lehmschicht, die verhindert, dass ihre großartigen Ideen an die Basis gelangen. Bei mir sind Manager diejenigen Führungskräfte, die die Organisationen am Laufen halten, die also versuchen, die Willensbekundungen der Spitze in tägliches Tun zu übersetzen.
Dabei bin ich selbst von einem Umfeld geprägt worden, in dem es im Wesentlichen um wissensbasierte Dienstleistungen ging, weniger um die Produktion von Gütern. Der Gegenstand der zu erbringenden Leistung und der täglichen Arbeit ist in solchen Unternehmen oft weniger klar als in einem produzierenden Unternehmen, aber ich denke, dass viele meiner Überlegungen auch für Manager solcher Unternehmen hilfreich sein können. Außerdem sind viele Unternehmen, die am Ende reale Güter wie ein Auto produzieren, doch in weiten Teilen eher wissensbasierte Dienstleister als reine Blechbieger und Schrauber.
Es ist gar nicht so einfach und klar, was ein solcher Manager tut. Wenn Sie selbst Manager sind, sind Sie vielleicht einmal, wie ich, von Ihrem Kind aufgefordert worden, zu erklären, was Sie eigentlich so machen undwofür Sie Ihr Geld bekommen. Und dann wissen Sie, dass es gar nicht so einfach ist, diesen Beruf zu beschreiben. Ich habe es vor Jahren, als mein Jüngster diese Frage stellte, für eine gute Idee gehalten, einen typischen Arbeitstag zu schildern. Als ich dann einige Tage später von der Arbeit nach Hause kam, fragte mich mein Sohn: „Na, hast du wieder gut geschwallt?“ Bei ihm war nur hängen geblieben, dass ich anscheinend den ganzen Tag damit verbringe, in den unterschiedlichsten Formaten mit und zu unterschiedlichen Menschen zu reden, eben zu „schwallen“.
Natürlich ist das Gespräch mit Mitarbeitern oder Kollegen, der Vortrag vor Chefs oder Partnern, die Diskussion mit Projekten im Ringen um die richtigen Problemlösungen usw. usf. ein großer Teil der täglichen Arbeit, aber es ist auch nicht alles. Deshalb versuche ich in den folgenden Abschnitten jeweils einen mir wichtigen Aspekt der Tätigkeit eines Managers zu beschreiben. Es ist meine subjektive Sicht der Dinge und es geht mir nicht um die Erarbeitung einer großartigen wissenschaftlichen Theorie. Deshalb zitiere ich auch nicht die Literatur im Text, um eine Art Wissenschaftlichkeit vorzutäuschen, sondern gebe Ihnen zum Schluss eine Liste mit Literaturempfehlungen, um bestimmte Aspekte vielleicht zu vertiefen. Ansonsten soll jeder Beitrag vor allem als Anregung zur Reflexion und zur eigenen Positionsbestimmung dienen. Und wenn Ihnen Themen auffallen, die in meinem Arbeitsplan nach Ihrer Ansicht fehlen, bin ich natürlich für Ihre Hinweise besonders dankbar. Ansonsten bitte ich vorab schon hier um Nachsicht des Lesers. Getreu dem Motto eines langjährigen Chefs „Lieber einen Freund verlieren als eine gute Pointe“ neige ich zu spitzen, nicht immer ausgewogenen Formulierungen. Bei Themen, die mir sehr am Herzen liegen oder die mir im Berufsleben sehr viel Pein bereitet haben, kann das auch schon mal in hoffentlich immer noch positivem Zynismus abgleiten.
2. Management – die mechanistische Sicht
Schlägt man in der Encyclopedia Britannica 2000 den Begriff Management nach, findet sich dort als Erläuterung das Kürzel POSDCORB für die Disziplinen Planning, Organising, Staffing, Developing, Coordinating, Budgeting. So sind auch viele MBA-Studiengänge gestaltet. Die Studenten erlernen jede Menge Werkzeuge und Methoden, mit denen man geschäftliche Situationen in irgendeiner Form beurteilen, steuern, priorisieren kann. So glaubt man dann die jungen Leute bestens gerüstet, um Positionen im Management einzunehmen. Dahinter steckt die Überzeugung, dass Management im Grunde ein durch und durch rationales Geschäft ist. Die Geschäftswelt muss nur ausreichend genau modelliert und vermessen werden, dann kann man quasi durch mathematische Optimierung herausfinden, welche Entscheidungen man treffen muss.
Eine oft und gerne verwendete Methode ist der sogenannte Business Case. Dabei versucht man alternative geschäftliche Investitionen möglichst genau in Bezug auf Kosten, Dauer, weiterem Ressourcenbedarf, Risiko etc. einzuschätzen, trifft Annahmen über die Wirkung auf den Kunden, schätzt Produktionskosten und zukünftige Umsätze und modelliert so die ökonomische Wirkung der Alternativen. Das Ergebnissieht dann oft recht wissenschaftlich aus, aber es steht doch vielfach auf tönernen Füßen. In einem stabilen Markt wie der Automobilindustrie konnte man wohl voreinigen Jahren noch einigermaßen verlässlich schätzen, was die Wirkung einer bestimmten technologischen Modifikation ist, wie viel mehr Autos man dann in welchen Märkten verkaufen kann, was Entwicklungs- und Produktionskosten sein werden.
Wenn ich mich in ganz neue Technologien bewege, wie bspw. mit der E-Mobilität, wird das schon deutlich schwieriger, und bei vollkommen neuen Geschäftsmodellen sind alle diese Entscheidungswerkzeuge sehr fragwürdig. Aber selbst bei scheinbar recht langweiligen Investitionsthemen, etwa die Modernität und Flexibilität von Infrastrukturen, versagen diese Methoden anscheinend völlig.
Als langjähriger IT-Chef eines DAX-Unternehmens musste ich immer wieder dafür kämpfen, die technische Infrastruktur up-to-date zu halten. Bei der Bemessung der Nutzenpotentiale mussten wir oft viel Kreativität und gestalterische Flexibilität anwenden, um zu einem positiven Business Case zu kommen, aber wir waren uns sicher, dass die Investition nötig war. Denn auch wenn die Werbung vielfach anderes verspricht, kann die neue Software oder Hardware erst einmal nichts fundamental Neues, aber man läuft sonst aus der Wartung, Sicherheitslücken entstehen, die Zusammenarbeit mit anderen Produkten funktioniert nicht mehr usw. Aber das verhilft einem nicht zu einem positiven Business Case, denn man bekommt selten sofort so viel Nutzen und neue Funktionalität, dass es die Investitionrechtfertigen würde. Vielfach scheitern solche Investitionsvorhaben an diesen Werkzeugen, werden zu lange hinausgezögert und mit den Konsequenzen muss dann der Nutzer leben, insbesondere dann, wenn plötzlich die Infrastrukturen kritisch werden.
Unternehmen und andere Organisationen, die bei Beginn der Corona-Pandemie über moderne IT-Infrastrukturen verfügten, konnten die neuen Arbeitsformen viel leichter handhaben als andere. Bei der Weiterentwicklung öffentlicher Infrastrukturen ist es genauso: Eine neue Autobahn zu bauen, ist für einen Politiker viel leichter vermittelbar, als eine alte Brücke zu renovieren. Der Ersatz der alten Brücke kostet viel Geld und stört den Verkehr für lange Zeit, aber es bringt keinen zusätzlichen Nutzen. Die Renovierung hat also einen schlechten Business Case! Aber wir alle wissen, wie viel besser es uns heute ginge, wenn man rechtzeitig in Bahn- oder Strominfrastrukturen investiert hätte.
Eigentlich wissen auch alle von dem begrenzten Nutzen dieser Business-Cases. Trotzdem spielt jeder dieses Spiel mit, weil einem allein schon die Dokumentation dieser Untersuchung besonders dann hilft, wenn es schiefgeht und die Wirklichkeit anders verläuft als im Business Case angenommen. Man kann dann wenigstens dokumentieren, dass man eigentlich alles richtig und den Vorschriften entsprechend gemacht hat.
Besonders wichtig ist die Dokumentation, alles richtig und objektiv gemacht zu haben, in dem Handlungsraum eines Managers, den sein Umfeld mit dem größten Misstrauen beobachtet: dem Einkauf von Produkten und Dienstleistungen! Hier besteht der Verdacht, dass der Manager immer den Lieferanten wählt, der ihm die besten Essenseinladungen, die meisten ChampionsLeague-Besuche, den besten Bordeaux zu Weihnachten und noch weitere Vorteile liefert.
Schauen wir uns dazu mal ein kleines Beispiel an: In ihrem Unternehmen steht ein größeres IT-Projekt an und Sie sollen entscheiden, mit welchem Dienstleister sie das Projekt umsetzen wollen. Natürlich dürfen Sie das als IT-Chef nicht allein entscheiden, da Sie ja – siehe oben – sowieso nur ihren Lieblingslieferanten nehmen. Deshalb übernimmt die Einkaufsabteilung die Führung im Ausschreibungsprozess, damit hier eine objektiv richtige und compliance-technisch saubere Entscheidung getroffen wird.
Um am Ende des Ausschreibungsverfahrens möglichst vergleichbare Bewertungen vorliegen zu haben, einigen sich die Fachabteilung und der Einkauf vorher, nach welchen Kriterien denn die Lieferanten bewertet werden sollen und mit welcher Gewichtung die einzelnen Kriterien in die Gesamtbewertung eingehen sollen. Dann einigt sich das Auswahlteam nach jeder Bewerbervorstellung auf die Punktezahlen und muss dann am Ende nur noch ausrechnen, wer gewonnen hat. Das sieht dann hinterher alles ganz wissenschaftlich aus und auch die Compliance-Abteilung ist ganz zufrieden.
Solche Ausschreibungen drehen sich nicht einfach um den Kauf eines einigermaßen klar umrissenen und austauschbaren Produktes, sondern hier werden Hardware- und Softwareprodukte zusammen mit Projektdienstleistungen eingekauft – oft sogar verbunden mit mehrjährigen Dienstleistungsverträgen zur Unterstützung der neugeschaffenen Lösungen, integriert in die Prozesswelt des eigenen Unternehmens.
Das kann die Einkaufsabteilung nur sehr schwer beurteilen. Wenn das aber so wissenschaftlich aussehende Verfahren einmal ein Ergebnis geliefert hat, ist es sehr schwierig, daran noch etwas zu ändern.
Was also tun? Mein Freund Gunter Dueck zeigte mir einmal einen möglichen Ausweg! In der Sprache der Mathematiker heißt dies: Ich löse das inverse Problem! Ich passe bei der Auswahl der Bewertungskriterien und deren Gewichtung auf, dass Lieferanten, denen ich den Job zutraue, gut aussehen, und die, die ich wegen früherer schlechter Erfahrungen nicht will, mit großer Wahrscheinlichkeit herausfallen. In den Besprechungen nach den Vorstellungen der Lieferanten setze ich das besonders dort ein, wo der Hebel für meinen Kandidaten groß ist. So habe ich mir die Bewertungsfunktion definiert, die automatisch das von mir gewünschte Ergebnis liefert.
Es gibt eine mechanistische, technokratische Sicht auf Management, die von der Annahme ausgeht, dass es reicht, seine Werkzeuge zu kennen, diese systematisch, rational und unnachgiebig anzuwenden – und schon wird der Erfolg sich einstellen. Ich glaube nicht daran. Ich bin nach vielen Jahren im Beruf fest überzeugt, dass es nicht reicht, sich mit den Zahlen zu beschäftigen, sondern man sich auch inhaltlich mit den Themen befassen muss. Das heißt nicht, dass man sich keine Business Cases ansehen soll oder keine Bewertungskriterien für Ausschreibungen überlegen soll. Man sollte nur diesen Methoden nicht die Entscheidung überlassen.
Erlauben Sie mir, dazu eine kleine Parabel zu erzählen: Stehen zwei ältere Herren vor einer sehr großen und imposanten Brücke. Der eine ist der Architekt, der die Brücke entworfen und die Umsetzung vorangetrieben hat. Der andere ist der CFO der Firma. Der Architekt schaut vollständig gegenwartsentrückt auf die Brücke: „Das ist MEINE Brücke. Sie verbindet zwei Länder. Jeden Tag fahren Tausende von Autos darüber. Tausende von Menschen benutzen sie. Die Spannbreite zwischen den Pfeilern hat sich bis dahin niemand getraut umzusetzen. Am Ende habe ich noch einen Künstler den letzten Schliff geben lassen. Genau so wollte ich sie haben. Das ist MEINE Brücke!“ Der CFO darauf: „Du Idiot! Du hattest 200 Millionen geschätzt und es wurden dann 250 Millionen! Du hättest die Firma damit fast umgebracht!“ Der Architekt hält inne, schaut wieder lange gegenwartsentrückt auf die Brücke und sagt schließlich: „... egal ...“
Fazit: Wenn es den Architekten, der die Brücke in jedem Falle haben wollte, nicht gäbe, stünde dort keine Brücke. Man benötigt zwar auch den CFO, der das Ganze auf der Spur hält, aber die entscheidende Komponente ist der Architekt. Oder mathematisch ausgedrückt: Eine (von vielen) notwendigen Bedingungen ist der CFO. Die hinreichende Bedingung aber ist der Architekt. Ohne den Überzeugungstäter entsteht nichts. Es gibt keine inhaltliche Vision und es gibt keine treibende Kraft, die auch in schwierigen Zeiten in eine klare Richtung führt. Er ist die entscheidende und alles prägende Komponente. Es ist etwas, das man nicht erzeugen, das man als Manager aber schützen kann. Und es schadet nicht, wenn der Manager selber auch einen inhaltlichen Gestaltungswillen besitzt. Man kann Mitarbeiter sicher besser überzeugen, wenn man selber von den Zielen überzeugt ist!
Deswegen ist Management am Ende auch kein abstraktes Konzept, das man an der Business School in fünf Jahren erlernen kann. Es ist eine Erfahrungswissenschaft. Man muss Projekte mitgemacht haben, um den Angstschweiß der Mitarbeiter riechen zu können, um das normale Knirschen im Projekt von den Vorzeichen des großen Crashs unterscheiden zu können. Nach dem alten Motto „Lerne zu klagen, ohne zu leiden“ klagt der Vertrieb immer über den Preis oder die Funktionalität der Produkte und wie schwer es ist, sie zu verkaufen. Es braucht Erfahrung, zu erkennen, wann es wirklich ein Problem ist. Die mechanistische Sicht auf Management mag noch funktionieren, wenn alles einen einigermaßen geordneten Gang geht, wenn hohe Kontinuität im Umfeld des Geschäfts besteht und nur weiterentwickelt und nicht entwickelt werden muss. Aber in Zeiten dauerhafter, grundlegender und immer schnellerer Veränderungsprozesse sind diese Methoden nur noch begrenzt nützlich.
3. If you can’t measure it, you can’t manage it
Das Zitat wird oft Peter Drucker zugeordnet, dem Erfinder der Managementlehre schlechthin, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Diskussion über Management prägte. Drucker hat zwar viele Bücher geschrieben, aber dieses Zitat findet sich so nicht bei ihm. Er hat tatsächlich 1-mal gesagt: „If you can’t measure it, you can’t improve it.“ Im konkreten Fall ging es wohl darum, die Situation an einem Telefonhelpdesk zu verbessern. Und Drucker meinte mit seinem Kommentar, dass man irgendwelche Indikatoren braucht, an denen man festmachen kann, ob getroffene Maßnahmen denn auch irgendetwas bewirken und sich die Situation verbessert. Man könnte es auch so fassen: Wenn du etwas verbessern willst, überlege dir im Vorfeld, woran du merkst, dass es besser geworden ist.
Als andere mögliche Quelle wird dann noch William Edwards Deming erwähnt. Deming ist amerikanischer Statistiker und Pionier des Qualitätsmanagements und einer prozessorientierten Unternehmenssicht. Er hat ab 1950 führend zur Entwicklung des japanischen Qualitätsmanagements beigetragen und wurde in den USA erst ab den 80ern bekannt, als die amerikanische produzierende Industrie von den Japanern zertrümmert wurde. Deming hat aber das genaue Gegenteil gesagt: „It is wrong to suppose that if you can’t measure it, you can’t manage it – a costly myth!“
Aber trotz unklarer Herkunft ist dieser Spruch wohl das in Managementdiskussionen mir am häufigsten begegnete Zitat. Vielleicht kam es sogar in meinem Bereich noch öfter vor als in anderen Unternehmensbereichen, denn die IT sollte natürlich immer die Daten für all diese Messungen bereitstellen.
Die Mechaniker der Unternehmensführung verwendeten diesen Spruch jedenfalls als Rechtfertigung, dass sie für alles und jedes, was sie managen sollten, eine Kenngröße oder auf Neudeutsch einen KPI (Key Performance Indicator) brauchten. Und machten den fatalen Umkehrschluss, dass ich hinfort nur noch meine KPIs in den Zielbereich bringen muss und dann sei die Welt gut. Aber KPIs sind – wie ihr Name schon sagt – eben nur Indikatoren dafür, dass etwas schon so sein könnte, wie es sollte, aber sie sind noch lange kein Nachweis, dass es wirklich so ist.
Wenn eine Software keine Fehler hat, ist das sicher schon einmal eine gute Sache, aber es heißt noch lange nicht, dass die Software gut ist. Etwas kann vollständig fehlerfrei sein, aber komplett nutzlos! Natürlich soll man sich die Fehlerstatistik anschauen, aber man sollte sich davor hüten, diese Zielgröße dann einfach als Zielvorgabe der Mitarbeiter zu nutzen und mit der Messgröße die Firma zu steuern. Das hat Deming mit seinem Zitat gemeint: Wenn man einen Indikator für die Wirklichkeit nimmt und danach steuert, wird man automatisch falsch steuern, weil der Indikator nicht die Wirklichkeit ist.
Auch Kundenzufriedenheit ist nur ein Indikator, ob etwas gut ist, aber auch keine korrekte Messgröße. Bei unseren Umfragen bei den Nutzern unserer IT-Anwendungen im Unternehmen schnitt immer eine SAP-Anwendung am besten ab, mit der die Mitarbeiter Urlaub buchen konnten, die Auszahlung von Überstunden anstoßen, Weiterbildungskurse buchen etc. Das haben die Leute geliebt, auch wenn das SAP-Interface nicht unbedingt nutzerfreundlich ist. Die jährliche Planung haben die Vertriebsmitarbeiter gehasst, und egal, wie wir uns angestrengt haben: Kundenzufriedenheit gab es bei dieser Anwendung nie.





























