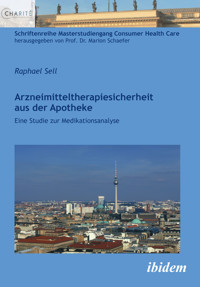
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Schriftenreihe Masterstudiengang Consumer Health Care
- Sprache: Deutsch
Jeden Tag suchen Millionen Menschen in Deutschland eine Apotheke auf, unter ihnen viele alte und chronisch kranke Patienten. Mit dem Alter steigt die Zahl der angewendeten Arzneimittel. Eine zunehmende Komplexität der Therapie erhöht jedoch auch das Risiko für unerwünschte Wirkungen. Welche Probleme treten bei der Arzneimitteltherapie auf? Wie kann in einer alternden Gesellschaft die Therapiesicherheit gewährleistet und optimiert werden? Raphael Sell stellt die Ergebnisse eines landesweit angelegten Projektes der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt vor, in dessen Verlauf die Medikation von mehr als 1000 Patienten in 300 Apotheken dokumentiert und umfassend analysiert wurde. Identifizierte Probleme wurden von den Apothekern mit den Patienten und ihren behandelnden Ärzten besprochen und nach Möglichkeit geklärt. Sell beschreibt in seiner Analyse die Zusammensetzung der Medikation, wertet Ergebnisse und Prozess der Medikationsanalysen aus und untersucht Vorkommen, Risikofaktoren und Klärung der Probleme. Schließlich diskutiert er auf Basis der Projektergebnisse und der aktuellen Literatur, welchen Beitrag Apotheken zur Sicherheit der Arzneimitteltherapie leisten können und welche Rahmenbedingungen erforderlich sind, um die gewonnenen Erkenntnisse erfolgreich in die tägliche Versorgungspraxis umzusetzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
1. Abkürzungsverzeichnis
2. Zusammenfassung
3. Einleitung
4. Ziel- und Aufgabenstellung
5. Material und Methodik
5.1 Definition der Medikationsanalyse
5.2 Ablauf der Medikationsanalyse
5.2.1 Übersicht des Ablaufs
5.2.2 Medikationsanamnese
5.2.3 Identifikation arzneimittelbezogener Probleme
5.2.4 Dokumentation der Medikationsanalyse
5.3 Sammlung, Digitalisierung und Strukturierung der Daten
5.4 Auswertung der Daten
5.4.1 Codierung der Wirkstoffe in ATC-Klassifikation
5.4.2 Codierung der ABP-Kategorien in PIE-Doc®
5.4.3 Verfahren zur Ermittlung der statistischen Signifikanz
6. Darstellung der Ergebnisse
6.1 Beschreibung der Teilnehmer und der Arzneimitteltherapie
6.2 Prozessdaten der Medikationsanalyse
6.3 Ergebnisse der Medikationsanalyse
6.4 Unterschiede der Arzneimitteltherapie zwischen Teilnehmern
6.5 Prozessdaten der Medikationsanalyse nach Teilnehmergruppen
6.6 Identifikation und Lösung arzneimittelbezogener Probleme
7. Diskussion
7.1 Teilnehmerzahl und -struktur
7.2 Medikationspläne und Anwendungsgründe
7.3 Medikation
7.4 Indikationsgebiete
7.5 Prozess der Medikationsanalysen
7.6 Arzneimittelbezogene Probleme
7.7 Teilnehmermerkmale und arzneimittelbezogene Probleme
7.8 Präparatmerkmale und arzneimittelbezogene Probleme
7.9 Limitationen des Projektes
8. Schlussfolgerungen
10. Literaturverzeichnis
12. Anhang
Danksagung
Schriftenreihe Masterstudiengang Consumer Health Care
Impressum
1. Abkürzungsverzeichnis
ABDA Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände e.V.
ABP Arzneimittelbezogene Probleme
AM Arzneimittel
ANOVA Analysis of variance (Varianzanalyse)
ATC-Code Anatomisch-therapeutisch-chemischer Code
BAK Bundesapothekerkammer
BTM Betäubungsmittel
DIMDI Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information
GKV Gesetzliche Krankenversicherung
NEM Nahrungsergänzungsmittel
n. s. nicht signifikant (in Tabellen verwendet)
OR Odds ratio (Quotenverhältnis)
OTC / Non-Rx Over-the-counter („über den Ladentisch“) Medikation / nicht-rezeptpflichtige Arzneimittel
PCNE Pharmaceutical Care Network Europe (Europäisches Netzwerk für pharmazeutische Betreuung)
PIE-Doc® Problem-Interventions-Ergebnis-Dokumentation
Rx Rezeptpflichtige Arzneimittel
UAW Unerwünschte Arzneimittelwirkung
WHO World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)
2. Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wurden Rohdaten eines Projektes der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt zur Arzneimitteltherapiesicherheit ausgewertet. Im Frühjahr 2015 wurden von 300 Apotheken insgesamt 1090 Patienten rekrutiert. Die teilnehmenden Patienten wurden gebeten, ihre Arzneimittel und arzneimittelähnlichen Präparate und, sofern vorhanden, ihren Medikationsplan zu einem Anamnesetermin in die Apotheke zu bringen. Die Apotheker führten Medikationsanalysen zur Optimierung der Arzneimitteltherapiesicherheit durch. Hierbei identifizierte arzneimittelbezogene Probleme klärten sie in einem Auswertungsgespräch mit dem Patienten und, wenn erforderlich, dem Arzt. Es wurden Daten zu Teilnehmern, Medikation, identifizierten arzneimittelbezogenen Problemen sowie deren Klärung und zum Analyseprozess dokumentiert. Diese wurden zentral von der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt gesammelt und in der vorliegenden Arbeit ausgewertet.
Ziel der Arbeit ist es, die Arzneimitteltherapie, die Art, Häufigkeit und Klärung arzneimittelbezogener Probleme, und den für Medikationsanalysen erforderlichen Zeitaufwand zu beschreiben und zwischen Teilnehmergruppen zu vergleichen. Darüber hinaus sollten Faktoren identifiziert werden, welche mit einem erhöhten Risiko für arzneimittelbezogene Probleme assoziiert sind.
Die Teilnehmer waren zum Zeitpunkt der Analyse durchschnittlich 72 Jahre alt und zu 52,0 % weiblich. Ein Medikationsplan war bei 64,9 % vorhanden, wobei dieser Anteil mit dem Alter anstieg und bei Männern höher war. Die Teilnehmer brachten im Mittel 10,6 Präparate je Teilnehmer (insgesamt 11579) zum Anamnesetermin mit, bei Frauen, älteren Teilnehmern und vorhandenem Medikationsplan war die Anzahl der Präparate höher. Die Therapie setzte sich zu 79,8 % aus rezeptpflichtigen Arzneimitteln, zu 14,3 % aus nicht-rezeptpflichtigen Arzneimitteln und zu 5,8 % aus Nicht-Arzneimitteln zusammen. Bei 13,8 % aller Präparate handelte es sich um Bedarfsmedikation. Die häufigsten Indikationsbereiche bezogen sich auf das kardiovaskuläre System (36,0 %), das alimentäre System und Stoffwechsel (20,0 %), das Nervensystem (11,5 %) sowie Blut und blutbildende Organe (8,9 %), welche zusammen drei Viertel aller Präparate abdeckten. Bei 31,7 % aller Teilnehmer war für mindestens ein Präparat keine Indikation bekannt, bei männlichen und älteren Teilnehmern war dieser Anteil signifikant höher. Bei den Medikationsanalysen wurden 4460 arzneimittelbezogene Probleme bei 3836 Präparaten dokumentiert. 84,2 % aller Teilnehmer waren von mindestens einem Problem betroffen. Am häufigsten waren Arzneimittelinteraktionen bei 53,7 % und Probleme mit Anwendung und Compliance bei 46,7 % aller Teilnehmer. Es folgten unerwünschte Arzneimittelwirkungen bei 21,2 %, Probleme bei der Dosierung bei 19,1 % und Probleme bei der Arzneimittelauswahl bei 18,1 % der Teilnehmer. Lediglich bei 3,0 % aller Teilnehmer wurden Lagerungsprobleme festgestellt. Rezeptpflichtige Arzneimittel waren geringfügig häufiger mit Problemen assoziiert, nicht-rezeptpflichtige Arzneimittel und Nicht-Arzneimittel entsprechend seltener. Probleme mit Anwendung und Compliance waren bei Teilnehmern ohne Medikationsplan sowie in der Altersgruppe der 75- bis 84-jährigen signifikant häufiger. Die Gesamtanzahl arzneimittelbezogener Probleme war nicht mit Alter, Geschlecht oder Vorhandensein eines Medikationsplans assoziiert. Es gab jedoch eine positive Korrelation mit der Anzahl Präparate je Teilnehmer.
72,2 % der Probleme konnten bereits im Gespräch zwischen Apotheker und Patient geklärt werden, bei 12,7 % wurde ein Arzt hinzugezogen, bei 5,0 % war keine Klärung möglich, bei den restlichen fehlte die Dokumentation. Probleme mit Anwendung und Adhärenz sowie Lagerungsprobleme konnten überproportional häufig bereits im Patientengespräch geklärt werden, bei Problemen mit der Dosierung, der Arzneimittelauswahl und unerwünschten Arzneimittelwirkungen wurde überproportional häufig ein Arzt kontaktiert. Die Medikationsanalysen dauerten durchschnittlich 66,7 min, wobei die interindividuellen Schwankungen sehr ausgeprägt waren. Die Analysedauer nahm mit der Anzahl der untersuchten Präparate und der Anzahl identifizierter arzneimittelbezogener Probleme zu. Apothekenbasierte Medikationsanalysen können ein Mittel sein, arzneimittelbezogene Probleme zu identifizieren und die Arzneimittetherapiesicherheit zu unterstützen. Zu den Risikofaktoren zählten je nach Art des Problems eine hohe Anzahl angewendeter Präparate, mangelnde Kenntnis der Anwendungsgründe, ein Alter über 75 Jahre und das Nichtvorhandensein eines Medikationsplans. Die Mehrzahl der identifizierten Probleme konnte zwischen Apotheker und Patient geklärt werden.
3. Einleitung
Bedingt durch die demographische Entwicklung nimmt in den Industrienationen bei steigender Lebenserwartung und niedriger Geburtenrate der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung zu [1]. In Deutschland lag der Anteil der über 65-jährigen im Jahr 2015 bei 21,1 % [2]. Mit steigendem Lebensalter nehmen auch das Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko zu, so waren 2009 nach laut der GEDA-Studie 20 % der Männer und 30 % der Frauen zwischen 65 und 74 Jahren in Deutschland multimorbide, d.h. sie litten an 2 oder mehr chronische Krankheiten. Bei Befragten über 75 Jahre stieg dieser Anteil auf über 25 % bei Männern und über 34 % bei Frauen [3]. Das Bundesland Sachsen-Anhalt, in dem die dieser Arbeit zugrundeliegende Studie durchgeführt wurde, weist mit einem Durchschnittsalter von 47,4 Jahren die älteste Bevölkerung unter den Bundesländern auf (deutschlandweiter Durchschnitt: 44,2 Jahre) [4]. Daher ist es in besonderem Ausmaß von den Herausforderungen für die Gesundheitssysteme betroffen, die diese Entwicklung mit sich bringt.
Ältere Patienten unterscheiden sich in verschiedenen therapierelevanten Merkmalen von jüngeren Patienten, welche jedoch in klinischen Zulassungsstudien für Arzneimittel überproportional vertreten sind [5]. In Folge dieser Unterrepräsentation sind im Rahmen einer Pharmakotherapie auftretende erwünschte und unerwünschte Wirkungen bei älteren Patienten schwieriger zu prognostizieren, obwohl diese auf Grund der höheren Morbidität häufiger auf Arzneimittel angewiesen sind. Daher kommt Beobachtungen bei der praktischen Anwendung gerade für diese Altersgruppe eine besondere Bedeutung für die Erkennung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen und Anwendungsproblemen zu.
Unter dem Begriff „frailty“ (dt.: Gebrechlichkeit) werden physiologische und pathophysiologische Veränderungen in verschiedenen Organsystemen im Alter subsummiert, die in einer erhöhten Empfindlichkeit des Körpers gegenüber exogenen Stressoren resultieren [6]. Einige der Veränderungen – etwa die Verminderung des Gesamtkörperwassers, des Serumalbumins, der Leberdurchblutung und der Nierenfunktion – können sich auf die Pharmakokinetik, also Freisetzung, Aufnahme, Verteilung, Metabolismus und Exkretion von Arzneistoffen, auswirken. Andere, etwa eine veränderte Expressionsdichte oder Empfindlichkeit von Rezeptoren, wirken sich auf die Pharmakodynamik, also den Effekt der Arzneistoffe auf den Organismus, aus. Wieder andere, wie die Abnahme der Muskelmasse, Störungen des Gleichgewichtsinns und des Sehens, können additiv mit der Arzneimitteltherapie das Sturzrisiko erhöhen [7]. Unterschiede in der Wirkung oder erhöhte Risiken für unerwünschte Wirkungen von Arzneimitteln können im Alter ggf. eine Therapieanpassung erforderlich machen. Oftmals führen bei älteren Patienten geringere Arzneistoffdosen zur gewünschten Wirkung, was sich in dem häufig zitierten Grundsatz „start low, go slow“ (dt.: beginne niedrig, steigere langsam) spiegelt [8]. Neben den allgemeinen Empfehlungen existieren zudem mehrere im Expertenkonsens erstellte explizite Listen mit Wirkstoffen, die bei älteren Patienten ein ungünstiges Nutzen-Risiko-Profil aufweisen sollen, etwa die deutsche PRISCUS-Liste [9].
In Folge der häufigen Multimorbidität steigen mit zunehmendem Alter auch Umfang und Komplexität der Arzneimitteltherapie. Eine weitere mögliche Ursache hierfür ist die sogenannte „Verschreibungskaskade“, in welcher die unerwünschte Wirkung eines Arzneimittels fälschlicherweise als neue Erkrankung gedeutet wird, die es durch Verschreibung eines weiteren Arzneimittels zu therapieren gilt [10]. Dieser Vorgang wird weiter begünstigt, wenn mehrere Ärzte (z.B. Hausarzt, Fachärzte und Klinikärzte) Arzneimittel verordnen, ohne die anderweitige Medikation zu kennen. Auch die Selbstmedikation des Patienten, die den behandelnden Ärzten nicht bekannt sein muss, kann Teil der Kaskade sein.
Für eine umfangreiche Arzneimitteltherapie hat sich der Begriff „Polypharmazie“ (synonym: „Polymedikation“, „Multimedikation“) etabliert. Vorschläge für eine Quantifizierung dieses Begriffes reichen von mindestens zwei bis zu mindestens neun Arzneimitteln [11], andere Autoren verwenden den Begriff dagegen für sämtliche Arzneimittel ohne Indikation [12]. Eine der gebräuchlichsten Definitionen definiert den Begriff als dauerhafte Einnahme von fünf oder mehr systemisch wirksamen Arzneimitteln [13]. Nachdem diese Festlegung bereits in diversen deutschen Studien verwendet wurde [14], soll sie zugunsten der Vergleichbarkeit der Ergebnisse auch in der vorliegenden Arbeit herangezogen werden.
Polypharmazie muss dabei nicht zwingend ungerechtfertigt sein; sie kann sich bereits aus der leitlinienkonformen Arzneimitteltherapie weniger gleichzeitig vorliegender Erkrankungen ergeben [5]. Gleichwohl ist sie mit einem erhöhten Risiko für arzneimittelbezogene Probleme assoziiert [15]. Darüber hinaus geht sie in einigen Fällen, scheinbar paradoxerweise, mit einer gleichzeitigen Unterverordnung essentieller Arzneimittel einher [16, 17]. Dass der Umgang mit Polypharmazie von wachsender Bedeutung ist, zeigt sich auch daran, dass 2013 eigens eine hausärztliche Leitlinie zum Thema verabschiedet wurde [18].
Arzneimittelbezogene Probleme („drug-related problems“) wurden 1999 vom Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) wie folgt definiert [19]:
“A Drug-Related Problem is an event or circumstance involving drug therapy that actually or potentially interferes with desired health outcomes.”
Eine deutschsprachige Übersetzung der Definition wurde 2001 von Mitgliedern des PCNE in der Pharmazeutischen Zeitung publiziert [20]:
„Arzneimittelbezogene Probleme sind Ereignisse oder Umstände bei der Arzneimitteltherapie des Patienten, die tatsächlich oder potenziell das Erreichen von angestrebten Therapiezielen verhindern.“
Somit beschreibt die Definition nicht nur tatsächlich eingetretene unerwünschte Effekte der Arzneimitteltherapie, sondern auch potentielle Risiken für den Therapieerfolg, die z.B. aus Medikationsfehlern resultieren können. Die Art arzneimittelbezogener Probleme kann dabei vielfältig sein und beinhaltet u. a. die Verordnung kontraindizierter Arzneimittel, die Verordnung potentiell inadäquater Arzneimittel bei älteren Patienten, Arzneimittelinteraktionen, unbeabsichtigte Mehrfachmedikationen, Über- oder Unterdosierungen, Adhärenzprobleme und unerwünschte Arzneimittelwirkungen.
Arzneimittelbezogene Probleme können zu klinisch bedeutsamen unerwünschten Wirkungen, wie Stürzen, Blutungen und Delir, führen [21-23]. An ca. 5% aller Krankenhauseinweisungen sind unerwünschte Wirkungen von Arzneimitteln ursächlich oder verkomplizierend beteiligt, wie nationale [24] und internationale [25] Studien zeigen. Für die Qualität und Ökonomie der Gesundheitsversorgung sind Prävention und Lösung arzneimittelbezogener Probleme daher von maßgeblicher Bedeutung.
Apotheker befinden sich in mehrfacher Hinsicht in einer vorteilhaften Position, um arzneimittelbezogene Probleme zu identifizieren. Die Disziplin der klinischen Pharmazie, in deren Bereich die Bewertung der Arzneimitteltherapie von Patienten fällt, hat 2001 ihren Eingang in die Approbationsordnung für Apotheker und damit in Lehrplan und Examensprüfungen der Pharmaziestudiums gefunden [26]. Öffentliche Apotheken stellen eine niedrigschwellige Anlaufstelle für Medikationsfragen dar und führen – zumindest bei Stammkunden – oft eine digitale Dokumentation der Arzneimittelanamnese, welche datenbankgestützte Prüfungen auf Arzneimittelinteraktionen ermöglicht. Weiterhin werden vom Patienten in der Apotheke Verordnungen verschiedener Ärzte eingelöst und Arzneimittel zur Selbstmedikation erworben, so dass im Idealfall die Gesamtmedikation abgebildet und auf Probleme geprüft werden kann.
Auf Basis dieser Voraussetzungen hat in den letzten Jahren der Bereich der pharmazeutischen Betreuung („Pharmaceutical Care“) an Bedeutung gewonnen, welche 1990 als Konzept präsentiert [27] und 2013 vom PCNE zu der folgenden Definition entwickelt wurde [28]:
„Pharmaceutical care is the pharmacist‘s contribution to the care of individuals in order to optimise medicines use and improve health outcomes.”
Eine deutschsprachige Übersetzung der Definition findet sich auf der Website der Förderinitiative Pharmazeutische Betreuung e.V. [29]:
„Pharmazeutische Betreuung ist die konsequente Wahrnehmung der Mitverantwortung des Apothekers bei der Arzneimitteltherapie, mit dem Ziel, konkrete therapeutische Ergebnisse zu erreichen, die geeignet sind, die gesundheitsbezogene Lebensqualität des Patienten zu verbessern.“





























