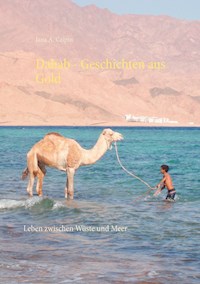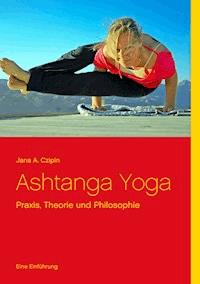
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das Buch dient als allgemein verständliche Einführung in Ashtanga Yoga und verbindet die Erkenntnisse moderner Wissenschaft mit den uralten Weisheiten der Yogaphilosophie. Es gibt einen Überblick über die Entwicklung des Yogas und bringt Ashtanga Yoga in Kontext zu anderen Yogastilen und deren Terminologie und Philosophie. Weiters werden die Ziele des Ashtanga Yogas beschrieben, und wie wir mit Hilfe der Praxis Leiden überwinden können. In klarer, verständlicher Sprache arbeitete die Autorin heraus, wie uns diese spezielle Praxis nützlich sein kann, und sie erklärt, was mit Körper und Geist geschieht, wenn wir diese Form von Yoga ausüben. Die LeserInnen erfahren auch, auf welchen Prinzipien Ashtanga Yoga basiert, und was für unsere Yoga-Praxis hilfreich sein kann. Weiters beschäftigt sich das Buch mit der Überwindung von Hindernissen, denen wir früher oder später auf unserem spirituellen Weg begegnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein Dank gilt besonders Luna Susanne Baillod, Giuditta Cordero-Moss und Carmen Tromballa
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel
Die Entwicklung von Yoga
Upanishaden
Bhagavad Gita
Bhakti Yoga
Karma Yoga
Dhyana Yoga
Jnana Yoga
Yoga Sutras
Hatha Yoga Pradipika
Yoga in unserer Zeit
Kapitel
Befreiung von Leiden
Ziele des Yogas
Leiden verhindern
Die Kleshas
Selbstkontrolle
Selbsterkenntnis - Samadhi
Die Ursache von Leiden
Kapitel
Ashtanga Yoga
Kriya Yoga
Der achtfache Pfad
Yama: Zurückhaltung, Verbote
Niyama: Selbstdisziplin, innere Disziplin
Asanas -Körperübungen
Bandhas
Dristis
Vinyasa
Die Ashtanga Serien
Pranayama – Atemübungen
Ujjayi-Pranayama
Pratyahara– Zurückziehen der Sinne
Dharana – Konzentration
Exkurs Mantras
Dhyana – Meditation
Samadhi – Erleuchtung
Kapitel
Die Yogapraxis
Die Überwindung von Hindernissen
Zwei komplementäre Prinzipien
Das Umfeld der Praxis
Schlusswort
Literatur
Vorwort
YS I.1
Jetzt erfolgt die Unterweisung in Yoga.1
Der indische Heilige Ramakrishna beschrieb Yoga als ein Haus, in dem es verschiedene Wege zur Dachterrasse gibt, auf der Erleuchtung und Glückseligkeit zu finden sind, also verschiedene Wege zum Licht der Erkenntnis.
Mit dem gleichen Ziel vor Augen nehmen manche Menschen die breite Marmortreppe rechts, andere die engen Holzstufen links, einige verwenden eine Leiter, andere – sehr wenige – finden den Lift und können direkt zur Terrasse hinauffahren. So mancher wird am wilden Wein an der Außenmauer hochklettern, einige gehen alleine, andere in Gruppen. Es ist gleichgültig, welchen Weg (Lehrer/Schule/Philosophie) man wählt, wichtig ist nur, dass man nicht im Keller seines Lebens in Abhängigkeit und Unbewusstheit verbleibt und darüber jammert, dass man die Sonne nicht sehen kann. Jeder Suchende wird den Weg zum Dach nehmen, der ihm angemessen erscheint und der zu ihm passt.
Ashtanga Yoga ist nun einer dieser Wege, der vor allen Menschen zusagt, die sich gerne bewegen, die aktiv sind und die Herausforderungen mögen. Dieses Buch beschreibt Ashtanga Yoga für all diejenigen, die sich für die Hintergründe und die Philosophie dieser alten Yogaform interessieren.
Yoga erfreute sich in den letzten zwanzig Jahren einer großen Beliebtheit, die ihren Ausgang in den 60er und 70er Jahren von den USA aus nahm, und mit der Gesundheits- und Fitnesswelle nach Europa herüber schwappte. Menschen aus allen Alters- und Berufsgruppen besuchen mittlerweile Yogaklassen. Aber die unzähligen Yogaschulen und Traditionen machen es manchmal schwer herauszufinden, welches Yoga das für einen geeignete ist.
Hatha, Kundalini, Hormonyoga, Nuad, Bikram, Sivananda, Vinyasa oder Lachyoga sind nur einige der gängigen Bezeichnungen, die die ungeheure Vielfalt der Yogastile kennzeichnen. Jede Person ist ein Unikat und was dem einen gefällt, erscheint dem anderen langweilig oder sogar blödsinnig.
Diese Vielfalt kommt daher, dass Yoga in seiner jahrtausendealten Geschichte in zahlreiche Richtungen wachsen konnte und unterschiedlichen Einflüsse unterworfen wurde.
Was die meisten Menschen von Yoga kennen, ist die Praxis der Körperpositionen, in Sanskrit als Asanas bezeichnet. Wenigen Menschen ist bewusst, dass diese Positionen in erster Linie praktiziert wurden, um den Körper, und hier vor allem das Nervensystem, optimal für die geistige Aktivität der Meditation vorzubereiten. Diese ist notwendig, um spirituelle Erkenntnis über sich und die Welt zu erlangen und um auf das Dach der Erleuchtung zu gelangen. Die meisten modernen Bücher über Yoga beschäftigen sich mit vor allem mit der Praxis dieser Körperhaltungen, während die antiken Bücher vor allem die Philosophie des Yogas erklären und die spirituelle Entwicklung beschreiben, die sich mit der Praxis einstellt.
Alle alten Texte über Yoga wurden in Sanskrit abgefasst, das wie das Lateinische eine nicht mehr aktiv gesprochene Wissenschaftssprache ist. So blieb und bleibt viel Raum zur individuellen Auslegung. Obwohl sich die verschiedenen Yogatraditionen auf dieselben Quellen beziehen, haben sie zum Teil differenzierte Vorstellungen über die Yogapraxis entwickelt.
Fallweise stellen sie sogar unterschiedliche Regeln und Vorschriften auf, weil sie zum Teil auf von einander abweichenden philosophischen und weltanschaulichen Auffassungen beruhen.
Das vorliegende Buch dient als allgemein verständliche Einführung ins Ashtanga Yoga, die die vorher erwähnte Verwirrung vieler Yogaübenden beheben soll und zum Weiterstudieren einlädt. Es verbindet die Erkenntnisse moderner Wissenschaft mit den uralten Weisheiten der Yogaphilosophie. Bei den Erklärungen und Darstellungen wurde mehr Wert auf allgemeine Verständlichkeit gelegt als auf wissenschaftliche Genauigkeit, und die hier dargestellten Erkenntnisse und Überlegungen sind ebenfalls durch die kulturellen und gesellschaftlichen Einflüsse der Autorin gefiltert.
Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die allgemeine Entwicklung des Yogas und bringt Ashtanga Yoga in Kontext zu anderen Yogastilen und deren Terminologie und Philosophie. Das zweite Kapitel beschreibt die Ziele des Ashtanga Yogas und wie wir Leiden überwinden können. Das folgende Kapitel arbeitet heraus, wie uns diese spezielle Praxis nützlich sein kann, und beschreibt, was mit Körper und Geist passiert, wenn wir diese Form von Yoga ausüben. Das letzte Kapitel erklärt die Prinzipien, auf denen Ashtanga Yoga basiert, und was hilfreich für unsere Yoga-Praxis sein kann. Weiters beschäftigt es sich mit der Überwindung von Hindernisse, denen wir auf unserem spirituellen Weg früher oder später begegnen.
Das Buch dient als allgemein verständliche Einführung in Ashtanga Yoga und verbindet die Erkenntnisse moderner Wissenschaft mit den uralten Weisheiten der Yogaphilosophie.
Es gibt einen Überblick über die Entwicklung des Yogas und bringt Ashtanga Yoga in Kontext zu anderen Yogastilen und deren Terminologie und Philosophie. Weiters werden die Ziele des Ashtanga Yogas beschrieben und wie wir mit Hilfe der Praxis Leiden überwinden können. In klarer, verständlicher Sprache arbeitete die Autorin heraus, wie uns diese spezielle Praxis nützlich sein kann, und sie erklärt, was mit Körper und Geist passiert, wenn wir diese Form von Yoga ausüben. Die LeserInnen erfahren auch, auf welchen Prinzipien Ashtanga Yoga basiert, und was für unsere Yoga-Praxis hilfreich sein kann. Weiters beschäftigt sich das mit der Überwindung von Hindernisse, denen wir früher oder später auf unserem spirituellen Weg begegnen.
1. Kapitel:
Die Entwicklung von Yoga
Die wichtigste Quelle und Grundlage des Ashtanga2 Yogas sind die Yoga Sutras des indischen Gelehrten Patanjali. Über die historische Person Patanjali ist wenig bekannt, man nimmt an, dass er irgendwann zwischen 200 v.Ch. und 300 n.Ch. gelebt hat.
Das System des Ashtanga Yogas wurde nicht von ihm erfunden, viel mehr dürfte er das Wissen, das ihm zur Verfügung stand, zu einem einheitlichen System zusammengestellt, strukturiert und verfeinert haben.
Jahrhundertelang war das Wissen über Yoga nur wenigen Auserwählten zugänglich, weil es vor allem innerhalb von Familien weitergegeben wurde oder direkt vom Guru zum Schüler. Bevor Bücher wie die Bhagavad Gita, die Yoga Sutras oder die Hatha Yoga Pradipika geschrieben und verbreitet wurden, gab man das Wissen vor allem mündlich weiter und nur weniges wurde bildlich oder gar schriftlich festgehalten, auch weil nur sehr wenige Menschen lesen konnten.
Die ersten bildlichen Darstellungen von Yoga-Übungen wurden in Nordindien als Artefakte der Indus-Kultur3 entdeckt, die sich um 2800-1800 v. Chr entlang des Indus auf dem indischen Subkontinent entwickelt hatte. Diese Kultur erstreckte sich über das heutige Pakistan und Teile von Indien und Afghanistan. Bei Ausgrabungen fand man etwa 5000 Jahre alte Siegel, die Figuren in Yoga- oder meditationsähnlichen Positionen zeigen.
Wissenschaftler nehmen an, dass diese Haltungen zur Kultivierung eines beständigen Geist eingenommen wurden. Das würde bedeuten, dass die Menschen dieser Kultur schon Meditation praktizierten, noch bevor die Texte der Veden formuliert wurden.
Die Veden4 sind eine umfassende Sammlung von heiligen Hymnen aus der nordindischen Eisenzeit (etwa 1200 bis 300 v.Chr.), die wichtige menschliche Erfahrungen und Erkenntnisse festhalten. Sie beinhalten umfassende Kenntnisse über zahlreiche Aspekte des Lebens, vom Ackerbau bis zur richtigen Art die Veden zu singen.5 In diesen Schriften finden wir die ersten Anmerkungen zu Yoga. In Indien wird traditionellerweise angenommen, der Weise Vyasa6 habe die ursprünglich einheitlichen Veden in vier Abschnitte geteilt:
Samhitas
: Sammlung von Mantras oder Gesängen
Brahmanas
, Texte, die heilige Rituale beschreiben und
Aranyakas
, die sogenannten "Waldtexte", die gefährliche Rituale festhalten und interpretieren und deshalb außerhalb menschlicher Ansiedelungen praktiziert werden sollten.
Upanishaden
: philosophische und spekulative Lehren
Vedangas
: Hilfswissenschaften zum Verständnis und zur korrekten Überlieferung der Veden
Für Yoga interessieren uns vor allem die Upanishaden:
Die Upanishaden (800 v. Chr. - 200 v. Chr.)
Die rund 150 Upanishaden7 stellen eine Sammlung bedeutsamer philosophischer Schriften dar. Während sich die Brahmanas vor allem mit Opferritualen beschäftigen, werden in den Upanishaden Zweifel an diesen mechanisch ausgeführten Ritualen ausgedrückt.
Die Themen der Texte sind unter anderem die Essenz und der Sinn des Daseins, verschiedene Arten von Meditation und Gottesverehrung, sowie die Lehre von der Wiedergeburt. Es wird das Wesen von Brahman beschrieben, der universellen Weltenseele, von der Atman – die individuelle Seele - eine Reflexion in jedem Lebewesen darstellt. Brahman – und damit auch Atman – tragen Attribute wie unvergänglich, unsterblich, unendlich, ewig, rein, unberührt von äußeren Veränderungen, ohne Anfang und Ende, unbegrenzt durch Zeit, Raum und Kausalität; sie stellen das reine Sein dar. Die durch unsere Sinne wahrnehmbare Welt wird als maya8, als Schleier oder Illusion aufgefasst. Ziel der Yogapraxis ist es demnach, diese Illusion zu erkennen, sich mit Atman – dem göttlichen Selbst, das ein jeder von uns in sich trägt – zu identifizieren, und sich damit von der falschen Identifizierung mit dem physischen Körper zu befreien. Diese Identifizierung wird als Ursache für menschliches Leiden angesehen.
Die Upanishaden vertreten demnach ein monistisches System, das den Ursprung der Welt in einem einzigen, alles durchdringenden Prinzip (Brahman) sieht. Viele Yogaschulen, die sich z.B. auf die spätere Vedanta-Philosophie9 berufen, folgen dieser Vorstellung und streben in der Yogapraxis die Erkenntnis von oder die Vereinigung mit der allumfassenden Energie an, die im religiösen Sinn als Gott oder das Göttliche beschrieben wird.
Auch das Epos der Bhagavad Gita, das einen weiteren wichtigen Text in der Yogaliteratur darstellt, vertritt diese philosophische Richtung.
Bhagavad Gita (ca. 500 - 200 v. Chr)
Die Bhagavad Gita10 umfasst ungefähr 700 Verse und wird als Teil des Mahabharata-Epos11 angesehen. Der Text beschäftigt sich mit den purusharthas, den vier "menschlichen Lebenszielen":
In der Bhagavad Gita wird die vedische Ansicht vertreten, dass Erleuchtung nur dann stattfinden könne, wenn die Identifikation des Geistes mit dem sterblichen Ego - dem "falschen Selbst" - aufgehoben ist, und der Mensch sich mit dem reinen, unsterblichen Selbst (= Atman) identifiziert. Dieser Idee nach ist das Lebensziel des Menschen (und damit auch das Ziel des Yogas), den Geist von der Illusion zu befreien und ihn allein auf die Realität der universellen Energie (= Brahman) zu konzentrieren.
Diese Philosophie wird in Form einer Geschichte vermittelt, die sich um das moralische Dilemma des mächtigen Kriegers Arjuna dreht. Am Vorabend einer großen Schlacht, die zwei mächtige Familien vernichten wird, hadert Arjuna mit seinem Schicksal, soll er doch gemäß seines Berufsethos in den Kampf ziehen, obwohl er Verwandte und Freunde auch auf der gegnerischen Seite hat. Er will nicht kämpfen und geliebte Menschen töten, doch in einem langen Gespräch mit dem Gott Krishna erklärt dieser Arjuna vier Yogawege, deren Weisheiten ihm helfen, sein Dilemma zu überwinden und trotz des voraussehbaren Unglücks, Erfüllung und Erleuchtung im Leben zu finden.
Die vier Yogawege werden in 18 Kapiteln beschrieben: das Yoga der Hingabe (= Bhakti Yoga), der Handlung (= Karma Yoga), der Meditation (= Dhyana Yoga) und des Wissens (= Jnana Yoga).
Manche Interpreten denken, dass in der Anordnung der Yogawege ein progressiver Charakter zu erkennen ist. Auf der Basis von Glauben und Hingabe können wir Selbstlosigkeit erlernen. Dies leitet uns zur Kontrolle des Geistes und diese wiederum führt zur Erkenntnis des "wahren Selbst". Alle vier Yogawege müssen berücksichtigt und praktiziert werden, man kann jedoch ihre Gewichtung individuell ausgelegen.
Bhakti Yoga: Yoga der Hingabe
Im Bhakti12 Yoga findet der Praktizierende durch die Kraft seines Glauben Erleuchtung, dies wird oft mit der Erkenntnis des Göttlichen und der Liebe zu Gott gleichgesetzt. Bhakti Yoga hat die Identifikation des Individuums mit Gott durch Liebe zum Ziel und steht für das Vertrauen in einen göttlichen Plan und für absolute Ergebenheit an eine höhere Aufgabe. So weist Krishna
Arjuna an:
BG XVIII.65
Sei dir meiner immer bewusst, verehre mich, mache jede deiner Handlungen zu einer Opfergabe an mich, und du wirst zu mir kommen, das verspreche ich, denn du stehst mir nah.
Arjuna kann darauf vertrauen, dass Gott ihn nicht verlassen wird, egal was geschieht. Krishna beschreibt hier die positiven Aspekte des Glaubens:
BG XVIII.70+71 Diejenigen, die über diese heiligen Worte meditieren, verehren mich mit Weisheit und Hingabe. Auch die, die diese Worte glaubend hören und frei von Zweifel sind, werden eine glücklichere Welt finden, in der gute Menschen wohnen.
Der Glaube an einen größeren Zusammenhang aller Dinge hilft uns zu erkennen, dass aus Unglück und Schicksalsschlägen etwas Gutes und Notwendiges erwachsen kann. Tiefer Glaube unterstützt Menschen darin, selbst in den schlimmsten Lebenslagen nicht zu verzweifeln, und er hilft, nicht zu resignieren oder verrückt zu werden.
Bhakti gilt darüber hinaus als eine Metapher für die Liebe zu allen Lebewesen und allem, was existiert. Nur die Kraft der Liebe hält die Menschen davon ab, einander umzubringen. Sie kann negative Impulse ausgleichen, welche meistens aus Instinkt oder Verzweiflung heraus geboren werden. Wenn wir Liebe und Mitgefühl in uns entwickeln, können wir in Harmonie mit uns selbst und mit unserer Umgebung leben. Das wiederum verhilft unserem Geist zu einem ausgeglichenen Zustand und reduziert negative Erfahrungen und Leiden.
Menschen mit einem stark emotionalen Temperament oder einer tiefen religiösen Überzeugung konzentrieren sich meistens auf Bhakti Yoga. Jeder wirklich religiöse Mensch – unabhängig davon, welcher Religion er angehört - folgt dem Pfad des Bhakti-Yogas. Wir können uns Jesus als einen Bhakti-Yogi vorstellen, denn er predigte die Liebe zu Gott wie auch zu den Menschen.
In Indien wird Bhakti Yoga in verschiedenen Formen praktiziert, z.B. durch Kirtan-Singen,13 das Singen von Mantras,14 Meditation über das Göttliche, Gebete, das Lesen und Schreiben ekstatischer Lyrik oder durch die Ausübung religiöser Rituale.
Im nicht-religiösem Sinn interpretieren wir Bhakti als absolute Hingabe an das, was wir tun. Diese Hingabe unterstützt den Geist, sich auf die vor uns liegende Arbeit zu konzentrieren und fokussiert zu bleiben. Ein nicht-religiöser Mensch kann Bhakti Yoga als den Glauben an sich selbst und sein "Gut-Sein" verstehen.
Karma Yoga: Yoga des selbstlosen Tuns
Diese Form von Yoga ist besonders für Menschen mit einem aktiven Temperament geeignet, da es das Ego einer starken Kontrolle unterwirft und Egoismus zügelt.
Krishna erklärt, Arjuna müsse seine Handlungen ausführen, ohne auf die Wünsche seines Egos zu achten. Es werde ihm geboten, selbstlos zu handeln und es wird ihm versprochen, er werde erfolgreich sein, wenn er seinen Pflichten nachkommt und nicht emotional von den Früchten seiner Arbeit abhängig ist. Was hier angesprochen wird, ist die Auffassung, dass die Freude an unserer Arbeit wichtiger sein sollte als z.B. das Geld, das wir mit einer Arbeit verdienen.
BG II.47
Du hast ein Recht auf Arbeit, aber kein Recht auf die Früchte deiner Arbeit. Du sollst nicht nur für den Gewinn arbeiten, noch sollst du dich danach sehnen, nicht arbeiten zu müssen.
Krishna beschreibt weiter, welche Gefahr es mit sich bringt, wenn man sein Leben nur auf die Befriedigung der Sinne hin ausrichtet.
BG II.62+63
Wer ständig nur an die Objekte der Sinnesbefriedigung denkt, der macht sich von ihnen abhängig. Abhängigkeit erzeugt Sehnsucht, die Lust nach Besitz, die sich zur Wut formt (wenn man nicht bekommt, was man möchte). Wut bewölkt das Urteilsvermögen und verhindert, dass wir aus Fehlern lernen. Verloren ist dann die Kraft zur Unterscheidung von Weisem und Nicht-Weisem. Dein Leben ist dann reine Verschwendung.
Viele Menschen verspüren heutzutage so ein Gefühl der Sinnlosigkeit. Sie gehen einer Arbeit nach, die auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, aber keine innere Befriedigung mit sich bringt. Um die Leere zu füllen, streben sie nach noch mehr Geld, noch mehr Besitz und Konsumgütern und sind doch nie zufrieden. Karma Yoga weist darauf hin, dass wahre Zufriedenheit nicht in materiellen Dingen liegt, sondern nur in uns selbst zu finden ist.
Es verlangt, auf Gewinnstreben zu verzichten und unsere Handlungen nicht auf eine persönliche Bereicherung hin auszurichten. Mit der Ausübung von Karma Yoga reduziert man Stolz, Selbstsucht und Egoismus, mit der Zeit können diese Eigenschaften sogar ablegt werden.
Viele Yogatraditionen verlangen von ihren Schülern in der einen oder anderen Form freiwillige und unbezahlte Arbeit, damit sie auf diese Weise Karma Yoga verinnerlichen. In einem indischen Ashram wird Karma Yoga üblicherweise dadurch geleistet, indem man bei der Verwaltung und Instandhaltung des Ashrams hilft, sei es durch Toilettenputzen, Mitarbeit in der Küche oder die Ausübung einer unbezahlten Tätigkeit, die zum Funktionieren und zur Erhaltung der Gemeinschaft beiträgt. So gesehen ist alles Karma Yoga, das ohne persönliche Bereicherung für die Gemeinschaft geleistet wird. Das kann genauso gut ein Freiwilligendienst bei einer Rettungsorganisation sein wie unentgeltliche Mitarbeit bei sozialen Projekten.
Dhyana Yoga: Yoga der Beherrschung, des Willens
Das Ziel von Dhyana Yoga ist es, in der Körper-Geist Beziehung innere Harmonie und Ausgeglichenheit herzustellen. Die Beherrschung und Kontrolle des Geistes steht im Mittelpunkt aller Übungen. Durch Dhyana Yoga wird Selbstbeherrschung erlernt, die jedoch nicht eine Unterdrückung der Triebe und Instinkte zur Folge hat, sondern bestrebt ist, diese starken Kräfte zu kontrollieren. Sind die instinktiven Kräfte "gezähmt", dann können wir sie gezielt zu unserem Wohle einsetzen, und ihre destruktiven Anteile vermögen nicht mehr so viel Schaden anzurichten. Da dieser Yogaweg den Geist unter die Kontrolle des Willens bringt, ist er besonders für Personen mit stark individualistischer Prägung geeignet.
In Indien wird der Geist als "König" (Sanskrit raja) der psychophysischen Struktur angesehen, deswegen wird Dhyana Yoga auch häufig als Raja Yoga bezeichnet. Der Begriff Raja Yoga ist ein Retronym, das in dem relativ "jungen" Buch der Hatha Yoga Pradipika (ca. 15. Jahrhundert) verwendet wurde, um Dhyana/ Raja Yoga vom "neuen Trend" des Hatha Yogas zu unterscheiden.
Ashtanga Yoga wird wegen seines Fokuss auf die Kontrolle des Geistes dem Raja Yoga zugeordnet, wobei die Erkenntnisse und Weisheiten der anderen Yogawege von Patanjali in dieses System integriert wurden.
Jnana Yoga: Yoga der Erkenntnis
Jnana-Yoga zieht intellektuelle und logisch denkende Menschen an, weil es den Schleier der Unwissenheit beseitigt und Wissen als das höchste Ziel ansieht. So wird das Studium heiliger und weiser Bücher und Meditation empfohlen, die uns die wahre Natur der Objekte und deren Substanz entschleiert.
Nach vedischer Ansicht ist die wahrnehmbare Welt eine Illusion (Maya) und Aufgabe des Menschen ist es, das "wahre, göttliche Selbst" (Atma) in sich zu erkennen und so zwischen wahr und falsch unterscheiden zu können. Damit dies möglich ist, brauchen wir Erkenntnis und einen geschärften Verstand. Mit einem tieferen Verständnis für die größeren Zusammenhänge und die wahre Natur der Dinge reduziert sich die Gefahr, in die Irre zu gehen und Fehler auf Grund falscher Information zu begehen.
Jnana Yoga lehrt vier Mittel, die uns das ermöglichen:
Viveka
– Unterscheidung: Durch eine genaue Differenzierung entwicklen wir die Fähigkeit, zwischen dem, was real und ewig ist (in den Upanischaden als Brahman bezeichnet) und dem, was nicht-real und temporär ist (= Maya) zu unterscheiden.
Vairagya
– Leidenschaftslosigkeit: Durch diese Praxis wird man in die Lage versetzt, sich von allem zu lösen, was "vorübergehend", also vergänglich ist. So kann man sich auf die Erkenntnis des Absoluten (Brahman) konzentrieren. Selbst der