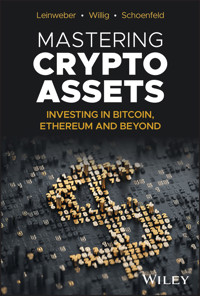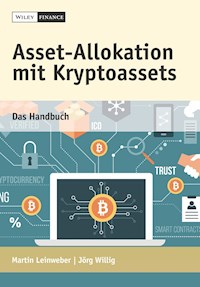
43,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Niedrige Zinsen und eine höhere Inflation setzen Kapitalanleger unter Handlungsdruck. Vor der Aufgabe des langfristigen Kaufkrafterhalts stehen private Anleger ebenso wie Stiftungen, Pensionskassen, Staatsfonds und Family Offices. Institutionelle Investoren wenden sich daher schon seit Jahren alternativen Anlagen wie Venture Capital oder Private Equity-Beteiligungen zu. Schrittweise wächst auch die Aufgeschlossenheit gegenüber neuen digitalen Assets.
Die Informationen zu dieser Anlageklasse sind jedoch noch fragmentiert und lückenhaft. Folgerichtig zählt die Londoner "Economist Group" das mangelnde Verständnis zu den größten Hindernissen auf dem Weg zur Allokation von Kryptoassets.
Praxisorientierte Darstellung aus Sicht der Investoren
"Asset-Allokation für Kryptoassets" ist das erste Handbuch für die Integration digitaler Assets in Anlageportfolios. Martin Leinweber und Jörg Willig beantworten die relevanten Fragen aus der Perspektive von Investoren und lassen dabei ihre langjährige Erfahrung als institutionelle Portfolio Manager einfließen.
Neben einer Darstellung der Entstehung digitaler Assets und der dahinterstehenden Motivation gehen die Autoren ausführlich auf die für Anleger wichtigen Themengebiete ein.
- Taxonomie und Bewertung von Kryptoassets
- Kryptoassets als eigenständige Assetklasse
- Chancen und Risiken im Vergleich zu anderen Anlagen
- Gegenüberstellung von Krypto-Aktien und Kryptoassets
- Allokationsquoten von Kryptoassets in der Asset-Allokation
- Integration digitaler Assets in bekannte Langfriststrategien
- Anlagemöglichkeiten und verfügbare Instrumente
- Entwicklung der Marktinfrastruktur und Dienstleister
Mit "Asset-Allokation mit Kryptoassets" zeigen die Autoren, wie private und professionelle Anleger digitale Assets in ihre Portfolios integrieren können.
Interviews
Abgerundet wird das Buch durch Interviews mit Spezialisten und einem Geleitwort von Alexander Höptner (BitMEX). Mit den Autoren sprachen:
- Patrick Karb (Hauck & Aufhäuser Innovative Capital)
- Thomas Kettner (MV Index Solutions),
- Max Lautenschläger (Iconic Holding)
- Bernadette Leuzinger (Crypto Finance Gruppe)
- Prof. Dr. Philipp Sandner (Frankfurt School Blockchain Center)
- Désirée Velleuer & Reto Stiffler (Crypto Consulting, SwissRex)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Alle Bücher von WILEY-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
© 2022 Wiley-VCH GmbH
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Print ISBN: 978-3-527-51071-9ePub ISBN: 978-3-527-83815-8Umschlaggestaltung: Christian Kalkert,Birken-HonigsessenCoverbild: elenabsl - stock.adobe.com
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Geleitwort
Notiz
Vorwort
Danksagung
1 Einführung
Aus der Vision in den Alltag
Anmerkungen zu Darstellungen und Schreibweisen
Anmerkungen
2 Der Bitcoin – eine kurze Historie
Von der Tankkarte zum Trustless Payment System
Enter Satoshi Nakamoto
Enter Bitcoin
Bitcoin versus Blockchain
Einsatzfelder
Die Bausteine des Bitcoin
Die treibenden Kräfte hinter Bitcoin
Bitcoin-Mythen
Fazit: Die Geschichte schreitet voran
Experteninterview mit Prof. Dr. Philipp Sandner
Anmerkungen
3 Das Kryptobiotop
Die Taxonomie der Kryptowährungen
Fazit Kryptobiotop
Experten-Interview mit Max Lautenschläger
Anmerkungen
4 Bewertung von Kryptoassets
Angebot und Nachfrage
Der Netzwerkeffekt und Metcalfe's Law
Bewertung von Kryptoassets mit Cashflow
Bewertung von DeFi-Token
Statistischer Ansatz
Fazit Bewertung
Experteninterview mit Désirée Velleuer & Reto Stiffler
Anmerkungen
5 Kryptos als Assetklasse
Merkmale einer Assetklasse
Wie groß ist der Kryptomarkt?
Handelsvolumina am Kryptomarkt
Die Lebenszyklen des Bitcoin
Der Vergleich zu Gold
Der Vergleich zu Geld
Korrelationen
Zinsen auf Kryptos
Rendite – The sky and other limits
Vergleich zu anderen Assetklassen
Kryptoaktien: Alternative, Ergänzung oder keines von beidem?
Fazit Kryptos als Assetklasse
Experteninterview mit Bernadette Leuzinger
Anmerkungen
6 Asset-Allokation
Ausgangssituation
Alternative Allokation: Enter Bitcoin
Bekannte Asset-Allokation-Ansätze
Special: Bitcoin & Gold
Die everyield-Allokation: real und digital
Zusammenfassung aller Allokationen
Fazit Asset-Allokation
Experteninterview mit Patrick Karb
Anmerkungen
7 Index Investments
Historie der Index Investments
Digital-Asset-Indizes
Custom Indexing: Indizes im Eigenbau
Aktive Indizes: mit Disziplin zur Outperformance
Fazit Index Investments
Experteninterview mit Thomas Kettner
Anmerkungen
8 Ausblick
Die Institutionalisierung des Krypto-Ökosystems
Das Krypto-Ökosystem in der Region DACHLI
Tokenisierung
Anlageformen
Derivate und synthetische Assets
Nehmen Sie den Wandel an!
Anmerkungen
Über die Autoren
Abkürzungsverzeichnis
Literatur
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abb. 1.1: Darstellung linearer und semi-logarithmischer Skalierung
Abb. 1.2: Bitcoin: Protokoll, Netzwerk, Coin
Kapitel 2
Abb. 2.1: Webseite Bitcoin.org
Kapitel 3
Abb. 3.1: Marktkapitalisierung der Top-10-Währungen
Abb. 3.2: Marktkapitalisierung der Top-10 Smart-Contract-Plattformen
Abb. 3.3: Durchschnittliche Gebühren pro Transaktion im Ethereum-Netzwerk
Abb. 3.4: Anzahl der USD-Tether-Transaktionen auf Ethereum und TRON
Abb. 3.5: Marktkapitalisierung der Top-10 Centralized Exchanges
Abb. 3.6: Marktkapitalisierung der Top-10 Stablecoins
Abb. 3.7: Kategorisierung von Stablecoins
Abb. 3.8: Preisverlauf des algorithmischen Stablecoin Ampleforth
Abb. 3.9: Kursverlauf von Stablecoins seit Januar 2020
Abb. 3.10: Marktkapitalisierung der Top-10 Privacy Coins
Abb. 3.11: Marktkapitalisierung der Top-10 im Sektor Decentralized Finance
Abb. 3.12: Decentralized-Finance-Schichtmodell
Abb. 3.13: Total Value Locked (TVL) in US-Dollar im Sektor Decentralized Fin...
Abb. 3.14: Total Value Locked (TVL) in Ether im Sektor Decentralized Finance...
Abb. 3.15: Marktkapitalisierung der Top-10 Decentralized Exchanges
Kapitel 4
Abb. 4.1: Anteil der Bitcoin, die mindestens ein Jahr lang nicht gehandelt w...
Abb. 4.2: Bitcoin auf mit Börsen assoziierten Adressen
Abb. 4.3: Stock-to-Flow für Bitcoin und Edelmetalle
Abb. 4.4: Bitcoin-Preisprognose aus dem Stock-to-Flow-Modell
Abb. 4.5: Hashrate und Umsatz der Miner im Bitcoin-Netzwerk
Abb. 4.6: Anzahl aktiver Adressen im Bitcoin-Netzwerk
Abb. 4.7: Bitcoin-Whale-Index (Anzahl der Adressen mit mehr als 1000 Bitcoin...
Abb. 4.8: Assetklassen im Größenvergleich
Abb. 4.9: Entwicklung von Kosten und Nutzen eines Netzwerks
Abb. 4.10: Modellierung eines Wachstumsprozesses durch eine Gompertz-Funktio...
Abb. 4.11: Prognostizierte versus realisierte Werte der Anwendung von Metcal...
Abb. 4.12: Mangelnde Akzeptanz und negative Preisentwicklung des Bitcoin PoS...
Abb. 4.13: Modellierung der Entwicklung eindeutiger Adressen (unique address...
Abb. 4.14: Modellbasierte Projektion der Marktkapitalisierung des Bitcoin
Abb. 4.15: Abweichung des Bitcoinpreises vom Modellwert
Abb. 4.16: Umsatzstarke DeFi-Token
Abb. 4.17: Bewertung von SushiSwap im Vergleich zu traditionellen Handelsplä...
Abb. 4.18: Mittels Bootstrapping erzeugte Simulationspfade des Bitcoin
Abb. 4.19: Median, 25 %- und 10 %-Perzentil-Pfade der Simulation
Abb. 4.20: Aus der Simulation abgeleitete Verlustwahrscheinlichkeit
Kapitel 5
Abb. 5.1: Marktkapitalisierung des Kryptomarktes
Abb. 5.2: Marktkapitalisierung der größten Kryptoassets
Abb. 5.3: Anteil des Bitcoin am Gesamtmarkt
Abb. 5.4: Kursverlauf des Altcoins Steem
Abb. 5.5: Mittleres Handelsvolumen relevanter Coins (Juli 2020 bis Juni 2021...
Abb. 5.6: Bitcoin Handelsvolumen (Juli 2020 bis Juni 2021)
Abb. 5.7: Mittleres Handelsvolumen verschiedener Assets (Juli 2020 bis Juni ...
Abb. 5.8: Tägliches Handelsvolumen des Bitcoin
Abb. 5.9: Jährliches Wachstum des Angebots an Bitcoin und Gold
Abb. 5.10: Entwicklung der Zentralbankbilanzen
Abb. 5.11: Entwicklung der Kaufkraft des US-Dollar (US City Average, 1982/19...
Abb. 5.12: Jährliche Inflationsrate in Venezuela
Abb. 5.13: Zirkulierendes und maximales Angebot einiger Kryptoassets
Abb. 5.14: Die Anscombe-Grafiken
Abb. 5.15: Korrelationen verschiedener Assetklassen (2013-2020)
Abb. 5.16: Rollierende Korrelationen verschiedener Assetklassen zum Bitcoin ...
Abb. 5.17: Verteilung der Korrelationen verschiedener Assetklassen (2018-202...
Abb. 5.18: Rollierende Korrelationen innerhalb der Kryptoassets (2018-2021)...
Abb. 5.19: Verteilung der Korrelationen verschiedener Kryptoassets zum Bitco...
Abb. 5.20: Weltweit ausstehendes Volumen an globalen Staatsanleihen mit nega...
Abb. 5.21: Zinskurven USA und Deutschland
Abb. 5.22: Mittlere Rendite von US-High Yield-Anleihen
Abb. 5.23: Kursentwicklung des Bitcoin (19. August 2011 = 100)
Abb. 5.24: Jährliche Kursveränderungen des Bitcoin, Stand 22.6.2021
Abb. 5.25: Entwicklung des Bitcoin in verschiedenen Phasen
Abb. 5.26: Tägliche Veränderung des Bitcoin gegen den US-Dollar
Abb. 5.27: QQ-Plot der wöchentlichen Kursveränderungen des Bitcoin gegen den...
Abb. 5.28: Gesamtertrag von US-Large Cap Aktien
Abb. 5.29: Gesamtertrag von US-Staatsanleihen
Abb. 5.30: Gesamtertrag des breiten Rohstoffmarktes
Abb. 5.31: Gesamtertrag von Gold
Abb. 5.32: Trends von Aktien und Bitcoin
Abb. 5.33: Drawdowns von Aktien und Bitcoin
Abb. 5.34: Entwicklung der ‘Name Changer’-Aktie der Long Island Iced Tea aka...
Abb. 5.35: Auswirkungen technischer Disruption auf die Aktienkurse betroffen...
Abb. 5.36: Kursverlauf von Bitcoin und Kryptoaktien
Abb. 5.37: Verlauf eines Kryptoaktien-Portfolios im Vergleich zum Bitcoin
Kapitel 6
Abb. 6.1: Entwicklung des Case-Shiller-KGV des US-Aktienmarkts
Abb. 6.2: Reale Drawdowns von US-Aktien und Staatsanleihen
Abb. 6.3: Pufferfunktion von Staatsanleihen vom 19.2.2020 bis 23.3.2020
Abb. 6.4: Gewicht des Bitcoin in einem Minimum-Varianz-Portfolio
Abb. 6.5: Historische Drawdowns des Bitcoin (Quelle: messari.io, everyield.i...
Abb. 6.6: Auswirkungen des Rebalancing auf ein Portfolio aus 25 % REITs, Gol...
Abb. 6.7: Drawdowns eines Portfolios aus 25 % REITs, Gold, Staatsanleihen un...
Abb. 6.8: Struktur bekannter Asset-Allokations-Strategien
Abb. 6.9: Langfristige Entwicklung bekannter Asset-Allokations-Strategien
Abb. 6.10: Drawdowns bekannter Asset-Allokations-Strategien
Abb. 6.11: Entwicklung des Permanent Portfolio und der Warren Buffett-Alloka...
Abb. 6.12: Die All-Seasons-Allokation
Abb. 6.13: Entwicklung der All-Seasons-Allokation mit und ohne Bitcoin
Abb. 6.14: Drawdowns der All-Seasons-Allokation mit und ohne Bitcoin
Abb. 6.15: Die Permanent Portfolio-Allokation
Abb. 6.16: Entwicklung der Permanent Portfolio-Allokation mit und ohne Bitco...
Abb. 6.17: Drawdowns der Permanent Portfolio-Allokation mit und ohne Bitcoin...
Abb. 6.18: Die Global Market-Allokation
Abb. 6.19: Entwicklung der Global Market-Allokation mit und ohne Bitcoin
Abb. 6.20: Drawdowns der Global Market-Allokation mit und ohne Bitcoin
Abb. 6.21: Die Robert Arnott-Allokation
Abb. 6.22: Entwicklung der Rob Arnott-Allokation mit und ohne Bitcoin
Abb. 6.23: Drawdowns der Robert Arnott-Allokation mit und ohne Bitcoin
Abb. 6.24: Die Marc Faber-Allokation
Abb. 6.25: Entwicklung der Marc Faber-Allokation mit und ohne Bitcoin
Abb. 6.26: Drawdowns der Marc Faber-Allokation mit und ohne Bitcoin
Abb. 6.27: Die Endowment-Allokation
Abb. 6.28: Entwicklung der Endowment-Allokation mit und ohne Bitcoin
Abb. 6.29: Drawdowns der Endowment-Allokation mit und ohne Bitcoin
Abb. 6.30: Die Warren Buffett-Allokation
Abb. 6.31: Entwicklung der Buffett-Allokation mit und ohne Bitcoin
Abb. 6.32: Drawdowns der Warren Buffett-Allokation mit und ohne Bitcoin
Abb. 6.33: Allokation aus 90 % Gold und 10 % Bitcoin
Abb. 6.34: Entwicklung der everyield-Allokation aus Real Assets und Kryptoas...
Abb. 6.35: Drawdowns der everyield-Allokation
Abb. 6.36: Langfristige Entwicklung der everyield-Allokation aus Real Assets...
Abb. 6.37: Kennzahlen aller vorgestellten Asset-Allokations-Strategien
Kapitel 7
Abb. 7.1: US-Aktien: Large Caps vs. Small Caps im Vergleich zum Gesamtmarkt...
Abb. 7.2: US-Aktienmarkt: Auswirkungen unterschiedlicher Gewichtungsmethodik...
Abb. 7.3: Zusammensetzung der Large Cap Digital Asset Indizes von Bitwise un...
Abb. 7.4: Entwicklung der Large Cap Digital Asset Indizes von Bitwise und MV...
Abb. 7.5: Bitwise 10 Index (Large Caps) vs. Bitwise 70 Index (Small Caps) im...
Abb. 7.6: Bitwise 10 Index (Large Caps) vs. Bitwise 70 Index (Small Caps) im...
Abb. 7.7: Entwicklung monatlicher Volatilitäten im Goldmarkt
Abb. 7.8: Entwicklung eines Portfolios aus fünf Kryptoassets
Abb. 7.9: Drawdowns eines Portfolios aus fünf Kryptoassets
Abb. 7.10: Bitcoin – Entwicklung Buy & Hold vs. Momentum
Abb. 7.11: Bitcoin – Drawdowns Buy & Hold vs. Momentum
Abb. 7.12: Volatilitätsgewichtete Sektorallokation von Kryptoassets
Kapitel 8
Abb. 8.1: Übersicht der Infrastruktur für Kryptoassets im Raum DACHLI
Abb. 8.2: Bitcoin-Handelsvolumen am Spot- und Derivatemarkt
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort
Danksagung
Fangen Sie an zu lesen
Über die Autoren
Abkürzungsverzeichnis
Literatur
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
3
4
7
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
271
272
273
274
275
276
277
279
280
281
282
Geleitwort
Egal ob Hedge Funds, Großbanken oder Millennials, viele Anleger diskutieren heute darüber, ob sie Kryptoassets in ihre Portfolios aufnehmen sollen, und wenn ja: Wie, zu welchem Zeitpunkt und wie viele?
Seit Jahresbeginn ist bei den Transaktionsvolumina der Kryptoassets ein sehr starker Aufwärtstrend zu beobachten; allein in den zwölf Monaten von Juni 2020 bis Juni 2021 stieg die Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährungen von knapp unter 260 Milliarden US-Dollar auf über 1,5 Billionen US-Dollar1.
Aufgrund dieses Wachstums und des dadurch geweckten Interesses von privaten und institutionellen Anlegern weltweit, befassen sich auch die Aufsichtsbehörden wesentlich stärker mit dieser Anlageklasse. Meines Erwartens wird dies wiederum dazu beitragen, eine bessere Marktinfrastruktur zu schaffen, und den Weg ebnen für eine breitere Akzeptanz von Kryptoassets.
Auch aus der Sicht traditioneller Finanzdienstleistungsunternehmen sieht man erste Zeichen des Wohlwollens gegenüber Kryptoassets. Oft werden insbesondere die Vorteile der Kryptoassets hervorgehoben, wie der globale real-time Zahlungsverkehr, die Programmierbarkeit von Token sowie die rund um die Uhr aktive Marktinfrastruktur und die damit verbundene Liquidität der Assets. Ich bin überzeugt davon, dass dieser technologische Wandel die Finanzmärkte ins 21. Jahrhundert katapultieren wird und selbst traditionell eher risikoaverse Unternehmen sich alsbald der Anlageklasse »Krypto« annähern werden.
Das Buch von Martin Leinweber und Jörg Willig erscheint zu einem wichtigen Zeitpunkt und es besteht größere Notwendigkeit denn je, die Bedeutung und Opportunitäten von Kryptoassets besser zu verstehen. Asset-Allokation mit Kryptoassets kann hier maßgeblich zu einem besseren Verständnis beitragen, unabhängig davon, ob Sie ein High-Frequency Trader sind, der eine algorithmische Strategie verfolgt, oder ein institutioneller Portfolio-Manager, der einen diversifizierten Ansatz in verschiedenen Anlageklassen anstrebt.
Martins und Jörgs Bemühungen haben sich gelohnt, wenn die bereitgestellten Informationen über Kryptoassets auch nur geringfügig dazu beitragen, dass Anlageverwalter ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen.
Ich persönlich sehe klare Vorteile im Handel von Kryptoassets und freue mich auf die digitale Zukunft der Kapitalmärkte.
August 2021
Alexander Höptner, Chief Executive Officer, BitMEX
Notiz
1
https://coinmarketcap.com/charts/
.
Vorwort
Die Themen Kryptoassets und Asset-Allokation könnten jedes für sich mehrere Regalreihen füllen. Es ist daher keine leichte Aufgabe, beide in einem Buch zu behandeln. Dennoch ist es wichtig, diesen Schritt zu gehen, denn in der Schnittmenge von klassischen Kapitalanlagen und den neuen digitalen Assets entsteht gerade die Zukunft der Asset-Allokation. Uns geht es weder um Krypto-Maximalismus noch um den Erhalt des Status quo, sondern um die Integration von alter und neuer Welt. In Zeiten, in denen Staatsanleihen mit einem Gesamtwert von mehr als 40 Billionen US-Dollar eine negative Realrendite aufweisen, müssen Investoren über neue Instrumente nachdenken. Zu den möglichen Alternativen in der Asset-Allokation zählen auch die digitalen Assets.
In diesem Buch gehen wir nicht der Frage nach, welche Kryptowährung es in fünf Jahren noch gibt, oder wie hoch oder tief deren Kurs dann sein mag. Auch die Frage, welches digitale Token aktuell in einer bestimmten Marktnische aus technischer Sicht herausragt, ist für strategisch orientierte Kapitalanleger nicht relevant. Schon auf Grund der frühen Entwicklungsphase vieler Projekte sowie der offenen regulatorischen Aufgaben sind derartige Fragen kaum seriös zu beantworten. Wir stellen Möglichkeiten der Integration dieser neue Assetklasse in den Anlageprozess professioneller Investoren vor und zeigen, mit welchen Auswirkungen gerechnet werden sollte. Dazu gehören ausführliche Darstellungen möglicher Anlagequoten und der damit verbundenen Chancen, aber auch offene Worte zu den Risiken von Kryptoassets.
Als wir dieses Buchprojekt starteten, notierte Bitcoin bei 7000 US-Dollar, die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptoassets betrug 180 Milliarden US-Dollar und das Thema Decentralized Finance spielte kaum eine Rolle. Auf Grund der enormen Veränderungen mussten wir einige Kapitel mehrmals überarbeiten und aktuelle Entwicklungen aufnehmen. Unternehmen wie MicroStrategy und Tesla investierten in Bitcoin, PayPal integrierte das Kryptoasset in seine Prozesse und El Salvador erklärte Bitcoin sogar zum öffentlichen Zahlungsmittel. Autoren, die ein Buch von bleibendem Wert über einen so dynamischen Sektor schreiben, wandeln auf einem schmalen Grat zwischen größtmöglicher Aktualität und der Einhaltung des Abgabetermins. Schlussendlich geht es uns aber mit diesem Buch nicht um die täglichen Veränderungen von Kursdaten und Handelsvolumina, sondern um langfristig erkennbare Tendenzen und die Bereitstellung von Informationen, die für unsere Leser auch zukünftig informativ und nützlich sind.
Professionelle Anleger haben weder Zeit noch Lust, sich auf Kanälen wie Twitter, Telegram, Reddit, Slack, Medium oder in verschiedenen Blogs über einzelne Aspekte der digitalen Assets zu informieren. Daher halten wir ein Buch für eine wichtige Ergänzung zu diesen fragmentierten Informationskanälen. Es ist das richtige Medium, wenn es eine disziplinierte Selektion der verfügbaren Daten, Informationen und Zusammenhänge mit dauerhaftem Informationsgehalt beinhaltet.
Wenn wir es schaffen, zu einer größeren Aufgeschlossenheit gegenüber dieser neuen Assetklasse beizutragen, dann haben wir unser Ziel erreicht.
August 2021
Martin Leinweber und Jörg Willig
Danksagung
Wir bedanken uns beim Wiley-Verlag, der unser Projekt von Anfang an unterstützt hatte. Insbesondere gilt unser Dank unserem Lektor Markus Wester, der für Fragen und Feedback immer zur Verfügung stand.
Erich Kästner sagte schon »Kein Buch ohne Vorwort!«, daher vielen Dank an Alexander Höptner für das Erstellen eines Geleitworts.
Einen besonderen Dank widmen wir unseren Interviewpartnern Patrick Karb, Thomas Kettner, Max Lautenschläger, Bernadette Leuzinger, Prof. Dr. Philipp Sandner, Reto Stiffler und Désirée Velleuer.
Wir danken auch all jenen aus der Kryptoasset- und Finanz-Community, die Ideen, Ratschläge und Kommentare beigesteuert haben, insbesondere Matthias Albrecht, Mauro Casellini, Lucas Ereth, Susanne Fromm, Jens Geider, Marius Grieseler, Milko Hensel, Dr. Sven Hildebrandt, Dr. Gerhard Hinterhäuser, Marco Infuso, Itzik Joshua, Thomas Kramer, Julian Liniger, Dominik Poiger, Julian Richter, Felix Saible, Martin Schmidt, Paul Sengebusch, Dr. Daniel Alexander van Skye, Sigvard Wohlwend und Roger Wurzel. Wir bitten um Verzeihung, wenn wir jemanden vergessen haben, der uns auf dieser Reise begleitet hat.
Das gesamte Manuskript wurde mit der Software R in RStudio verfasst. Wir möchten an dieser Stelle allen Entwicklern und Unterstützern dieses Projekts danken, insbesondere Hadley Wickham, Yihui Xie, Matt Dancho und Richard Iannone, sowie der gesamten Community von stackoverflow.
Für die Inspiration und die daraus resultierende Motivation, dieses Buch zu schreiben, möchten wir uns bei Meb Faber, dem Mitgründer und CEO von Cambria Investment Management, und Raoul Pal, Gründer und CEO von Real Vision Group, herzlich bedanken.
Zu guter Letzt wollen wir uns für die Unterstützung unserer Familien bedanken, die uns in dieser Zeit ertragen mussten. Nebenberuflich ein Buch zu schreiben, bedeutet, jede freie Minute zu nutzen, frühmorgens, spätabends und an den Wochenenden. Ohne euch hätten wir das nie geschafft.
1Einführung
Yes, risk-taking is inherently failure-prone. Otherwise, it would be called sure-thing-taking.
Jim McMahon
Aus der Vision in den Alltag
Erfolgreiche Ideen brauchen Zeit. Viele Menschen halten an bekannten Dingen fest und begegnen möglichen Veränderungen zunächst mit Skepsis. Das war bei der Erfindung der Eisenbahn und des Automobils nicht anders als beim World Wide Web oder dem Mobiltelefon. Ein möglicher Grund dieser Zurückhaltung liegt in der unterschiedlichen Gewichtung der Chancen und Risiken einer neuen Entwicklung. So sorgten sich einige Bürger angesichts der ersten Eisenbahn über die möglichen Auswirkungen der hohen Reisegeschwindigkeit auf den menschlichen Körper. Die Vorteile eines sich rasch entwickelten Transportnetzes mit all seinen Möglichkeiten rückten erst später ins Blickfeld. Wie schnell sich Wahrnehmungen verändern können, zeigt das erst 1989 vom britischen Physiker Timothy Berners-Lee entwickelte und zunächst belächelte World Wide Web, einem Informationsdienst auf dem Internet. Heute ist für viele eine Welt ohne das Web kaum mehr vorstellbar, und die Vernetzung im Privatleben und in der Wirtschaft ist nahezu allumfassend.
Der Kapitalmarkt ist nur einer von zahlreichen Bereichen, in denen Kryptoassets zu grundlegenden Veränderungen führen werden. Eine kritische Haltung gegenüber dieser neuen Technologie ist daher nicht nur nachvollziehbar, sondern wünschenswert. Notwendig ist jetzt eine offene Diskussion, die nicht nur alle Aspekte der neu entstehenden Strukturen, sondern auch die guten und schlechten Seiten der derzeitigen Systeme umfasst. Auch Stillstand darf kein Selbstzweck sein.
Die Entwicklung des Computers ist ein bemerkenswertes Beispiel für den langfristigen Weg einer technischen Neuerung von den Tischen der Entwickler bis in das Wohnzimmer und die Hosentaschen der Anwender. Die heutzutage beiläufig stattfindende Nutzung von Höchstleistungselektronik lässt viele vergessen, wie lang der Weg bis hierher war.
Im Jahr 1949 beschrieb Edmund Berkeley in seinem Buch »Giant Brains, or Machines That Think« den ersten echten Personal Computer. Immerhin 400 dieser Maschinen mit dem Namen »Simon« wurden in den folgenden zehn Jahren verkauft. Ebenfalls von Berkeley stammt der GENIAC aus dem Jahr 1955. Das Akronym steht für den wundervollen Namen »Genius Almost-Automatic Computer«.
Von der Leistungsfähigkeit heutiger Hard- und Software wagten damals nur wenige zu träumen. Dennoch sahen Optimisten schon frühzeitig viele der kommenden Möglichkeiten der Computertechnologie voraus. Zwar wurde manche Entwicklung langsamer als erwartet realisiert, denn jeder Fortschritt brachte neue Schwierigkeiten mit sich, die schließlich aber von den Forschern und Ingenieuren überwunden wurden.
Die stetigen Verbesserungen führten zu einem über Jahrzehnte anhaltenden exponentiellen Anstieg der Rechenleistung.1 Simultan wuchs das theoretische Fundament und die Entwicklung von Software entwickelte sich zu einem neuen Industriezweig, der immer leistungsfähigere und bedienbare Applikationen schuf. Der Fortschritt mündete letztendlich in der vollständigen Entkoppelung der Endanwender von den hinter einer Anwendung stehenden Prozessen. Jeder, der will, kann die Apps auf einem Smartphone benutzen. Hochkomplexe Technologien, von Visionären erdacht und von großartigen Entwicklern über Jahrzehnte entwickelt, evolutionär verbessert und immer wieder revolutioniert, sind im Alltag angekommen.
Auch im Finanzsektor führten die beschriebenen technischen Veränderungen zu einer Revolution. Das bargeldlose Bezahlen wurde zu einem alltäglichen Vorgang, was in den meisten Fällen auch für das Online-Banking gilt. Von diesem Punkt aus ist die Integration von Kryptoassets in den Alltag der Menschen technologisch betrachtet nur ein kleiner Schritt. Auch die regulatorischen Vorbereitungen laufen bereits. Die Möglichkeiten, die diese digitalen Assets für Investoren mit sich bringen, sind weitreichend. Im Vordergrund stehen Kosteneinsparungen, sofortiges Settlement und die vollständige Transparenz aller Transaktionen. Die technologische Evolution wird sich jedoch nicht mit diesen Punkten zufriedengeben, sondern ambitionierte Ziele ins Visier nehmen. Ein naheliegendes Beispiel ist die Generierung sicherer digitaler Token, die einen anteiligen Besitz an beliebigen physischen Assets wie Immobilien oder Kunstwerken repräsentieren. Eine derartige Entwicklung brächte völlig neuen Möglichkeiten für die Asset-Allokation mit sich.
Anmerkungen zu Darstellungen und Schreibweisen
Eine besondere Herausforderung bei der Betrachtung einer so jungen Assetklasse wie Kryptos sind die Vielzahl ständig neu entstehender Projekte. Ähnlich wie bei der Entstehung des Web ist nicht seriös zu prognostizieren, welches Projekt sich durchsetzen und welches scheitern wird. Eine solche Fragestellung würde der Vielfalt möglicher Anwendungsfälle auch nicht gerecht. Viele Projekte, die in zehn Jahren im Mittelpunkt stehen werden, existieren möglicherweise noch gar nicht. Ähnlich gelagert ist der Fall bei der Abbildung von Kursverläufen und Marktwerten dieses oder jenes Kryptoassets. Wir haben die Abbildungen so aktuell wie möglich gehalten, doch mit dem Abgabetermin des Manuskripts wird aus jeder dynamischen Entwicklung ein statischer Chart. Allein im Zeitraum zwischen dem Beginn der Arbeit am Manuskript und dem Abgabetermin bewegte sich der Kurs des Bitcoin in einer Spanne zwischen 5277 und 60 984 US-Dollar. Wenn Sie dieses Buch in die Hand nehmen, werden sich viele Preise deutlich verändert haben. Alle Abbildungen dienen daher ausdrücklich keiner Kursprognose oder der Annahme, ein bestimmter Trend würde sich fortsetzen oder auch nicht. Vielmehr dienen sie ausschließlich der Illustration bestimmter Entwicklungen, die auf dem Weg zu einem umfassenden Verständnis der neuen Assetklasse unterstützen sollen.
Skalierung in Charts
Bei der Abbildung sehr langfristiger Entwicklungen oder sehr starker Wachstumsverläufe an den Kapitalmärkten werden in der Regel Charts mit logarithmischen Preisskalen genutzt (log charts). Bei diesen Skalen sind nicht die absoluten, sondern die prozentualen Abstände zwischen zwei Punkten auf der Preisachse gleich groß. Somit werden prozentual gleich große Preisveränderungen immer auch gleich dargestellt (vgl. Abbildung 1.1).
Abb. 1.1: Darstellung linearer und semi-logarithmischer Skalierung
Der Informationsgehalt der Darstellung des Bitcoin-Preises mit linearer Preisskala ist gering, denn nahezu die gesamte Entwicklung bis 2016 wird zu einer Linie komprimiert. Ein solches Bild ist irreführend, denn es erweckt den falschen Eindruck, der Großteil der gesamten Preissteigerung habe erst in jüngster Zeit stattgefunden. Wir werden daher, dort wo es angeraten ist, auf die logarithmische Skalierung der Preisachse zurückgreifen.
Die Schreibweise von Bitcoin
Das Wort Bitcoin mit großem B bezieht sich auf das Protokoll und das Peer-to-Peer Netzwerk. Klein geschrieben steht das Wort bitcoin für den nativen Token2 dieses Netzwerks (vgl. Abbildung 1.2).
Abb. 1.2: Bitcoin: Protokoll, Netzwerk, Coin
Der Einfachheit halber werden wir das Wort Bitcoin stets großschreiben, da sich aus dem jeweiligen Kontext eindeutig ergibt, ob das Token oder das Protokoll gemeint ist. Die Bezeichnung Bitcoin wird in diesem Buch ausschließlich im Singular eingesetzt. In dieser Hinsicht folgen wir der üblichen Schreibweise.3
Anmerkungen
1
Moore's Law: Eine Faustregel des Intel-Mitgründers Gordon Earle Moore, nach der sich die Komplexität integrierter Schaltkreise in regelmäßigen Zeitabständen verdoppelt. Es gibt verschiedene kursierende Varianten mit unterschiedlichen Zeitspannen. Generell erwies sich die Kernaussage eines dauerhaften exponentiellen Anstiegs aus dem Jahr 1965 als bemerkenswert korrekt.
2
Nativer Token: Die direkt von einem Blockchain Protokoll wie Bitcoin geschaffene Kryptowährung, in der Transaktionskosten abgerechnet werden, und die zur Anreizsetzung bei der Netzwerksicherung dient.
3
Vgl. Antonopoulos (2017).
2Der Bitcoin – eine kurze Historie
»Breeding homing pigeons that could cover a given space with ever increasing rapidity did not give us the laws of telegraphy, nor did breeding faster horses bring us the steam locomotive.«
Edward J. v. K. Menge, 1930
Das Jahr 2009 hielt einen reichen Fundus an guten und weniger guten Nachrichten für die Menschheit bereit. In Sri Lanka endete der 25 Jahre lang andauernde Bürgerkrieg, die Schweinegrippe wurde von der WHO zu einer globalen Pandemie erklärt und Politiker in Zimbabwe nahmen mit dem mittlerweile dritten Zimbabwe-Dollar einen erneuten Anlauf zur Eindämmung der Hyperinflation. Außerdem beendete Tiger Woods seine Karriere als Profigolfer, der Autor Terry Pratchett wurde von der Queen geadelt und Uri Geller erwarb eine unbewohnte Insel, weil er Gerüchten zufolge dort einen ägyptischen Schatz vermutete. Auf globaler Ebene wurde Christiano Ronaldo für seine Leistungen im Vorjahr zum Weltfußballer gekürt, die Slowakei führte den Euro ein und die Volksrepublik China machte das Hanyu Pinyin zur offiziellen latinisierten Umschrift der chinesischen Sprache.
Die meisten dieser Geschehnisse sind nach einem kurzen Aufflackern im obligatorischen Jahresrückblick rasch in Vergessenheit geraten. Ein Ereignis, das bis heute nachwirkt, hat es seinerzeit gar nicht erst in eine Rückblende geschafft. Am 3. Januar 2009 startete ein unbekannter Entwickler das Bitcoin-Netzwerk.
Das Jahr 2009 war das zweite Jahr der größten Finanzmarktkrise der vergangenen 100 Jahre. Während auch tiefgreifende Krisen an den Börsen und Kreditmärkten nichts Ungewöhnliches sind, stellt das Ausmaß der im Zuge der Entwicklungen der Jahre 2008 und 2009 durchgesetzten Eingriffe in den Kapitalmarkt eine Zäsur dar.1 Seither stehen die Finanzmärkte unter dem Einfluss immer umfangreicherer Aktionen von Notenbanken, die an vielen Stellen die Mechanismen der freien Preisfindung ausgehebelt haben. Die einsetzende Gewöhnung der Marktteilnehmer an Zinssenkungen und regelmäßig aufgestockte Ankaufprogramme für Anleihen und Kreditverbriefungen, sobald das ökonomische Fahrwasser unruhiger wird, führte zu einem völlig verschobenen Anreizsystem. Ergänzend führen die niedrigen und teils negativen Zinssätze die klassischen Bewertungsansätze des Kapitalmarktes an ihre Grenzen. Die Resultate von Methoden, die seit Dekaden selbstverständlich genutzt wurden, sind nun oft kaum mehr anwendbar oder sogar irreführend und damit nicht nur nutzlos, sondern gefährlich.
Nahezu sämtliche Ventile, durch die sich der von Zeit zu Zeit entstehende Druck an den Finanzmärkten entladen konnte, wurden sukzessive geschlossen. Als finaler Druckbegrenzer verbleibt der größte aller Märkte, der globale Währungsmarkt mit einem täglichen Handelsvolumen von mehr als 6,5 Billionen US-Dollar.2 Auch in diesem Segment nutzen Zentralbanken seit jeher ihren Spielraum, Kursbewegungen zu beeinflussen, mal mit mehr und mal mit weniger Erfolg. Zwar erscheint der Einfluss der Zentralbanken kurzfristig oft übermächtig, doch den wichtigsten Faktor können auch diese Institutionen nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen: das Vertrauen der Menschen in eine Währung. Schwindet dieses Vertrauen, dann beginnen die Menschen, sich nach möglichen Alternativen umzuschauen.
Seit dem Beginn der Finanzkrise hat das Vertrauen in die globalen Finanzinstitutionen großen Schaden genommen. Die anhaltenden Markteingriffe der Zentralbanken und die ins Surreale abdriftenden eingesetzten Geldbeträge untergraben langsam aber stetig den Glauben der Menschen an die langfristige Stabilität vieler Währungen und greifen so das Fundament des globalen Finanzsystems an.3 So wurde in den vergangenen Jahren der Boden für die Akzeptanz möglicher Alternativen bereitet. Was fehlte, war die Ausweichmöglichkeit. Mit dem Start des Bitcoin-Netzwerkes und der Entstehung einer neuen Assetklasse begann die Entwicklung einer möglichen Alternative. Bevor das erste Kryptoasset das Licht der Welt erblicken konnte, mussten jedoch einige Giganten ihre Arbeit erledigen, auf deren Schultern der Entwickler des Bitcoin später steigen sollte.
Von der Tankkarte zum Trustless Payment System
Neben allen technischen Problemen, die es auf dem langen Weg hin zur Einführung eines funktionierenden, dezentralen Zahlungssystems zu überwinden galt, mussten auch die Menschen vom Nutzen digitaler Zahlungsmittel in der Praxis überzeugt werden. Auch der bargeldlose Zahlungsverkehr hatte zu Beginn mit viel Skepsis zu kämpfen.
Ein frühes Beispiel für den sinnvollen Einsatz bargeldlosen Zahlungsverkehrs lieferten in den 1980er-Jahren einige Tankstellenbesitzer in den Niederlanden. Zahlreiche Überfälle, bei denen das Bargeld geraubt wurde, führten zur Schaffung eines bargeldlosen Zahlungssystems. Die Eigner der Tankstellen wollten zum einen das finanzielle Risiko, aber auch die persönlichen Gefahren reduzieren und führten die Kartenzahlung ein. Die Kunden nahmen das System an und konnten an den teilnehmenden Tankstellen fortan per Karte bargeldlos bezahlen. Was heute selbstverständlich klingt, war seinerzeit ein bemerkenswerter Schritt.
Während die Kartenzahlung noch greifbar ist, existieren virtuelle Währungen nur noch innerhalb von Rechnern. Als solche startete im Jahr 1998 die Internet-Währung »Flooz«, deren Funktionsweise bekannten Bonuspunkt-Systemen ähnelt. Anwender konnten durch webbasierte Einkäufe Flooz verdienen, die sie dann bei Einkäufen über teilnehmende Webseiten wieder gegen Waren tauschen konnten. Ein Flooz entsprach dem Gegenwert von einem US-Dollar. Wie vergleichbare Projekte erreichte auch der Flooz nie die für einen Erfolg notwendige kritische Masse. Das Ende des ersten Internet Hypes zur Jahrtausendwende überlebte das System nicht.
Sowohl das Modell der Kartenzahlung in den Niederlanden als auch das Konzept des Flooz waren Unternehmungen, die sich an der Lösung spezifischer Probleme versuchten. Es gab jedoch schon zu Beginn der 1980er-Jahre Projekte, die einen wirklich großen Wurf wagten. Eines davon konzipierte David Chaum, ein bekannter Informatiker, der mehr als dreißig einschlägige Patente hält. Eines davon trägt den Titel »Blind Signature Systems«4 und stammt aus dem Jahr 1988. Schon Jahre zuvor hatte der damals bei der University of California, Berkeley, tätige Forscher und Entwickler mit der Veröffentlichung seines Papers »Untraceable Electronic Mail, Return Addresses, and Digital Pseudonyms« einen Meilenstein in der Geschichte der verschlüsselten digitalen Kommunikation gesetzt. Auch wenn die Titel der beiden Patente nicht auf digitale Währungen hinweisen, sind die von Chaum entwickelten Methoden elementare Bausteine von Kryptoassets.
Im Jahr 1989 finalisierte Chaum die Arbeit an einem Protokoll für eine digitale Währung, deren Namen eCash er für sein Unternehmen DigiCash schützen ließ. Das Konzept nutzte zahlreiche seiner Erkenntnisse, darunter die der »blind signature«5. Dieses Verfahren ermöglicht die Verifikation des Absenders einer Nachricht ohne die Offenlegung des enthaltenen Inhaltes und ist ein wichtiges Element bekannter Kryptoassets. Dem Unternehmen DigiCash und dessen digitaler Währung war dennoch kein langfristiger Erfolg beschieden. Der Aufstieg des E-Commerce hatte gerade erst begonnen, und die Anzahl der Nutzer konnte trotz der ausgezeichneten technischen Umsetzung nicht in ausreichendem Maße gesteigert werden. Technisch ähnelte eCash dem Aufbau von PayPal. Als problematisch stellte sich vor allem die Abhängigkeit von den für die Nutzung von eCash lizensierten Banken heraus. Zwar konnten durch die feste Anbindung an das bestehende Finanzsystem Schwierigkeiten bei rechtlichen Themen wie der Verhinderung von Geldwäsche vermieden werden. Andererseits wurde eCash dadurch für die Nutzer nicht attraktiver, denn es stellte durch die starre Anbindung an die existierenden Systeme kein unabhängiges Geldsystem dar.
Im Jahr 1998 meldete DigiCash Insolvenz an. Die Arbeit von David Chaum war jedoch nicht umsonst. Die von ihm entwickelten und in der Praxis erprobten Konzepte bereiteten den Boden für die nachfolgenden Entwicklungen. Vor allem die Notwendigkeit einer zentralen Autorität und die Abhängigkeit vom existierenden Banksystem stellten Hürden dar, die es zukünftig zu überwinden galt. Eines wurde allen Befürwortern einer digitalen Währung durch die zentrale Natur des eCash-Systems und die anhaltenden Probleme mit den Regulierungsbehörden spätestens zu dieser Zeit klar. Ein robustes und unabhängiges Geldsystem muss dezentral konzipiert sein.
Rund zehn Jahre nach dem Start von DigiCash konzipierte Wei Dai, ein chinesischer Hardware Entwickler, das digitale Geld b-Money6. In seinem Paper beschrieb Dai ein Protokoll, das schon viele Punkte des Bitcoin vorwegnahm. Beschrieben wurden beispielsweise die Möglichkeiten, den Rechenaufwand zur Lösung eines mathematischen Problems als proof-of-work zu nutzen und den beteiligten Rechner für seine geleistete Arbeit zu vergüten. Auch die Nutzung eines gemeinsamen Buchhaltungssystems (distributed legder), dessen Einträge kollektiv verifiziert und akzeptiert werden, wurde von Dai erwähnt. Über die Konzeptionsphase kam sein Protokoll zwar nie hinaus, es beeinflusste jedoch spürbar die nachfolgenden Entwicklungen. Zu Ehren von Wei Dai wurde die kleinste Einheit des Ether7, der wei, nach ihm benannt.
Ein weiterer bedeutender Pionier der digitalen Währungen ist der aus Ungarn stammende Nicholas Szabo. Im Jahr 1998 entwickelte der Informatiker mit dem bit gold-Protokoll einen direkten Vorläufer des Bitcoin, der essenzielle Bausteine seines Nachfolgers bereits erkennen ließ.8 Der Kern des bit gold-Protokolls ist das proof-of-work-Konzept, bei dem Szabo sich an der Arbeit von Adam Back orientierte. Dieser hatte ein Jahr zuvor einen entsprechenden Algorithmus geschaffen, der zur Vermeidung von Spam-Nachrichten und zur Vorbeugung gegen Distributed-Denial-of-Service Attacken9 in Netzwerken eingesetzt werden konnte. Das Konzept verhindert die unlimitierte Kommunikation von Netzwerkteilnehmern, indem es als Voraussetzung für die Akzeptanz einer übermittelten Nachricht eine vorher verrichtete Arbeit voraussetzt. Für DDoS-Angreifer oder Absender von Spam-Nachrichten entstünden somit bei jeder Anfrage oder versandten Nachricht ein Rechenaufwand. Die damit einhergehenden Kosten würden solche Angriffe teuer und damit unattraktiv machen.
Das Konzept des Nachweises geleisteter Rechenarbeit, das proof-of-work, ist ebenso einfach wie genial. Die Teilnehmer eines Netzwerks stellen Rechenleistung für die Lösung mathematischer Probleme zur Verfügung. Hat ein Rechner die Lösung einer Aufgabe gefunden, kann er diese in das Netzwerk kommunizieren. Da der Rechner seinen Arbeitseinsatz durch die Lösung der Aufgabe unter Beweis gestellt hat, kann nun ein Eintrag in das öffentliche Verzeichnis des Netzwerks erfolgen. Jeder Eintrag wird dann ein Teil der nächsten zu lösenden Aufgabe. So entsteht eine stetig länger werdende Kette an Einträgen, die durch den enormen investierten Rechenaufwand de facto unveränderlich ist. Diese Kette, mit allen jemals auf dem Netzwerk erfolgten Transaktionen, ist der Kern der global verteilten dezentralen Buchhaltung des Netzwerks, der distributed ledger.
Der Beitrag von Szabo zur Schaffung eines dezentralen Geldsystems ist außerordentlich. Lediglich das double-spend-Problem konnte Szabo mit seinem bit gold-Protokoll nicht zufriedenstellend lösen. Dabei handelt es sich um die Frage, wie sich in einem Zahlungssystem die mehrfache Ausgabe derselben Geldeinheit verhindern lässt. Bezahlt beispielsweise ein Käufer einen Musikdownload und kann die Dienstleistung nutzen, bevor die Transaktion final abgerechnet wurde, kann die selbe Geldeinheit für die Zahlung einer weiteren Dienstleistung genutzt werden oder einfach an eine andere Adresse gesendet werden. Die Lösung dieser schwierigen Aufgabe blieb vorerst offen. Wenn aber Nakamato sagen würde, er habe wie Newton auf den Schultern von Riesen gestanden, dann ist Szabo einer dieser Riesen.
Enter Satoshi Nakamoto
»If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants.«
Isaac Newton
Der nächste große Schritt war Satoshi Nakamotos Bitcoin-Protokoll, das der Entwickler in einem Whitepaper als Peer-to-Peer Bezahlsystem beschrieb. Das Protokoll kombiniert verschiedene Bausteine seiner Vorgänger und löst als Blockchain Anwendung auch das Problem des double spend. Alle Transaktionen finden direkt Peer-to-Peer zwischen den Teilnehmern in einem Netzwerk ohne zentrale Autorität und ohne zentrale Buchhaltung statt. Alle notwendigen Informationen sämtlicher Transaktionen werden in Daten-Blöcken gespeichert, die sequenziell zu einer Kette von Blöcken verknüpft werden, einer Blockchain. Die einzelnen Blöcke sind dabei über eine kryptografische Hashfunktion miteinander verkettet. Jeder Block beinhaltet so transformierte Informationen des vorangegangenen Blocks. Da sich dies durch die gesamte Kette hindurchzieht, kann kein einzelner Block verändert oder aus dieser Kette herausgelöst werden.
Die Mehrheit der Rechenleistung des Netzwerks einigt sich auf eine einzige valide Kette aus Blöcken. So entsteht eine stetig wachsende Reihe an Transaktionen, die mehrheitlich akzeptiert der korrekten Historie aller Transaktionen entspricht. Das Netzwerk übernimmt somit eigenständig die Schaffung neuer Einträge, die Überprüfung von Transaktionen auf Konsistenz mit der Transaktionshistorie und deren Fortschreibung. Eine zentrale Instanz ist ebenso überflüssig wie eine dritte, prüfende Partei. Auch die Datenhaltung ist ungewöhnlich. Die gesamte Blockchain ist auf jedem Knoten (full node) des Netzwerks vorhanden. Anstelle einer zentralen Datenhaltung werden die Daten im Netzwerk redundant vorgehalten. Die Datenmenge ist daher größer als bei einer zentralen Speicherung. Die Redundanz führt aber zu einer robusten Datenhaltung, denn der Ausfall einzelner Netzwerkknoten spielt für die Datensicherheit keine Rolle.
Enter Bitcoin
Der 31. Oktober 2008 markiert das Datum der Veröffentlichung des Bitcoin Whitepapers mit dem Titel »Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System«.10 Es ist bis heute nicht bekannt, ob sich hinter dem Decknamen Satoshi Nakamoto eine einzelne Person oder eine Gruppe von Entwicklern verbirgt.11
Während der Arbeit am Paper und bereits zwei Monate vor der Veröffentlichung registrierte Nakamoto die Domain »bitcoin.org« (siehe Abbildung 2.1). Das Eigentum an dieser Domain gab Nakamoto umgehend an mehrere Personen weiter, die nicht zum Kern der Bitcoin-Entwickler zählten. Nicht nur auf Ebene der Programmierung wurde die Gefahr einer Zentralisierung des dezentralen Projektes so von Beginn an minimiert.12
Abb. 2.1: Webseite Bitcoin.org
Am 3. Januar des Jahres 2009 war es soweit. Mitten in der größten Finanzkrise seit den 1930er-Jahren13 wurde mit dem Genesis Block der Ursprung der Bitcoin Blockchain gelegt. Dieser Block ist der erste Block, der jemals auf dem Bitcoin-Netzwerk erzeugt wurde. Da die Belohnung für Erstellung des Blocks im Rahmen des Mining seinerzeit bei 50 Bitcoin lag, entstanden zeitgleich mit diesem ersten Block auch die ersten 50 Bitcoin.
Der Zeitpunkt für den Start des Netzwerkes wurde nicht zufällig gewählt. Das globale Finanzsystem stand seinerzeit vor einem Komplettversagen. Ein Detail lässt einen Blick auf die Beweggründe Nakamotos zu, der mit der Erzeugung des ersten Blocks der Bitcoin Blockchain eine kurze Textnachricht übermittelte. Bei dieser Botschaft handelt es sich um das Zitat der Überschrift eines Artikels aus der englischen Tageszeitung The Times vom 3. Januar 2009, in dem über die Pläne des damaligen Finanzministers Alistair Darling berichtet wird, die britischen Banken im Rahmen einer erneuten Rettungsaktion mit hunderten Milliarden britischen Pfund zu stützen. Der kurze Text lautete »The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks«. Für Nakamoto stellte das Bitcoin-Netzwerk als bankenunabhängiges Peer-to-Peer-System für den globalen Zahlungsverkehr eine Alternative zum bestehenden, zentralisierten System dar.
Bitcoin versus Blockchain
Der Bitcoin ist als nativer Token des Bitcoin-Netzwerks nur eine Ausprägung einer Kryptowährung. Daher ist die bekannteste Kryptowährung kein Synonym für die Blockchain, sondern lediglich ihre bislang bekannteste Anwendung. Obwohl die folgenden Ausführungen sich spezifisch auf Nakamotos Entwicklung beziehen, gelten nachfolgend dargestellte Prinzipien auch für andere Kryptoassets.
Das System Bitcoin besteht aus mehreren Komponenten. Zum einen ist es die Client-Software, die jeder auf einem Computer installieren kann. Rechner, die diese Software nutzen, bilden die Knoten eines verteilten Netzwerks, über das die Kommunikation der Computer untereinander erfolgt. Neben der installierten Client-Software hält jeder Netzwerkknoten eine vollständige Version der aktuellen Blockchain mit allen jemals erfolgten Bitcoin Transaktionen in seinem Speicher.
Die Regeln des Netzwerks sind im Bitcoin-Protokoll definiert. Die Client-Software implementiert diese codierten Regeln, die unter anderem festlegen, wie neue Bitcoin entstehen, wer diese erhält und wie Transaktionen im Netzwerk verifiziert werden können. Die Mining-Rechner sind die Buchhalter des verteilten Netzwerks, die gemeinsam in einem dezentralen, redundant abgelegten Hauptbuch arbeiten. Für ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung einer fehlerfreien und unabänderlichen Buchhaltung werden die Miner mit neu geschaffenen Bitcoin belohnt. Zusätzlich können sie Transaktionsgebühren vereinnahmen.
Die Nutzung einer Blockchain und das ökonomische Anreizsystem für die Miner ermöglichen eine dezentrale und unabhängige Überprüfung sämtlicher Eigentumsverhältnisse und Transfers im Netzwerk. Die Übertragung von Bitcoin zwischen zwei Teilnehmern erfolgt direkt bilateral. Eine Rückabwicklung von Transaktionen im Falle von Fehleingaben oder Streitigkeiten ist nicht möglich. Bitcoin Transaktionen sind endgültig. Die Unabhängigkeit von jeglicher Drittpartei und die Finalität einmal ausgeführter Transaktionen sind die grundlegenden Unterschiede zwischen Blockchain-basierten und konventionellen Transaktionssystemen.
Im Gegensatz zu typischen Finanztransaktionen, bei denen sich die beteiligten Personen oder Organisationen durch einen Ausweis oder eine eindeutige ID identifizieren müssen, gibt es für die Nutzung des Bitcoin-Netzwerks keine derartige Anforderung. Um eine Transaktion ausführen zu können, muss eine Person oder Organisation nur einen privaten Schlüssel14 und eine Bitcoin-Adresse15 besitzen.
Anonymität jedoch, wie vielfach hervorgehoben, bietet der Bitcoin nicht. Vorsichtige Nutzer können zwar versuchen, die Transparenz der eigenen Transaktionen zu verschleiern. Der erreichbare Grad an Anonymität im Netzwerk wird jedoch überschätzt. Nach Aussagen von Forschern der Cornell Universität können bereits simple Webtracker und Cookies, die in viele Websites eingebettet sind, die Zuordnung von Bitcoin Transaktionen zu einer Person ermöglichen. In mehr als 60 % der untersuchten Fälle sei eine eindeutige Verknüpfung möglich.16 Es erfordert nur wenig Fantasie, sich vorzustellen, wie einfach die Zuordnung der meisten Transaktionen zu den ausführenden Personen ist, wenn nur genügend Daten systematisch zusammengefasst werden können. Schon jetzt gibt es Beispiele von Strafverfolgungsbehörden, die Straftäter auf Grund der von diesen im Zusammenhang mit den ausgeübten Vergehen durchgeführten Bitcoin-Transaktionen überführen konnten.17
Einsatzfelder
Ironischerweise ist Bitcoin auf Grund technischer Restriktionen und der unvermeidlichen Transaktionskosten kaum als Zahlungsmittel für eine Vielzahl kleiner Transaktionen geeignet. Nakamotos ursprüngliche Vision eines »Peer-to-Peer Electronic Cash System« erfüllt die von ihm geschaffene Kryptowährung in der aktuellen Form nicht. Inspiriert vom Bitcoin entwickelten sich jedoch andere Projekte, die für diesen Einsatzzweck besser geeignet sind. Trotz der Möglichkeiten, auch unter Nutzung des Bitcoin-Netzwerks eine Lösung für den alltäglichen Zahlungsverkehr zu schaffen, liegen dessen Stärken anderswo.
In den letzten Jahren kristallisierte sich die Vorteilhaftigkeit des Bitcoin-Netzwerks vor allem für zwei Anwendungen heraus. Zum einen sind dies grenzüberschreitende Großtransaktionen, die sich mit Kryptowährungen schnell und unbürokratisch, sehr günstig und ohne Settlement-Risiken18 durchführen lassen. Es spielt weder für die Kosten noch für die Dauer eines Transfers eine Rolle, ob sie einen einzigen oder 10 000 Bitcoin transferieren. Es spielt auch keine Rolle, ob sich diese Transaktion zwischen Ihnen und Ihrem Nachbarn oder einer Person auf der anderen Erdhalbkugel abspielt. Das Internet hat keine Grenzen und das Auslösen einer beliebig großen Transaktion ist nicht schwieriger als eine E-Mail zu versenden. Abwicklungssysteme werden ebenso wenig benötigt wie zwischengeschaltete Organisationen und das Settlement der Transaktion erfolgt umgehend. Die Bitcoin befinden sich entweder noch beim Sender oder bereits beim Empfänger. Zwischen diesen beiden Zuständen gibt es nichts, keinen Intermediär und damit auch kein entsprechendes Risiko.
Zudem entwickelt sich Bitcoin auf Grund des tendenziell abnehmend inflationären bis leicht deflationären Charakters zunehmend als zentralbankunabhängige Anlage ohne Zinsänderungs- oder Adressausfallrisiko. In Zeiten, in denen Zentralbanken nicht mehr die Geldwertstabilität, sondern mit der Steigerung der Inflationsrate den Kaufkraftverlust als primäres Ziel verfolgen, gewinnt dieser Punkt an Bedeutung.
Die Bausteine des Bitcoin
Während Blockchains und Bitcoin bereits seit einem Jahrzehnt existieren, nimmt die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren erst seit einigen Jahren zu. Der starke Anstieg des Bitcoin-Kurses und die damit verbundenen Schlagzeilen im Jahr 2017 führten erstmals zu einer Wahrnehmung von Kryptoassets durch breitere Bevölkerungsschichten. Während private Anleger vor allem von hohen Kursgewinnen angezogen wurden, galt das Interesse professioneller Anleger zunächst eher den Einsatzmöglichkeiten von Blockchain-Anwendungen in der Finanzbranche. Die neue Technologie hat offensichtliche disruptive Elemente, die einerseits enorme Prozessverbesserungen für Finanzunternehmen, vor allem für Asset-Manager, mit sich bringen. Andererseits stellt ein ausgereiftes und skalierbares Blockchain-basiertes System die Notwendigkeit klassischer Intermediäre und die mit diesen zwangsläufig verbundenen Kosten in Frage. Um sich den relevanten Fragen widmen zu können, ist ein grundlegendes Verständnis der Bitcoin-Terminologie notwendig.
Der Bitcoin ist der derzeit bekannteste Anwendungsfall einer Blockchain. Die Blockchain ist die zentrale Komponente des Bitcoin-Netzwerks, sie ist jedoch nicht gleichbedeutend mit dem Bitcoin. Blockchain-Anwendungen lassen sich für viele Zwecke nutzen, und das gesamte Bitcoin-System besteht nicht allein aus der Blockchain, sondern aus mehreren Komponenten. Das von Nakamoto ins Leben gerufene Zahlungssystem ist ein eher simpler Spezialfall der Nutzung einer Blockchain. Die Genialität des Bitcoin-Systems liegt nicht in der Blockchain allein, sondern in der sinnvollen Kombination verschiedener existierender Technologien zu einem effizienten Ganzen. Gerade in der Simplizität und der Beschränkung auf das Wesentliche liegen die Stärken des Protokolls. Je einfacher ein System ist, desto weniger Angriffspunkte bietet es.
Im folgenden Abschnitt werden wir auf die Grundlagen der Blockchain und des Bitcoin-Netzwerks eingehen. Für technisch Interessierte gibt es zahlreiche Bücher, die auch die Konstruktionsmerkmale von Bitcoin und Kryptowährungen detailliert beschreiben.19 Leser mit Vorkenntnissen können diesen Abschnitt überspringen.
Die Blockchain
Im Kern handelt es sich bei einer Blockchain um eine verteilte Datenbank, die von mehreren Benutzern in einem Netzwerk gemeinsam genutzt werden kann. Die Datenhaltung erfolgt nicht in einer zentralen Instanz, sondern redundant auf jedem einzelnen Rechner, der Teil des Netzwerks ist. Einzelne Daten, beim Bitcoin-Netzwerk sind es Transaktionsdaten, werden in Blöcken (block) zusammengefasst, die dann unverrückbar und eindeutig zu einer wachsenden Historie verkettet (chain) werden. Um dies zu ermöglichen, werden verschiedene Technologien wie das Internet, kryptografische Methoden und Hashfunktionen eingesetzt.
Eine Blockchain kann in verschiedenen Ausprägungen gestaltet werden. Eine öffentliche Blockchain (public blockchain), wie die des Bitcoin-Netzwerks, hat keine Hürden hinsichtlich der Nutzung. Jeder kann dem Netzwerk beitreten und es vollumfänglich nutzen. Eine private Blockchain (private blockchain) ist vergleichbar mit einem Intranet, erfordert eine Nutzerverifikation und kann je nach Konstruktion sämtliche Mechanismen vom Mining bis hin zu Manipulationen einzelner Einträge auf der Blockchain über eine zentrale Instanz beeinflussen. Private Blockchains repräsentieren daher eine dezentral konstruierte, aber zentral koordinierte Anwendung. Die dritte Kategorie sind die permissioned blockchains, die Elemente aus den privaten und öffentlichen Blockchains kombinieren. Ein Beispiel für eine solche Blockchain ist Ripple (XRP). Es gibt keine guten oder schlechten Blockchains. Die jeweilige Konstruktion hängt vom Einsatzzweck und von anderen Parametern, etwa dem Datenschutz, ab.
Kryptografie
Die Kryptografie beschäftigt sich als Teilgebiet der Kryptologie mit Verfahren zur Verschlüsselung von Daten. Obwohl alle historischen Bitcoin-Transaktionen unverschlüsselt und damit für jedermann einsehbar sind, spielen Verschlüsselungsalgorithmen eine unverzichtbare Rolle. Im Bitcoin-Netzwerk kommt ein klassisches asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren mit privaten und öffentlichen Schlüsseln zum Einsatz. Wie diese Schlüssel generiert werden, hängt vom kryptografischen Algorithmus ab. Beispiele für asymmetrische Systeme sind der RSA (Rivest-Shamir-Adleman) und der ECC (Elliptic-Curve Cryptography) Algorithmus, der beim Bitcoin eingesetzt wird. Die asymmetrische Kryptografie erhöht auf skalierbare Weise die Sicherheit der Kommunikation in nicht vertrauenswürdigen Netzwerken.
Einen ausreichend langen privaten Schlüssel zu knacken, ist praktisch nicht möglich. Nur derjenige, der im Besitz dieses Schlüssels ist, kann Transaktionen im Netzwerk anstoßen und Bitcoin von einer Adresse an eine andere senden. Durch die Freigabe einer Transaktion mit dem privaten Schlüssel wird gleichzeitig die Authentizität des Absenders sichergestellt. Die Bedeutung des privaten Schlüssels im Netzwerk kann man daher nicht überbewerten. Wer den privaten Schlüssel zu einer bestimmten Adresse im Netzwerk besitzt, kann frei über die mit dieser Adresse assoziierten Bitcoin verfügen. Es ist kein weiterer Nachweis der Identität oder des Besitzrechtes notwendig. Ohne diesen Schlüssel hingegen geht nichts mehr. Dieses Vorgehen mag kompliziert klingen, wird jedoch vollständig von der Wallet-Software des Anwenders übernommen. Die Aufgabe des Nutzers besteht lediglich darin, seinen privaten Schlüssel nicht zu verlieren.
Hashfunktionen
Die meisten Menschen haben bereits von verschiedenen Verschlüsselungsverfahren gehört. Schon Kinder machen spielerische Experimente mit Geheimtinten oder stecken sich Zettel mit einfach verschlüsselten Botschaften zu. Mit Hashfunktionen aber haben wohl nur die wenigsten Menschen bereits zu tun gehabt. Daher kann sich kaum jemand vorstellen, was sich hinter diesem essenziellen Baustein des Bitcoin-Netzwerks verbirgt.
Eine Hashfunktion ist eine mathematische Funktion. Sie ordnet jedem gegebenen Eingangswert eine Ausgabe, den Hashwert oder kurz »Hash« der Eingabe, zu. Dabei erfüllt sie mehrere Kriterien.
Eine Hashfunktion ist unumkehrbar. Aus einem Eingangswert kann leicht eine Ausgabe berechnet werden. Aus dieser Ausgabe sind jedoch keinerlei Rückschlüsse auf die Eingabe möglich. Wie bei einer Zigarette ist es ein Leichtes, diese zu einem Häufchen Asche umzuwandeln. Der Rückweg ist, zum Leidwesen aller Raucher, ausgeschlossen.
Auch bei zwei Eingangswerten, die sich nur marginal unterscheiden, sind keinerlei Ähnlichkeiten beim Ergebnis sichtbar.
Die Zuordnung muss eindeutig sein. Jede Eingabe resultiert exakt in einem Hashwert und zwei unterschiedliche Eingaben führen immer zu unterschiedlichen Hashwerten.
Das Ergebnis einer Hashfunktion hat unabhängig von der Länge des Inputs immer die gleiche Länge.
Eine Hashfunktion muss schnell berechenbar sein, damit sie in der Praxis eingesetzt werden kann.
Es gibt verschiedene Hashfunktionen. Ein bekannter Vertreter dieser Gattung hört auf den schönen Namen SHA-512. Wir wollen uns diese Funktion einmal bei der Arbeit anschauen, übergeben ihr daher einen einfachen Satz und werfen einen Blick auf das Ergebnis. Das erste der beiden folgenden Beispiele zeigt den Hashwert eines Zitats des Physikers Richard P. Feynman, der sagte: »I would rather have questions that can't be answered than answers that can't be questioned.«
Die Funktion liefert als Hashwert dieses Satzes die folgende Zeichenkette:
adbdc0b3741d344597b7049bff22f72e0ba629e5a68be081b210f74bbd9f429046c7c845f9a956859b08b7802e68f80d0ac4c4c3d9637df92aa87f5bf3dbdedd
Nun ändern wir die Eingabe, indem wir den abschließenden Punkt des Zitats streichen. Wir übergeben nun den Satz »I would rather have questions that can't be answered than answers that can't be questioned« an die Funktion. Diese minimale Änderung der Eingabe resultiert in folgendem, stark vom ersten Ergebnis abweichenden Hashwert:
f1fa8a235ff0947058678928e6cc614b3803b5db30e0f813de6d738779fdb2b8e98150d254062b84f525f80f9118ea14bd1d8ff1405e534ad102d2d7d7bc2c49.
Niemand kann aus den Ausgabewerten Rückschlüsse auf die Eingaben ziehen. Eine minimale Änderung der Eingabe, hier der Punkt am Satzende, führt zu nicht kalkulierbaren Veränderungen der Ausgabe. Die Funktion SHA-512 hat Ihre Aufgabe erfüllt.
Die treibenden Kräfte hinter Bitcoin
»It might make sense just to get some in case it catches on. If enough people think the same way, that becomes a self fulfilling prophecy.«
Satoshi Nakamoto im Jahr 2009
Viele, die sich eine Weile mit Kryptowährungen im Allgemeinen und dem Bitcoin im Besonderen beschäftigt haben, können die sich bietenden Möglichkeiten nur erahnen, sind aber fasziniert von der Idee eines dezentralen Geldsystems. Wie revolutionär diese Idee ist, dürfte vor allem Fachleuten bewusst sein, die täglich mit den technischen und juristischen Wirren des Finanzalltags zu tun haben. Ein System, in dem Transaktionen ohne Gegenparteirisiko und Zeitverzug abgewickelt werden können, das unabhängig von politischen Einflüssen und einer zentralen Autorität ist und alle historischen Transaktionen mit exaktem Zeitstempel öffentlich und kostenlos verfügbar macht, ist ein großer Wurf.
Die Konzeption eines digitalen Assets klingt abstrakt und wirkt technisch komplex. Für Menschen ohne nennenswerte Technikaffinität und mit nur geringem Interesse an der Funktionsweise der Finanzmärkte ist so eine Entwicklung schwer zu greifen. Die mangelnde Regulatorik und der in den Anfangsjahren sprichwörtliche Wilde Westen mit seinen extremen Preisschwankungen schreckten viele Menschen ab. Medienberichte, die vor diesem »gefährlichen Zeug« warnten, erhöhten die Attraktivität ebenso wenig wie die Kursrückgänge nach dem Preisanstieg im Jahr 2017. Auch die oft an Desinteresse grenzenden Wissenslücken manchen Verfassers solcher Artikel halfen nicht weiter, die Angst der Anleger blieb. Gerade in Deutschland kam mit den Erinnerungen an das Aktiendebakel des »Neuen Marktes« ein Trauma wieder zum Vorschein.