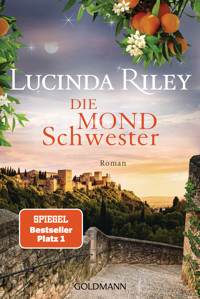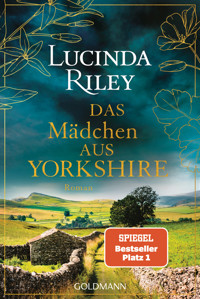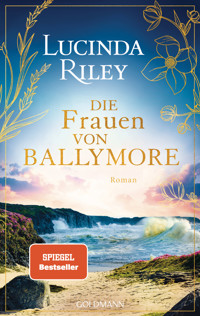11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die sieben Schwestern
- Sprache: Deutsch
Paris, 1928. Ein Junge wird gerade noch rechtzeitig entdeckt, bevor er stirbt, und von einer Familie aufgenommen. Er ist klug und liebenswert, und er entfaltet seine Talente in dem neuen Zuhause. Hier wird ihm ein Leben ermöglicht, von dem er nicht zu träumen gewagt hätte. Doch er weigert sich, einen Hinweis darauf zu geben, wer er wirklich ist. Als er zu einem jungen Mann heranwächst, verliebt er sich und besucht das berühmte Pariser Konservatorium. Die Schrecken seiner Vergangenheit kann er darüber beinahe vergessen, ebenso wie das Versprechen, das er einst geschworen hat, einzulösen. Aber Unheil ballt sich zusammen über Europa, und niemand ist mehr in Sicherheit. Tief in seinem Herzen weiß er, dass die Zeit kommen wird und er wieder fliehen muss.
Ägäis, 2008. Alle sieben Schwestern sind an Bord der »Titan« zusammengekommen, um sich von ihrem geliebten Vater, der ihnen stets ein Rätsel blieb, zu verabschieden. Zur Überraschung aller ist es die verschwundene Schwester, die von Pa Salt damit betraut wurde, ihnen die Spur in ihre Vergangenheit aufzuzeigen. Aber für jede Wahrheit, die enthüllt wird, taucht eine neue Frage auf, und die Schwestern müssen erkennen, dass sie ihren Vater kaum gekannt haben. Noch schockierender aber ist, dass diese lang begrabenen Geheimnisse noch immer Auswirkungen auf ihrer aller Leben haben.
»Atlas. Die Geschichte von Pa Salt« erzählt von einem Leben voller Liebe und Verluste, umspannt Meere und Kontinente und führt die »Sieben-Schwestern«-Serie zu einer Atem beraubenden Auflösung.
Harry Whittaker ist Lucinda Rileys Sohn, dem sie vor ihrem Tod die Geschichte von »Atlas« in die Hände gelegt hat, damit er sie nach ihren Vorstellungen zum Abschluss bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1023
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Paris, 1928. Ein Junge wird gerade noch rechtzeitig entdeckt, bevor er stirbt, und von einer Familie aufgenommen. Er ist klug und liebenswert, und er entfaltet seine Talente in dem neuen Zuhause. Hier wird ihm ein Leben ermöglicht, von dem er nicht zu träumen gewagt hätte. Doch er weigert sich, einen Hinweis darauf zu geben, wer er wirklich ist. Als er zu einem jungen Mann heranwächst, verliebt er sich und besucht das berühmte Pariser Konservatorium. Die Schrecken seiner Vergangenheit kann er darüber beinahe vergessen, ebenso wie das Versprechen, das er einst geschworen hat einzulösen. Aber Unheil ballt sich zusammen über Europa, und niemand ist mehr in Sicherheit. Tief in seinem Herzen weiß er, dass die Zeit kommen wird und er wieder fliehen muss.
Ägäis, 2008. Alle sieben Schwestern sind an Bord der Titan zusammengekommen, um sich von ihrem geliebten Vater, der ihnen stets ein Rätsel blieb, zu verabschieden. Zur Überraschung aller ist es die verschwundene Schwester, die von Pa Salt damit betraut wurde, ihnen die Spur in ihre Vergangenheit aufzuzeigen. Aber für jede Wahrheit, die enthüllt wird, taucht eine neue Frage auf, und die Schwestern müssen erkennen, dass sie ihren Vater kaum gekannt haben. Noch schockierender aber ist, dass diese lang begrabenen Geheimnisse noch immer Auswirkungen auf ihrer aller Leben haben.
»Atlas. Die Geschichte von Pa Salt« erzählt von einem Leben voller Liebe und Verluste, umspannt Meere und Kontinente und führt die »Sieben-Schwestern«-Serie zu einer atemberaubenden Auflösung.
Harry Whittaker ist Lucinda Rileys Sohn, dem sie vor ihrem Tod die Geschichte von »Atlas« in die Hände gelegt hat, damit er sie nach ihren Vorstellungen zum Abschluss bringt.
Weitere Informationen zu Lucinda Riley sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie unter www.penguin.de/Autor/Lucinda-Riley/p411595.rhd.
LUCINDA RILEY
HARRY WHITTAKER
Atlas
Die Geschichte von Pa Salt
ROMAN
Aus dem Englischen von Karin Dufner, Sonja Hauser, Sibylle Schmidt und Ursula Wulfekamp
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Atlas. The Story of Pa Salt« bei Macmillan, London.
Die Übersetzung von Vorwort, Prolog und Kapitel 1 – 16 besorgte Sonja Hauser, von Kapitel 17 – 35 Karin Dufner, von Kapitel 36 – 49 Sibylle Schmidt und von Kapitel 50 – 64 sowie Epilog und Dank Ursula Wulfekamp.
Dies ist ein Roman. Fiktion und Realität stellen hier eine untrennbare künstlerische Einheit dar. Ein Anspruch auf historische Richtigkeit und Vollständigkeit besteht daher nicht, mithin sind einzelne historische Fakten teilweise im Dienste der künstlerischen Gestaltungsfreiheit leicht verändert worden und damit umso mehr Ausdruck der kreativ-schriftstellerischen Fantasie.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2023
Copyright © der Originalausgabe 2022
by Lucinda Riley & Harry Whittaker
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: Alamy Stock Foto/Dmytro Surkov; Getty Images/zhihao, Xuanyu Han; Stocksy/Kara Riley; FinePic®, München; Tessa Träger
Abbildungen Innenteil: Hemesh Alles
CN · Herstellung: ast
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-26103-0V006
www.goldmann-verlag.de
Lucinda widmet diesen Roman ihren Leserinnen und Lesern auf der ganzen Welt.
Ich widme ihn meiner Mutter Lucinda, die mich in jeder Hinsicht inspiriert hat. – H. W.
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Harry, ich bin Lucinda Rileys ältester Sohn. Vielleicht überrascht es Sie, auf dem Umschlag dieses so lange erwarteten Romans zwei Verfassernamen zu sehen.
Kurz vor der Veröffentlichung von Dieverschwundene Schwester im Jahr 2021 verkündete Lucinda, dass es noch einen achten Teil der Sieben Schwestern-Reihe geben würde, in dem sie die Lebensgeschichte des mysteriösen Pa Salt erzählen wollte. In ihrer Anmerkung am Ende des siebten Bandes schrieb sie: »Ich habe die Geschichte seit acht Jahren im Kopf und kann es gar nicht erwarten, sie schließlich und endlich zu Papier zu bringen.«
Tragischerweise ist Mum im Juni 2021 gestorben, nachdem 2017 eine Krebserkrankung bei ihr diagnostiziert worden war. Nun nehmen Sie vielleicht an, dass es ihr nicht mehr gelungen ist, etwas von Pa Salts Leben niederzuschreiben. Doch die Wege des Schicksals sind verschlungen und unergründlich. 2016 flog Mum auf Einladung von Produzenten nach Hollywood, die beabsichtigten, die Filmrechte an den Sieben Schwestern zu erwerben. Natürlich wollten sie wissen, wie die Reihe enden würde – vier Bücher vor dem eigentlichen Abschluss.
So war Mum gezwungen, ihre Gedanken dazu schriftlich niederzulegen, und verfasste für die potenziellen Produzenten dreißig Seiten Text über den Höhepunkt der Serie. Ich muss Ihnen vermutlich nicht sagen, dass diese Seiten wie immer bei ihr spannungsgeladen, voll dramatischer Ereignisse und gewürzt mit einer gewaltigen Überraschung waren.
Fans der Reihe wissen, dass Pa Salt in jedem der Bände kurz auftaucht. Mum hat die Entwicklung dieser Figur über die Jahrzehnte der Handlung hinweg akribisch aufgezeichnet und für die Detektive unter den Leserinnen und Lesern in der Erzählung eine Spur gelegt. Solchermaßen hat Lucinda mehr »zu Papier gebracht«, als auf den ersten Blick sichtbar wurde.
2018 haben Mum und ich die Deine Schutzengel-Serie für Kinder ins Leben gerufen und miteinander vier Bücher geschrieben. Dabei hat sie mich gebeten, die Sieben Schwestern-Reihe für sie zu Ende zu führen, falls das Schlimmste eintreten sollte. Unsere Gespräche darüber werden unter uns bleiben; nur so viel: Ich war ihre Rückversicherung für das Undenkbare. Das leider eintrat. Mum hat, glaube ich, genauso wenig wie ich in Betracht gezogen, dass sie tatsächlich sterben könnte. Mehrmals schaffte sie es, die Gesetze von Medizin und Natur auszuhebeln und dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Aber Mum hatte immer etwas Magisches an sich.
Nach ihrem Tod war klar, dass ich mein Versprechen einlösen würde. Viele Leute haben mich gefragt, wie stark der Druck war, der auf mir lastete. Schließlich werden in Atlas Geheimnisse gelüftet, über die sich Leserinnen und Leser schon seit einem Jahrzehnt den Kopf zerbrechen. Ich habe die Erfüllung dieser Aufgabe eher als einen Tribut an Mum gesehen und das Buch für meine beste Freundin und Heldin geschrieben. Somit kann ich nicht von Druck sprechen, ich würde das Projekt eher als Liebesdienst bezeichnen. Natürlich werden manche Leserinnen und Leser sich nun Gedanken darüber machen, welche Teile des Romans von Lucinda stammen und welche von mir, doch ich halte das nicht für wichtig. Die Geschichte ist einfach eine Geschichte, Punkt. Am Ende dieses Buches werden Sie voll und ganz auf Ihre Kosten gekommen sein, das weiß ich. Dafür hat Mum gesorgt.
Lucindas wahrscheinlich größte Leistung besteht darin, dass niemand die versteckte Antriebskraft hinter der Reihe korrekt entschlüsselt hat – und es sind buchstäblich Tausende von Theorien im Umlauf. Atlas wird diejenigen belohnen, die diese Romane seit dem ersten Band lieben, aber darin wird auch eine neue Geschichte erzählt (die letztlich schon immer da war, verborgen in den ersten fünftausend Seiten). Möglicherweise bin ich nur derjenige, der jetzt den Vorhang beiseite zieht …
Die Arbeit an Atlas – Die Geschichte von Pa Salt war für mich gleichzeitig die Herausforderung und das Privileg meines Lebens. Der Roman ist Lucindas Abschiedsgeschenk, und ich freue mich sehr, ihn Ihnen nun präsentieren zu können.
Harry Whittaker, 2022
Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, als Eure Schulweisheit sich träumt, Horatio.
William Shakespeare
Personen
Atlantis
Pa Salt
Adoptivvater der Schwestern (verstorben)
Marina (Ma)
Mutterersatz der Schwestern
Claudia
Haushälterin von Atlantis
Georg Hoffman
Pa Salts Anwalt
Christian
Skipper
Die Schwestern d’Aplièse
Maia
Ally (Alkyone)
Star (Asterope)
CeCe (Celaeno)
Tiggy (Taygeta)
Elektra
Merry (Merope)
Prolog
Tobolsk, Sibirien1925
Als der bitterkalte Wind den Schnee vor ihnen aufwirbelte, zogen die beiden Jungen die Kragen ihrer dünnen Fellmäntel tief ins Gesicht.
»Komm!«, rief der Ältere. Obwohl er gerade erst elf geworden war, hatte seine Stimme bereits etwas Raues, Hartes. »Es reicht. Lass uns nach Hause gehen.«
Der Jüngere – er war sieben – hob den Haufen Brennholz vom Boden auf, den sie gesammelt hatten, und lief dem Größeren hinterher.
Auf halbem Weg nach Hause bemerkten die Kinder ein schwaches Piepsen. Der ältere Junge blieb stehen.
»Hörst du das?«
»Ja«, antwortete der Kleinere, dem die Arme von dem schweren Holz wehtaten. Obwohl sie noch nicht lange still standen, begann er zu zittern. »Können wir bitte heimgehen? Ich bin müde.«
»Jammer nicht rum«, herrschte der Ältere ihn an. »Ich schau mal nach, was los ist.« Er kniete am Fuß einer Birke nieder. Zögernd folgte ihm der Kleinere.
Vor ihnen flatterte ein Spatzenjunges, nicht größer als eine Rubelmünze, hilflos auf dem hartgefrorenen Boden.
»Das ist aus dem Nest gefallen«, erklärte der ältere Bursche seufzend. »Oder … sei mal kurz still.« Die beiden verstummten, und wenig später hörten sie von oben einen schrillen Ruf. »Ah, ein Kuckuck!«
»Der Vogel von der Uhr?«
»Ja. Aber das ist kein freundliches Tier. Der Kuckuck legt seine Eier in die Nester fremder Vögel. Wenn sein Küken ausschlüpft, schubst es die anderen raus.« Er rümpfte die Nase. »Und das ist hier passiert.«
»O nein.« Der jüngere Bursche strich dem Vögelchen vorsichtig über den Kopf. »Keine Angst, wir sind ja da.« Er schaute seinen Begleiter an. »Vielleicht sollten wir auf den Baum klettern und ihn ins Nest zurücksetzen.« Er versuchte, das Nest auszumachen. »Es scheint sehr hoch oben zu sein.« Plötzlich vernahm er ein hässliches Knirschen. Als er den Blick senkte, sah er, dass der ältere Junge das Küken mit dem Stiefel zertreten hatte.
»Was hast du getan?«, rief der Kleinere entsetzt aus.
»Die Mutter hätte es nicht mehr angenommen. Es war das Beste, es gleich umzubringen.«
»Aber … das kannst du doch gar nicht wissen.« Tränen traten dem Jüngeren in die braunen Augen. »Wir hätten es wenigstens versuchen können.«
Der Ältere winkte ab. »So was hat keinen Sinn. Das ist Zeitverschwendung, von vornherein zum Scheitern verurteilt.« Er wandte sich ab und stapfte den Hügel hinunter. »Lass uns nach Hause gehen.«
Der kleinere Junge beugte sich zu dem leblosen Küken hinunter. »Was mein Bruder getan hat, ist schrecklich«, schluchzte er. »Aber er leidet. Er konnte nicht anders.«
Atlas
Tagebuch1928 – 1929
I
Boulogne-Billancourt, Paris, Frankreich
Das Tagebuch ist ein Geschenk von Monsieur und Madame Paul Landowski. Da ich nicht spreche, halten sie es für eine gute Idee, wenn ich die Dinge notiere, die mir durch den Kopf gehen. Anfangs dachten sie, ich wäre dumm, hätte den Verstand verloren, was in vielerlei Hinsicht sogar stimmen mag. Möglicherweise bin ich aber auch nur geistig erschöpft, weil ich mich schon so lange auf diesen Verstand verlassen muss. Und der ist wie ich sehr müde.
Ihnen ist klar, dass ich zumindest einen Funken Intelligenz besitze, denn sie haben mich gebeten, etwas aufzuschreiben. Zuerst meinen Namen, mein Alter und woher ich stamme. Doch ich habe schon vor Langem gelernt, dass man in Schwierigkeiten geraten kann, wenn man solche Dinge notiert, und Schwierigkeiten möchte ich nie wieder. Folglich habe ich am Küchentisch sitzend ein Gedicht zu Papier gebracht, das ich von Papa kenne. Es gibt keinen Hinweis darauf, woher ich kam, bevor ich unter einer Hecke in ihrem Garten entdeckt wurde. Es war keiner meiner Lieblingstexte, aber ich hatte das Gefühl, dass die Worte zu meiner Stimmung passten und sich eigneten, diesem freundlichen Paar, das mir das Schicksal gesandt hatte, als der Tod an meine Tür klopfte, zu zeigen, wie ich mich äußern konnte. Also schrieb ich:
Mond und Plejaden sind untergegangen,
die Nacht ist halb vorbei,
die Jugend vergeht,
und ich schlafe allein.
Ich notierte das Gedicht in Französisch, Englisch und Deutsch, obgleich keine dieser Sprachen diejenige ist, mit der ich das Reden lernte (denn das kann ich sehr wohl. Doch ähnlich wie Geschriebenes lässt sich – besonders in Eile – Gesprochenes gegen einen verwenden). Ich muss gestehen, dass ich mich über den erstaunten Blick Madame Landowskis freute, als sie den Text las. Er würde ihr nicht helfen zu ergründen, wer ich war oder zu wem ich gehörte. Als das Hausmädchen Elsa eine Schale mit Essen vor mir auf den Tisch knallte, schaute die junge Frau drein, als wäre es ihr am liebsten, wenn man mich schnellstmöglich dorthin zurückschickte, wo ich hergekommen war.
Stumm zu bleiben fällt mir nicht schwer. Mittlerweile ist es über ein Jahr her, dass ich mein Zuhause verlassen habe. In dieser Zeit habe ich meine Stimme nur benutzt, wenn es sich nicht vermeiden ließ.
Beim Schreiben kann ich aus dem winzigen Fenster im Dachboden blicken. Vor einiger Zeit sah ich die Landowski-Kinder, die vom Unterricht nach Hause kamen, den Weg herauflaufen. Sie wirkten sehr schick in ihren Schuluniformen – Françoise mit weißen Handschuhen und Strohhut, ihre Brüder mit weißen Hemden und Jacken. Monsieur Landowski klagt oft über Geldmangel, aber das große Gebäude, der herrliche Garten und die hübschen Kleider, die die Damen des Hauses tragen, deuten eher auf Reichtum hin.
Ich kaue auf meinem Stift herum. Das wollte Papa mir abgewöhnen, indem er das Ende in alle möglichen scheußlich schmeckenden Dinge tauchte. Einmal erklärte er mir, an diesem Tag hätte der Stift bestimmt einen gar nicht so schlechten Geschmack, sei jedoch giftig, weswegen ich tot umfiele, wenn ich ihn in die Nähe meines Mundes bringen würde. Aber beim Nachgrübeln über den Text, den er mir zu übersetzen gegeben hatte, schob ich ihn zwischen die Lippen. Als er das sah, stieß er einen Schrei aus, packte mich am Kragen, trug mich hinaus und stopfte mir Schnee in den Mund, den ich gleich darauf ausspucken musste. Ich bin nicht gestorben, und bis zum heutigen Tag frage ich mich, ob das eine Schocktherapie war, um mir diese Gewohnheit auszutreiben, oder ob der Schnee und das Ausspucken mich tatsächlich gerettet haben.
Obwohl ich mich sehr bemühe, mich an ihn zu erinnern, verblasst sein Bild allmählich, weil ich ihn so lange nicht gesehen habe.
Vielleicht ist es das Beste, wenn ich meine Vergangenheit vergesse. Falls sie mich dann irgendwann foltern sollten, kann ich ihnen nichts verraten. Und falls Monsieur und Madame Landowski meinen, ich würde etwas in das Tagebuch schreiben, das sie mir freundlicherweise gegeben haben, und dem kleinen Schloss mit Schlüssel vertrauen, den ich in meinem Lederbeutel aufbewahre, täuschen sie sich gewaltig.
»In das Tagebuch kannst du alles schreiben, was du fühlst oder denkst«, hat Madame Landowski mir erklärt. »Nur du darfst es lesen, es ist dein ganz privater Ort. Ich verspreche dir, dass wir nie hineinschauen werden.«
Dankbar lächelnd lief ich nach oben in meine Dachkammer. Ich glaube ihr nicht. Aus Erfahrung weiß ich, dass weder Schlösser noch Versprechen ein Hindernis darstellen.
Beim Leben deiner geliebten Mutter verspreche ich dir, dass ich zu dir zurückkomme … Bete für mich, warte auf mich …
Ich schüttle den Kopf, versuche die Erinnerung an Papas letzte Worte an mich loszuwerden. Obwohl andere Dinge, an die ich mich gern erinnern würde, wie die Schirmchen des Löwenzahns einfach wegfliegen, sobald ich sie festhalten will, bewegt sich dieser Satz nicht von der Stelle, egal, was ich tue.
Das Tagebuch ist in Leder gebunden und hat hauchdünnes Papier. Es muss die Landowskis mindestens einen Franc gekostet haben (so nennen sie hier das Geld). Weil sie es mir geschenkt haben, um mir zu helfen, benutze ich es. Außerdem habe ich mich während meiner langen Reise oft gefragt, ob ich, da ich zu schweigen lernte, das Schreiben vergessen könnte. Weil ich weder Papier noch Stift bei mir trug, vertrieb ich mir die Zeit in den eisig kalten Winternächten, indem ich im Kopf Gedichte aufsagte und mir vorstellte, die Buchstaben »vor meinem geistigen Auge« zu schreiben.
Ich mag den Ausdruck sehr – Papa nannte dieses »geistige Auge« das Fenster zur Fantasie. Wenn ich nicht gerade mit Gedichten beschäftigt war, zog ich mich oft an jenen Ort zurück, von dem Papa behauptete, er habe keine Grenzen. Er sei so groß, wie man ihn sich wünsche. Kleingeister, fügte er hinzu, besäßen laut Definition nur eine beschränkte Fantasie.
Obwohl die Landowskis mich retteten und sich um mein leibliches Wohl kümmerten, grübelte ich nach wie vor über Dinge, die ich nicht niederschreiben konnte, weil ich nie wieder einem anderen Menschen vertrauen durfte.
Deshalb würden die Landowskis, wenn sie diese Worte einmal lasen – und ein Teil von mir war sicher, dass sie es aus Neugierde irgendwann täten –, ein Tagebuch in Händen halten, das beginnt, als ich bereits meine letzten Gebete gesprochen hatte.
Möglicherweise hatte ich sie gar nicht gesprochen. Ich war fiebrig, erschöpft und halb verhungert, vielleicht hatte ich sie nur geträumt. An jenem Tag, an dem ich in das hübscheste Frauengesicht blickte, das mir je begegnet war.
Während ich einen kurzen, sachlichen Bericht darüber zu Papier brachte, wie diese wunderschöne Dame mich aufgenommen, mir sanfte Worte ins Ohr geflüstert und mir erlaubt hatte, das erste Mal seit Ewigkeiten wieder in einem Haus zu schlafen, dachte ich über ihre Traurigkeit bei unserer letzten Begegnung nach. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass sie Izabela, kurz Bel, heißt. Sie und Landowskis Atelierassistent Monsieur Brouilly (der mir angeboten hat, ihn »Laurent« zu nennen, obwohl ich ihn, stumm wie ich momentan bin, gar nicht ansprechen würde) sind in heißer Liebe zueinander entbrannt. In jener Nacht, in der sie so traurig aussah, war sie gekommen, um sich zu verabschieden. Nicht nur von mir, sondern auch von ihm.
Trotz meiner Jugend wusste ich bereits einiges über die Liebe. Nachdem Papa weggegangen war, hatte ich mich durch all seine Bücher gearbeitet und erstaunliche Dinge über Erwachsene erfahren. Anfangs hatte ich den in Geschichten geschilderten physischen Akt als Komödie aufgefasst, doch als selbst ernsthafte Autoren ihn auf ähnliche Weise beschrieben, war mir klar geworden, dass er tatsächlich so ablaufen musste. So etwas würde ich in meinem Tagebuch keinesfalls notieren!
Ein leises Kichern entrang sich meiner Kehle. Ich schlug die Hände vor den Mund. Es fühlte sich seltsam an, denn Kichern war ein Ausdruck von Fröhlichkeit. Die natürliche körperliche Reaktion darauf.
»Du liebe Güte!«, flüsterte ich. Wie seltsam, meine eigene Stimme zu vernehmen, die mir tiefer erschien als früher. Hier oben im Dachboden würde mich niemand hören. Die beiden Hausmädchen schrubbten, polierten und arbeiteten sich unten durch den niemals kleiner werdenden Berg Wäsche, von der stets welche an den Leinen hinter dem Haus hing. Trotzdem durfte ich mir diese Fröhlichkeit und dieses Glücklichsein nicht angewöhnen, denn wenn ich in der Lage war zu kichern, bedeutete das, dass ich eine Stimme besaß und sprechen konnte. Ich versuchte, an traurige Dinge zu denken. Das fühlte sich merkwürdig an, weil es mir letztlich nur gelungen war, mich nach Frankreich durchzuschlagen, indem ich mir Schönes vorstellte. Meine Gedanken wanderten zu den Hausmädchen. Abends konnte ich sie in dem Raum neben dem meinen klagen hören. Sie beschwerten sich über ihren kargen Lohn, die langen Arbeitsstunden, die klumpigen Matratzen und ihre im Winter bitterkalte Dachkammer. Am liebsten hätte ich gegen die Wand geklopft und gerufen, sie könnten froh sein um diese Wand zwischen uns, froh darüber, dass die Familie nicht in einem einzigen Raum zusammenleben musste, dass sie überhaupt einen Lohn erhielten, wie karg er auch sein mochte. Und was die Kälte anbelangte … Inzwischen kannte ich die klimatischen Bedingungen in Frankreich und Paris. Und die paar Grad unter null, die ein Problem für sie darstellten, brachten mich fast wieder zum Kichern.
Ich beendete den ersten Abschnitt in meinem nagelneuen »offiziellen« Tagebuch und las ihn noch einmal durch. Dabei malte ich mir aus, Monsieur Landowski mit seinem komischen kleinen Kinn- und dem buschigen Oberlippenbart zu sein.
Ich lebe in Boulogne-Billancourt, wo mich die freundliche Landowski-Familie bei sich aufgenommen hat. Die Eltern heißen Monsieur und Madame Paul und Amélie Landowski, die Kinder Nadine (20), Jean-Max (17), Marcel (13) und Françoise (11). Sie sind alle sehr nett zu mir. Sie sagen, ich bin sehr krank gewesen und werde einige Zeit brauchen, um wieder zu Kräften zu kommen. Die Hausmädchen heißen Elsa und Antoinette, und es gibt eine Köchin namens Berthe. Sie bietet mir immer etwas von ihrem köstlichen Gebäck an, damit ich Fleisch auf die Knochen bekomme, wie sie meint. Als sie mir das erste Mal einen vollen Teller hinschob, habe ich noch den letzten Krümel aufgegessen und mich fünf Minuten später heftig übergeben müssen. Der Arzt, der daraufhin kam, erklärte Berthe, mein Magen ist wegen meiner Unterernährung geschrumpft, sie darf mir nicht so viel Süßes hinstellen, weil ich sonst sehr krank werden und möglicherweise sogar sterben könnte. Das hat Berthe ziemlich aus der Fassung gebracht. Nun aber, da ich wieder fast normal esse, hoffe ich, ihre Kochkünste würdigen zu können. Eine Angestellte, von der die Familie oft redet, kenne ich noch nicht. Sie heißt Madame Evelyn Gelsen und ist die Haushälterin. Momentan hat sie Urlaub und besucht ihren Sohn, der in Lyon lebt.
Ich fürchte, dieser freundlichen Familie durch das viele Essen, das ich mittlerweile zu mir nehme, hohe Kosten zu verursachen. Und dann musste meinetwegen auch noch der Arzt kommen. Wie teuer Ärzte sein können, weiß ich. Ich habe weder Geld noch Arbeit und sehe keine Möglichkeit, mich den Landowskis gegenüber erkenntlich zu zeigen, was sie irgendwann erwarten werden und was nur recht und billig ist. Wie lange ich hier bleiben darf, weiß ich nicht, aber ich versuche, jeden Tag in ihrem wunderschönen Heim zu genießen. Ich danke dem Herrn für ihre Güte und schließe sie in mein Abendgebet ein.
Als ich zufrieden nickte, senkten sich meine Zähne unwillkürlich in das Ende des Stifts. Ich hatte den Tagebucheintrag einigermaßen einfach gehalten, damit er sich las, als stammte er von einem normalen zehnjährigen Jungen. Sie durften nicht erfahren, welche Bildung ich genossen hatte. Nachdem Papa weggegangen war, hatte ich mich bemüht, eigenständig weiterzulernen, wie er es von mir erwartete, doch ohne seine Anleitung war ich nicht so recht vorangekommen.
Ich nahm einen schönen weißen Bogen unberührtes Papier aus der Schublade in dem alten Sekretär – eine Schublade und einen Ort, an dem ich schreiben konnte, zu haben, war für mich ein unvorstellbarer Luxus – und verfasste einen Brief.
Atelier Landowski
Rue Moisson Desroches
Boulogne-Billancourt
7. August 1928
Lieber Monsieur und liebe Madame Landowski,
ich möchte Ihnen beiden für Ihr Geschenk danken. Ein schöneres Tagebuch habe ich nie besessen. Ich werde jeden Tag hineinschreiben, wie Sie es wünschen.
Vielen Dank dafür, dass ich bei Ihnen sein darf.
Gerade als ich ein höfliches »Ihr« und meinen Namen daruntersetzen wollte, hielt ich inne. Stattdessen faltete ich das Blatt zweimal und schrieb ihre Namen darauf. Am nächsten Tag würde ich es auf das Silbertablett für die Post legen.
Noch mochte ich mein Ziel nicht erreicht haben, aber ich war gar nicht mehr so weit davon entfernt. Verglichen mit der Distanz, die ich bereits zurückgelegt hatte, handelte es sich sozusagen um einen Spaziergang die Rue Moisson entlang und wieder zurück. Nein, ich wollte noch nicht gehen. Wie der Arzt Berthe erläutert hatte, musste ich zu Kräften kommen, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Ich hätte dem Arzt sagen können, dass nicht die physischen Entbehrungen das Schlimmste gewesen waren, sondern die Ängste, die mich nach wie vor quälten. Die Hausmädchen hatten mir, vermutlich weil es sie langweilte, sich über die anderen im Haus zu beklagen, erzählt, dass ich nachts laut stöhne und sie aufwecke. Während meiner langen Reise hatte ich mich an meine Albträume gewöhnt und war erschöpft sofort wieder eingeschlafen, aber das Leben hier, wo ich ausgeruht in meinem eigenen warmen Bett lag, verweichlichte mich. Nun konnte ich danach oft keinen Schlaf mehr finden. Ich wusste nicht einmal so genau, ob »Albträume« die richtige Bezeichnung dafür war. Häufig zwang mein Geist mich unerbittlich, Dinge in der Fantasie noch einmal zu durchleben, die mir tatsächlich widerfahren waren.
Ich stand auf, ging mit dem Tagebuch in der Hand zum Bett und schlüpfte unter die Decke, die ich bei der momentanen Temperatur eigentlich nicht gebraucht hätte. Dort schob ich das Tagebuch in meine Pyjamahose, sodass es eng an der Innenseite meines Oberschenkels anlag. Dann nahm ich den Lederbeutel, der um meinen Hals hing, und platzierte ihn am anderen Oberschenkel. Wenn ich auf meiner langen Reise irgendetwas gelernt hatte, dann das, wo man wertvolle Dinge am sichersten versteckte.
Ich sank auf die Matratze – über die sich Elsa und Antoinette beklagten, obwohl mir darauf war, als würde ich auf einer Wolke aus Engelsflügeln schlummern –, schloss die Augen, sprach ein kurzes Gebet für Papa und meine Mama, wo auch immer sie im Himmel sein mochte, und versuchte einzuschlafen.
Doch ein Gedanke ließ mir keine Ruhe. So ungern ich mir das eingestand: Es gab einen tieferen Grund für meinen Dankesbrief an die Landowskis. Obwohl ich wusste, dass ich meine Reise irgendwann fortsetzen musste, war ich noch nicht bereit, auf dieses wunderbarste aller Gefühle zu verzichten, auf das der Sicherheit.
II
»Wie findest du ihn, junger Mann?«, fragte Monsieur Landowski mich, als ich in die Augen unseres Herrn und Schöpfers blickte, von denen eines fast so groß war wie ich. Monsieur Landowski hatte gerade den Kopf der Statue fertig, die sie in Brasilien als Cristo Redentor bezeichneten und die ich Christus nannte. Von Laurent Brouilly wusste ich, dass sie oben auf einem Berg in einer Stadt namens Rio de Janeiro aufgestellt werden würde. Wenn alle Teile zusammengebaut wären, würde sie dreißig Meter hoch sein. Da ich die Miniaturversion der Skulptur kannte, konnte ich mir ausmalen, wie sie mit weit ausgebreiteten Armen über Rio stünde. Geschickt gemacht, dachte ich, denn aus der Ferne konnte man sie für ein Kreuz halten. Wie sie die Statue den Berg hinaufbekommen und zusammensetzen wollten, war in den vergangenen Wochen ausführlich und voller Sorge diskutiert worden. Monsieur Landowski schien sich über viele Köpfe Gedanken machen zu müssen, denn er arbeitete gleichzeitig an der Skulptur eines Chinesen namens Sun Yat-sen und kam mit deren Augen nicht so recht voran. Der Bildhauer war wohl ein rechter Perfektionist.
An den langen heißen Sommertagen zog es mich in Monsieur Landowskis Atelier. Ich schlich hinein und versteckte mich hinter den zahlreichen großen Felsblöcken, die auf dem Boden darauf warteten, Gestalt anzunehmen. In der Werkstatt wimmelte es gewöhnlich von Lehrlingen und Assistenten, die sich wie Laurent dort aufhielten, um vom großen Meister zu lernen. Die meisten schenkten mir keine Beachtung, nur Mademoiselle Margarida begrüßte mich morgens stets mit einem Lächeln. Sie war eng mit Bel befreundet, weshalb ich wusste, dass man ihr vertrauen konnte.
Eines Tages entdeckte Monsieur Landowski mich in seinem Atelier und rügte mich wie ein Vater, weil ich ihn nicht um Erlaubnis gebeten hatte. Ich schüttelte den Kopf und wich, abwehrend die Arme von mir gestreckt, rückwärts zur Tür zurück. Da winkte mich der freundliche Monsieur zu sich.
»Brouilly sagt, du siehst uns gern bei der Arbeit zu. Stimmt das?«
Ich nickte.
»Dann musst du dich nicht verstecken. Solange du versprichst, nichts anzufassen, bist du hier willkommen, Junge. Wenn nur meine eigenen Kinder so viel Interesse an meinem Beruf zeigen würden wie du.«
Seitdem durfte ich mit einem von ihm nicht benötigten Specksteinstück und einem eigenen Handwerksset am Arbeitstisch sitzen.
»Schau zu und lerne, Junge«, riet Landowski mir.
Ich befolgte seinen Rat. Nicht, dass das meine Bemühungen erfolgreicher gemacht hätte. Mit Hammer und Meißel klopfte ich auf meinen Stein ein. Doch egal, wie sehr ich mich anstrengte, ihm auch nur die schlichteste Form abzuringen – am Ende lag bloß ein Haufen zerkrümelter Steinchen vor mir.
»Also, mein Junge, wie findest du ihn?« Monsieur Landowski deutete auf den Kopf des Cristo. Ich nickte. Dieser freundliche Mann, der mich bei sich aufgenommen hatte, versuchte nach wie vor, mir eine gesprochene Antwort zu entlocken. Aber das Risiko konnte ich trotz meines schlechten Gewissens nicht eingehen.
Madame Landowski, die mittlerweile wusste, dass ich schreiben konnte und verstand, was man mir sagte, hatte mir einen Stapel Zettel gegeben.
»Wenn ich dich etwas frage, schreibst du die Antwort auf, ja?«
Von da an war es leicht gewesen, mich mit ihr zu verständigen.
Um nun Monsieur Landowskis Frage zu beantworten, holte ich meinen Stift aus der Hosentasche, notierte in riesigen Buchstaben ein Wort auf ein Blatt Papier und reichte es ihm.
Als er es las, lachte er.
»›Magnifique‹, soso. Vielen Dank, junger Herr. Wollen wir hoffen, dass der Cristo genauso begeistert aufgenommen wird, wenn er erst einmal stolz oben auf dem Corcovado steht. Immer vorausgesetzt, wir schaffen es überhaupt, ihn ans andere Ende der Welt zu verfrachten …«
»Geben Sie die Hoffnung nicht auf«, meinte Laurent, der hinter mir stand. »Bel sagt, die Zahnradbahn könne bald in Betrieb genommen werden.«
»Ach, sagt sie das?« Monsieur Landowski hob eine seiner buschigen grauen Augenbrauen. »Da scheinen Sie mehr zu wissen als ich. Heitor da Silva Costa verspricht mir ständig, dass wir uns darüber unterhalten, wie meine Skulptur nach Brasilien gebracht und aufgestellt werden soll, aber das Gespräch findet nie statt. Ist es schon Mittag? Ich glaube, ich könnte zur Beruhigung meiner Nerven ein Glas Wein gebrauchen. Allmählich bekomme ich das Gefühl, dass dieses Cristo-Projekt meinen Ruf ruinieren wird. Wie dumm von mir, mich auf einen solchen Wahnsinn einzulassen!«
»Ich hole das Essen«, verkündete Laurent und ging in die winzige Küche, an die ich mich bis in alle Ewigkeit in jeder Einzelheit erinnern werde, weil sie meine erste sichere Zuflucht war, seit ich meine Heimat so viele Monate zuvor verlassen hatte. Ich beobachtete, wie Laurent eine Flasche Wein öffnete. Wie so oft, wenn ich früh aufwachte, hatte ich mich in der Morgendämmerung ins Atelier geschlichen, um den schönen Dingen darin nahe zu sein. Dort saß ich dann und stellte mir vor, wie Papa wohl darüber gelacht hätte, dass ich ausgerechnet hier gelandet war und nicht etwa in der nur wenige Kilometer entfernten Renault-Fabrik. Hier, an einem Ort, den er vermutlich als Tempel der Kunst bezeichnet hätte.
Als ich am Morgen inmitten der Felsblöcke gesessen und in das sanfte Gesicht des Cristo geblickt hatte, war ein Geräusch aus dem Raum hinter dem Vorhang hervorgedrungen, in dem wir aßen. Ich war auf Zehenspitzen hingeschlichen und hatte hineingeschaut. Unter dem Tisch hatte ein Paar Füße hervorgelugt. Das Geräusch hatte sich als das leise Schnarchen von Laurent entpuppt. Seit Bels Abreise nach Brasilien erschien er morgens oft verkatert. Seine Augen waren rot und verquollen, und seine Haut wirkte blass und grau, als müsste er sich gleich übergeben. (Mit Männern und Frauen in diesem Zustand hatte ich Erfahrung.)
Wie er sich nun ein Glas bis zum Rand vollschenkte, begann ich mir Sorgen um seine Leber zu machen. Und um sein Herz. Natürlich konnte dieses Organ nicht im physischen Sinne brechen, aber irgendetwas war in diesem Mann durch die Liebe kaputtgegangen. Vielleicht würde ich eines Tages begreifen, warum man den Schmerz mit Alkohol ertränken wollte.
»Santé!« Die beiden Männer prosteten einander zu. Ich machte mich unterdessen in der Küche nützlich und holte Brot, Käse und die dicken roten Tomaten, die im Garten der Frau am anderen Ende der Straße wuchsen.
Das wusste ich, weil ich gesehen hatte, wie die Haushälterin Evelyn die Küche mit einer Kiste voller Gemüse betrat. Da sie nicht gerade schlank und auch nicht mehr ganz jung war, hatte ich ihr die Kiste abgenommen und sie abgestellt.
»Gott, ist das heiß heute«, hatte sie gestöhnt und sich auf einen der Holzstühle plumpsen lassen. Ich hatte ihr ein Glas Wasser gebracht, bevor sie darum bitten konnte, und Papier und Bleistift aus der Tasche geholt, um eine Frage für sie aufzuschreiben.
»Warum ich nicht die Hausmädchen schicke?«, hatte sie laut vorgelesen. »Weil keine der beiden einen fauligen Pfirsich von einem guten unterscheiden kann, Kleiner. Sie sind Stadtmädchen und haben keine Ahnung von frischem Obst und Gemüse.«
Ich hatte einen weiteren Satz notiert:
Das nächste Mal begleite ich Sie und trage die Kiste.
»Das ist sehr nett von dir, junger Mann. Wenn das Wetter so bleibt, komme ich vielleicht auf dein Angebot zurück.«
Das Wetter blieb, wie es war, und so begleitete ich sie und half ihr. Unterwegs erzählte sie mir stolz von ihrem Sohn, der an der Universität studierte und Ingenieur werden wollte.
»Aus dem wird etwas, denk an meine Worte«, meinte sie, während sie das Gemüse am Stand inspizierte und ich die Kiste für das bereithielt, das ihren strengen Maßstäben gerecht wurde. Von sämtlichen Personen im Haushalt der Landowskis war Evelyn mir die liebste, obwohl ich anfangs vor ihrer Heimkehr Angst gehabt hatte, denn durch die Wand hatte ich die Hausmädchen über »den Drachen« spotten hören. Ich war ihr als »der namenlose Junge, der nicht sprechen kann« vorgestellt worden. (Von Marcel, dem dreizehnjährigen Sohn der Landowkis; dass er mich voller Argwohn betrachtete, konnte ich verstehen – mein plötzliches Auftauchen hätte in jeder Familie für Aufruhr gesorgt.) Evelyn hingegen hatte lediglich meine ausgestreckte Hand geschüttelt und mich mit einem freundlichen Lächeln begrüßt.
»Je mehr Leute, desto lustiger, sage ich immer. Was für einen Sinn hat ein so großes Haus, wenn Zimmer leer stehen?« Sie hatte mir zugezwinkert und später, als sie meine begehrlichen Blicke auf die Reste der Tarte Tatin vom Mittagessen bemerkte, ein Stück heruntergeschnitten.
Es war schon merkwürdig, wie eine Frau mittleren Alters und ich eine Art geheimen und (jedenfalls von meiner Seite) unausgesprochenen Bund eingehen konnten. Ich hatte in ihren Augen das Leid gesehen. Vielleicht erkannte sie in den meinen etwas Ähnliches.
Ich wusste, dass ich Klagen über mich am ehesten vermied, indem ich mich entweder unsichtbar machte (bei den Landowski-Kindern und in gewissem Maße auch bei Monsieur und Madame Landowski) oder jenen, die Hilfe benötigten, also hauptsächlich den Bediensteten, unter die Arme griff. Evelyn, Berthe, Elsa und Antoinette hatten in mir einen stets willigen kleinen Helfer. Zu Hause hatte oft ich den geringen Wohnraum, der uns zur Verfügung stand, aufgeräumt. Schon als kleiner Junge war mir wichtig gewesen, dass sich alles an seinem Platz befand. Papa war aufgefallen, wie sehr ich feste Strukturen liebte, und er hatte gescherzt, ich würde einmal eine hervorragende Hausfrau abgeben. In meinem alten Zuhause war es praktisch unmöglich gewesen, dauerhaft Ordnung zu halten, weil sich alles in dem einen Raum abspielte. Bei den Landowskis hingegen faszinierte mich die Aufgeräumtheit. Fast am liebsten half ich Elsa und Antoinette beim Abnehmen der in der Sonne getrockneten Wäsche. Die Hausmädchen amüsierten sich darüber, wie sehr ich darauf achtete, dass die Laken exakt auf Kante zusammengelegt wurden, und ich konnte nicht anders, als meine Nase in jedes einzelne Wäschestück zu stecken und seinen sauberen Geruch einzuatmen. Einen schöneren Duft gab es nicht für mich.
Nun schnitt ich die Tomaten genauso sorgfältig in Scheiben, wie ich die Wäsche faltete, und gesellte mich zu Monsieur Landowski und Laurent an den Tisch. Dort sah ich zu, wie sie Stücke von dem frischen Baguette abbrachen und etwas von dem Käse abschnitten. Erst als Monsieur Landowski mir signalisierte, dass ich es ihnen gleichtun solle, beteiligte ich mich an dem Festmahl. Papa hatte gern erzählt, wie köstlich französisches Essen schmecke, und es stimmte. Nachdem mir anfangs so übel geworden war, weil ich alles wie ein kleiner Wilder – so hatte Berthe mich einmal in Hörweite genannt – in mich hineinschlang, als wäre es meine letzte Mahlzeit überhaupt, speiste ich nun gesittet und meiner Kinderstube angemessen.
Die Gespräche drehten sich nach wie vor um den Cristo und die Augen von Sun Yat-sen. Monsieur Landowski war ein weltweit angesehener Künstler – im Sommer hatte er die Goldmedaille im Kunstwettbewerb der Olympischen Spiele gewonnen. Soweit ich das beurteilen konnte, hatte der Ruhm ihn nicht verändert. Das bewunderte ich am meisten an ihm. Er arbeitete, wann immer er konnte, und ließ oft das Abendessen ausfallen, weswegen Madame Landowski bisweilen klagte, seine Kinder und sie wollten ihn auch einmal zu Gesicht bekommen. Seine Detailversessenheit und sein Perfektionismus beeindruckten mich. Er hätte seine Werke ja einfach von Laurent vollenden lassen können. Ich beschloss, ihn mir, egal, was ich selbst einmal machen würde, zum Vorbild zu nehmen und stets mein Bestes zu geben.
»Und was ist mit dir, Junge? Hallo, Junge!«
Wieder einmal tauchte ich aus meinen Gedanken auf. Ich war es so gewohnt, mich derart zurückzuziehen, dass es mich jedes Mal erstaunte, wenn Menschen mir Interesse entgegenbrachten.
»Du hast nicht zugehört, stimmt’s?«
Ich entschuldigte mich mit einem Blick und schüttelte den Kopf.
»Ob Sun Yat-sens Augen deiner Ansicht nach gelungen sind, habe ich dich gefragt. Das Foto von ihm habe ich dir gezeigt, erinnerst du dich?«
Ich nahm meinen Stift und überlegte mir die Antwort sorgfältig. Man hatte mir beigebracht, immer die Wahrheit zu sagen, aber nun musste ich diplomatisch sein. Also notierte ich die Worte, die ich in dieser Situation für angemessen hielt, und gab ihm den Zettel.
Fast, Monsieur.
Landowski trank einen Schluck Wein und lachte schallend.
»Wie wahr, mein Junge, wie wahr. Also werde ich mich heute Nachmittag wieder ans Werk machen.«
Als die beiden Männer satt waren, räumte ich ab und brühte den Kaffee so auf, wie Monsieur Landowski ihn gern mochte. Nebenbei stopfte ich die Brot- und Käsereste in meine Hosentaschen. Man konnte ja nie wissen, wann das Essen knapp werden würde. Sobald ich den beiden den Kaffee gebracht hatte, verabschiedete ich mich mit einem Nicken und kehrte in meine Dachkammer zurück. Dort verstaute ich Brot und Käse in der Schreibtischschublade. Ziemlich oft landete das, was ich dort verbarg, am folgenden Morgen in der Mülltonne … Aber wie gesagt: Man konnte ja nie wissen.
Nachdem ich mir die Hände gewaschen und mich gekämmt hatte, ging ich nach unten, um das Silber zu putzen. Das konnte ich meiner Sorgfalt wegen sogar Evelyns kritischer Meinung nach gut. Ich genoss ihr Lob, weil ich so lange keines mehr erhalten hatte. Die Freude währte allerdings nicht lange, denn an der Tür drehte sie sich zu Elsa und Antoinette um, die gerade Messer und Gabeln in die mit Samt ausgeschlagenen Schubladen legten.
»Ihr könntet euch beide eine Scheibe vom Geschick dieses jungen Mannes abschneiden«, bemerkte sie und verließ den Raum. Elsa und Antoinette sahen mich wütend an. Doch weil sie faul waren und nicht viel Geduld besaßen, überließen sie es gern mir, das Silber zu polieren. Ich liebte es, in der Stille des großen Esszimmers an dem glänzenden Mahagonitisch zu arbeiten und meine Gedanken schweifen zu lassen.
Fast jeden Tag, seit mein Körper und meine Sinne sich zu erholen begonnen hatten, zerbrach ich mir den Kopf darüber, wie ich Geld verdienen könnte. Ich wusste, dass ich von den freundlichen Landowskis abhängig war. Schon am Abend konnten sie sagen, meine Zeit bei ihnen sei zu Ende. Dann wäre ich wieder draußen auf der Straße, verletzlich und allein. Instinktiv wanderten meine Finger zu dem Lederbeutel, den ich unterm Hemd trug. Die vertraute Form zu spüren tröstete mich, obwohl mir das, was sich darin befand, nicht gehörte und ich es nicht verkaufen konnte. Dass es die Reise überstanden hatte, grenzte an ein Wunder, doch dass es sich in meinem Besitz befand, war Segen und Fluch zugleich. Seinetwegen lebte ich nun in Paris, unter dem Dach von Fremden.
Beim Polieren der silbernen Teekanne kam ich zu dem Schluss, dass es im Haus nur eine Person gab, der ich genug vertraute, um sie um Rat zu fragen. Evelyn wohnte in dem, wie die Familie es nannte, »Häuschen«, einem Anbau des Haupthauses. Immerhin, meinte Evelyn, hatte es ein eigenes Bad und – wichtiger – eine eigene Eingangstür. Nach dem Abendessen würde ich all meinen Mut zusammennehmen und an dieser Tür klopfen.
***
Durch das Fenster des Esszimmers beobachtete ich, wie Evelyn zu ihrem Häuschen ging. Sie entfernte sich stets, sobald der Hauptgang serviert war, und überließ es den beiden Hausmädchen, das Dessert aufzutragen und den Abwasch zu erledigen. Während des Abendessens lauschte ich den Gesprächen der Familie. Nadine, die älteste Tochter, die noch unverheiratet war, verließ das Haus oft mit Staffelei, Pinseln und Palette. Ich kannte keines ihrer Werke, wusste aber, dass sie auch Kulissen fürs Theater entwarf. Weil ich noch nie ein Stück auf der Bühne gesehen hatte, konnte ich sie nicht nach ihrer Arbeit fragen. Und da sie ganz auf ihr eigenes Leben konzentriert zu sein schien, nahm sie kaum Notiz von mir. Gelegentlich schenkte sie mir ein Lächeln, wenn wir uns frühmorgens begegneten. Dann war da noch Marcel, der sich eines Tages vor mir aufgebaut, die Hände in die Hüften gestemmt und mir mitgeteilt hatte, dass er mich nicht möge. Wie dumm von ihm! Er kannte mich ja nicht. Ich hatte gehört, wie er mich seiner jüngeren Schwester Françoise gegenüber als »Speichellecker« bezeichnete, weil ich vor dem Abendessen in der Küche half. Irgendwie konnte ich ihn verstehen. Jeden anderen hätte es auch argwöhnisch gemacht, dass seine Eltern einen Straßenjungen, der in ihrem Garten aufgefunden worden war und nicht sprechen wollte, einfach so bei sich aufnahmen.
Aber als ich zum ersten Mal die Musik vernahm, die aus einem der unteren Räume in die Küche drang, verzieh ich ihm alles. Ich hielt in dem inne, was ich gerade tat, und lauschte wie gebannt. Papa hatte mir auf seiner Geige die Stücke vorgespielt, die er beherrschte. Doch welche Klänge ein begabter Mensch einem Klavier entlocken konnte, hatte ich noch nie erlebt. Es war herrlich. Seitdem musste ich ständig an Marcels Finger denken. Wenn ich ihn heimlich beobachtete, staunte ich, wie schnell und fehlerlos sie über die Tasten huschten, und musste mich zwingen, den Blick abzuwenden. Eines Tages würde ich den Mut aufbringen, Marcel zu fragen, ob ich ihm beim Spielen zuschauen dürfe. Egal, wie er mich behandelte: In meinen Augen war er ein Magier.
Sein älterer, fast schon erwachsener Bruder Jean-Max verhielt sich mir gegenüber gleichgültig. Ich wusste nur wenig über das, was er machte, wenn er das Haus verließ. Einmal brachte er mir Boule bei, den Nationalsport der Franzosen. Es dauerte nicht lange, bis ich dieses Spiel, bei dem es darum geht, größere Kugeln durch einen Wurf so nahe wie möglich an einer kleineren zu platzieren, ziemlich gut beherrschte.
Françoise, die jüngste Tochter der Landowskis, war nicht viel älter als ich. Bei meiner Ankunft hatte sie sich mir gegenüber freundlich, wenn auch ein wenig scheu gezeigt. Als sie mir im Garten wortlos eine Art Bonbon an einem Stöckchen schenkte, hatte ich mich sehr gefreut. Wir hatten nebeneinandergesessen, an unseren Süßigkeiten geschleckt und den Bienen beim Nektarsammeln zugeschaut. Sie leistete Marcel beim Klavierüben Gesellschaft und malte wie Nadine gern. Oft sah ich sie mit Blick aufs Haus an einer Staffelei sitzen. Ich hatte keine Ahnung, ob sie gut malte oder nicht, weil ich keines ihrer Werke kannte, nahm aber an, dass eine hübsche pastorale Landschaft mit Feld und Fluss, die im unteren Flur hing, von ihr stammte. Dicke Freunde wurden wir nie, denn höchstwahrscheinlich ist es sterbenslangweilig, Zeit mit jemandem zu verbringen, mit dem man sich nicht unterhalten kann. Doch sie lächelte mich oft freundlich an. Hin und wieder – normalerweise sonntags, wenn Monsieur Landowski frei hatte – spielten alle Boule oder picknickten gemeinsam. Obwohl sie mich jedes Mal einluden mitzugehen, schlug ich das Angebot aus Achtung vor ihrer Zeit als Familie aus, und weil ich auf die harte Weise erfahren hatte, welchen Schaden Ressentiments anrichten können.
Nach dem Abendessen half ich Elsa und Antoinette beim Abspülen. Sobald sie nach oben gegangen waren, schlüpfte ich zur Küchentür hinaus und eilte zur hinteren Seite des Hauses, damit niemand mich bemerkte.
Vor Evelyns Tür schlug mein Herz wie wild. Machte ich einen Fehler? Sollte ich umkehren und die ganze Sache vergessen?
»Nein«, flüsterte ich. Irgendwann musste ich jemandem vertrauen. Mein Instinkt, der mich so lange am Leben gehalten hatte, sagte mir, dass ich das Richtige tat.
Zitternd streckte ich die Hand aus, um leise an der Tür zu klopfen. Keine Reaktion, natürlich nicht, denn nur jemand, der direkt auf der anderen Seite stand, hätte mich hören können. Also klopfte ich lauter. Wenige Sekunden später wurde der Vorhang am Fenster zurückgezogen, und gleich darauf öffnete sich die Tür.
»Ja, wen haben wir denn da?«, fragte Evelyn lächelnd. »Komm herein. Passiert nicht oft, dass jemand bei mir klopft«, meinte sie schmunzelnd.
Ich betrat den gemütlichsten Raum, den ich bis dahin gesehen hatte. Obwohl ich wusste, dass das Häuschen einmal eine Garage für Monsieur Landowskis Wagen gewesen war und auf Betonboden stand, erblickte ich darin nur Schönes. Zwei Polstersessel mit bunt bestickten Steppdecken waren auf die Mitte des Raums ausgerichtet. An den Wänden hingen Familienporträts und Stillleben, und auf dem ordentlich aufgeräumten Mahagonitisch am Fenster befand sich ein Blumenstrauß. Ich entdeckte eine kleine Tür, die vermutlich zum Schlafzimmer und zum Bad führte, und auf einem Regal über einer Anrichte voller Porzellantassen und Gläser stapelten sich Bücher.
»Setz dich.« Evelyn deutete auf einen der Sessel und entfernte eine Petit-Point-Handarbeit von dem ihren. »Möchtest du Limonade? Sie ist selbst gemacht, nach meinem eigenen Rezept.«
Ich nickte begeistert. Bevor ich nach Frankreich gekommen war, hatte ich noch nie Limonade getrunken, und jetzt konnte ich gar nicht genug davon bekommen.
Evelyn ging zur Kommode, nahm zwei Gläser, füllte sie mit milchig-gelber Flüssigkeit aus einem Krug voll Eis und sank in ihren Sessel, in den sie aufgrund ihrer Leibesfülle kaum passte. »Santé!« Sie hob ihr Glas.
Ich hob das meine ebenfalls.
»Also«, meinte Evelyn, »was kann ich für dich tun?«
Da ich bereits notiert hatte, was ich sie fragen wollte, musste ich nur noch den Zettel aus der Tasche holen und ihr geben.
Sie las, was darauf stand, und blickte mich an.
»Du möchtest wissen, wie du Geld verdienen kannst? Deswegen bist du hier?«
Ich nickte.
»Junger Mann, ich bin mir nicht sicher, ob ich dir da helfen kann. Darüber muss ich nachdenken. Warum hast du denn das Gefühl, etwas verdienen zu müssen?«
Ich bedeutete ihr mit einer Geste, dass sie den Zettel umdrehen solle.
»›Falls die freundlichen Landowskis irgendwann beschließen, keinen Platz mehr für mich zu haben‹«, las sie laut vor. »Angesichts seines Erfolges und seiner zahlreichen Aufträge würde ich sehr bezweifeln, dass sie in nächster Zeit in ein kleineres Haus umziehen müssen. Folglich wird hier immer Platz für dich sein. Aber ich kann nachvollziehen, was du meinst. Du fürchtest, dass sie dich eines Tages einfach vor die Tür setzen, stimmt’s?«
Ich nickte heftig.
»Und dann wärst du einer von vielen jungen hungernden Waisen auf den Straßen von Paris. Was mich zu einer wichtigen Frage führt: Bist du überhaupt Waise? Ja oder nein reicht.«
Ich schüttelte genauso heftig den Kopf, wie ich zuvor genickt hatte.
»Wo sind deine Eltern?«
Sie gab mir den Zettel zurück, und ich schrieb die Antwort darauf.
Ich weiß es nicht.
»Verstehe. Ich dachte, du hättest sie vielleicht im Krieg verloren, aber der war 1918 zu Ende, und dafür bist du zu jung.«
Ich zuckte, bemüht um einen neutralen Gesichtsausdruck, mit den Achseln. Bei freundlichen Menschen wird man leicht unvorsichtig, und das durfte ich keinesfalls.
Sie musterte mich stumm. »Du kannst reden, junger Mann, das weiß ich. Die brasilianische Dame, die hier bei uns war, hat uns verraten, dass du dich an dem Abend, an dem sie dich fand, in fließendem Französisch bei ihr bedankt hast. Die Frage ist nur: Warum tust du es nicht? Vorausgesetzt, dir hat es nicht in der Zwischenzeit die Sprache verschlagen, was ich sehr bezweifle, fällt mir als Antwort nur ein, dass du Angst hast, jemandem zu vertrauen. Habe ich recht?«
Ich war hin und her gerissen … Am liebsten hätte ich Ja gesagt, mich in ihre tröstenden Arme geworfen und ihr alles erzählt, aber das konnte ich nicht. Ich signalisierte ihr, dass ich den Zettel benötige, schrieb etwas darauf und gab ihn ihr zurück.
Ich hatte Fieber und erinnere mich nicht, mit Bel gesprochen zu haben.
Nachdem Evelyn meine Worte gelesen hatte, lächelte sie. »Verstehe, junger Mann. Du lügst, das ist mir klar. Was du erlebt hast, hindert dich daran, jemandem zu vertrauen. Vielleicht werde ich dir eines Tages, wenn wir beide uns ein wenig besser kennen, etwas über mein Leben erzählen. Im Krieg war ich als Krankenschwester an der Front. Das Leid, das ich dort gesehen habe, werde ich nie vergessen. Vorübergehend hat es mir sogar das Vertrauen in die Menschen geraubt – und den Glauben an Gott. Glaubst du an Gott?«
Ich nickte unsicher.
»Vermutlich befindest du dich an demselben Punkt wie ich damals. Ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich wieder an irgendetwas glauben konnte. Weißt du, was mir Glauben und Vertrauen zurückgegeben hat? Die Liebe zu meinem kleinen Jungen. Die hat alles ins Lot gerückt. Natürlich kommt die Liebe von Gott oder wie man das nennen mag, was uns Menschen auf unsichtbare Weise mit ihm verbindet. Selbst wenn wir manchmal das Gefühl haben, von ihm verlassen worden zu sein, ist das nicht der Fall. Aber egal. Leider habe ich keine Antwort auf deine Frage. Auf den Straßen von Paris gibt es viele Jungen wie dich, die irgendwie überleben, wie, darüber möchte ich lieber nicht so genau nachdenken … Ich wünschte, du würdest mir wenigstens so weit vertrauen, mir deinen Namen zu verraten. Ich schwöre dir: Monsieur und Madame Landowski sind gute, freundliche Menschen. Sie würden dich niemals einfach so hinauswerfen.«
Wieder machte ich ihr ein Zeichen, dass sie mir den Zettel reichen solle, und sobald ich etwas darauf geschrieben hatte, gab ich ihn ihr zurück.
Was werden sie dann mit mir machen?
»Wenn du sprechen könntest, würden sie dich für immer bei sich wohnen lassen und dich in die Schule schicken wie ihre anderen Kinder. Doch so, wie die Sache steht, ist das wohl nicht möglich, oder? Kaum eine Schule würde einen stummen Jungen nehmen, egal, welche Vorkenntnisse er hat. Ich vermute, du besitzt Bildung und würdest gern weiter unterrichtet werden. Stimmt’s?«
Ich zuckte mit den Achseln, wie alle im Haus es so oft taten.
»Bitte keine Lügen, junger Mann«, herrschte Evelyn mich an. »Du hast deine Gründe zu schweigen, aber wenigstens könntest du ehrlich sein. Möchtest du weiter an deiner Bildung arbeiten oder nicht?«
Nach kurzem Zögern nickte ich.
Evelyn schlug sich auf den Oberschenkel. »Na also. Du musst dich entscheiden, ob du bereit bist zu sprechen, denn dann wäre deine Zukunft im Hause Landowski bedeutend sicherer. Du wärst ein normales Kind, könntest eine normale Schule besuchen, und sie würden dich in ihrer Familie lassen, das weiß ich.« Evelyn gähnte. »Ich muss morgen früh raus, junger Mann, doch ich habe diesen Abend und deine Gesellschaft sehr genossen. Du kannst jederzeit wieder bei mir klopfen, wenn dir danach ist.«
Ich stand auf, bedankte mich mit einem Kopfnicken und ging zur Tür. Evelyn erhob sich, um mir zu folgen. Gerade als ich den Knauf drehen wollte, spürte ich, wie sie sacht die Hände auf meine Schultern legte, mich zu sich herumdrehte und an sich drückte.
»Ein bisschen Liebe ist das Einzige, was du brauchst, chéri. Ich wünsche dir eine gute Nacht.«
III
26. Oktober 1928
Heute wurde vor dem Abendessen der Kamin im Speisezimmer angezündet. Ich finde es aufregend, einen solchen Kamin zu sehen, begreife aber nicht, warum alle sich über die Kälte beklagen. Sämtliche Familienmitglieder erfreuen sich bester Gesundheit und sind sehr beschäftigt. Monsieur Landowski macht sich Sorgen über den Transport seines kostbaren Cristo nach Rio de Janeiro. Und Sun Yat-sen muss er auch noch fertigstellen. Ich versuche, mich so viel wie möglich im Haus nützlich zu machen, und hoffe, nicht als Last empfunden zu werden. Besonders freue ich mich über meine neuen Wintersachen, die früher Marcel gehörten. Der Stoff, aus dem Hemd, Hose und Pullover sind, fühlt sich wunderbar fein und weich an auf der Haut. Madame Landowski hat freundlicherweise beschlossen, mir Bildung angedeihen zu lassen, auch wenn ich momentan nicht die Schule besuchen kann, weil ich stumm bin. Sie hat Mathematikaufgaben und einen Rechtschreibtest für mich erstellt. Ich strenge mich an, die richtigen Lösungen zu finden. Und ich bin froh und dankbar, mit so großzügigen Menschen in diesem schönen Haus wohnen zu dürfen.
Ich legte den Stift weg und klappte das Tagebuch in der Hoffnung zu, dass neugierige Leser an nichts von dem, was darin steht, Anstoß nehmen würden. Dann holte ich den kleinen Stapel Papier unter der Schublade hervor, den ich auf die gleiche Größe zugeschnitten hatte wie die Tagebuchseiten. Darauf notiere ich, was ich wirklich denke. Anfangs schrieb ich nur in das Tagebuch, um denen zu gefallen, die es mir geschenkt hatten, für den Fall, dass sie sich einmal erkundigten, ob ich es auch benutze. Aber irgendwann begann ich zu merken, wie belastend es für mich war, meine Gedanken und Gefühle nicht aussprechen zu dürfen. Sie nun schriftlich fixieren zu können empfand ich als erleichternd. Eines Tages, wenn ich nicht mehr bei den Landowskis wäre, würde ich diese Seiten an den passenden Stellen einschieben, sodass ein aufrichtigeres Bild von meinem Leben entstünde.
Ich glaube, es lag an Evelyn, dass es mir so schwerfiel, an den Abschied zu denken, denn ich hatte ihr Angebot, sie jederzeit besuchen zu dürfen, angenommen. Ihre mütterlichen Gefühle erschienen mir echt. Ich saß mit ihr in ihrem gemütlichen Zimmer und hörte zu, wie sie ihre leidvolle Geschichte erzählte. Ihr Mann und ihr älterer Sohn sind nicht aus dem Krieg zurückgekommen. Seit ich bei den Landowskis bin, habe ich viel über diesen Krieg erfahren, den ich, da ich 1918 zur Welt kam, nicht persönlich erlebt habe. Unzählige Männer starben auf dem Schlachtfeld, weil man sie zwang, aus dem Schützengraben zu springen, oder schrien vor Schmerz, wenn Granaten ihnen Arme oder Beine wegrissen. Evelyns Schilderungen jagten mir einen Schauer über den Rücken.
»Am meisten bringt mich aus der Fassung, dass mein Anton und mein Jacques ganz allein und ohne Trost sterben mussten.«
Als ich sah, wie Evelyns Augen feucht wurden, streckte ich die Hand nach ihr aus. Am liebsten hätte ich tröstende Worte gesprochen wie: »Mein Beileid. Das muss furchtbar für Sie sein. Auch ich habe alle Menschen verloren, die ich liebte …«
Sie erklärte mir, das sei der Grund, warum sie so stolz auf den einen verbliebenen Sohn sei und ihn um jeden Preis schützen wolle. Falls man ihn ihr ebenfalls nähme, würde sie den Verstand verlieren. Fast hätte ich ihr gestanden, dass ich den meinen verloren hatte, er aber zu meiner Überraschung allmählich zurückkehrt.
Es wurde immer schwieriger, stumm zu bleiben, denn ich wusste: Sobald ich etwas sagte, würde ich zur Schule gehen können. Und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als weiter lernen zu dürfen. Doch man würde mir Fragen über meine Herkunft stellen, die ich nicht beantworten konnte. Oder ich müsste lügen, und diese guten Menschen, die mir Kleidung und Essen und ein Dach über dem Kopf gaben, hatten bei Gott etwas Besseres verdient.
***
»Hereinspaziert!«, begrüßte mich Evelyn, als ich die Tür öffnete. Sie hatte ein schlimmes Bein, das vermutlich stärker schmerzte, als sie zugab. Ich schien nicht der Einzige zu sein, der sich seiner Stellung im Haushalt der Landowskis unsicher war.
»Mach schon mal den Kakao, junger Mann. Es ist alles vorbereitet«, sagte sie.
Ich atmete den wunderbaren Duft der Schokolade ein. Bestimmt hatte ich früher schon einmal davon gekostet, aber jetzt war ich regelrecht süchtig danach. Der Kakao mit Evelyn gehörte inzwischen zu meinen Lieblingszeiten des Tages.
Ich stellte eine der beiden Tassen auf das Tischchen neben Evelyn und die andere auf den Sims über dem Kamin, in dem ein Feuerchen prasselte. Als ich mich setzte, fächelte ich mir Luft zu, weil mir von der Wärme fast schwindelig war.
»Du kommst aus einem sehr kalten Land, stimmt’s?«, meinte Evelyn, die mir in einem unachtsamen Moment Informationen entlocken wollte.
Ich nahm die Tasse mit dem Kakao in die Hand und nippte daran, um ihr zu beweisen, dass es mir trotz des warmen Wollpullovers nicht unangenehm war, etwas Heißes zu trinken.
»Eines Tages wirst du mir schon noch eine Antwort geben. Aber fürs Erste bist du mir ein Rätsel.«
Ich sah sie fragend an.
»Ich meine, niemand weiß, wer du wirklich bist«, erklärte sie. »Was dich interessant macht. Nach einer Weile könnte es allerdings langweilig werden.«
Autsch! Das hatte gesessen.
»Verzeih. Ich sage das nur, weil ich mir deinetwegen Sorgen mache. Monsieur und Madame Landowski könnten irgendwann die Geduld verlieren. Ich habe sie neulich, als ich im Salon Staub wischte, reden hören. Sie spielen mit dem Gedanken, dich zu einem Psychiater zu schicken. Weißt du, was das ist?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Ein Psychiater stellt Fragen und bildet sich ein Urteil über deinen Geisteszustand und die Ursachen dafür. Wenn er dich für gestört hielte, müsstest du möglicherweise in eine Klinik.«
Meine Augen weiteten sich vor Entsetzen. Ich wusste, was sie meinte. Einer unserer Nachbarn zu Hause, den wir oft schreien und kreischen gehört und einmal sogar nackt die Hauptstraße unseres Ortes entlanglaufen gesehen hatten, war in ein sogenanntes »Sanatorium« gebracht worden. Solche Sanatorien scheinen grässliche Orte zu sein, voll mit Männern und Frauen, die schreien und kreischen oder einfach nur dasitzen und wie tot vor sich hin starren.
»Entschuldige, das hätte ich dir nicht sagen sollen«, meinte Evelyn. »Allen ist klar, dass du nicht verrückt bist. Eher verbirgst du deine Klugheit. Sie wollten dich zum Psychiater schicken, um herauszufinden, was du uns nicht mitteilen kannst, obwohl du dazu in der Lage wärst.«
Wie immer schüttelte ich heftig den Kopf. Meine Standarderwiderung lautete: Ich hatte Fieber und kann mich nicht daran erinnern, mit Bel geredet zu haben. Was nicht einmal ganz gelogen war.
»Sie versuchen dir zu helfen, mein Junge. Bitte schau mich nicht so entgeistert an.« Evelyn griff nach einem braunen Päckchen, das neben ihrem Sessel lag. »Für dich, für den Winter.«
Ich hatte schon lange kein Geschenk mehr aufgemacht. Es fühlte sich an wie Geburtstag. Am liebsten hätte ich das Öffnen genüsslich ausgekostet, aber Evelyn ermutigte mich, das Papier einfach aufzureißen. In dem Päckchen befanden sich ein bunt gestreifter Schal und eine Wollmütze.
»Probier die Sachen an, junger Mann. Schau, ob sie dir passen.«
Obwohl mir glühend heiß war, tat ich ihr den Gefallen. Der Schal passte natürlich, aber die Wollmütze war mir ein wenig zu groß, sodass sie mir über die Augen rutschte.
»Gib sie mir«, forderte Evelyn mich auf und krempelte kurz darauf den vorderen Rand der Mütze um. »So dürfte es hinhauen. Was meinst du?«
Dass ich vor Hitze vergehe, wenn ich die Sachen nur eine Sekunde länger anbehalte …
Ich nickte begeistert, stand auf, trat zu ihr und umarmte sie. Als ich mich von ihr löste, merkte ich, dass meine Augen tränennass waren.
»Du dummer Bengel, du weißt ja, wie gern ich stricke. Von der Sorte habe ich Hunderte für unsere Jungs an der Front gemacht.«
Ich kehrte zu meinem Sessel zurück. Das Wort »Danke« lag mir auf der Zunge, doch ich hielt es zurück. Als ich den Stuhl erreichte, nahm ich Mütze und Schal ab, legte sie sorgfältig zusammen und verstaute sie ehrfürchtig wieder in dem braunen Papier.
»Wird Zeit, dass wir zwei ins Bett kommen«, sagte Evelyn nach einem Blick zur Uhr auf dem Kaminsims. »Aber zuerst muss ich dir noch etwas Wunderbares erzählen.« Sie deutete auf einen Brief, der hinter der Uhr steckte. »Der ist von meinem Sohn Louis. Er will mich an meinem freien Tag besuchen. Wie findest du das?«
Ich nickte erfreut. Trotzdem merkte ich, dass ich ein wenig eifersüchtig auf diesen großartigen Louis war, den seine Mutter abgöttisch liebte. Vielleicht wäre ich sogar in der Lage, ihn zu hassen, dachte ich.
»Du sollst ihn kennenlernen. Er lädt mich zum Mittagessen im Ort ein. So gegen halb vier sind wir wieder da. Schau doch um vier hier vorbei, ja?«
Es war gar nicht leicht, nicht so mürrisch zu wirken, wie ich mich fühlte. Ich tippte auf das Päckchen, verabschiedete mich mit einem kurzen Winken und einem breiten Lächeln von ihr und verließ den Raum. Am Abend rollte ich mich beunruhigt in meinem Bett zusammen. In Gedanken war ich bei dem Konkurrenten um Evelyns Zuneigung und bei dem, was sie über den Psychiater gesagt hatte, zu dem die Landowskis mich vielleicht schicken würden.
In der Nacht schlief ich nicht gut.
***
Am Sonntagnachmittag wusch ich mir das Gesicht über der Wasserschale, die eines der Hausmädchen jeden Tag frisch füllte. Hier oben unter dem Dach hatten wir keine »Örtlichkeiten« (wieder etwas, worüber sich Elsa und Antoinette beklagten, da sie nachts nach unten gehen mussten, um ihr Geschäft zu erledigen). Ich bürstete mir die Haare und entschied mich gegen den Wollpullover, weil Evelyn für ihren Sohn bestimmt den Kamin angezündet hatte. Unten verließ ich das Haus durch die Küchentür. Auf halbem Weg zu Evelyn ließ mich ein Geräusch mitten in der Bewegung erstarren. Ich lauschte mit geschlossenen Augen, unwillkürlich trat ein Lächeln auf meine Lippen. Dieses Musikstück kannte ich. Es wurde nicht von einem Meister wie meinem Vater, aber immerhin von jemandem gespielt, der viele Jahre geübt hatte.
Sobald die Musik aufhörte, sammelte ich mich, ging zu Evelyns Tür und klopfte. Sie wurde von einem schmalen, groß gewachsenen jungen Mann geöffnet, der, wie ich wusste, neunzehn war.