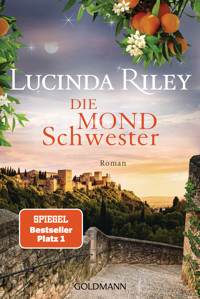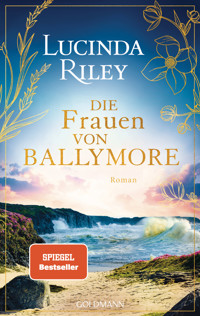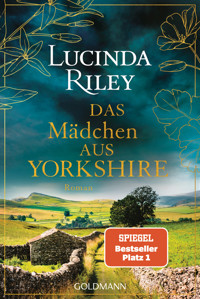11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die sieben Schwestern
- Sprache: Deutsch
Sieben Sterne umfasst das Sternbild der Plejaden, und die Schwestern d’Aplièse tragen ihre Namen. Stets war ihre siebte Schwester aber ein Rätsel für sie, denn Merope ist verschwunden, seit sie denken können. Eines Tages überbringt der Anwalt der Familie die verblüffende Nachricht, dass er eine Spur entdeckt hat: Ein Weingut in Neuseeland und die Zeichnung eines sternförmigen Rings weisen den Weg. Allerdings kann nur eine Frau, Mary, Antworten geben – und sie ist auf einer Reise um die Welt. Es beginnt eine Jagd quer über den Globus, doch es scheint, als wolle Mary um jeden Preis verhindern, gefunden zu werden...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1077
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Sieben Sterne umfasst das Sternbild der Plejaden, und die Schwestern d’Aplièse tragen ihre Namen. Stets war ihre siebte Schwester aber ein Rätsel für sie, denn Merope ist verschwunden, seit sie denken können. Eines Tages überbringt der Anwalt der Familie die verblüffende Nachricht, dass er eine Spur entdeckt hat: Ein Weingut in Neuseeland und die Zeichnung eines sternförmigen Rings weisen den Weg. Es beginnt eine Jagd quer über den Globus, denn Mary McDougal – die Frau, die als Einzige bestätigen kann, ob ihre Tochter Mary-Kate die verschwundene Schwester ist – befindet sich auf einer Weltreise. Während die Schwestern ihre Suche nach Neuseeland, Kanada, England, Frankreich und Irland führt, schlüpft ihnen Mary immer wieder durch die Finger. Und es scheint, als wollte sie unbedingt verhindern, gefunden zu werden …
Weitere Informationen zu Lucinda Riley sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie unter www.penguin.de/Autor/Lucinda-Riley/p411595.rhd.
Lucinda Riley
Die verschwundene Schwester
Der siebte Band der »Sieben Schwestern«-Reihe
ROMAN
Aus dem Englischen von Karin Dufner, Sonja Hauser, Sibylle Schmidt und Ursula Wulfekamp
Die Originalausgabe erscheint 2021 unter dem Titel »The Missing Sister« bei Macmillan, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Übersetzung von Kapitel 1–23 besorgte Sonja Hauser, von Kapitel 24–34 Sibylle Schmidt, von Kapitel 35–43 Karin Dufner und von Kapitel 44–54 Ursula Wulfekamp.
Copyright © der Originalausgabe 2021 by Lucinda Riley
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Johanna Huber / Huber Images; plainpicture / AWL / Andrea Comi
CN · Herstellung: Han
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-20196-8V007
www.goldmann-verlag.de
Für Harry
Mut ist wissen, wovor man keine Angst haben muss.
Platon
Personen
Atlantis
Pa Salt
Adoptivvater der Schwestern (verstorben)
Marina (Ma)
Mutterersatz der Schwestern
Claudia
Haushälterin von Atlantis
Georg Hoffman
Pa Salts Anwalt
Christian
Skipper
Die Schwestern d’Aplièse
Maia
Ally (Alkyone)
Star (Asterope)
CeCe (Celaeno)
Tiggy (Taygeta)
Elektra
Merope (fehlt)
Mary-Kate
Gibbston ValleyNeuseeland
Juni 2008
I
Nie werde ich vergessen, wo ich war und was ich tat, als ich meinen Vater sterben sah. Ich stand an ziemlich genau derselben Stelle wie jetzt, die Arme auf das Holzgeländer der Veranda um unser Haus gestützt, und schaute den Erntehelfern zu, wie sie sich zwischen den Reihen der Rebstöcke vorarbeiteten, an denen schwer die reifen Trauben hingen. Gerade als ich mich zu ihnen gesellen wollte, nahm ich aus dem Augenwinkel wahr, wie mein Vater, ein Schrank von einem Mann, urplötzlich aus meinem Blickfeld verschwand. Zuerst dachte ich, er hätte sich hingekniet, um heruntergefallene Trauben aufzuheben – er hasste jegliche Art von Verschwendung, was er auf die streng presbyterianische Einstellung seiner schottischen Eltern zurückführte –, da stürzten Helfer aus den Reihen neben der seinen zu ihm. Von der Veranda aus waren es gute hundert Meter. Ich rannte hinüber. Als ich ihn erreichte, hatte ihm schon jemand das Hemd aufgerissen und versuchte, ihn wiederzubeleben, indem er mit aller Kraft die Hände auf seinen Brustkorb presste und ihn von Mund zu Mund beatmete, während ein anderer die Notrufnummer wählte. Der Krankenwagen kam zwanzig Minuten später.
Wie er so mit wächserner Gesichtsfarbe auf der Tragbahre lag, wurde mir klar, dass ich seine tiefe, sonore Stimme, die immer so ernst klang, jedoch auch von der einen Sekunde auf die andere in ein raues, kehliges Lachen übergehen konnte, nie wieder hören würde. Tränenüberströmt küsste ich sanft seine wettergegerbte Wange, sagte ihm, dass ich ihn liebe, und verabschiedete mich von ihm. Im Nachhinein betrachtet wirkte das ganze schreckliche Ereignis, die Verwandlung eines vor Leben strotzenden Menschen in eine kraftlose, leere Körperhülle surreal und letztlich unbegreiflich.
Nachdem Dad monatelang unter Schmerzen in der Brust gelitten hatte, die er als Sodbrennen abtat, war es uns endlich gelungen, ihn zu einem Arztbesuch zu bewegen. Der hatte ihm mitgeteilt, seine Cholesterinwerte seien zu hoch, er müsse Diät halten. Meine Mutter und ich wären fast verzweifelt, weil er weiterhin aß, worauf er Appetit hatte, und dazu jeden Abend eine Flasche Rotwein aus seinem eigenen Weingut leerte. Eigentlich hätte es uns also nicht überraschen dürfen, als schließlich das Schlimmste passierte. Vielleicht hatten wir ihn aufgrund seiner starken Persönlichkeit und Jovialität für unsterblich gehalten, aber wie meine Mutter so richtig bemerkte, bestehen wir am Ende doch alle nur aus Fleisch und Knochen. Wenigstens hatte er bis ganz zum Schluss so gelebt, wie er wollte. Außerdem war er immerhin dreiundsiebzig gewesen, eine Tatsache, die ich aufgrund seiner Körperkraft und Lebenslust gern vergaß.
Ja, ich fühlte mich betrogen. Schließlich war ich erst zweiundzwanzig. Obwohl ich wusste, dass ich spät in das Leben meiner Eltern getreten war, begriff ich, was das bedeutete, erst bei Dads Tod. In den Monaten, die er mittlerweile nicht mehr unter uns weilte, hatte ich Wut über diese Ungerechtigkeit empfunden; warum war ich nicht früher zur Welt gekommen? Mein großer Bruder Jack hatte mit seinen zweiunddreißig zehn Jahre mehr mit unserem Dad verbringen dürfen als ich.
Mum schien meinen Zorn zu spüren, auch wenn ich nie offen mit ihr darüber sprach. Genau deswegen plagten mich Schuldgefühle, weil sie ja nichts dafür konnte. Ich liebte sie von ganzem Herzen. Wir standen uns seit jeher sehr nahe, und sie trauerte ebenfalls, das sah ich. Weil wir uns bemühten, einander zu trösten, gelang es uns irgendwie, dieses tiefe Tal der Tränen zu durchschreiten.
Jack, der den Löwenanteil seiner Zeit damit verbrachte, sich durch den Bürokratieberg nach Dads Tod zu wühlen, war uns eine große Stütze. Er musste nun die Leitung von The Vinery übernehmen, dem Weingut, das Mum und Dad aus dem Nichts aufgebaut hatten. Wenigstens hatte Dad ihn gut darauf vorbereitet.
Dad hatte Jack von Kindesbeinen an mitgenommen, wenn er im Reigen der Jahreszeiten seine kostbaren Rebstöcke hätschelte, die je nach Wetterlage irgendwann zwischen Februar und April die Trauben hervorbrachten, aus denen man einen köstlichen, seit Kurzem sogar preisgekrönten Pinot noir kelterte und lagerte, um ihn in Neuseeland und Australien zu verkaufen. Er hatte Jack jeden einzelnen Schritt gezeigt, sodass dieser schon mit zwölf Jahren die Helfer hätte anleiten können.
Mit sechzehn hatte Jack dann offiziell verkündet, er wolle in die Fußstapfen von Dad treten und eines Tages The Vinery leiten, was Dad natürlich sehr freute. Jack hatte Betriebswirtschaft studiert und anschließend begonnen, Vollzeit im Weinberg zu arbeiten.
»Es gibt nichts Schöneres, als ein intaktes Erbe zu hinterlassen«, hatte Dad zu Jack nach dessen sechsmonatigem Aufenthalt auf einem Weingut in den australischen Adelaide Hills gesagt und bei einer Flasche Wein erklärt, nun sei er bereit.
»Vielleicht möchtest du ja eines Tages auch ins Familienunternehmen einsteigen, Mary-Kate. Trinken wir darauf, dass es noch in Hunderten von Jahren McDougals auf diesem Weingut geben wird!«
Während Jack Dads Traum teilte, geschah bei mir genau das Gegenteil. Möglicherweise lag es daran, dass Jack so aufrichtig vom Anbau hervorragender Weine begeistert war. Er roch nicht nur mit seiner feinen Nase faule Trauben aus einem Kilometer Entfernung, sondern war obendrein ein ausgezeichneter Geschäftsmann. Ich hingegen sah, während ich vom Mädchen zur jungen Frau heranwuchs, lediglich zu, wie Dad und Jack zwischen den Rebstöcken patrouillierten und im »Labor« arbeiteten (so nannten sie liebevoll einen großen Schuppen mit Blechdach). Mich interessierten andere Dinge. Mittlerweile war The Vinery für mich etwas, das nichts mit mir und meiner Zukunft zu tun hatte. Trotzdem half ich in den Schul- und Uniferien in unserem kleinen Laden mit oder ging meinen Eltern und Jack zur Hand, wo ich gebraucht wurde, auch wenn Wein einfach nicht meine Leidenschaft war. Obwohl Dad enttäuscht gewirkt hatte, als ich ihm mitteilte, ich werde Musik studieren, war es ihm gelungen, Verständnis für mich aufzubringen.
»Das freut mich für dich«, hatte er gesagt und mich umarmt. »Aber Musik ist ein weites Feld, Mary-Kate. Wohin genau soll die Reise gehen?«
Verlegen hatte ich ihm gestanden, dass ich eines Tages als Sängerin meine eigenen Songs schreiben wolle.
»Das ist ein höllisch großer Traum, und zu seiner Verwirklichung kann ich dir nur viel Glück wünschen. Auf deine Mum und mich wirst du immer zählen können, das ist dir klar, oder?«
»Wie schön, Mary-Kate«, hatte Mum ihm beigepflichtet. »Sich durch Gesang ausdrücken zu können, ist etwas Wunderbares.«
Ich hatte tatsächlich Musik studiert, und zwar an der hoch angesehenen University of Wellington. Ein modernes Aufnahmestudio für meine Songs zur Verfügung zu haben und mich mit anderen Studenten austauschen zu können, die meine Liebe teilten, war einfach unglaublich. Ich trat im Duo mit Fletch auf, einem engen Freund, der Rhythmusgitarre spielte und dessen Singstimme gut mit der meinen harmonierte. Hin und wieder schafften wir es, einen Gig in Wellington zu ergattern, und auch beim Studienabschlusskonzert im vergangenen Jahr waren wir mit von der Partie gewesen. Bei der Gelegenheit hatte meine Familie mich das erste Mal live singen und Keyboard spielen gehört.
»Ich bin sehr stolz auf dich, MK.« Dad hatte mich fest an sich gedrückt. Das war einer der schönsten Momente meines Lebens gewesen.
»Und heute, ein Jahr nach meinem Abschluss, sitze ich nach wie vor hier zwischen Rebstöcken«, jammerte ich. »Aber mal ehrlich, MK, hast du echt geglaubt, Sony würde mit einem Plattenvertrag für dich ums Eck kommen?«
In dem Jahr nach der Uni war ich im Hinblick auf meine Zukunft immer niedergeschlagener geworden, und durch Dads Tod hatte meine Kreativität einen schweren Schlag erlitten. Es fühlte sich an, als hätte ich die beiden größten Lieben meines Lebens gleichzeitig verloren, da die eine unauflöslich mit der anderen verbunden war. Dads Faible für weibliche Singer-Songwriter hatte seinerzeit meine Leidenschaft für die Musik geweckt. Ich war mit den Stimmen von Joni Mitchell, Joan Baez und Alanis Morissette aufgewachsen.
Die Zeit in Wellington hatte mir vor Augen geführt, wie behütet und idyllisch meine Kindheit in diesem herrlichen Garten Eden des Gibbston Valley gewesen war. Die Berge, die sich zu beiden Seiten des Tals erhoben, bildeten einen natürlichen Schutzwall, und in dem fruchtbaren Boden gedieh wie durch Zauberhand eine Überfülle an saftigen Früchten.
Ich weiß noch, wie Jack mich als Teenager überredete, von den wilden Stachelbeeren zu kosten, die an dornigen Sträuchern hinter dem Haus wuchsen, und wie er lauthals lachte, als ich die sauren Beeren angewidert ausspuckte. Meine Eltern legten mir keine Zügel an, wenn ich in der freien Natur herumtobte, weil sie wussten, dass mir, wenn ich in den kühlen, klaren Bächen planschte oder Kaninchen durchs struppige Gras jagte, nichts passieren konnte. Während meine Eltern im Weingut schufteten, neue Rebstöcke pflanzten, sie vor hungrigen Tieren schützten und schließlich die Trauben ernteten und pressten, hatte ich in meiner eigenen Welt gelebt.
Plötzlich schob sich eine Wolke vor die grelle Morgensonne, sodass das Tal in einem satteren Grün erschien. Das waren die ersten Vorboten des Winters. Nicht zum ersten Mal überlegte ich, ob es die richtige Entscheidung gewesen war hierzubleiben. Zwei Monate zuvor hatte Mum zu meiner Überraschung erklärt, sie wolle sich auf eine »Weltreise« begeben und Freunde besuchen, die sie jahrelang nicht gesehen habe. Und sie hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte, sie zu begleiten. Seinerzeit hoffte ich noch, dass die Demoaufnahme, die ich mit Fletch eingespielt und kurz vor Dads Tod an Plattenfirmen auf der ganzen Welt geschickt hatte, deren Interesse wecken würde. Doch immer wieder hatten wir Absagen erhalten, mit der Begründung, unsere Musik sei leider nicht das, wonach der betreffende Produzent »im Moment« suche.
»Liebes, du weißt so gut wie ich, dass es mit zum Schwierigsten überhaupt gehört, im Musikgeschäft Fuß zu fassen«, hatte Mum gemeint.
»Und genau deswegen sollte ich hierbleiben«, hatte ich geantwortet. »Fletch und ich arbeiten an neuen Songs. Ich kann ihn nicht im Stich lassen.«
»Nein, natürlich nicht. Zum Glück bleibt dir ja, wenn alle Stricke reißen, immer noch The Vinery.«
Ich hätte dankbar für ihren Trost und dafür sein sollen, dass ich mir im Laden und in der Buchhaltung Geld verdienen konnte. Doch wie ich nun so den Blick über meinen Garten Eden schweifen ließ, seufzte ich tief. Der Gedanke, den Rest meines Lebens darin zu verbringen, gefiel mir nicht, egal wie sicher und schön es in dem Tal war. Seit meinem Studium und besonders nach Dads Tod hatte sich alles verändert. Es fühlte sich an, als hätte das Herz dieses Ortes mit dem seinen zu schlagen aufgehört. Zu allem Überfluss hatte Jack, der schon vor Dads Tod wusste, dass er den Sommer bei einem Winzer im französischen Rhônetal verbringen wollte, nach einem Gespräch mit Mum beschlossen, diese Reise trotz allem anzutreten.
»Unsere Zukunft liegt jetzt in Jacks Händen, und er muss so viel lernen, wie er kann«, hatte Mum mir erklärt. »In seiner Abwesenheit leitet unser Verwalter Doug das Weingut. Zum Glück ist gerade die ruhige Saison und somit genau der richtige Zeitpunkt für einen solchen Aufenthalt.«
Doch jetzt, da Mum am Vortag zu ihrer »Weltreise« aufgebrochen und auch Jack nicht da war, fühlte ich mich sehr allein und lief Gefahr, in ein tiefes Loch zu fallen.
»Du fehlst mir, Dad«, murmelte ich, als ich zum Frühstücken hineinging, obwohl ich eigentlich keinen Appetit hatte. Die Stille im Haus trug nicht gerade dazu bei, meine Stimmung zu heben. In meiner Kindheit hatte es darin stets von Menschen gewimmelt. Wenn keine Lieferanten oder Erntehelfer da waren, besuchten uns Leute, die sich das Weingut ansehen wollten und mit denen Dad ins Gespräch gekommen war. Er ließ sie gern seinen Wein kosten und lud sie oft sogar zu uns nach Hause zum Essen ein. In Neuseeland wurde Gastfreundschaft großgeschrieben, und so war ich es gewöhnt, mit Wildfremden an unserem langen Kiefernholztisch mit Blick aufs Tal zu sitzen. Keine Ahnung, wie es meiner Mutter ein ums andere Mal gelang, so schnell ein schmackhaftes Essen in ausreichender Menge herbeizuzaubern.
Außerdem fehlten mir Jacks Ruhe und Energie. Obwohl er mich gern neckte, konnte ich mir sicher sein, dass er unerschütterlich zu mir halten und mich beschützen würde.
Ich nahm einen Tetrapak Orangensaft aus dem Kühlschrank und schüttete den letzten Rest daraus in ein Glas, bevor ich mich daranmachte, an einem Laib altem Brot herumzusäbeln. Damit es einigermaßen essbar wurde, toastete ich es. Dann stellte ich eine kurze Einkaufsliste zusammen, weil die Vorräte so gut wie aufgebraucht waren. Der nächstgelegene Supermarkt befand sich in Arrowtown. Mum hatte jede Menge Sachen in großen Plastikbehältern für mich eingefroren, doch ich hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, sie für mich allein aufzutauen.
Vor Kälte zitternd ging ich mit der Liste ins Wohnzimmer und setzte mich auf das alte Sofa vor dem riesigen Kamin aus dem für die hiesige Gegend so typischen grauen Vulkangestein. Dieser Kamin hatte meine Eltern vor dreißig Jahren dazu gebracht, das zu erwerben, was einmal eine Hütte mitten in der Wildnis, eine Hütte mit einem einzigen Raum ohne fließendes Wasser und Toilette, gewesen war. Mum und Dad hatten sich oft daran erinnert, wie sie und der damals zweijährige Jack in jenem ersten Sommer in dem Bach zwischen den Felsen hinterm Haus badeten und buchstäblich ein Loch im Boden für ihr tägliches Geschäft benutzten.
»Das war der glücklichste Sommer meines Lebens«, schwärmte Mum, »und im Winter war’s wegen des Kamins sogar noch schöner.«
Mum liebte echtes Kaminfeuer, und sobald der erste Frost das Tal überzog, schickte sie Dad, Jack und mich in den Laden, um gut abgelagertes Feuerholz zu kaufen. Das legten wir in die Nischen zu beiden Seiten des Kamins, bevor Mum einige Scheite aufschichtete und ein Streichholz anriss. Das Ritual nannten wir in unserer Familie »das erste Feuer anzünden«. Von diesem Augenblick an prasselte dieses Feuer munter die ganzen Wintermonate hindurch, bis zwischen September und November, unserem Frühjahr, die Sternhyazinthen und Schneeglöckchen (deren Zwiebeln sie sich aus Europa schicken ließ) unter den Bäumen blühten.
Vielleicht sollte ich den Kamin jetzt anmachen. Ich erinnerte mich an die behagliche Wärme, die mich in der Kindheit an klirrend kalten Tagen nach der Schule zu Hause empfangen hatte. Dad war das Herz des Weinguts, Mum mit ihrem Kaminfeuer das unseres Heims.
Ich zwang mich, nicht weiter nachzugrübeln, denn ich war nun wirklich zu jung, um mich mit Erinnerungen an die Kindheit trösten zu wollen. Ich brauchte Gesellschaft, das war alles. Doch leider hielten sich die meisten meiner Unifreunde entweder im Ausland auf und genossen die letzte Zeit der Freiheit, bevor sie sich einen festen Job suchten und ein Leben aufbauten, oder sie steckten bereits im Berufsalltag.
Wir besaßen einen Festnetzanschluss, aber der Internetempfang war schlecht. E-Mails zu schicken gestaltete sich wie ein Albtraum, weswegen Dad oft die halbe Stunde nach Queenstown gefahren war, um sie vom Computer eines Freundes im Reisebüro aus zu senden. Unser Tal hatte er scherzhaft »Brigadoon« genannt, nach einem alten Film über ein Dorf, das alle hundert Jahre einen einzigen Tag lang zum Leben erwacht und somit nie durch die Außenwelt verändert wird. Möglicherweise konnte man unser Tal tatsächlich als »Brigadoon« bezeichnen – schließlich veränderte es sich kaum –, doch es war definitiv nicht der richtige Ort für eine angehende Singer-Songwriterin, sich einen Namen zu machen. Ich träumte von Manhattan, London oder Sydney, wo in den Hochhäusern Plattenproduzenten nur darauf warteten, Fletch und mich zu Starruhm zu katapultieren …
Da riss das Klingeln des Festnetztelefons mich aus meinen Gedanken, und ich hob ab.
»Sie sind mit The Vinery verbunden«, sagte ich wie seit Kindertagen.
»Hi, MK, ich bin’s, Fletch.« So nannten alle außer Mum mich.
»Hallo«, erwiderte ich erfreut. »Was gibt’s Neues?«
»Leider nichts. Ich wollte dein Angebot annehmen und dich besuchen. Hab zwei Tage frei im Café und muss mal raus aus der Stadt.«
Und ich würde gern rein in die Stadt …
»Super! Komm, wann du willst. Ich bin da.«
»Wie wär’s mit morgen? Ich nehme das Auto, das heißt, ich werde den ganzen Vormittag brauchen, vorausgesetzt, Sissy lässt mich nicht im Stich.«
Sissy war der Lieferwagen, mit dem Fletch und ich zu unseren Gigs fuhren. Der Van war zwanzig Jahre alt und voller Rost, und aus dem wackeligen Auspuff, den Fletch provisorisch mit Schnur befestigt hatte, quoll dichter Rauch. Hoffentlich schaffte Sissy die mehrstündige Reise von Dunedin, wo Fletch mit seiner Familie lebte.
»Dann sehen wir uns so gegen Mittag?«, fragte ich.
»Ja. Ich kann’s kaum erwarten. Du weißt ja, wie gut’s mir bei euch gefällt. Wir könnten ein paar Stunden auf dem Klavier rumprobieren, an neuen Songs basteln. Was meinst du?«
»Warum nicht?«, antwortete ich, obwohl ich wusste, dass es mit meiner Kreativität momentan nicht allzu weit her war. »Tschüs, Fletch, bis morgen.«
Ich beendete das Gespräch und kehrte zurück zum Sofa. Wenigstens fühlte ich mich jetzt, da Fletch mich besuchen wollte, besser – sein Humor und seine optimistische Lebenseinstellung würden mich aufmuntern.
Da hörte ich von draußen einen Pfiff, mit dem unser Verwalter Doug uns immer darauf aufmerksam machte, dass er sich auf dem Gelände aufhielt. Ich stand auf und ging auf die Terrasse, von wo aus ich Doug und eine Gruppe kräftiger Männer von den pazifischen Inseln zwischen den kahlen Rebstöcken hindurchstapfen sah.
»Hi!«, begrüßte ich sie.
»Hi, MK! Ich zeig den Leuten gerade, wo sie mit der Arbeit anfangen sollen«, erklärte Doug.
»Prima. Hallo, Jungs«, rief ich, und sie winkten zu mir herauf.
Ihr Auftauchen brachte Leben ins Tal, und als noch die Sonne hinter der Wolke hervorspitzte, verbesserte sich meine Stimmung zusehends.
II
Atlantis Genfer See, Schweiz
Juni 2008
»Du siehst blass aus, Maia. Ist alles in Ordnung?«, erkundigte sich Ma, als sie die Küche betrat.
»Ja, danke, ich habe nur letzte Nacht nicht gut geschlafen, weil ich die ganze Zeit an Georg Hoffmans Eröffnung denken musste.«
»Das war allerdings eine Überraschung. Kaffee?«
»Ähm, nein, danke. Wenn Kamillentee im Haus ist, wäre mir der lieber.«
»Natürlich haben wir welchen«, mischte sich Claudia ein, die die grauen Haare wie stets streng zu einem Knoten gebunden trug. Auf ihr sonst so mürrisches Gesicht trat ein Lächeln für Maia, als sie einen Korb voll mit ihren frisch gebackenen Brötchen und Gebäckstücken auf den Küchentisch stellte. »Vor dem Schlafengehen trinke ich selbst gern eine Tasse.«
»Du scheinst dich wirklich nicht wohlzufühlen, Maia. Ich habe noch nie erlebt, dass du morgens keinen Kaffee magst«, bemerkte Ma und schenkte sich welchen ein.
»Gewohnheiten sind da, um sie abzulegen«, erwiderte Maia müde. »Wie du dich vielleicht erinnerst, leide ich unter Jetlag.«
»Ich weiß, chérie. Iss doch einen Happen, leg dich anschließend wieder ins Bett und versuch zu schlafen, ja?«
»Nein, Georg hat gesagt, er würde später vorbeischauen, um zu besprechen, was wir hinsichtlich der … verschwundenen Schwester tun sollen. Wie verlässlich, glaubst du, sind seine Quellen?«
»Ich habe keine Ahnung.« Ma seufzte.
»Sehr«, mischte sich Claudia erneut ein. »Wäre er sich seiner Sache nicht sicher, hätte er sich nicht mitten in der Nacht hierherbemüht.«
»Guten Morgen, meine Lieben.« Ally betrat die Küche und gesellte sich zu den anderen. Ihr kleiner Sohn Bär schlummerte, den Kopf schlaff zur Seite, eine winzige Faust in eine Strähne von Allys rotgoldenen Locken verkrallt, in einer Trageschlaufe vor ihrem Bauch.
»Soll ich ihn dir abnehmen und in sein Bettchen legen?«, erbot sich Ma.
»Nein. Sobald er merkt, dass er allein ist, wacht er bestimmt auf und fängt zu schreien an. Maia, du schaust schrecklich blass aus«, stellte Ally fest.
»Das habe ich auch gerade gesagt«, pflichtete Ma ihr bei.
»Keine Sorge, mir geht’s gut«, wiederholte Maia. »Übrigens: Ist Christian da?«, fragte sie Claudia.
»Ja. Er möchte mit dem Boot über den See hinüber nach Genf fahren, um Lebensmittel für mich zu besorgen.«
»Könntest du ihn bitte anrufen und ihm sagen, dass ich ihn gern begleiten würde? Ich muss ein paar Dinge in der Stadt erledigen, und wenn wir uns bald auf den Weg machen, bin ich zurück, wenn Georg mittags kommt.«
»Selbstverständlich.« Claudia nahm den Hörer in die Hand, um Christian zu informieren.
Ma stellte Ally eine Tasse Kaffee hin. »Ich habe zu tun. Frühstückt ihr ruhig weiter.«
»Christian meint, das Motorboot ist in einer Viertelstunde bereit«, erklärte Claudia und legte auf. »Und ich muss Marina helfen.« Sie nickte Ally und Maia zu und verließ die Küche.
»Bist du wirklich okay?«, erkundigte sich Ally bei Maia, sobald sie allein waren. »Du bist kreidebleich.«
»Bitte mach dir keine Gedanken, Ally. Vielleicht habe ich mir im Flugzeug den Magen verdorben.« Maia trank einen Schluck Tee. »Irgendwie fühlt es sich hier fremd an, findest du nicht? Ich meine, dass einfach alles so weiterläuft wie vor Pas Tod. Dabei ist nichts mehr so wie früher. Pa hat eine gewaltige Lücke hinterlassen.«
»Ich bin schon eine Weile in Atlantis und habe mich wahrscheinlich dran gewöhnt, aber ja, du hast recht.«
»Du sagst, ich schaue krank aus, Ally, doch du scheinst ziemlich abgenommen zu haben.«
»Ach, das war bloß der Schwangerschaftsbauch …«
»Das glaube ich nicht. Das letzte Mal habe ich dich vor einem Jahr gesehen, als du von hier weggefahren bist, um dich zum Fastnet-Rennen mit Theo zu treffen. Da warst du noch nicht schwanger.«
»Doch, ich hab’s nur nicht gewusst«, erwiderte Ally.
»Das heißt, du hast gar nichts gemerkt? Dir war morgens nicht übel oder so?«
»Anfangs nicht. Das hat, wenn ich mich recht entsinne, nach ungefähr acht Wochen angefangen. Von da an ging’s mir richtig dreckig.«
»Jedenfalls bist du zu dünn. Vielleicht achtest du nicht genug auf dich.«
»Für mich allein ist es mir einfach zu viel Aufwand, etwas Richtiges zu kochen. Und selbst wenn ich mich mal zum Essen hinsetze, muss ich meistens gleich wieder aufspringen und mich um den kleinen Mann kümmern.« Ally streichelte liebevoll Bärs Wange.
»Muss ganz schön hart sein, sein Kind allein aufzuziehen.«
»Ja. Natürlich gibt es da meinen Bruder Thom, aber der ist stellvertretender Chefdirigent beim Philharmonischen Orchester Bergen, was bedeutet, dass ich ihn außer sonntags kaum jemals zu Gesicht bekomme. Manchmal nicht einmal dann, denn gelegentlich ist er mit den Musikern auf Tournee. Nicht der Schlafmangel und das ständige Stillen und Windelwechseln belasten mich, sondern dass ich mit niemandem reden kann, besonders wenn’s Bär nicht gut geht und ich mir Sorgen um ihn mache. Deswegen ist es so schön, Ma zu haben, sie kennt sich mit Babys aus wie keine Zweite.«
»Ja, eine bessere Großmutter kann man sich nicht vorstellen«, meinte Maia lächelnd. »Pa hätte sich sicher über Bär gefreut. Der Kleine ist zum Anbeißen. Aber jetzt muss ich nach oben, mich umziehen.«
Als Maia aufstand, ergriff Ally die Hand ihrer älteren Schwester. »Es ist so schön, dich wiederzusehen. Du hast mir sehr gefehlt.«
»Und du mir.« Maia küsste Ally auf die Stirn. »Bis später.«
* * *
»Ally! Maia! Georg ist da!«, rief Ma am Mittag die Treppe hinauf.
Von oben ertönte ein gedämpftes »Wir kommen gleich«.
»Erinnern Sie sich noch, wie Pa Salt Ihnen zu Weihnachten ein altes Messingmegafon geschenkt hat?«, fragte Georg schmunzelnd, als er Ma in die Küche und hinaus auf die sonnendurchflutete Terrasse folgte. Er wirkte deutlich entspannter als am Abend zuvor. Seine stahlgrauen Haare waren ordentlich nach hinten gekämmt, und zu seinem eleganten Nadelstreifenanzug trug er ein geschmackvolles kleines Einstecktuch.
»Ja«, antwortete Ma und bot Georg einen Platz unter dem Sonnenschirm an. »Natürlich hat das auch nichts genützt, weil alle Mädchen ihre Musik voll aufgedreht hatten, auf ihren Instrumenten spielten oder miteinander stritten. Im Dachgeschoss ging es immer zu wie im Irrenhaus. Und ich fand es herrlich. Ich könnte Ihnen Claudias Holunderblütenlikör anbieten oder eine gekühlte Flasche von Ihrem provenzalischen Lieblingsrosé. Was ist Ihnen lieber?«
»Da heute so ein schöner Tag ist und ich in diesem Sommer noch keinen Rosé getrunken habe, entscheide ich mich dafür. Danke, Marina. Soll ich uns beiden einschenken?«
»Für mich lieber nicht. Ich habe heute Nachmittag zu tun, und …«
»Ich bitte Sie! Sie sind Französin! Ein Gläschen Rosé wird Sie schon nicht umbringen. Ich bestehe darauf«, sagte Georg gerade, als Maia und Ally sich zu ihnen gesellten. »Hallo, meine Lieben.« Georg erhob sich. »Möchten Sie einen Rosé?«
»Einen kleinen Schluck für mich, danke, Georg«, antwortete Ally und nahm Platz. »Vielleicht schläft Bär dann die kommende Nacht besser«, fügte sie lachend hinzu.
»Für mich nicht«, meinte Maia. »Fast hätte ich die Schönheit von Atlantis vergessen. In Brasilien ist alles so … überlebensgroß – die Menschen sind laut, die Farben der Natur grellbunt, und es herrscht eine schreckliche Hitze. Im Vergleich dazu fühlt sich das Leben in dieser Gegend sanft und ruhig an.«
»Jedenfalls ist es hier sehr friedlich«, pflichtete Ma ihr bei. »Wir können froh sein, an einem Ort zu wohnen, an dem die Natur sich von ihrer besten Seite zeigt.«
»Der Schnee fehlt mir«, murmelte Maia.
»Dann komm doch mal im Winter nach Norwegen, das kuriert dich.« Ally grinste. »Noch schlimmer ist der Dauerregen dort. In Bergen regnet’s deutlich öfter, als es schneit. Georg, wissen Sie inzwischen mehr über das, was Sie uns gestern Abend mitgeteilt haben?«
»Nur dass wir unser weiteres Vorgehen besprechen sollten. Einer von uns muss die Adresse aufsuchen, die ich habe, um herauszufinden, ob diese Frau tatsächlich die verschwundene Schwester ist.«
»Und wie sollen wir das feststellen?«, fragte Maia. »Gibt es irgendetwas, anhand dessen wir sie identifizieren können?«
»Ich habe die Zeichnung von einem recht ungewöhnlichen Schmuckstück, das ihr offenbar geschenkt wurde. Wenn sie es besitzt, wissen wir zweifelsfrei, dass sie die Richtige ist. Ich habe die Zeichnung mitgebracht.« Georg nahm ein Blatt Papier aus seiner schmalen Lederaktentasche und legte es auf den Tisch, sodass alle die Abbildung sehen konnten.
Ally betrachtete sie genau; Maia blickte ihr über die Schulter.
»Der Ring ist aus dem Gedächtnis gezeichnet«, erklärte Georg. »In der Fassung befinden sich Smaragde, und der Stein in der Mitte ist ein Brillant.«
»Wunderschön«, hauchte Ally. »Schau, Maia, das Ganze hat die Form eines Sterns mit …«, sie zählte, »… sieben Spitzen.«
»Georg, wissen Sie, welcher Juwelier den gefertigt hat? Der Ring ist tatsächlich ziemlich ungewöhnlich«, bemerkte Maia.
»Leider nein«, antwortete Georg.
»Stammt die Zeichnung von Pa?«, erkundigte sich Maia.
»Ja.«
»Sieben Spitzen eines Sterns für sieben Schwestern …«, murmelte Ally.
»Georg, Sie haben gestern Abend gesagt, sie heißt Mary«, meinte Maia.
»Ja.«
»Hat Pa Salt sie gefunden? Wollte er sie adoptieren? Ist dann etwas passiert, und er hat sie verloren?«
»Ich weiß lediglich, dass er, bevor er … von uns gegangen ist, eine neue Information erhalten hat, und die sollte ich überprüfen. Nachdem klar war, wo die verschwundene Schwester geboren wurde, haben ich und andere beinahe ein Jahr benötigt, um ihren mutmaßlichen gegenwärtigen Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Im Lauf der Zeit habe ich in alle möglichen Richtungen ermittelt und bin jedes Mal wieder in Sackgassen gelandet. Doch diesmal hielt Ihr Vater seine Quelle für absolut zuverlässig.«
»Und wer war diese Quelle?«, hakte Maia nach.
»Das hat er mir nicht verraten.« Georg seufzte.
»Wenn es sich tatsächlich um die verschollene Schwester handelt, ist es doch sehr schade, dass sie nach der langen Suche erst ein Jahr nach Pas Tod aufgespürt wurde«, sagte Maia.
»Jedenfalls fände ich es wundervoll, wenn sie es wirklich wäre«, mischte sich Ally ein. »Und wenn wir sie rechtzeitig nach Atlantis bringen könnten, um mit uns an Bord der Titan zu gehen und zur Erinnerung an Pa den Kranz ins Wasser der Ägäis zu werfen.«
»Ja, das wäre toll«, pflichtete Maia ihr bei. »Allerdings gibt es da ein Problem. Diese Mary scheint ja nicht gerade in der Nähe zu wohnen. Und wir wollen in ein paar Wochen zu unserer Griechenlandfahrt aufbrechen.«
»Obendrein bin ich momentan leider ziemlich beschäftigt«, gestand Georg. »Wenn dem nicht so wäre, würde ich mich selbst auf die Suche nach Mary machen.«
Wie um seine Aussage zu unterstreichen, begann Georgs Handy zu klingeln. Er entschuldigte sich und stand vom Tisch auf.
»Darf ich etwas vorschlagen?«, fragte Ma in die Stille hinein.
»Natürlich, Ma, schieß los«, forderte Maia sie auf.
»Nachdem Georg uns gestern Abend mitgeteilt hatte, dass Mary augenblicklich in Neuseeland lebt, habe ich heute Vormittag recherchiert, wie weit Sydney und Auckland auseinanderliegen. Weil …«
»… CeCe sich in Australien aufhält«, führte Maia den Satz für sie zu Ende. »Das ist mir gestern Abend auch durch den Kopf gegangen.«
»Der Flug von Sydney nach Auckland dauert drei Stunden«, fuhr Ma fort. »Wenn CeCe und ihre Freundin Chrissie einen Tag früher aufbrechen, als ursprünglich geplant, könnten sie einen Zwischenstopp in Neuseeland einlegen, um festzustellen, ob diese Mary tatsächlich die ist, für die Georg sie hält.«
»Großartige Idee, Ma«, meinte Ally. »Aber ob CeCe das möchte? Sie hasst Flüge.«
»Wenn wir es ihr erklären, tut sie uns bestimmt den Gefallen«, sagte Ma. »Es wäre doch wirklich etwas ganz Besonderes, wenn die fehlende Schwester bei der Familienzusammenkunft zu Ehren eures Vaters dabei sein könnte.«
»Weiß diese Mary denn überhaupt etwas über Pa Salt und unsere Familie?«, warf Ally ein. »Inzwischen treffen wir Schwestern uns nicht mehr so oft. Folglich wäre dies die ideale Gelegenheit, uns alle kennenzulernen, immer vorausgesetzt, sie ist die Gesuchte. Und natürlich vorausgesetzt, sie möchte uns treffen. Ich finde, als Erstes sollten wir so bald wie möglich CeCe kontaktieren. In Australien ist bereits Abend.«
»Was machen wir mit den anderen Schwestern?«, gab Maia zu bedenken. »Sollen wir es ihnen sagen?«
»Gute Frage. Schicken wir Star, Tiggy und Elektra doch eine Mail, damit sie Bescheid wissen«, schlug Ally vor. »Willst du CeCe anrufen, Maia, oder soll ich das übernehmen?«
»Mach lieber du das, Ally. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich mich vor dem Mittagessen gern hinlegen. Mir ist immer noch ein bisschen übel.«
»Du Arme.« Ma stand auf. »Du bist in der Tat ein wenig grün um die Nase.«
»Ich begleite dich ins Haus und rufe CeCe an«, verkündete Ally. »Hoffentlich ist sie nicht mit ihrem Großvater auf einem ihrer Malausflüge im Outback. Wo er wohnt, hat sie offenbar kein Netz.«
Claudia trat aus der Küche auf die Terrasse. »Ich bereite jetzt das Mittagessen vor.« Sie wandte sich Georg zu, der zum Tisch zurückgekehrt war. »Möchten Sie bleiben?«
»Nein, danke. Ich habe noch einige dringende Dinge zu erledigen und muss gleich los. Wie wollen Sie alle weiter vorgehen? Gibt es einen Plan?« Er blickte Ma an.
Als Ally und Maia die Terrasse verließen, bemerkte Ally die Schweißperlen auf Georgs Stirn; er wirkte unruhig.
»Wir setzen uns mit CeCe in Verbindung und fragen sie, ob sie hinfliegen will«, sagte Ally.
»Georg, sind Sie davon überzeugt, dass sie die Gesuchte ist?«, erkundigte sich Ma.
»Leute haben mich überzeugt, die informiert sein müssten, ja«, antwortete er. »Ich hätte mich gern weiter mit Ihnen unterhalten, muss jetzt aber gehen.«
»Die Mädchen schaffen das schon, Georg. Sie sind erwachsene Menschen und wissen sich zu helfen.« Ma legte ihm beruhigend die Hand auf den Arm. »Versuchen Sie, sich zu entspannen.«
»Ich gebe mir Mühe, Marina.« Er seufzte.
* * *
Ally suchte die Nummer von CeCes australischem Handy in ihrem Adressbuch, nahm den Hörer des Telefons im Flur in die Hand und wählte.
»Nun mach schon …« Es klingelte fünfmal, sechsmal. Ally wusste, dass es wenig Sinn hatte, CeCe etwas auf den Anrufbeantworter zu sprechen, weil sie den kaum jemals abhörte.
»Verdammt.« Tatsächlich meldete sich CeCes Mailbox. Sie legte auf und wollte gerade nach oben gehen, um Bär zu stillen, als das Telefon klingelte.
»Allô?«
»Hallo, bist du das, Ma?«
»CeCe! Ich bin’s, Ally. Danke, dass du zurückrufst.«
»Keine Ursache. Ich hab die Nummer von Atlantis erkannt. Ist alles in Ordnung?«
»Ja, alles bestens. Maia ist gestern angekommen, und ich freue mich wahnsinnig, sie wiederzusehen. Wann genau geht dein Flug nach London, CeCe?«
»Wir machen uns übermorgen von Alice Springs aus auf den Weg nach Sydney. Ich hab dir, glaube ich, gesagt, dass wir ein paar Tage in London bleiben werden, weil ich dort den Verkauf meiner Wohnung regeln und mich mit Star treffen will. Wie üblich graut mir vor dem Flug.«
»Ich weiß. Hör zu, CeCe, Georg hat Neuigkeiten. Keine Sorge, nichts Schlechtes, eher eine Überraschung.«
»Und zwar?«
»Informationen über … unsere fehlende Schwester. Er meint, sie könnte in Neuseeland leben.«
»Die berühmte Siebte Schwester? Wow!«, rief CeCe aus. »Das sind allerdings Neuigkeiten. Wie hat Georg sie gefunden?«
»Keine Ahnung. Du kennst ja seine Geheimnistuerei. Also …«
»… willst du mich fragen, ob ich nicht nach Neuseeland rüberfliegen könnte, um sie zu treffen, stimmt’s?«, führte CeCe den Satz für sie zu Ende.
»Erraten, Sherlock.« Ally lachte. »Das verlängert deine Reise zwar ein bisschen, doch du bist ihr von uns Schwestern geografisch am nächsten. Es wäre schön, wenn sie in der Ägäis dabei sein könnte, wo wir den Kranz für Pa ins Meer werfen.«
»Ja, aber wir wissen überhaupt nichts über diese Frau. Weiß sie denn was über uns?«
»Wir sind uns nicht sicher. Georg sagt, er hat lediglich einen Namen und eine Adresse. Ach ja, und die Zeichnung von einem Ring, der beweist, dass sie die Richtige ist.«
»Und wie lautet die Adresse? Neuseeland ist groß.«
»Ich kann Georg bitten, sie dir zu nennen. Georg?« Ally winkte ihn zu sich, als er auf dem Weg zur Haustür aus der Küche trat. »CeCe. Sie würde gern erfahren, wo genau in Neuseeland Mary lebt.«
»Mary? Heißt sie so?«, erkundigte sich CeCe.
»Anscheinend. Ich geb dich mal an Georg weiter.«
Ally lauschte, während Georg die Adresse laut vorlas.
»Danke, CeCe«, sagte Georg schließlich. »Sämtliche Kosten werden aus dem Treuhandvermögen beglichen. Meine Sekretärin Giselle bucht die Flüge. Ich reiche den Hörer jetzt wieder Ally, weil ich noch zu tun habe.« Als er Ally den Hörer in die Hand drückte, fügte er hinzu: »Meine Büronummer haben Sie. Setzen Sie sich mit Giselle in Verbindung, falls Sie irgendetwas brauchen. Adieu.«
»Gut. Hi, CeCe«, begrüßte Ally ihre Schwester ein zweites Mal und verabschiedete sich mit einem kurzen Winken von Georg, der gerade zur Haustür hinausging. »Hast du eine Ahnung, wo in Neuseeland das ist?«
»Moment, ich frage Chrissie.«
Gemurmel, dann meldete CeCe sich wieder.
»Chrissie sagt, das ist auf der Südinsel. Sie meint, wir sollten, wenn das geht, von Sydney aus nach Queenstown fliegen, weil das einfacher wäre als nach Auckland. Wir sehen uns das gleich genauer an.«
»Wunderbar! Und, würdest du’s machen?«, fragte Ally.
»Du kennst mich: Ich liebe Reisen und Abenteuer und hasse Fliegen. In Neuseeland bin ich noch nie gewesen; ich hätte Lust, einen Blick drauf zu werfen.«
»Toll! Danke, CeCe. Wenn euch das die Sache erleichtert: Schick mir die nötigen Informationen per Mail, dann bitte ich Georgs Sekretärin, die Flüge für euch zu buchen. Ich faxe dir die Zeichnung von dem Ring.«
»Okay. Weiß Star Bescheid?«
»Nein, genauso wenig wie Elektra und Tiggy. Denen schreibe ich jetzt allen eine Mail.«
»Star will mich bald anrufen, damit wir uns in London verabreden. Der kann ich Bescheid sagen. Ganz schön aufregend, was?«
»Ja, wenn sie wirklich die Gesuchte ist. Tschüs, CeCe, melde dich«, verabschiedete sich Ally.
»Bis bald, Ally.«
III
CeCeGibbston Valley, Neuseeland
»CeCe, du hältst die Karte verkehrt herum!«, rief Chrissie nach einem Blick zum Beifahrersitz aus.
»Tu ich nicht … hoppla, vielleicht doch.« CeCe runzelte die Stirn. »Für mich schauen die Wörter drauf so und so gleich aus, und die Straßenkringel … Herrgott, wann sind wir eigentlich am letzten Wegweiser vorbeigekommen?«
»Ist schon eine Weile her. Was für eine Landschaft!«, schwärmte Chrissie und lenkte den Mietwagen an den Straßenrand, um die majestätischen Berge unter dem dräuenden Wolkenhimmel zu bewundern. Als die ersten Regentropfen auf die Windschutzscheibe prasselten, schaltete sie die Heizung ein.
»Keine Ahnung, wo wir sind.« CeCe reichte Chrissie die Karte und betrachtete die leere Straße vor und hinter ihnen. »Queenstown scheint ewig her zu sein. Da hätten wir uns Proviant mitnehmen sollen, aber ich dachte, unterwegs wär noch genug Gelegenheit, was zu kaufen.«
»Wenn ich unsere ausgedruckte Wegbeschreibung zu The Vinery richtig lese, müsste bald ein Hinweisschild auftauchen. Fahren wir einfach weiter. Irgendwann begegnet uns schon jemand, der uns zeigen kann, wo’s langgeht.« Chrissie strich eine Locke ihrer schwarzen Haare aus dem Gesicht. Sie hatten sowohl in Melbourne als auch in Christchurch Zwischenstopps einlegen müssen und waren beide hungrig und müde.
»Wir sind gefühlt Stunden keinem Wagen mehr begegnet.«
»CeCe, wo ist deine Abenteuerlust?«
CeCe zuckte mit den Achseln. »Vielleicht werde ich auf meine alten Tage ein Weichei und sitze lieber gemütlich daheim als bei strömendem Regen in ’nem Auto im Nirgendwo. Außerdem ist mir kalt!«
»Hier steht der Winter vor der Tür. Nicht mehr lange, dann liegt auf den Berggipfeln Schnee. Du bist zu sehr an das Klima in Alice Springs gewöhnt, das ist das Problem«, meinte Chrissie, legte den Gang ein und fuhr weiter. Die Scheibenwischer arbeiteten auf Hochtouren, die Berge waren nur noch verwaschen wahrzunehmen.
»Ja, ich liebe die Sonne, war immer schon so. Kann ich mir dein Hoodie ausleihen, Chrissie?« Sie griff auf den Rücksitz und öffnete einen der Rucksäcke.
»Klar. Hier ist es viel kälter als bei uns, das hab ich dir doch gesagt. Gut, dass ich auch eins für dich eingepackt habe, was?«
»Danke, Chrissie. Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde.«
»Geht mir genauso.«
CeCe ergriff Chrissies Hand und drückte sie. »Sorry, wenn ich mich so blöd anstelle.«
»Tust du gar nicht, Cee. Du bist bloß nicht sonderlich … praktisch veranlagt. Das ist meine Stärke. Dafür bin ich nicht so kreativ wie du. Zusammen sind wir ein Klasseteam, oder?«
»Ja.«
In Chrissies Gesellschaft fühlte CeCe sich sicher. Die vergangenen Monate gehörten zu den schönsten ihres bisherigen Lebens. Die Zeit, die sie mit Chrissie verbrachte, und ihre Malausflüge mit ihrem Großvater Francis ins Outback füllten ihr Leben – und ihr Herz – aus wie nie zuvor. Nach dem traumatischen Verlust von Star hatte sie geglaubt, nicht wieder glücklich sein zu können, doch Chrissie und Francis waren in die von Star hinterlassene Lücke geschlüpft. CeCe hatte eine – wenn auch ziemlich unkonventionelle – Familie gefunden, in die sie passte.
»Schau, da vorn ist ein Schild.« CeCe deutete in den peitschenden Regen. »Fahr näher ran und lass uns nachsehen, was draufsteht.«
»Das kann ich von hier aus lesen. Zu The Vinery geht’s nach links. Juhu, wir haben’s geschafft!«, jubelte Chrissie und lenkte den Wagen einen schmalen, holprigen Feldweg entlang. »Wissen deine Schwestern übrigens Bescheid, dass ich nach Atlantis mitkomme?«
»Klar. Zumindest die, mit denen ich geredet habe.«
»Denkst du, sie werden schockiert sein … über uns?«
»Pa hat uns beigebracht, jeden Menschen zu akzeptieren, egal, welche Hautfarbe oder sexuelle Orientierung er hat. Unsere Haushälterin Claudia runzelt möglicherweise die Stirn, aber die ist nicht mehr ganz jung und ziemlich konservativ.«
»Und du, Cee? Fühlst du dich wohl dabei, wenn wir zusammen zu deiner Familie fahren?«
»Das weißt du doch. Warum beschäftigt dich das plötzlich so?«
»Weil … Obwohl du mir alles über deine Schwestern und Atlantis erzählt hast, sind sie mir bis jetzt nicht … real erschienen. Und jetzt werden wir in Kürze bei ihnen sein. Ich habe Angst. Besonders vor dem Treffen mit Star. Schließlich wart ihr beide ein Team, bevor ich auf der Bildfläche aufgetaucht bin …«
»Du meinst wohl eher, bevor sie ihren Freund Maus kennengelernt hat, oder? Vergiss nicht: Star war diejenige, die von mir wegwollte.«
»Ja, aber sie ruft dich nach wie vor jede Woche an, und ihr schickt euch ständig SMS, und …«
»Chrissie! Star ist meine Schwester. Und du, du bist …«
»Ja?«
»Du bist meine Partnerin. Das ist etwas komplett anderes. Ich hoffe wirklich, dass in meinem Leben Raum für euch beide ist.«
»Natürlich, doch so ein Coming-out ist eine große Sache.«
»Puh, wie ich dieses Wort hasse.« CeCe schüttelte sich. »Ich bin und bleibe ich und hasse es, in irgendeine Schublade gesteckt zu werden. Schau! Da ist noch ein Wegweiser zu The Vinery. Fahr rechts ab.«
Sie bogen in einen weiteren schmalen Weg ein. In der Ferne sah CeCe Reihe um Reihe kahler Rebstöcke.
»Schaut nicht so aus, als wär The Vinery sonderlich erfolgreich. In Südfrankreich hängen die Rebstöcke um diese Zeit voller Blätter und Trauben.«
»Cee, du vergisst, dass die Jahreszeiten in dieser Weltgegend wie in Australien andersherum verlaufen. Schätze, die Trauben werden irgendwann zwischen Februar und April geerntet, im hiesigen Spätsommer oder Herbst. Deswegen sind jetzt keine Blätter und Früchte dran. Da vorn ist ein weiteres Schild. ›Verkauf‹, ›Anlieferung‹ und ›Empfang‹. Fahren wir zum Empfang, ja?«
»Aye, aye, Chef.« CeCe fiel auf, dass der Regen nachließ und die Sonne zwischen den Wolken hervorlugte. »Das Wetter hier erinnert mich an das in England. Im einen Moment Regen, im nächsten Sonne.«
»Vielleicht leben deswegen so viele Engländer in dieser Gegend. Allerdings hat dein Großvater gestern gesagt, dass die meisten Neuseeländer aus Schottland und Irland eingewandert sind.«
»Die haben sich ans andere Ende der Welt aufgemacht, um ihr Glück zu suchen. Ähnlich wie ich. Da geht’s zum Empfang. Was für ein hübsches altes Steingemäuer. Sieht richtig gemütlich aus, wie es in diesem Tal liegt, so auf allen Seiten von schützenden Bergen umgeben. Erinnert mich ein bisschen an unser Zuhause am Genfer See, ohne See«, bemerkte CeCe, als Chrissie den Wagen anhielt.
Das zweistöckige Farmhaus duckte sich an eine Hügelflanke knapp oberhalb des Weinguts, das sich terrassenförmig bis ins Tal erstreckte. Die Mauern bestanden aus massiven, grob gehauenen und sauber ineinandergefügten grauen Felsbrocken. In den großen Fenstern spiegelte sich der blaue Himmel, und eine überdachte Veranda mit Blumenkästen voll knallroter Begonien umgab das Gebäude auf allen Seiten. Die unterschiedlichen Grautöne der verwitterten Steinmauern verrieten, dass im Lauf der Jahre mehrfach an das Haupthaus angebaut worden war.
»Der Empfang ist dort drüben«, riss Chrissie CeCe aus ihren Gedanken und deutete auf eine Tür links vom Farmhaus. »Vielleicht ist jemand da, der uns helfen kann, Mary zu finden. Hast du die Zeichnung von dem Ring, die Ally dir gefaxt hat?«
»Die hab ich in meinen Rucksack gesteckt, bevor wir losgefahren sind.« CeCe stieg aus, nahm ihren Rucksack vom Rücksitz und holte zwei Zettel heraus.
»Also echt, CeCe, die sind ja völlig verknittert«, stellte Chrissie entsetzt fest.
»Na und? Wie der Ring ausschaut, ist doch zu erkennen.«
»Ja, aber sonderlich professionell wirkt es nicht gerade, wenn wir so an der Tür einer Wildfremden klopfen und ihr oder jemandem aus ihrer Familie erzählen, dass sie deiner Ansicht nach deine verschollene Schwester ist … Möglicherweise hält sie dich für verrückt. Ich würde es wahrscheinlich tun«, fügte Chrissie hinzu.
»Was bleibt uns anderes übrig, als zu fragen? Ups, nun werde ich plötzlich nervös. Du hast recht, am Ende denken sie tatsächlich, ich bin verrückt.«
»Immerhin hast du das Foto von deinen Schwestern und deinem Vater dabei. Darauf seht ihr alle ziemlich normal aus.«
»Aber nicht wie Schwestern, oder?«, meinte CeCe, während Chrissie die Wagentüren schloss und zusperrte. »Lass uns reingehen, bevor ich kalte Füße kriege.«
Der Empfang – ein kleiner mit Kiefernholz ausgestatteter Raum an der Seite des Haupthauses – war verwaist. CeCe betätigte die Klingel auf dem Tisch.
»So viele Weine«, bemerkte Chrissie, die an den Regalen voller Flaschen vorbeischlenderte. »Manche haben sogar Preise gewonnen. Hier scheint es richtig professionell zuzugehen. Wir sollten um eine Verkostung bitten.«
»Es ist erst Mittag, und du schläfst sofort ein, wenn du tagsüber Alkohol trinkst. Du musst noch fahren …«
»Hallo, kann ich behilflich sein?«, erkundigte sich eine groß gewachsene junge Frau mit blonden Haaren und strahlend blauen Augen, die durch eine Tür an der Seite des Raums eintrat. Was für ein hübsches Mädchen!, dachte CeCe.
»Ja, ich wollte fragen, ob wir mit Mary McDougal sprechen könnten«, antwortete CeCe.
»Die bin ich«, erklärte die Frau. »Was kann ich für euch tun?«
»Tja, ähm …«
»Ich bin Chrissie, und das ist CeCe«, sprang Chrissie CeCe bei, die nicht weiterwusste. »Es geht um Folgendes: CeCes Vater ist gestorben, und sein Anwalt sucht seit Jahren nach jemandem, den CeCe und ihre Familie die ›verschwundene Schwester‹ nennen. Vor Kurzem hat besagter Anwalt die Information erhalten, dass diese verschwundene Schwester möglicherweise eine Frau namens Mary McDougal ist und hier wohnt. Sorry, klingt ziemlich merkwürdig, aber …«
Mittlerweile hatte CeCe sich gefangen. »Pa Salt – das ist unser Vater – hat sechs Mädchen gleich nach ihrer Geburt adoptiert und immer von der ›verschwundenen Schwester‹ geredet, die er nicht finden konnte. Wir sind samt und sonders nach dem Siebengestirn der Plejaden benannt, und die Jüngste, Merope, wurde nie aufgespürt. Sie ist die fehlende siebte Schwester wie in all den Geschichten von den Sieben Schwestern.«
Als die Frau sie fragend anblickte, fuhr CeCe hastig fort:
»Wahrscheinlich kennst du die nicht. Wir hingegen sind mit diesen Mythen aufgewachsen. Die meisten Leute dürften, wenn sie sich nicht gerade für Astronomie und griechische Sagen interessieren, noch nie was von den Sieben Schwestern gehört haben.« CeCe merkte, dass sie sich in sinnlosen Erörterungen verlor, und verstummte.
»Nein, nein, ich habe durchaus von den Sieben Schwestern gehört«, erwiderte Mary lächelnd. »Meine Mutter – sie heißt übrigens ebenfalls Mary – hat Altphilologie studiert. Sie zitiert ständig Platon und andere Denker.«
»Deine Mutter heißt auch Mary?« CeCe sah sie mit großen Augen an.
»Klar, Mary McDougal, genau wie ich. Mein Name lautet offiziell Mary-Kate, doch alle nennen mich MK. Ähm … habt ihr sonst noch Informationen über diese verschwundene Schwester?«
»Ja, diese Zeichnung von einem Ring.« Chrissie legte den verknitterten Zettel auf den schmalen Tisch zwischen ihnen und Mary-Kate. »Er besteht aus sternförmig in sieben Spitzen angeordneten Smaragden und einem Brillanten in der Mitte. Diese Mary scheint ihn von jemandem geschenkt bekommen zu haben. Offenbar belegt er ihre Identität. Leider haben wir nur diesen einzigen greifbaren Hinweis. Vermutlich kennst du den Ring nicht, und wir sollten lieber wieder gehen. Tut uns leid, dass wir dich gestört haben, und …«
»Moment! Darf ich mir die Zeichnung genauer anschauen?«
CeCe staunte. »Du kennst ihn?«
»Könnte sein, ja.«
CeCe wurde flau im Magen. Sie hätte sich gewünscht, nach Chrissies Hand zu greifen, damit ihre Freundin die ihre tröstend drückte, doch zu so einer Geste war sie in der Öffentlichkeit noch nicht in der Lage. Also wartete sie, während die junge Frau die Zeichnung betrachtete.
»Sicher bin ich mir nicht, aber der Ring sieht dem von meiner Mum sehr ähnlich«, erklärte Mary-Kate schließlich. »Oder besser gesagt: meinem Ring. Sie hat ihn mir zu meinem einundzwanzigsten Geburtstag geschenkt.«
»Echt?« CeCe schnappte nach Luft.
»Ja, sie hat ihn, solange ich denken kann, und trug ihn nur zu besonderen Anlässen. Ich fand ihn immer schon hübsch. Er ist sehr klein, weswegen er ihr bloß am kleinen Finger passt, wo er nicht gut ausschaut, oder am Ringfinger, und da sind schon ihr Verlobungs- und ihr Ehering. Da ich mich in absehbarer Zeit weder verloben noch heiraten möchte, ist bei mir der Finger egal«, fügte sie grinsend hinzu.
»Heißt das, er ist jetzt bei dir?«, hakte CeCe nach. »Könnten wir einen Blick darauf werfen?«
»Mum hat mich vor ihrer Reise gefragt, ob ich ihn ihr leihe, weil ich ihn so selten trage. Aber vielleicht hat sie ihn dann doch nicht mitgenommen … Kommt einfach mit rauf, ja?«
In dem Moment streckte ein groß gewachsener, muskulöser Mann mit Akubra-Hut den Kopf zur Tür herein.
»Hi, Doug«, begrüßte Mary-Kate ihn. »Alles im grünen Bereich?«
»Ja, ich hol bloß Wasser für die Leute.«
Doug deutete auf die kräftigen Männer, die vor der Tür standen.
»Hi.« Als er eine Palette Flaschen aus dem Kühlschrank nahm, wandte er sich CeCe und Chrissie zu. »Seid ihr Touristen?«
»Ja, schon irgendwie. Ist superschön hier«, antwortete Chrissie, die den australischen Akzent des Mannes erkannte.
»Stimmt.«
»Ich wollte gerade mit den beiden nach oben gehen«, erklärte Mary-Kate. »Sie meinen, zwischen ihnen und mir könnte irgendeine familiäre Verbindung bestehen.«
»Ach.« Doug musterte CeCe und Chrissie und runzelte die Stirn. »Egal, die Jungs und ich machen vor dem Haus Pause. Musst nur rufen, wenn du was brauchst.«
Doug deutete auf einen runden Holztisch, an den seine Männer sich gerade setzten.
»Danke, Doug«, sagte Mary-Kate.
Er nickte, bedachte CeCe und Chrissie mit einem weiteren kritischen Blick und verließ den Raum.
»Mit denen sollte man sich besser nicht anlegen, was?« CeCe nickte in Richtung der Gruppe draußen.
»Nein«, pflichtete Mary-Kate ihr lachend bei. »Vor Doug müsst ihr trotzdem keine Angst haben. Seit Mum und mein Bruder Jack weg sind, meint er, mich beschützen zu müssen. Das sind wirklich Superjungs. Gestern Abend hab ich sogar mit ihnen gegessen. Also kommt mit.«
»Wenn dir das lieber ist, können wir gern auch hier warten«, bot Chrissie an.
»Kein Problem. Obwohl ich zugeben muss, dass ich das Ganze ein bisschen schräg finde. Aber egal, wie ihr seht, hab ich einen Eins-a-Bodyguard.«
Mary-Kate hob die Klappe des Empfangstischs an, um sie einzulassen. Dann führte sie sie einige steile Holzstufen hinauf und einen Flur entlang in einen luftigen Raum mit Holzbalken, der auf der einen Seite auf das Tal und die Berge dahinter ging und auf der anderen von einem riesigen Kamin beherrscht wurde.
»Setzt euch. Ich schaue mal, ob der Ring da ist.«
»Danke, dass du uns vertraust!«, rief CeCe ihr nach.
»Keine Ursache. Ich sag meinem Kumpel Fletch, er soll euch Gesellschaft leisten.«
»Gern.« Chrissie nickte.
Sobald Mary-Kate den Raum verlassen hatte, nahmen CeCe und Chrissie auf dem alten, aber bequemen Sofa vor dem Kamin Platz. Chrissie drückte CeCes Hand. »Alles in Ordnung?«
»Ja. Die ist echt nett. Keine Ahnung, ob ich zwei wildfremde Menschen nach so einer Geschichte in mein Haus gelassen hätte.«
»Stimmt. Wahrscheinlich sind die Leute hier vertrauensseliger als die in den Städten. Außerdem warten ja ihre Beschützer draußen vor der Tür.«
»Mit ihren blonden Haaren, der hellen Haut und den großen blauen Augen erinnert sie mich an Star.«
»Das kann ich wegen der Fotos, die du mir von ihr gezeigt hast, nachvollziehen, aber vergiss nicht, dass ihr Schwestern nicht blutsverwandt seid. Deshalb ist vermutlich auch Mary-Kate mit keiner von euch richtig verwandt«, erinnerte Chrissie CeCe.
Da ging die Tür auf, und ein groß gewachsener, schlaksiger Mann Anfang zwanzig betrat den Raum. Seine langen hellbraunen Haare lugten unter einem Wollbeanie hervor, mehrere Silberpiercings zierten seine Ohren.
»Hi, ich bin Fletch. Freut mich, euch kennenzulernen.«
CeCe und Chrissie stellten sich vor, während Fletch sich in einen Sessel ihnen gegenüber setzte.
»MK hat mich zu euch geschickt. Ich soll aufpassen, dass ihr sie nicht ausraubt.« Fletch grinste. »Was ist das für ’ne Geschichte, wegen der ihr hier seid?«
CeCe überließ es Chrissie, alles zu erzählen, weil diese das so viel besser konnte als sie.
»Das Ganze mag merkwürdig klingen«, endete Chrissie, »denn CeCe stammt aus einer eigenartigen Familie. Keine der Schwestern ist seltsam, nur dass ihr Vater sie in sämtlichen Weltgegenden adoptiert hat, ist es.«
»Wisst ihr, warum? Ich meine, warum gerade euch?«, fragte Fletch.
»Keine Ahnung«, antwortete CeCe. »War wahrscheinlich reiner Zufall, weil er viel reiste. Er hat uns entdeckt und mit nach Hause genommen.«
»Verstehe. Nein, eigentlich versteh ich’s nicht, aber …«
In dem Moment betrat Mary-Kate den Raum.
»Ich hab in mein eigenes Schmuckkästchen und in das von Mum geschaut. Der Ring ist nicht da. Sie scheint ihn doch mitgenommen zu haben.«
»Wie lange wird sie weg sein?«, erkundigte sich CeCe.
»Als sie gefahren ist, hat sie gesagt: ›Solange ich Lust habe.‹« Mary-Kate zuckte mit den Achseln. »Mein Dad ist kürzlich gestorben. Da hat sie beschlossen, eine Weltreise zu machen und sämtliche Freunde zu besuchen, die sie jahrelang nicht gesehen hat. – Jetzt wär sie dazu noch in der Lage, hat sie gemeint.«
»Mein Beileid. Wie du weißt, ist der meine auch erst vor Kurzem gestorben«, erklärte CeCe.
Mary-Kate bedankte sich. »Das war echt hart. Ist erst ein paar Monate her.«
»Für deine Mum muss das ein ziemlicher Schock gewesen sein«, bemerkte Chrissie.
»O ja. Obwohl Dad dreiundsiebzig war, ist er uns nie so alt vorgekommen. Mum ist um einiges jünger; nächstes Jahr hat sie runden Geburtstag. Sie wird sechzig. Ihr sieht man das Alter ebenfalls nicht an. Da drüben steht ein Foto von ihr, mir, meinem Bruder Jack und meinem Dad von letztem Jahr. Mein Dad hat immer behauptet, Mum hätte Ähnlichkeit mit der Schauspielerin Grace Kelly.«
Mary-Kate holte das Bild, um es CeCe und Chrissie zu zeigen. Und die beiden gelangten zu folgendem Schluss: Mary-Kate war zwar hübsch, ihre Mutter hingegen konnte man trotz ihres Alters nur als echte Schönheit bezeichnen.
»Wow! Ich hätte sie für nicht viel älter als vierzig gehalten.« Chrissie stieß einen Pfiff aus.
»Ja«, pflichtete CeCe ihr bei. »Sie ist atemberaubend schön.«
»Stimmt, und obendrein eine großartige Frau. Alle lieben meine Mum«, erklärte Mary-Kate lächelnd.
»Absolut richtig«, meldete sich Fletch zu Wort. »Sie ist ein ganz besonderer Mensch, sehr freundlich und warmherzig.«
»Unsere Adoptivmutter Ma ist genauso. Sie gibt uns allen Selbstvertrauen«, bemerkte CeCe, während sie die anderen Fotos auf dem Kamin betrachtete. Auf einem Schwarz-Weiß-Bild war eine junge, glücklich lächelnde Mary in dunklem Talar zu sehen. Im Hintergrund befanden sich Steinsäulen, die den Eingang zu einem imposanten Gebäude flankierten.
»Ist das da auch deine Mum?« CeCe deutete auf das Foto.
»Ja, bei ihrem Abschluss am Trinity College in Dublin«, antwortete Mary-Kate.
»Sie ist aus Irland?«
»Ja.«
»Und du weißt echt nicht, wie lange sie weg sein wird?«, hakte Chrissie nach.
»Nein, wie gesagt: Den Termin der Rückreise hat sie offengelassen. Sich nicht genau festzulegen, wann sie zurückkommt, ist für sie Teil des Vergnügens. Für die ersten paar Wochen gibt es allerdings einen Plan.«
»Ich möchte dir wirklich nicht auf die Nerven gehen, aber wir würden sie gern persönlich treffen und ihr Fragen zu dem Ring stellen. Hast du eine Ahnung, wo deine Mum gerade ist?«, erkundigte sich CeCe.
»Der Reiseplan hängt am Kühlschrank. Ich schau mal nach. Mit ziemlicher Sicherheit ist sie auf Norfolk Island.« Mary-Kate verließ das Zimmer.
»Norfolk?« CeCe runzelte die Stirn. »Ist das nicht ’ne Grafschaft in England?«
»Ja«, bestätigte Fletch, »doch eine winzige Insel im Südpazifik zwischen Australien und Neuseeland heißt auch so. Geiler Ort. Als Bridget, die älteste Freundin von MKs Mum, vor ein paar Jahren hier war, sind sie zusammen hingefahren. Der Freundin hat’s dort so gut gefallen, dass sie beschlossen hat, ihre Zelte in London abzubrechen und ganz nach Norfolk Island zu ziehen.«
»Laut Reiseplan müsste Mum noch auf der Insel sein«, teilte Mary-Kate ihnen mit, als sie zurückkehrte.
»Wann will sie wieder abreisen? Und wie kommen wir da hin?«, fragte CeCe.
»In zwei Tagen. Von Auckland aus ist es nur ein Katzensprung nach Norfolk Island. Allerdings geht nicht jeden Tag ein Flieger. Wir müssten uns erkundigen, wann«, meinte Mary-Kate achselzuckend.
»Scheiße!«, fluchte CeCe und sah Chrissie an. »Wir wollen morgen Abend spät nach London fliegen. Haben wir für diesen Abstecher Zeit?«
»Die müssen wir uns eben nehmen, findest du nicht?«, meinte Chrissie. »Schließlich ist sie von Europa aus gesehen sozusagen gleich ums Eck. Und wenn sich die verschwundene Schwester anhand des Rings identifizieren lässt …«
»Ich checke mal die Flüge nach Norfolk Island und die von Queenstown nach Auckland. Mit dem Flieger kommt man schneller hin als mit dem Wagen.« Fletch stand auf und trat an einen langen Esstisch aus Holz, auf dem sich Papiere und Zeitschriften häuften und ein altmodischer großer Computer stand. »Es könnte eine Weile dauern, weil das Internet hier extrem schlecht ist.« Er versuchte, etwas einzugeben. »Tja, wie erwartet: Momentan geht nichts.« Er seufzte.
»Auf dem Foto ist mir dein Bruder aufgefallen. Hält der sich gerade in Neuseeland auf?«, wandte sich CeCe an Mary-Kate.
»Normalerweise wäre er da, aber er ist vor Kurzem nach Südfrankreich geflogen, um mehr über die französische Kunst des Kelterns zu erfahren.«
»Er will also das Weingut von deinem Dad übernehmen?«, stellte Chrissie fest.
»Ja. Hey, habt ihr zwei eigentlich Hunger? Es ist schon nach Mittag.«
»Sogar einen Bärenhunger«, antworteten Chrissie und CeCe wie aus einem Mund.
Nachdem sie zu viert einen Imbiss aus Brot, dem örtlichen Käse und kaltem Braten hergerichtet hatten, räumten sie den Esstisch frei und nahmen Platz.
»Wo genau lebt ihr zwei?«, erkundigte sich Fletch nach einer Weile.
»In Alice Springs«, teilte CeCe ihm mit. »Doch mein Elternhaus heißt Atlantis und liegt am Genfer See in der Schweiz.«
»Atlantis, die mythische Heimat von Atlas, dem Vater der Sieben Schwestern«, meldete sich Mary-Kate zu Wort. »Euer Dad scheint die griechischen Sagen echt geliebt zu haben.«
»Ja. In einem Observatorium ganz oben in unserem Haus steht ein großes Teleskop. Sobald wir reden konnten, kannten wir sämtliche Namen aus dem Sternbild Orion auswendig«, erinnerte sich CeCe. »Wenn ich ehrlich bin, hat mich das nicht interessiert, bis ich nach Alice Springs kam und mir klar wurde, dass die Sieben Schwestern in den Mythen der Aborigines ebenfalls eine Rolle spielen. Ich hab mich gefragt, wieso es Geschichten über die Sieben Schwestern praktisch überall gibt. Zum Beispiel in der Kultur der Maya, der Griechen und Japaner … Die Sieben Schwestern sind auf der ganzen Welt bekannt.«
»Auch die Maori erzählen sich Sagen über sie«, ergänzte Mary-Kate. »Sie nennen das Sternbild der Plejaden Matariki. Bei ihnen besitzen die Schwestern allesamt spezielle Fähigkeiten und Gaben, an denen sie die Menschen teilhaben lassen.«
»Wie konnten die Kulturen damals voneinander wissen?«, wunderte sich Chrissie. »In grauer Vorzeit gab’s schließlich kein Internet, ja nicht mal Post oder Telefon. Wie können die Geschichten ohne Kommunikationsmöglichkeit zwischen den Völkern so ähnlich sein?«
»Du solltest wirklich meine Mum kennenlernen.« Mary-Kate lachte. »Die redet ständig über solche Themen, hat unheimlich viel im Kopf. – Anders als ich, muss ich zugeben. Ich interessiere mich mehr für Musik als für Philosophie.«
»Aber du siehst aus wie deine Mum«, stellte Chrissie fest.
»Ja, das behaupten viele Leute. In Wahrheit bin ich allerdings adoptiert.«
CeCe warf Chrissie einen Blick zu. »Wow!«, rief sie aus. »Wie ich und meine Schwestern. Weißt du, von wo genau du adoptiert wurdest? Und wer deine leiblichen Eltern sind?«
»Nein. Mum und Dad haben es mir erklärt, sobald ich alt genug war, es zu verstehen, doch für mich ist meine Mum meine Mum … und mein Dad war mein Dad. Basta.«
»Sorry, wenn ich nachhake«, entschuldigte sich CeCe hastig, »aber wenn du adoptiert bist …«
»… könntest du tatsächlich die verschollene Schwester sein«, führte Chrissie den Satz für sie zu Ende.
»Eure Familie scheint schon ziemlich lange nach dieser Person zu suchen«, erwiderte Mary-Kate sanft, »doch soweit ich mich erinnere, hat meine Mum nie was von einer ›verschwundenen Schwester‹ erwähnt. Ich weiß lediglich, dass bei der Adoption keine Namen offenbart wurden und sie in Neuseeland stattfand. Bestimmt kann Mum euch mehr sagen, sobald ihr sie trefft.«
Fletch stand auf. »Ich probier’s noch mal mit dem Internet, um festzustellen, ob es eine Möglichkeit gibt, in den nächsten vierundzwanzig Stunden nach Norfolk Island zu fliegen.« Er setzte sich am anderen Ende des Tisches vor den Computer.
»Hat deine Mum ein Handy?«, fragte Chrissie.
»Ja«, antwortete Mary-Kate, »aber auf Norfolk Island hat sie wahrscheinlich kein Netz. Das Schöne an der Insel ist ja gerade, dass die Leute dort der übrigen Welt in puncto Technik ungefähr fünfzig Jahre hinterherhinken.«