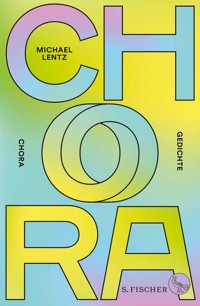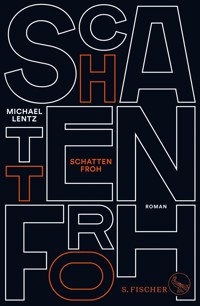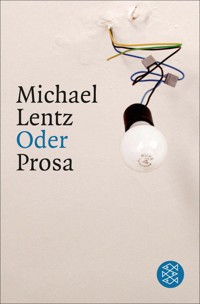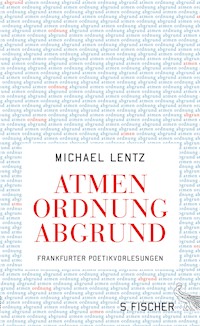
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die fünf Poetikvorlesungen von Michael Lentz legen den Bodensatz der Zwangsneurose frei, die wir Literatur nennen. Sie widmen sich Fragen des poetologischen Untergrunds, auf dem die Literatur sich bewegt. Ihr rhetorisches Ordnungsgefüge, so Lentz, verdeckt nur den Abgrund, über den sie uns führt. Wo findet sich in dieser Ordnung die Angst, fragt Lentz, wo entsteht Zauber in der Rhetorik? Was hält uns, wenn wir in den Abgrund blicken? Die Frankfurter Poetikvorlesungen bestehen seit 1959, erste Dozentin war Ingeborg Bachmann. Die Liste der Teilnehmer ist ein Who is who der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Zuletzt traten Alexander Kluge, Thomas Meinecke und Ulrich Peltzer auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Michael Lentz
Atmen Ordnung Abgrund
Frankfurter Poetikvorlesungen
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
Covergestaltung: buxdesign
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402095-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Michael Lentz, habe nun [...]
Die Dame Rhetorica
Rhetorik. Alles steht mit allem in Verbindung
I. Inventio
Exemplum Schiller
Angemessenheit – kein bloß rhetorischer Begriff
Der Sprache entlang schreiben
Exemplum Samuel Beckett: Das letzte Band
Ror Wolf – Der Sprache verschlägt es die Sprache
Vergessen, Suchen, Finden, Vergessen
II. Dispositio
Ordnung und Abweichung
Digressio – Der Roman
Lektüre als Digressio
Lektüren
Die Abweichungspoetik Ernst Jandls
Neue Anagramme – »In allen Regeln bin ich Egge«
Die Fatrasie
Franz Mon
Ror Wolf – Ordnung
III. Elocutio
Abweichung und Angemessenheit
Abweichung und Verständlichkeit
Sinnvermittlung zwischen Gedicht und Politik
»so ging die Spur in Verlur« Einige Vermutungen zu Oskar Pastiors Poetik der Camouflage
Chaos – Antichaos
Offne Worte?
Oskar Pastiors Poetik der Latenz
Quellenkunde: Staatstragende Poesie
Quellenkunde, Textbiopsien, pars pro toto – eine Art Säuberung?
»abschrankung ißt wegweiser«
Zufall, Atem, Atemschaukel
Verschließen, Versiegeln
Magie, Steganographie, Kunst des Vergessens
Kunst des Vergessens?
Die Katastrophe zum Schluss
Anhang
Ganz verständlich unverständlich – Die Lieder und Balladen des Krimgotischen Fächers
Oskar Pastior: Versuchte Rekonstruktion
IV. Memoria
Metapher und Gedächtnis – Die Memoriafunktion der Literatur
Erinnerung und Gedächtnis – Wachstafel und Magazin
Die memoria bei Hegel
Schrift und Tod
Ist der Tod zu Ende, fängt das Sterben an. Über Muttersterben
Erinnerung ist der Schmerz darüber, dass ich mich erinnere
Erinnerung als Neurose – Liebeserklärung
Das Exil ist der Buchstabe – Pazifik Exil
Gedächtnisort Sprache
Ausblick und Abgrund
V. Actio
Die Stimme in den antiken Rhetoriken
Stimme und Mimesis. Die Mimesis der Stimme
Stimme und Schmerz. Verstimmung und Stimme
Stimme und Schweigen
Daheim und anderswo
Ende gut. Zu meinen Sprechakten.
Ror Wolf
Michael Lentz, habe nun den text meines lebens, unveröffentlicht
Prolog
Die Dame Rhetorica
olitüde(Aus Oskar Pastior, sonetburger. Berlin: Rainer Verlag 1983 © Oskar Pastior Stiftung, Berlin)
Sie werden eine gütig dreinblickende, leicht nach vorn gebeugte Person sehen, die etwas hüftsteif dasteht, huldvoll in ihren Gesten, ihre Kleidung ein Stilbruch. Die Puschen und der wallende Unterrock passen nicht so recht zum darüber drapierten Festkleid, das Haupt ziert eine Krone – oder umgekehrt? Der Kopf ist im Vergleich zu den Füßen verschwindend klein, schmallippig die Gestalt. Eine belebte Puppe, die sich lieber wieder umziehen ginge, eine karnevaleske Anprobe zur Unzeit.
Sie werden sehen: Bei genauerer Betrachtung erweist sich die Person, wenn sie denn eine ist, als unbeschreiblich disparat. Stilbruch herrscht auf allen Ebenen – ein vermeintliches Paradox, ist der Figur die Frage nach dem Stil doch eine wesentliche. Die Figur beherbergt viele Figuren. Wer zählt sie alle, »nennt die Namen, die gastlich hier zusammenkamen«? Der Betrachter hat eine untersichtige Perspektive eingenommen, möglicherweise kniet er. Die Person verjüngt sich nach oben, bei näherem Hinsehen wirkt sie, als beuge sie sich ein wenig nach hinten. Beschreibt ihre inszenierte Erscheinung eine nach oben hin aufsteigende Wertehierarchie? Die amorphe Masse geerdet und von merkwürdigen Auswüchsen umzingelt, das Haupt himmlisch entrückt. Das Bild ums Bild: der Ausschnitt eines Triumphbogens, der das Figurenensemble mittig rahmt und ihm so Symmetrie verleiht. Die solchermaßen beherbergte Gestalt, eine wahre Unschuld, die nicht weiß, wohin mit ihren Händen, könnte sonst ins Wanken geraten, sich der Kleidung entledigen, ihre wahre Gestalt verraten. Der Triumphbogen ist der Rahmen des Bildes, das keinen Rahmen hat außer dem Papier als unechtes Passepartout, und Papier passt immer. Das Papier simuliert die Begrenzung seiner selbst, das Auge kann Bild von Abbild nicht unterscheiden und ebnet im Verbund mit dem Papier jedwede Tiefe ein: Die Erde ist eine Scheibe. Simulation ist eine Wirkmacht. Geht diese Wirkmacht von der Gestalt aus, ist ihre bildliche Darstellung eine Devotionalie.
Schrift ist ein Wallfahrtsort. Sie verheißt mehr, als sie halten kann. Sie erinnert uns permanent an Wörter und Dinge, denen wir nie begegnet sind, die wir nicht erlebt, an die wir nie im Leben gedacht haben. Aber wir richten unser Leben danach aus, nach dem Unbegegneten, Nichterlebten, Niegedachten.
Kommen wir der Gestalt, die uns alle gestaltet (und nun schon so lange aufgehalten hat), ein wenig näher. »Ein wenig«: So sagt man halt, wie weit es auch sein mag. »Näher«: reine Utopie, die letzte vielleicht, die unserem verschäftigten Alltag zugrunde liegt. »Zugrunde«: eine räumliche Metapher, final verwendet in »zugrunde richten«. »Zu Grunde«, da ist die Richtung des Richtens schon vorgegeben.
Die Füße der Gestalt werden von einem plumpen Unterrock umspielt. Das knielange Oberkleid scheint ebenso zu kurz geraten zu sein wie der mit einer Blumenbrosche über der Brust befestigte Umhang. Sein feiner Stoff macht den Unterrock zum Nachthemd. Die Kürze ergibt Sinn, sie gibt den Blick frei auf drei Hundeköpfe und einen lodernden Topf rechts und links zu den Füßen der Gestalt. Die in verschiedene Richtungen schauenden Hundeköpfe stecken in einer Art Sack, das Ensemble sieht aus wie ein hundekopfblühender Fenchel. Das Kleid der Dame ist beblümt, es ist der Fruchtkelch des Umhangs, den dieselbe Blumenornamentik schmückt. Die linke Hand, einladend ausgestreckt, öffnet den Blick auf das Futter des Umhangs: die Kehrseite der Rede. Die rechte Hand hält einen ellenlangen Stab, der in der Armbeuge und an der Schulter lehnt. Welche Hoheit wird der Dame mit diesem Zepter verliehen? Zwei Schlangen umwinden den Stab. Über ihren einander zugewandten Häuptern je ein Flügel. Eine diskusartige Scheibe bildet den Himmel dieses symmetrischen Gebildes. Der Himmel wird durch eine runde Kugel auf dem Stab gehalten. Ist diese Kugel die Welt, dann ist der Himmel die Hölle. Die Hölle hat eine viel größere Ausdehnung als die Welt. Dafür ist es viel exklusiver, auf der kleinen Welt zu sein, als in der Hölle zu schmoren. Die meisten sind bereits in der Hölle. Dass wir leben, ist vorübergehend. Augenscheinlich kann die Dame ihren Mund nicht halten. Was diesem Mund entkommt, sind keine Worte. Es tropft nicht herab aus diesem Mund, und doch scheint da etwas auszufließen. Eine dreistrahlige Kette.
Was weiß ich nun über diese Dame und ihre so verschwiegen vielsagende Inszenierung? Nicht eben viel. Ich kann sie mir aufgrund der Beschreibung ungefähr vorstellen, ich kann sie mir vielleicht in Erinnerung rufen, sollte ich sie schon einmal gesehen haben. Ich finde sie womöglich, ihrem Erscheinungsbild entsprechend, beachtlich unbeachtlich. Der symbolische und allegorische Gehalt des figürlichen Ensembles erschließt sich mir aber erst, wenn ich die rhetorische Ikonographie mitsamt ihren mythologischen Allusionen decodieren kann. Die Dame wird dann zu einem emblematischen Sinnbild. Sie wird zur Dame Rhetorica.
Rhetorica(Aus: Cristoforo Giarda, Bibliothecae Alexandrinae Icones Symbolicae, 1628)
Jedes Element in diesem Symbol-Kompositum hat seine eigene Deutungsgeschichte, und zugleich steht kein Element für sich in diesem Bild, das aus Bildern arrangiert wurde und bei Unkenntnis der für das Bildganze signifikanten Elemente wieder in Einzelbilder zerfällt. Hier herrscht eine Simultaneität von Ungleichem diachroner Herkunft, das nur von einem Namen und dem damit verbundenen System domestiziert wird: Rhetorica. Ihr gekröntes Haupt, auch als Himmel und als Staatsoberhaupt, ist den Blicken in ganzer Undeutlichkeit deutlicher entzogen als das durch überschüssiges Gewand anonymisierte Fußvolk.
Eine Hierarchie der Ordnungen. Füße. Die fußmessende Metrik der Antike. Versfüße. Der rechte Fuß der Rhetorica ist vorangestellt. Sie geht bemessenen Schrittes. Ihr Schritt ist bildlich eingefroren.
Es herrscht Bewegung im Stillstand. Literatur.
Die rhetorische Ikonographie hat ihre eigene bildnerische Geschichte.[1] Die Geschichte der visualisierten Personifikation der Rhetorik lässt sich beschreiben als ein Inventar von mythologisch-symbolischen Versatzelementen, die, vor dem semantischen Horizont der Sieben Freien Künste (septem artes liberales), zu emblematischen Arrangements mit unterschiedlicher Gewichtung der Attributionen kombiniert werden. Aus dieser bildnerischen ars combinatoria resultiert eine rezeptions- und wertungsgeschichtlich aufschlussreiche Typologie der Rhetorikikonographie. Die Ikonographie der Rhetorica als Kompositfigur ist selbst Teil der rhetorischen Wirkungsgeschichte, die sich, analog zu den verbalen Urteilen über sie, in zwei Lager teilt, deren Extreme Vergöttlichung und Verdammung heißen. Dies geschieht jeweils selbst, ob im Medium des Bildes oder des Wortes, mit rhetorischen Mitteln.
Die Entschlüsselung der Kompositfigur Rhetorica als Sinnbild erfolgt über die Entschlüsselung ihrer Teilelemente. Jedes segmentierbare Detail wird zu einem Symbol bzw. symbolisch aufgeladen und der zentralen Figur als Attribut zugewiesen. In einem Darstellungstypus können Elemente fehlen, die in einem anderen Typus den semiotischen Gehalt dominieren. An die Stelle eines – mitunter auch erotisch konnotierten – Schwertes als Symbol der Herrschaft, der göttlichen Gerechtigkeit oder der Gewalt kann so ein Symbol treten, dessen Deutung einen vor größere Probleme stellt, indem es mehr voraussetzt.
Findet sich in einer Handschrift von Martianus Cappellas’ De nuptiis Philologiae et Mercurii aus dem 10. Jahrhundert und über vier Jahrhunderte später in der Federzeichnung Die Beredsamkeit von Albrecht Dürer aus den Jahren 1495/96 eine Rhetorica bzw. Eloquentia, die mit dem Machtsymbol des Schwertes ausgestattet ist, so hält die Rhetorica-Darstellung in Cristoforo Giardas Bibliothecae Alexandrinae Icones Symbolicae aus dem Jahr 1626 bloß einen merkwürdigen Stab.[2]
Bei dem Stab, den die Dame gar nicht festzuhalten scheint, der wie ins Bild nachträglich hineinkopiert wirkt, handelt es sich um den Heroldsstab, der dem Herold als Überbringer von (militärischen) Befehlen oder sonstigen geheimen Botschaften Immunität und eine sichere Rückkehr gewähren sollte. Als Symbol des Handels wurde der Heroldsstab später Merkurstab genannt. Der Name Merkur ist das römische Äquivalent zum griechischen Hermes, dessen Qualitäten auf Merkur übertragen wurden.
Zwischen Merkur und der Rhetorik hatte bereits in der antiken Literatur »eine gedankliche Verbindung« existiert, die auch der »mittelalterlichen Geisteswelt (…) nicht fremd« war. Als bildliches Attribut der Rhetorik findet sich, so Stephan Brakensiek, der »Schlangenstab des Merkur, der Caduceus, erst in der humanistisch geprägten Kunst der Frühen Neuzeit«[3]. Das Schwert drängt er in seiner Symbolfunktion zurück.
Hermes war u.a. der Gott der Rhetorik und – für manche Rhetorikkritiker ein Synonym – der Magie. Mit dem Hermes- bzw. Merkurstab, lateinisch Caduceus, habe Merkur, so die Legende, die Seelen in den Orkus hinabgeführt und sie aus demselben wieder herausgebracht, wie Vergil es im 4. Buch der Aeneis beschreibt. Solchermaßen ist der Caduceus ein »Zauberstab der Analogie«, als welchen Novalis das poetische Verfahren der Dichtung bezeichnete.[4] Kraft seiner Redegewalt galt Merkur auch als »Begründer der Zivilisation«.[5] Ursprünglich soll der Hermesstab ein Ölzweig gewesen sein, der mit seinen zwei verknoteten Spitzen auch als züchtigende Rute dienen konnte. Hermes besänftigte mit ihm zwei kämpfende Schlangen, die daraufhin den Stab umwanden. Seitdem galt er als Friedensstifter. Der symbolisch aufgeladene Hermesstab verleiht der Dame Rhetorica somit auch den Status der Gerechtigkeit obwalten lassenden Friedensrichterin, was die Bedeutung der Redekunst für das Gericht bzw. die Gerichtsrede herausstellt. Als solche ist sie auch prominent dargestellt worden vom Kartäuserprior Gregor Reisch in den zwölf Büchern seiner Margarita Philosophica (1503), der für das Studium der septem artes liberales und als Handbuch der Philosophie wichtigsten Enzyklopädie des späten Mittelalters. Im dort abgebildeten, figurativ komplexen[6] Holzsschnitt Typus Rhetorice wird das aufwendig gestaltete Gewand der Rhetorik durch die »iusticia« gebändigt, die Inschrift des Gürtels. Der auch hier als Frau personifizierten Rhetorik ragen eine Lilie als Symbol der Beredsamkeit bzw. der Lob- und Strafrede und ein loderndes Flammenschwert aus dem Mund, Letzteres allerdings mit der Spitze voran, was als Selbstreflexivität auch im Sinne von Sich-selbst-Richten gedeutet werden kann. Dass Knauf und Griff des Schwertes von der Rhetorik weg weisen und somit zum Ergreifen des Schwertes einladen, kann gedeutet werden als Sentenz: Wer sich der Rhetorik bedient, bedient sich einer Waffe. Auf einer anderen Darstellung der Margarita Philosophica geht die Dame Grammatik mit einem geschulterten Degen geradezu lustwandeln.
Der Roman kann ein Schwert sein. Als reflektierende und selbstreflexive Form kann der Roman sich selbst richten, indem er eine permanente Selbstaufhebung betreibt. Er vollzieht sich im Flüchtigen, er flüchtet in Worten, weil er das Schwert nicht zur Anwendung bringen möchte. Er hat so viel Zeit, dass sich das Schwert verflüchtigt. Wer einen Roman schreibt, so ließe sich vielleicht schlussfolgern, leitet Gewalt in die Bewegung der Schrift um. Das »Fiktive als Mobilisierung des Imaginären«[7] kann allerdings die Korrektur dieser Abfuhr wieder einfordern, wenn eben auch nur fiktional. Gewalt wirkt so untergründig an der »Mobilisierung des Imaginären« mit – wobei konzediert sei, dass das Imaginäre in der Diversifikation der Begriffsverwendung selbst imaginär bleibt. Als solches vermag das Imaginäre »nicht gegenständlich zu werden«.[8] Das Drama hat weniger Zeit:
JUNGER SOLDAT
Ich leids nicht, reden Sie nicht, ich vertrag keine Ungerechtigkeit.
MUTTER COURAGE
Da haben Sie recht, aber wie lang? Wie lang vertragen Sie keine Ungerechtigkeit? Eine Stund oder zwei? Sehen Sie, das haben Sie sich nicht gefragt, obwohls die Hauptsach ist, warum, im Stock ists ein Elend, wenn Sie entdecken, jetzt vertragen Sies Unrecht plötzlich.
JUNGER SOLDAT
Ich weiß nicht, warum ich Ihnen zuhör. Bouque la Madonne, wo ist der Rittmeister?
MUTTER COURAGE
Sie hören mir zu, weil Sie schon wissen, was ich Ihnen sag, daß Ihre Wut schon verraucht ist, es ist nur eine kurze gewesen, und Sie brauchten eine lange, aber woher nehmen?
JUNGER SOLDAT
Wollen Sie etwa sagen, wenn ich das Trinkgeld verlang, das ist nicht billig?
MUTTER COURAGE
Im Gegenteil. Ich sag nur, Ihre Wut ist nicht lang genug, mit der können Sie nix ausrichten, schad. Wenn Sie eine lange hätten, möcht ich Sie noch aufhetzen. Zerhacken Sie den Hund, möcht ich Ihnen dann raten, aber was, wenn Sie ihn dann gar nicht zerhacken, weil Sie schon spüren, wie Sie den Schwanz einziehn. Dann steh ich da, und der Rittmeister hält sich an mich.
ÄLTERER SOLDAT
Sie haben ganz recht, er hat nur einen Rappel.
JUNGER SOLDAT
So, das will ich sehn, ob ich ihn nicht zerhack.
Er zieht sein Schwert. Wenn er kommt, zerhack ich ihn.
DER SCHREIBER guckt heraus
Der Herr Rittmeister kommt gleich. Hinsetzen.
Der junge Soldat setzt sich hin.
MUTTER COURAGE
Er sitzt schon. Sehn Sie, was hab ich gesagt. Sie sitzen schon. Ja, die kennen sich aus in uns und wissen, wie sies machen müssen. Hinsetzen! und schon sitzen wir. Und im Sitzen gibts kein Aufruhr. (…)[9]
Zurück zum Hermesstab, zum Caduceus. Über die Herkunft des Gegenstandes und des Namens Caduceus ist oft gerätselt worden. Neben der Ölzweig-Version gibt es auch etymologisch spitzfindige Erklärungen. Ludwig Julius Friedrich Höpfner zitiert diesbezüglich in Deutsche Encyclopädie oder Allgemeines Real-Wörterbuch aller Künste und Wissenschaften den »Mythologisten« Abt Plüche folgendermaßen: »Im Morgenlande trug jede in Ansehen und Würde stehende Person ein Zepter, oder einen Ehrenstab, und öfters eine goldne Platte an der Stirn, die man Cadosch, oder Caduceus nennte, welches einen Heiligen (im Hebräischen) bedeutet; anzuzeigen, wer diesen Stab trüge, sey ein Mann, der ein öffentliches Amt habe, der frey und ungehindert gehen und kommen könne, und dessen Person unverletzlich sey. Dies ist der Ursprung des Namens, den man dem Stabe des Mercurs beyleget. Also ward aus einem Bilde, dessen Absicht war, an ein Hinwegziehen zu erinnern, ein Wegweiser, Ausleger, (…) Götterbote.«[10] Wer den Caduceus der Rhetorik trägt, so ließe sich schlussfolgern, ist ein Diplomat der Rede und der Poesie, er kann in der Sprache ungehindert gehen und kommen, denn die Rhetorik hat ihn zur Kunst der Rede und der Sprache befähigt. Der Romanautor kann im Rahmen der Grenzen, die ihm die Sprache und das Imaginäre im Versuch seiner über das Fiktive vermittelten Gestaltwerdung auferlegen, im fiktiven Spiel, im Spiel des Fiktiven sich »frey und ungehindert« bewegen – eine Konfiguration, die konsequenterweise totalitäres Denken auf den Plan ruft, die Freiheit des Imaginären als das noch nicht Gleichgeschaltete zu assimilieren und zu kontrollieren. Das Imaginäre ist allerdings selbst totalitär, es lässt sich nicht abschalten, nicht kontrollieren, nicht in Erscheinung rufen, nicht vorhersagen, nicht in Dienst nehmen. Aus dem Imaginären wächst auch der Totalitarismus. Versteht man Imaginäres als Antizipation, über das bzw. über dessen Bilder zunächst noch »die Herrschaft (…) entzogen bleibt«, so geschieht Wolfgang Iser zufolge in der Vorstellung »ein Dirigieren von Imaginärem durch erinnerungsgeladene, kognitive Absichten, um Abwesendes oder Nicht-Gegebenes gegenwärtig zu machen«.[11]
Die Romantik kann begriffen, aber nicht auf den Begriff gebracht werden als das Totale des Imaginären. Deshalb fängt sie in der Antike an und hat bis heute nicht aufgehört anzufangen. Die Romantik ist ein Bumerang.
Die diskusartige Scheibe über dem Flügelpaar von Giardas Rhetorica ist untypisch für den Caduceus. Ob sie wohl eine Anspielung auf die von Plüche angeführte »goldne Platte an der Stirn« ist? Bei Giarda dient sie möglicherweise zur symbolischen Kennzeichnung des Hermesstabes als hoheitliches Insignium: Die Rhetorik regiert – ob mit Schwert oder Hermesstab.
Merkwürdiger noch als der in seinem Symbolgehalt kulturgeschichtlich variabel besetzte Caduceus mag die dreistrahlige Kette erscheinen, die Madame Rhetorik, als wäre es die natürlichste Sache der Welt, aus unversiegbarer Quelle aus dem Mund zu fließen scheint. Werden die Hunde insgeheim am Gängelband der Ketten geführt? Mit der Kette werde ich mich in der Abteilung Elocutio beschäftigen. Und mit den Hunden und dem lodernden Topf noch im Rahmen dieser Vorlesung.
Rhetorik. Alles steht mit allem in Verbindung
Es hat hier also alles seinen korrespondierenden Bezug. Die Lilien als Ornamente des rhetorischen Kleides sind nicht nur das Symbol der Unschuld, des Todes oder des Unerklärlichen, sondern auch der künstlerischen Phantasie, der selbst etwas Numinoses anhaftet. Als flores rhetorici, das heißt Tropen oder rhetorische Figuren, blühen sie selig in sich selbst, wenn man sie lässt und nicht in beengende Vasen ohne Wasser stellt. Diese Blumen sind mehr als Ornament und Zierde, sie sind das Selbstvermögen der Sprache. In der Natur als natura naturans kommen sie nicht vor, wohl aber unwillkürlich in der menschlichen Rede und, bewusster eingesetzt, im literarischen Text. Wie die rhetorische Ikonographie in miteinander korrespondierende symbolische Teilelemente, so ist die Rhetorik als Theorie und Technik der Redekunst zur Konstituierung ihrer Ordnung in einzelne Disziplinen untergliedert: inventio, dispositio, elocutio, memoria und actio bzw. pronuntiatio.
Quintilian diskutiert die Definitionsgeschichte der Rhetorik.[1] In seiner weitesten Begriffsbestimmung ist die nach ihrem artifex, dem Redner, benannte Rhetorik »die Lehre von der guten Rede«: »rhetorice (…) est bene dicendi scientia«,[2] an anderer Stelle »die Kunst, gut zu reden«: »rhetorice ars est bene dicendi«[3]. Quintilian gliedert die Rhetorik in die Kunst, den Künstler und das Kunstwerk: »Kunst soll dabei soviel heißen wie Lehrfach, das heißt also: sie ist die Lehre von der guten Rede. Der Künstler ist der Mann, der diese Lehre empfangen hat, das heißt also der Redner, dessen Ziel es ist, gut zu reden. Das Werk ist das, was von dem Künstler hervorgebracht wird, das heißt also die gute Rede. All das gliedert sich wieder in verschiedene Arten.«[4] Diese Arten (species) finden sich in den Rhetoriken von Aristoteles, Cicero, Quintilian und in der Rhetorica ad Herennium.[5]
Es handelt sich hier kurzgefasst um die fünf Stationen der Verfertigung einer Rede: Die inventio findet die Gedanken, die in der dispositio angeordnet und in der elocutio mittels Figurenschmuck eingekleidet werden. Die memoria als Erinnerungslehre stützt sich auf die bildtheoretisch fundierte Annahme einer topischen Organisation des Gedächtnisses und dient, auf die actio als öffentlicher Vortrag ausgerichtet, dem Auswendiglernen einer Rede. Die actio oder pronuntiatio bezeichnet die rednerische Praxis unter den Aspekten des auf Wirkung ausgerichteten Vortrags mit der Stimme, der Mimik und Gestik, der körperlichen Haltung und zum Beispiel der räumlichen und akustischen Bedingungen.
Rhetorik, warum? Hier herrscht sinnreiche Vernunft und ein vernünftiges Reich der Sinne. Es ist die Sehnsucht des ästhetischen Freelancers nach der Regelpoetik, nach der Selbstunterwerfung, nach dem Barock. Geistige Einkünfte in geregelten Bahnen.
Weil ich nicht Maß halten kann. Weil die Erfahrung lehrt, dass ein regelpoetisch angefertigtes Prokrustesbett allemal überraschendere, scharfsinnigere, rätselhaftere Ergebnisse zeitigt als die pure Not literarischen Produzierens. Einbildungskraft schafft noch keine Worte, fessellose Imagination fängt keinen Text.
Ich bin ordnungsbesessen, kann aber keine Ordnung halten. Literaturtheorie ist eine Ordnungsinstanz. Sie interessiert mich mehr als die Literatur. In der Beschäftigung mit Rhetorik wähne ich, alles an seinem Platz zu finden und wiederzuerkennen. Ich suche in theoretischen Texten meinen Einfall. Diese Texte dienen mir als exempla (praecepta), sie sind die poetologischen loci (Topoi). Erfinden des Stoffs – inventio – heißt auch hier Finden, Auffinden.
I.Inventio
frischgewaschenesgedicht(Aus Oskar Pastior, sonetburger. Berlin: Rainer Verlag 1983 © Oskar Pastior Stiftung, Berlin)
Gonsalv K. Mainberger beschreibt die inventio, wie sie in der Rhetorik kodiert ist, als Verkörperung der triadischen Struktur der Suche: »1) Suche nach Verborgenem, nach den in der Sache schlummernden Argumenten; 2) theoriegeleitete Techne zur Überwindung der Tyche [Forscherglück]; 3) schöpferisches Erfinden von Neuem, Überraschendem, Nützlichem, kurz von semantischem und mithin nachhaltigem oder fiktionalem Mehrwert.«[1]
Was suche ich, was ist das Verborgene? Die Tradition. Was ist Tradition? Das, was ich vorfinde. Wie verläuft die Suche? Gezielt auf Umwegen. Und die Umwege gehören auch zum Ziel.
Der Konnex zwischen Rhetorik und Literatur hat sich nie ganz verloren, auch und gerade über den historischen Wandel bzw. Bruch vom Mündlichen zum Schriftlichen hinaus nicht – das zeigt sich auch darin, dass die Rhetoriken, die doch allesamt die metasprachliche Systematisierung der Rede (als eine Königsdiziplin der Mündlichkeit) zum Gegenstand haben, im reflektierenden und selbstreflexiven Medium der Schrift verfasst wurden. Die Stimme und das Bild waren von Anfang an in der Schrift, und die Stimme ist gegenüber der Schrift nicht bloß archaisch, sie hat wie diese epistemologische und kognitive Qualitäten, und es findet sich Schrift in ihr. Die Selbstwahrnehmung, die sich selbst vernehmende und dabei die Rede bzw. die Stimme stabilisierende auditive Rückkopplungsschleife schreibt sich in die voranlaufende Stimme ein. Orale Poesie ist z.T. hochkomplex und rhetorisiert ante litteram.
Dass sich der Konnex zwischen Rhetorik und Literatur nie ganz verloren hat, zeigt sich auch in der romantischen Neubesetzung rhetorischer Figuren durch Friedrich Schlegel oder Novalis, und schlagend in Friedrich Nietzsches berühmtem Diktum »die Sprache ist Rhetorik«, mit dem er die Unmöglichkeit dekretierte, zwischen Sprache und Rhetorik ein Drittes zu denken, das als Ordnungsinstanz beide voneinander unterscheidbar machen könnte: »Das ist der erste Gesichtspunkt: die Sprache ist Rhetorik, denn sie will nur eine doxa, keine episteme übertragen.«[2] Sprache will nur eine Meinung, kein Wissen übertragen. Dass die Sprache stets nur etwas überträgt, führt dazu, dass jedes Wort als Tropus anzusehen ist, als Synekdoche, Metapher oder Metonymie.
Sprache ist Mangel, Sprache ist Verlegenheit – in Anbetracht der Unmöglichkeit, mit Sprache über Sprache hinaus zu gelangen und dem Leben mehr abzugewinnen als Schein, Wahrheit womöglich.
Ein weiterer Blick zur Rhetorica: Vom Kopf zu den Füßen. Vom Mund zum Hund. Die dem Mund entströmenden Ketten sind den drei Hunden zu Füßen der Rhetorica angelegt, dem hundekopfblühenden Fenchel. Dort siedelt auch das Feuer. Was Rede bzw. Sprache doch vermag! Zur Darstellung ihrer energetischen Prinzipien erfindet sie ihre Umwelt gleich mit und legt die Geister, die sie rief, in Ketten.
Hund und Feuer als Subimagines der Rhetorica sind Insignien einer rhetorischen Affektenlehre. Ihre hierarchische Subordinierung wird angezeigt durch ihre Gruppierung zu Füßen der Dame, was einerseits den Gesetzen der Schwerkraft, andererseits aber der Subordinierung der Affekte unter die sie leitende Vernunft folgt, welche die Rede mittels der rhetorischen Ordnung formt. Es findet also keine Schemaüberblendung, sondern eine substrukturierte Ordnung statt.
Den dreiköpfigen Zerberus (Kerberos), der als Höllenhund den Eingang zum Hades bewachte, besänftigte der Sänger-Dichter Orpheus dem Mythos nach mit seinem Gesang. In der Ikonographie der Rhetorica bei Giarda steht der orphische Zerberus für die Poesie und zugleich für die Tugend der Mäßigung. Als Sinnbild eines barocken Ideals ist er das Antidot zum Feuer, das für lodernde Leidenschaft steht. Der Rhetorik dient also ein auf Ausgleich bedachter Affektendualismus. Ist von dem einen Affekt zu viel oder zu wenig da, wird er von dem konträren Affekt abgelöscht oder angestachelt: Das Höllenfeuer im lodernden Topf der Leidenschaft treibt den Höllenhund, der durch Gesang oder Rede besänftigt wird.
Exemplum Schiller
Noch Friedrich Schiller wusste von den idealischen Vorzügen gegensätzlicher Affektdisposition zwischen dichterischem Subjekt und objektiver poiesis ein Lied zu singen. In seiner vernichtenden Rezension von Gottfried August Bürgers Gedichten warnt er den Dichter davor, »mitten im Schmerz den Schmerz zu besingen«. Seine Begründung richtet das rhetorische Angemessenheits-Prinzip am ästhetisch-philosophischen Begriff des »Idealschönen« aus, verliert also das Regulativ der Rhetorik nicht aus dem Blick: »So, wie der Dichter selbst bloß leidender Teil ist, muß seine Empfindung unausbleiblich von ihrer idealischen Allgemeinheit zu einer unvollkommenen Individualität herabsinken.« Dann führt Schiller das Kriterium der zeitlichen Distanz ein, die den Affekt mildert, den Dichter als Wissenden aber stärkt: »Aus der sanftern und fernenden Erinnerung mag er dichten, und dann desto besser für ihn, je mehr er an sich erfahren hat, was er besingt; aber ja niemals unter der gegenwärtigen Herrschaft des Affekts, den er uns schön versinnlichen soll.« Das Postulat der Distanz soll Schiller zufolge auch vor dem Subjekt nicht haltmachen, das so zu seinem eigenen, sich entfernenden Beobachter wird: »Selbst in Gedichten, von denen man zu sagen pflegt, daß die Liebe, die Freundschaft u.s.w selbst dem Dichter den Pinsel dabei geführt habe, hatte er damit anfangen müssen, sich selbst fremd zu werden, den Gegenstand seiner Begeisterung von seiner Individualität los zu wickeln, seine Leidenschaft aus einer mildernden Ferne anzuschauen.« In der rhetorischen Anthropologie ist die Vermittlung von natura als Anlage oder Talent (ingenium) und ars als Kunstlehre (techne) ein Kernmoment rhetorischer Pädagogik. In diesem Sinne zeigt sich auch Schiller als Pädagoge, der auf eine Vermittlung von Rhetorik, Ästhetik und Philosophie im Begriff des Idealschönen zielt, das einer ungezügelten Affektpoetik unter der Maßgabe eines autopoetisch freien Geistes gegensteuert: »Das Idealschöne wird schlechterdings nur durch eine Freiheit des Geistes, durch eine Selbsttätigkeit möglich, welche die Übermacht der Leidenschaft aufhebt.«[1]
Schillers Maxime veranlasste mich, den Prosatext Muttersterben so lange umzuarbeiten, bis er endlich eine Gestalt angenommen hatte, die primäre Affekte hinter eine eigene chronotopische Ordnung und Dynamik zurückdrängte: Schreiben mit kalter Leidenschaft.
Und tatsächlich: Es kommt nur in seltenen Momenten vor, dass ich nicht das Gefühl habe, es wirke im Hintergrund des Schreibens ein Regulativ, das manche Sätze verhindert und manche andere leider nicht. Dieses imaginäre Regulativ hat einen starken Assistenten, der die Sätze im Prozess ihres Entstehens abtastet und evtl. korrigiert: die Rhetorik – insbesondere mit ihren drei Stationen der inventio, dispositio und elocutio. Es ist bedauerlich, dass ich nicht alle rhetorischen Termini auswendig kann. Was würde das andererseits in einem Gespräch nutzen? Ergäbe es Sinn, zu sagen: »Entschuldigen Sie, Sie haben soeben klipp und klar ein Hendiadyoin verwendet« oder »Ihr Anakoluth sitzt da nicht ganz richtig«? Das hätte wohl genauso viel Erkenntniswert wie Karl Valentins analytisch ins Leere laufende Rede: »Die Gesellschaft im Eisenbahnwagen war sehr gemischt; es waren fast lauter Reisende, nur der eine Herr, der in München den Zug versäumte, fuhr nicht mit.«[2]
Angemessenheit – kein bloß rhetorischer Begriff
Angemessenheit ist ein ethisches und ästhetisches Postulat von ungebrochener Relevanz. Die Frage der Angemessenheit hat sich nach dem Ende normativer, das heißt auch rhetorikinduzierter Gattungspoetiken ästhetisch von der Interrelation zwischen res und verba auf die Kontextualität der verba untereinander verschoben, was beispielsweise an der expressionistischen und futuristischen Wortkunst, den historischen Avantgarden und der Konkreten Poesie zu beobachten ist.
Bertolt Brecht polemisierte gegen Gottfried Benn, dieser habe »Wörter zusammengeführt, die sich sonst niemals kennengelernt hätten«.[1] Ich verstehe die regelinduzierte Montage heterogenen, weil dekontextuierten Sprachmaterials zu spannungsgeladenen Sinnzusammenhängen als geradezu befreiend: Auf die Sprache ist Verlass, während oder wenn ich schon verlassen bin. Verlass. Die Sprache ist ein Verließ, in der Rhetorik selbst kann man sie finden – und in den Wörterbüchern, Enzyklopädien, Fachsprachenlexika. Nachts kann ich nicht schlafen, weil ich an den Tod denke. Das Denken an den Tod verläuft einförmig. Der Bildervorrat ist stark restringiert. Tagsüber kann ich nicht denken, weil ich Schlaf denke. Abgründe, die bedrohlich sind, weil man in sie nicht stürzen kann, die körperlich spürbar vor Augen stehen. Der Vollzug des Sturzes wird immer wieder aufgeschoben: ein Standbild, das nicht laufen lernen will. Die »Gewalt (…) der Beredsamkeit«[2] reißt die Abgründe selbst in den Abgrund. Dazu braucht es einen Zwang, eine Mechanik. Permanente Neubildung von Text ist selbst ein rhetorischer Zwang.
Oder warum genügt nicht ein Text für immer, ein einziger Text für alles?
Dieser Text müsste ein Gesetz sein. Kafkas Text Vor dem Gesetz lässt rhetorisch geschickt die Frage offen, was denn dieses Gesetz sei. Wer oder was hindert mich daran zu sagen: Das Gesetz ist die Sprache, die nach Nietzsche Rhetorik ist. Oder das Gesetz ist die Interpretation bzw. der unendliche Prozess der Interpretation, auch der Selbstinterpretation. »Da das Tor zum Gesetz offensteht wie immer und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehn«, heißt es in Kafkas Text.[3] Wie das Tor zum Gesetz steht auch das Tor zur Sprache offen wie immer, über dessen Schwelle man aber genauso wenig eintreten kann in die Sprache wie der Mann über die Schwelle des Tors in das Gesetz. Auch wir lagern immer nur vor der Sprache. Einlass erlangen wir vielleicht nicht einmal in den Tod. Wo sollte er sein? In uns. Der Türhüter ist auch in uns. Kant meinte, das moralische Gesetz sei in uns, der Begriff der Pflicht fordere »an der Handlung, objektiv Übereinstimmung mit dem Gesetze, an der Maxime derselben aber, subjektiv, Achtung fürs Gesetz, als die alleinige Bestimmungsart des Willens durch dasselbe«.[4] Vor dem Gesetz vollzieht sich das Gesetz performativ. Der Text ist das Gesetz. Das Gesetz ist, dass es nicht betreten werden kann. So verstanden, kann Vor dem Gesetz nicht interpretiert werden. Wie das Gesetz ist auch die Sprache kein Ort. Ortlos hat die Sprache aber Topoi als basale Erkenntnisquellen. Mit der Sprache kommt man über die Sprache nicht hinaus.
Doch: Auf die Sprache ist Verlass, während oder wenn ich schon verlassen bin. Die »prinzipielle Diskrepanz von Zeichen und Bezeichnetem«, die laut Bernd Scheffer »auch eine neue Schrift und ein neues Alphabet niemals (…) überbrücken«[5] können, ist jedweder sprachlichen Operation vorgängig und kann nur durch die Setzung negiert werden, dass etwas, ein Zeichen, auf kein Bezeichnetes weise. Wir sind diese Diskrepanz, indem wir sprechend und schreibend zwischen Zeichen und Bezeichnetem oszillieren »wie immer«. Wir sitzen oszillierend fest. In diesem Festsitzen ist auf die Sprache Verlass. Sprache über kontextuelle Verwendungszusammenhänge tanzen zu lassen, ihre Kleider neu zu kombinieren, so wie dies Franz Mon unternimmt, über dessen Wörter voller Worte in der Abteilung dispositio zu sprechen sein wird, zeugt von einem freien Geist. Und was dieser freie Geist zu leisten vermag, sagt Heinrich F. Plett in einem großartigen Satz: »Die rhetorische Energie trägt entscheidend dazu bei, den Sündenfall rückgängig zu machen.«[6]
Dass »in der Operationsweise, in der Struktur der Sprache und der Rhetorik selbst eine der bevorzugten Quellen der ars inveniendi sprudelt«,[7] wie Stefan Rieger dies formuliert, zeigt mein Text Das muss von etwas handeln aus dem Band Muttersterben:
Das muss eine Handlung sein. Da passiert was. Das ist selbstverständlich. Da läuft was ab. Da läuft etwas immer weiter hinterher. Bis es vor sich selber steht. Das muss dann aber schon schnell gelaufen sein. Also das geschehen dieser geschichte ist ein akt von vorgang ablauf oder abfolge mit aktion im handstreich und geschehen voller historie ein unternehmen so ganz mit entfaltung entwicklung oder vergangenheit wie es so schön heißt. Mit anderen worten ein bravourstück komplett mit eingriff und feldzug. Der gang der handlung ist somit voller vorleben oder vorwelt oder vorzeit ein lebenslauf sozusagen voller sitte überlieferung herkommen und weiterführung. Eine gewohnheit mit kampagne und machenschaften gewissermaßen. Streng genommen auch eine geschichte mit füllung eingeweide und inneres. Ursprünglich sicherlich eine ladung mit verpacktem nämlich füllsel ware substanz. Eigentlich auch eine sache mit vorgang ablauf und folge schritt und trott und fluss. Mit anderem namen eine angelegenheit der umtriebe und fortentwicklung, ein entwicklungsgang mit werdegang, eine operation mit tätigkeit und handstreich, ein geschehen quasi mit handlungsgerüst und inhalt, an und für sich also ein ereignis mit kern und gehalt, so gut wie ein prozess mit fortgang lauf und fabel, schließlich gleichsam ein verlauf mit maßnahme und tat, oder sagen wir ungefähr eine weitergabe mit brauch und erbe, ursprünglich ein fall mit gestern und hergang, demnach eine aktivität des früheren und gewesenen, könnte aber auch sein ein überfall angriff anschlag eine attacke offensive überrumpelung ein raubzug gewaltstreich einfall und vorstoß quasi, oder doch vielmehr ein attentat raubzug einbruch eine aggression und invasion ein anschlag ausfall einmarsch, vielleicht wohl eher ein komplott ansturm ausfall beziehungsweise eine offensive invasion und ränke, will heißen aktion kaprize erleuchtung, das heißt einmarsch alias flausen und funke und plan respektive überfall und hinterhalt, anderenfalls laune mucke grille will sagen gedanke nämlich sondern plünderung ansonsten beutezug und gegenangriff und eingebung und kapriole und handstreich wie gesagt dagegen lieber anders gesagt je nachdem auch besser gesagt je nachdem sonst außerdem ferner tradition. Das ist es.[8]
Der Sprache entlang schreiben
Das ist es. Der Sprache entlang schreiben. Der Sprache folgen. Ihr vertrauen, dass sie in die Realität einfädeln kann. Ihr vertrauen, dass sie Realität ist. Den Thesaurus anwerfen. Fächer aufmachen. Durch ein Labyrinth gehen. Im Dschungel sein. Die sich öffnenden Wege halten Seitenpfade verborgen, die sich erst zeigen, wenn es zu spät ist umzukehren. Ein Wort gibt das andere:
Das andere Wort gibt ein
Wort dir eben, das ein Tag
in andere Worte gibt, das
wieder Rabenditos nagt:
bis Tod nirwana-geerdet,
geistert dir da Wonne ab!
Ein Wort anders gibt »ade«,
das dortige wabert »nein«.
Das da beginnt wie roter
TagNeid. Andres Beiwort:
Dein erdenwortig »basta!«
GastDiebe, in RandWorte
abgeirrt wie StandOden,
nisten Worte dir da Gabe,
gaben Worte dir da Stein,
da, wo dein Nest abgeirrt.
Da ist bar ein DegenWort
dein Wort: Ein GastBarde.
Ein Wort gibt das andere: ein Anagramm.[1] Das Degenwort: Rhetorica. Das andere Wort: Tod. Wo liegt »da«? Es liegt im Alphabet, genauer in der Teilmenge des Alphabets, die von der zu anagrammierenden Ausgangszeile – »Ein Wort gibt das andere« – repräsentiert wird: abdeginorstw.
Das Wort Handlung gibt das Wort Geschehen. Das Wort Geschehen gibt das Wort Akt. Das Wort Akt gibt das Wort Vorgang und dieses das Wort Ablauf und dieses das Wort Abfolge und dieses das Wort Aktion und dieses das Wort Handstreich und dieses wieder das Wort Geschehen und dieses das Wort Historie, und Entfaltung gibt Entwicklung.
Was aber entwickelt sich? Es entwickelt sich eine Entfaltung. Es entfaltet sich das Spiel der Sprache. Dieses Spiel ist vorgeordnet und schafft Ordnung über sprachimmanente Textorganisationsprinzipien. Das vorgeordnete Spiel, in das der Sprechende und Schreibende eintritt, gewährleistet über die Ordnung schaffende »Erzeugungsmatrix«[2] der Sprache, dass das Spiel nicht arbiträr, die freie Wahl des Subjekts also eine in definierten und eben nicht kontingenten Grenzen ist. Imagination erscheint demgegenüber als ein unendliches und sich stets wandelndes, metamorphosierendes Dispositiv, das jedwede Gestaltung erfahren und jedwede Gestalt annehmen kann. Dem Imaginären gegenüber als »eine von den Restriktionen und Regeln der topisch beschränkten Außenrealität entfesselte Freistätte subjektiver rhetorischer Imagination«[3] erscheint das Gestaltungspotential von Sprache als defizitär. Gleichwohl neigt Peter L. Oesterreich zufolge das Ich »auch noch auf dem forum internum dazu, sich schematisch in den topischen Vorgaben und Rollenschemata seines äußerlich vorgegebenen Weltbildes zu bewegen«. So ließen sich »auch im rhetorischen Innenraum des Menschen zunächst mehr oder weniger schematische Reproduktionen eines stereotypischen Massenstils vorfinden«. Die genetische Introversion durch peristatische Umbesetzung gebe zwar »eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung zur Erzeugung eines authentischen Selbst ab«. Dazu bedürfe es ferner der »zweiten Operation: einer mehr oder weniger weitreichenden Enttopisierung des Weltinnenraumes«.[4]
Mit Erich Kleinschmidt ist aber festzuhalten, dass die »Entbindung des Imaginären (…) genuin an Ausdrucksmedien gebunden« ist, »deren wesentlichstes, weil allgemein nutzbares (…), die Sprache ist«. Die Beschränkung, die Sprache allein durch ihre Materialisation erleidet, die etwas festlegt, wenn auch vielfach anschlussfähig, und etwas anderes ausschließt, wird aufgewogen durch ihre wahrnehmbare Anwesenheit. Diese erlaubt es medial, mit imaginativen Komplexen als den aufkommenden Emanationen des Imaginären zu interagieren: »Imagination und Sprache bilden eine konstitutive Wechselbeziehung.«[5] Mit den Worten von Wolfgang Iser: »Das Imaginäre ist kein sich selbst aktivierendes Potential, sondern bedarf der Mobilisierung von außerhalb.«[6] Das Imaginäre muss intentional aufgeladen werden. Wenn Iser feststellt, das Fiktionale lasse sich »nicht als Bestimmung von Spiel verstehen, sondern« funktioniere »als Instanz, Imaginäres über seinen pragmatischen Gebrauch hinaus erfahrbar zu machen, ohne von dessen ›Entfesselung‹ überschwemmt zu werden, wie etwa im Traum oder in Halluzinationen«,[7] so ließe sich am Beispiel von Antonin Artaud, François Dufrêne oder Carlfriedrich Claus aufzeigen, dass gerade dies der Traum der Literatur sein kann, sich der Überschwemmung des entfesselten Imaginären hinzugeben und sich so als Medium zu begreifen. Inwieweit hier eine regulative Kontrolle des Kontrollverlustes greift, die Schwelle zwischen Fiktionalisierung, entgrenzter Autobiographie und dem Imaginären nur in Richtung der Psychopathologisierung überschritten werden kann, und dann vielleicht irreversibel, müsste an anderem Ort diskutiert werden.
Auch wenn das Subjekt nicht frei ›schalten und walten‹ kann, wie es sich das nur zu gerne imaginiert, insbesondere im Akt des Schreibens – es fühlt sich durch das Auffinden scharfsinniger Kombinationen nicht zu Unrecht belohnt, als hätte es diese allererst hervorgebracht. Das Erfinden fungiert ganz im rhetorischen Sinne des griechischen heuresis als Auffinden von Vorhandenem, das aus seiner Latenz an die Rede- bzw. Textoberfläche geholt wird.
Das muss von etwas handeln fungiert als Selektionsmodell bereitgestellter Wortpfade. Das zunächst in einen assertorischen Satzrahmen gefasste Ausgangswort »handeln« – Das muss von etwas handeln – wird als performative Äußerung, als illokutionärer Akt verstanden, der anschließend realisiert wird. Die Realisierung verbleibt ganz auf der Ebene von Synonymbildungen, wobei jedes neu eingeführte Synonym als Nukleus einer erneuten Synonymisierung dient. Jedes neu eingeführte Wort dient somit als Topos, als Ort innerhalb einer sich allmählich verfertigenden topographischen inventio. Von der Ausgangsgestalt »handeln« führt der Weg über Umwege auf unwegsames Gelände. Von »handstreich« über »sitte« und wieder zurück bis zu »invasion« und wieder zurück zu »handstreich« ist es da nicht weit. Und was sich mit »handstreich« als dem Bewegen der Seiten eines Wörterbuches deuten ließe, gibt sich, obwohl mit »plan«, schnell schon hinterhältig als bloße »laune« zu erkennen, die nichts im Sinn hat als eine »plünderung«, nämlich des Wörterbuches, das selbst noch diesen »beutezug« eingibt. Das muss von etwas handeln ist eine Selbstentnahme der Sprache, neukonfiguriert zu einer repräsentativen Textinsel. In der Drift des Synonymen etabliert die Sprache eine Ordnung, die über referentielle Abgründe, gewissermaßen ohne ein Wort zu verlieren, hinweggleitet und jeden Ort als Ursprung driftender Bewegung installieren kann. »Tradition« wird in diesem Kontext wörtlich gelesen als Hinübergeben über Orte und Zeiten.
Was muss von etwas handeln? Es bleibt ungesagt. Das Verborgene ist Tradition, Auslieferung ist Tradition. Tradition, eine Kriegstechnik. Überfall und Auslöschung. Die rhetorische Ikonographie kennt zahlreiche Darstellungen einer kriegerisch gerüsteten Rhetorica. Hier trägt die Sprache die Insignien der Kriegsrhetorik, die so handelt, als sei der Krieg ganz von selbst der Vater aller Dinge – und Wörter. Das redet Das muss von etwas handeln uns ein. Und wir bezeugen das.
Exemplum Samuel Beckett: Das letzte Band
wenn zum beispiel nur einer in einem Raum ist heißt ein Hörspiel von Franz Mon aus dem Jahr 1982. In Samuel Becketts Theaterstück Das letzte Band ist nur Krapp in einem Raum. Er ist sein eigener und sein einziger Zeuge. Er bezeugt sich selbst immer wieder im Spiegel eines Tonbandgerätes.
Ein Aufnahmemedium kann zu Selbstgesprächen verführen. Dient die Aufnahme dem oder der Sprechenden zunächst dazu, mit lauter Stimme autobiographisches Erleben zu dokumentieren, kann sich der Akt des Sprechens insbesondere dann, wenn das Erlebte als Sagbares erschöpft ist, als ein Sprechen überhaupt verselbständigen. Dieses Weitersprechen ist schnell vom Verstummen bedroht, denn der Zugriff auf einen selbst wieder imaginären, kreativ aufzufüllenden ›Vorrat‹ an Vorstellungen, die nicht wahrnehmungsinduziert, wohl aber mit sinnlichen Perzeptionen und Erinnerungen verknüpft sind, erweist sich als ein beschränkter, vermag der oder die Sprechende nämlich phantasmatische Wirklichkeitsentgrenzungen im Medium versprachlichter Bildfigurationen nicht beliebig abzurufen. Ein Aufnahmemedium wie das Tonband erlaubt, die Unterbrechungen der Erzählzeit mittels Unterbrechung der Aufnahme zu löschen und so die Spuren der allmählichen Verfertigung der imaginär überformten Erinnerung zu beseitigen. Das Tonband trägt so zur Selbsterfindung des Menschen bei, die Peter L. Oesterreich (mit René Descartes als philosophischer Kronzeuge und seinen Meditationen als neuzeitliches Paradigma) als »das zentrale anthropologische Projekt der Neuzeit« bezeichnet hat: »Als homo inveniens wird der Mensch zum Erfinder nicht nur seiner äußeren Kulturwelt, sondern auch seines eigenen, inneren Selbst.«[1] Dieser Prozess der Selbsterfindung des Menschen konfiguriert sich je nach zivilisatorischem Status quo anders.
An Krapp’s Last Tape von Samuel Beckett lässt sich beobachten, wie jemand über sich selbst zu Gericht sitzt im »steten Wechsel von Selbstschöpfung und Selbstvernichtung«[2], wie es bei Friedrich Schlegel heißt. Die »Selbstvernichtung« zeigt sich in Krapps Urteilen über sein früheres, stimmlich konserviertes Selbst dadurch, dass die Erfindung des eigenen Selbst als »Prozeß rhetorischer Autopoiesis«[3] von Ich-Dissoziationen bedroht ist: Das erinnernde Subjekt weist das mittels Tonbandaufnahme sich selbst sprechende und sich vorgängig erinnernde Subjekt, das selbst wieder erinnert wird, als nichtidentisch von sich. Vornübergebeugt, wie über ein Gewässer oder einen Spiegel, erlebt es im Anhören der eigenen Stimme eine narzisstische Kränkung, Alter und Ego finden nicht mehr zum Alter Ego zusammen. Gleichwohl bringt der 30 Jahre jüngere[4] andere Krapp den sich an seine Erinnerungen erinnernden und dabei oftmals scheiternden älteren Krapp zum Sprechen, zunächst in Form von Kommentaren zu dem Abgehörten, schließlich indem Krapp ein neues Band, Das letzte Band, bespricht. Dieser rhetorische Prozess der Selbsterfindung ist indes eine Wiederholung, hat doch schon der jüngere Krapp über sich zu Gericht gesessen, indem er seiner Meinung nach zehn bis zwölf Jahre alte Aufnahmen von sich anhörte, was er auf dem vom älteren Krapp abgehörten Band kundtut – eine metadiegetische Einlassung, die man als Matrjoschkaprinzip der Erinnerung bezeichnen könnte.[5] Der ältere Krapp ist somit sein eigenes Medium, erinnert er sich doch an seine Jugend und früheren Lieben mittels seiner vorgängigen Erinnerungen, an die er sich oftmals nicht mehr erinnern kann. Stutziges Nichterinnern oder Nicht-wahrhaben-Wollen lässt ihn das Tonband vorspulen oder abschalten, um nachzugrübeln, assoziativ abzudriften oder das Gehörte zum Teil zynisch zu kommentieren. Einig ist er sich mit dem jüngeren Krapp, der die Überwindung der Jugend feiert, darin, dass es zum Glück zu Ende geht. Die »rhetorische Genese« des »inneren Ich oder Selbst«[6] vollzieht sich bei Krapp als krisenhaftes Selbstgespräch, das er anscheinend nur mit Hilfe von Alkohol durchzustehen vermag: »Krapp (…) gets up, goes backstage into darkness. Ten seconds. Pop of cork. Ten seconds. Second cork. Ten seconds. Third cork. Ten seconds. Brief burst of quavering song.«[7]
Auch der Sprachgebrauch der beiden Krapps ist divergent. Dies zeigt sich neben dem elaborierteren Stil, den der jüngere Krapp pflegt, insbesondere an dessen Verwendung von Fachvokabular wie zum Beispiel »viduity«, das den älteren Krapp nötigt, ein »enormous dictionary«[8] zu konsultieren. Hierbei delektiert er sich insbesondere am Klang der nachgeschlagenen Begriffe und prüft auch schon mal die grammatische Korrektheit der lexikalischen Auskünfte. Überhaupt ist das artikulatorische Auskosten einzelner Wörter wie zum Beispiel »Spooool!«, das ihm ein »happy smile« ins Gesicht zaubert, gegenüber »All that old misery«[9] die einzige Freude, der er sich vorbehaltlos hingibt, sieht man einmal vom Alkohol ab.
Der bei sich und außer sich seiende Krapp hat es vielleicht schon aufgegeben, in sich zu sein. Futurologisch ausgewiesen als »a late evening in the future«, befindet sich Krapp in seiner »Bude« (»Krapp’s den«)[10] als einem locus imaginativus, einem subjektiv imaginativen Ort des Selbstgesprächs und inszeniert ein »gegen die öffentliche Außenwelt abgeschirmtes, eigenständiges und mit ihr konkurrierendes rhetorisches Szenarium«.[11]
Krapps forum externum ist der von seiner jüngeren Stimme besetzte Hallraum der Tonbandaufnahmen, die als Tagebuch oder Brief an sich selbst fungieren. Außenwelt wird über die Tonbandstimme vor das forum internum transportiert und wandelt sich zur Innenwelt. Krapp redet monologisch mit sich selbst, wobei er zwar auf sein abgehörtes Selbst, das ihm doch so fremd ist, reagieren, dieses frühere Selbst aber nicht mehr antworten kann. In der introversiven egologischen Umbesetzung der von Oesterreich angeführten fünf personalen peristatischen Topoi – »erstens die oratorische; zweitens die oppositionelle; drittens die klientelische; viertens die alliierte und fünftens die dezisionäre Redepartei« – agiert Krapp redend »mit sich, gegen sich, vor sich und für sich«.[12]
Selbstgewissheit – und das ist der fundamentale Unterschied zu den Cartesianischen Meditationen – erlangt er hierbei nicht. Sein Denken ist sprachzentriert, nicht mehr geistzentriert wie bei Descartes. Die sinnliche Wahrnehmung der Außenwelt hat sich in die unzuverlässige, beim älteren Krapp gleichwohl Spott produzierende sprachliche Repräsentation der (das Ich einbegreifenden) Außenwelt gewandelt, als gleichzeitiger Akt von inventio und memoria. Die Frage nach dem identitätsstiftenden Sein, das als ein zeitliches, wenn auch jenseits der Sprachgrenze des Todes nicht als ein teleologisches zu begreifen ist, ist für Krapp über das Abhören alter Tonbänder an das Spiegelmoment der Selbstwahrnehmung gebunden. Georges Berkeleys Fundamentalsatz empiristischer Erkenntnistheorie, »esse est percipi« (»Sein ist Wahrgenommenwerden«) erfährt hier eine dissoziative Modifikation: Im Wahrnehmen seiner selbst erscheint das Selbst als ein anderer. Nur so ist vielleicht Existenz für Krapp zu ertragen. Das Reale ist in der sprachlichen Evokation der Erinnerung schließlich immer noch eine Bedrohung, wie seine abwehrenden, ironischen, zynischen, sich unverständig oder unwillig gebärdenden Reaktionen auf erinnerte Erfahrungen zeigen, für die Topoi wie Liebe, Scheitern (auch als Schriftsteller), Tod und Abschied stehen.