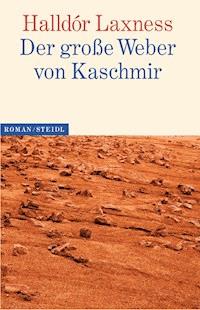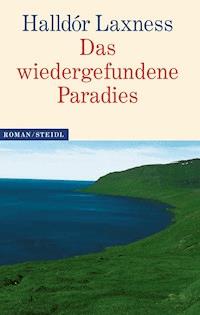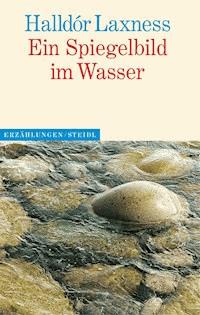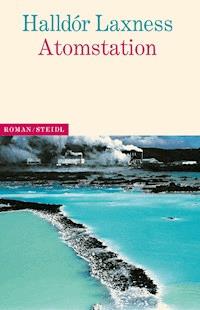
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Mädchen Ugla, vom isländischen Norden nach Reykjavik gekommen, sieht mit Staunen das Luxusleben, die Kälte hinter den schönen Fassaden und die politischen Umtriebe. Nach den heimlichen Besuchen der netten Männer aus Amerika herrscht Unruhe in der Stadt: Soll die Republik etwa zu einer amerikanischen Atomstation gemacht werden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Halldór Laxness Atomstation
Roman
Dieses Buch ist dem Andenken an
Erlendur í Unuhúsi (gestorben am 13.Februar 1947)
Erstes Kapitel
Budubodi
Soll ich diese Suppe hineintragen, sage ich.
Ja, in Jesu Namen, antwortet die schwerhörige Köchin, eine der größten Sünderinnen unserer Zeit; sie hat ein Glanzbild des Erlösers über die Stahlspüle gehängt. Die jüngste Tochter des Ehepaares, ein kleines Mädchen von sechs Jahren, das Thorgunnur heißt und Didi genannt wird, weicht nicht von ihrer Seite, starrt sie gottesfürchtig an, manchmal mit gefalteten Händen, ißt mit ihr draußen in der Küche, schläft bei ihr in der Nacht. Ab und zu blickt das Kind mit mißbilligender Miene, beinahe vorwurfsvollem Blick, mich an, das neue Dienstmädchen.
Ich nahm meinen Mut zusammen und trug die Terrine ins Eßzimmer. Die Familie hatte noch nicht Platz genommen; die ältere Tochter, die vor kurzem konfirmiert worden war, kam herein, ihr Gesicht hatte die schöne Farbe von Sahne, nur ihre Lippen und Nägel waren dunkel geschminkt; mit geschickter Hand ordnete sie ihre dichten, blonden Korkenzieherlocken. Ich sagte guten Abend, und sie sah mich wie aus weiter Ferne an, setzte sich an den Tisch und blätterte weiter in einer Modezeitschrift.
Dann kommt die Frau des Hauses herein, sie bewegt sich rasch, und es geht ein kalter Dufthauch von ihr aus; sie ist nicht gerade dick, sondern mollig, und zufrieden und gepflegt, ihre Armbänder klingeln, sie schaut mich zwar nicht an, sagt aber nun also, meine Liebe, während sie sich setzt, haben Sie schon gelernt, mit dem Elektrobohner umzugehen? Dann zeigt sie auf ihre Tochter, das ist unsere Dudu, und dort kommt der liebe Bobo; außerdem haben wir noch einen Großen, der schon studiert, er ist heute abend in der Stadt, um sich zu amüsieren.
Wie soll sich ein unschuldiges Mädchen aus dem Nordland diese Eingeborenennamen merken können, höre ich da hinter mir; dort steht ein großer, schlanker Mann mit schönem Kopf, leicht angegrauten Schläfen und einer Adlernase, der seine Hornbrille abnimmt und anfängt, sie zu putzen; und obwohl sein Lächeln offen ist, wirkt es gleichzeitig ein wenig müde und abwesend; das ist der Parlamentsabgeordnete für unseren Wahlkreis im Nordland, der Großkaufmann Doktor Bui Arland, bei dem ich angestellt bin.
Als er seine Brille fertiggeputzt und mich genug angesehen hat, reicht er mir die Hand und sagt: Das ist nett von Ihnen, daß Sie den weiten Weg vom Nordland auf sich genommen haben, um uns hier in Reykjavik zu helfen.
Und schon hatte ich Herzklopfen; und schwitzte; und konnte natürlich kein Wort sagen.
Er sagt meinen Namen vor sich hin: Ugla, die Eule, und fährt dann fort: ein gelehrter Vogel; und ihre Zeit ist die Nacht. Aber wie geht es meinem guten alten Falur im Eystridalur mit seinen halbwilden Pferden; und der Kirche? Ich hoffe, daß es uns in der nächsten Sitzungsperiode gelingt, diesem gottlosen Parlament ein bißchen Geld abzupressen, damit die Winde dort im Tal die Messe singen können, wenn erst einmal alles verödet ist. Die halbwilden Pferde müssen allerdings selbst sehen, wie sie auf ihre göttliche Art und Weise zurechtkommen, denn die deutschen Pferdehändler sind bankrott.
Wie froh ich war, daß er weitersprach, damit ich Zeit bekam, mich wieder zu fassen, denn dies war das erste Mal, daß ich ganz weiche Knie bekam, weil ich mit einem Mann sprach. Ich sagte, ich wollte das Harmonium in der Kirche spielen lernen und sei vor allem deshalb nach Reykjavik gekommen: Wir möchten nicht, daß das Tal verödet.
Ich hatte nicht darauf geachtet, daß mich der feiste Lümmel Bobo anstierte, während ich mit seinem Vater sprach und die gnädige Frau die Suppe schöpfte, bis er auf einmal loslachte; er blies die Backen auf, bis sie nicht noch mehr Luft fassen konnten und er herausprustete. Seine Schwester hörte auf, in der englischen Modezeitschrift zu blättern und prustete auch los. In der offenen Küchentür hinter mir steht das Engelsbild und hat die Gottesfurcht verloren und lacht; und sagt zu seiner Kindsmagd, um diese unerwartete Heiterkeit der Familie zu erklären:
Sie will Harmonium spielen lernen!
Die Frau des Hauses lächelte vor sich hin, während sie einen Blick zu ihnen hinüberwarf, und ihr Vater winkte mit der linken Hand in ihre Richtung, schüttelte den Kopf und sah mir ins Gesicht, alles gleichzeitig; aber er sagte nichts; er begann, Suppe zu essen.
Erst als ich mich daran gewöhnt hatte, daß die älteste Tochter sich an den Flügel setzte und, ohne mit der Wimper zu zucken, Chopin vom Blatt spielte, als ob nichts selbstverständlicher sei, wurde mir klar, wie komisch es war, wenn ein großes, dickes Frauenzimmer aus dem Nordland in einem kultivierten Haus verkündete, es wolle Harmonium spielen lernen.
Das sieht euch Nordländern ähnlich, einfach so mit Menschen zu sprechen, sagte die Köchin, als ich wieder hinauskam.
Da regte sich Widerspruch in mir, und ich antwortete: Ich bin auch ein Mensch.
Mein Koffer war schon gebracht worden, ebenso das Harmonium: Letzteres hatte ich an demselben Tag gekauft, für alles Geld, was ich in meinem bisherigen Leben gespart hatte, und das reichte nicht einmal; das Zimmer lag unter dem Dach, zwei Treppen hoch, ich durfte nicht üben, wenn Gäste da waren, im übrigen aber, wann immer ich Zeit hatte. Meine Arbeit bestand darin, das Haus zu putzen, dafür zu sorgen, daß die Kinder rechtzeitig in die Schule kamen, der Köchin zu helfen, zu servieren. Das Haus war weitaus vollkommener als das goldgeränderte Weihnachtskartenhimmelreich, auf das sich eine Frau mit schiefer Nase vertröstet, weil ihr dieses Leben nichts zu bieten hat, es ging nämlich elektrisch, den ganzen Tag wurden Maschinen eingesteckt und betrieben, Feuer gab es nicht, das Wasser der heißen Quellen kam aus der Erde, die glühenden Holzscheite im Kamin waren aus Glas.
Als ich den Hauptgang hineintrug, hatte das Lachen aufgehört, das junge Mädchen hatte angefangen, mit seinem Vater zu sprechen, und nur der kleine Dicke sah mich an. Die gnädige Frau sagte, sie und ihr Mann würden »ausgehen«, was auch immer das bedeutete, und Jona, die Köchin, müßte zu einer Versammlung: Sie hüten das Haus und geben Bubu etwas Warmes, wenn er kommt –
Bu – wie bitte, sagte ich.
Noch ein Eingeborener, sagte der Hausherr; er scheint aus Tanganjika zu stammen, oder aus Kenia; oder aus dem Land, wo sie sich das Haar mit Rattenschwänzen schmücken. Im übrigen heißt der Junge Arngrimur.
Mein Mann ist ein bißchen altmodisch, sagte die Dame des Hauses. Er würde den Jungen am liebsten Grimsi nennen. Doch die heutige Zeit ist schick. Man muß mit der Mode gehen.
Der Hausherr sagte: Sie sind aus dem Nordland, aus diesem unvergeßlichen Tal Eystridalur, die Tochter des Falur mit den halbwilden Pferden, der eine Kirche baut: Können Sie nicht bitte die Kinder für mich umtaufen.
Lieber würde ich mich in hunderttausend Millionen Stücke reißen lassen, als Gunsa genannt zu werden, sagte die älteste Tochter.
Sie heißt nämlich Gudny, sagte ihr Vater. Aber für sie taugt nichts außer dem schwärzesten Afrika: bu-bu, du-du, bo-bo, di-di–
Da sah die gnädige Frau ihren Mann fest an und sagte: Willst du denn wirklich so mit diesem Mädchen sprechen? Und mit einem Blick auf mich: Nehmen Sie die leeren Teller und tragen Sie sie hinaus, meine Beste.
Keine Angst vor ihr
Doch ich hatte keine Angst vor ihr, nicht einmal, als ich die glänzenden Silberschuhe in ihr Schlafzimmer trug; ich, mit meinen in Saudarkrokur gekauften Latschen. Sie saß sehr notdürftig bekleidet vor einem großen Spiegel, einen zweiten Spiegel schräg hinter sich, und summte vor sich hin, während sie ihre Zehennägel lackierte. Sie war dicker, als ich dachte, wenn sie nichts anhatte, aber nirgends schlaff.
Als ich ihre Schuhe hingestellt hatte und wieder hinausgehen wollte, hörte sie auf zu summen, sah im Spiegel vor sich, daß ich hinter ihr stand, und sagte zu mir, ohne sich umzudrehen:
Wie alt sind Sie eigentlich?
Ich sagte es ihr, einundzwanzig Jahre.
Haben Sie gar keine Ausbildung, fragte sie.
Nein, sagte ich.
Und waren Sie noch nie von zu Hause weg?
Ich war ein Jahr auf der Frauenschule im Nordland.
Sie drehte sich auf ihrem Stuhl um und sah mich direkt an. Auf der Frauenschule, sagte sie, was haben Sie dort gelernt?
Ach, eigentlich nichts, sagte ich.
Sie blickte mir ins Gesicht und sagte: Sie sind nicht ganz ohne einen Ausdruck von Bildung. Ein gebildetes Mädchen hat nie einen Ausdruck von Bildung. Ich ertrage keinen Ausdruck von Bildung bei Frauen. Das ist Kommunismus. Schauen Sie mich an, ich habe Abitur, aber das sieht keiner. Mädchen müssen fraulich sein. Darf ich Ihr Haar sehen, meine Liebe.
Ich trat zu ihr hin, und sie untersuchte mein Haar, und ich fragte, ob sie glaubte, ich hätte falsche Haare; oder Läuse.
Sie räusperte sich würdevoll und antwortete, indem sie mich von sich wegschob: Sie sind hier im Haus.
Ich wollte schweigend gehen, doch sie bekam Mitleid mit mir und sagte, um mich zu trösten: Sie haben kräftiges Haar; es ist schmutziggelb und sollte besser gewaschen werden. Ich sagte wahrheitsgemäß, daß ich es vorgestern gewaschen hätte, bevor ich von daheim abfuhr.
Mit Rinderharn, fragte sie.
Schmierseife, sagte ich.
Sie sagte: Sie könnten es besser waschen, meine ich.
Als ich schon halb zur Tür hinaus war, rief sie mich noch einmal und sagte: Was für Ansichten haben Sie?
Ansichten? Ich? Keine.
Soso, meine Liebe, das ist gut, sagte sie. Hoffentlich sind Sie keine von denen, die über Büchern liegen.
Ich habe schon manche Nacht über einem Buch gewacht.
Gott der Allmächtige steh’ Ihnen bei, sagte die gnädige Frau und schaute mich angstvoll an. Was haben Sie denn gelesen?
Alles, sagte ich.
Alles? sagte sie.
Auf dem Land liest man alles, sagte ich; fängt mit den Isländersagas an; und liest dann alles.
Aber doch wohl nicht die Kommunistenzeitung, sagte sie.
Wir lesen die Zeitungen, die wir umsonst bekommen in unserer Gegend, sagte ich.
Passen Sie auf, daß Sie keine Kommunistin werden, sagte die gnädige Frau. Ich habe ein Mädchen aus dem Volk gekannt, das alles las und Kommunistin wurde. Sie landete in einer Zelle.
Ich will Organistin werden, sagte ich.
Ja, Sie kommen aus einem sehr abgelegenen Teil des Landes, sagte die Frau. Gehen Sie jetzt, meine Liebe.
Zweites Kapitel
Dieses Haus – und unsere Erde
Die Köchin sagte, sie habe schon vielen Glaubensgemeinschaften angehört, sei aber jetzt endlich zu einer gestoßen, die das wahre Christentum verkünde. Dieser Glaube wurde von den Schweden finanziert und war in Smaland erfunden worden, war dann über den Atlantik ausgewandert und hieß jetzt nach einer amerikanischen Stadt mit einem langen Namen, den ich nicht behalten kann. Sie wollte mich auf die Versammlung mitnehmen. Sie sagte, sie habe nie volle Vergebung ihrer Sünden bekommen, bevor sie zu dieser smaländisch-amerikanischen Gemeinschaft kam.
Was für Sünden sind das? sagte ich.
Ich war ein wirklich schrecklicher Mensch, sagte sie. Aber Pastor Domselius sagt, in zwei Jahren könne ich hüpfen.
Nach smaländisch-amerikanischem Glauben begannen die Leute nämlich zu hüpfen, wenn sie heilig geworden waren. Und die Sünden lasteten so schwer auf dieser stämmigen Person, daß sie sich nur schwer in die Lüfte erheben konnte. Als ich sagte, ich hätte keine Sünden, sah sie mich voller Mitleid und Entsetzen an, erklärte sich aber dazu bereit, für mich zu beten, und sagte, das würde helfen, denn sie war davon überzeugt, daß der Gott in der smaländisch-amerikanischen Gesellschaft besondere Rücksicht auf sie nahm und das tat, was sie sagte. Man hatte ihr verboten, das kleine Mädchen auf Abendversammlungen mitzunehmen, aber bevor sie ging, jagte sie das arme Kind aus dem Bett und ließ es lange in seinem gepunkteten Nachthemd auf dem Boden knien, die Hände unter dem Kinn falten und fürchterliche Jesuslitaneien vorsagen, wobei es unzählige Verbrechen bekannte und den Erlöser beschwor, sich nicht an ihm zu rächen. Zum Schluß liefen dem Kind die Tränen über die Wangen herab.
Alles Leben floh am frühen Abend aus dem Haus, ich blieb allein zurück in dieser neuen Welt, die an einem einzigen Tag mein früheres Leben zu einer undeutlichen Erinnerung gemacht hatte, fast möchte ich sagen, zu einer Geschichte aus einem alten Buch. Drei Salons, zwei in der gleichen Richtung und der dritte im rechten Winkel dazu, voller Kostbarkeiten. Diese tausend schönen Dinge schienen alle von allein dorthin gelangt zu sein, ohne jegliche Anstrengung, wie Schafe im Frühjahr auf eine nicht eingezäunte Hauswiese strömen. Hier gibt es keinen Stuhl, der so ärmlich wäre, daß man ihn für unsere trächtige Kuh bekäme, unser ganzes Vieh würde nicht ausreichen, wenn alle in dieser Familie einen Sitzplatz haben sollten. Ich bin sicher, der Teppich im großen Salon kostet mehr als unser Hof mit allen Gebäuden. Wir haben ein Möbelstück, den durchgesessenen Diwan, den mein Vater vor ein paar Jahren auf der Versteigerung kaufte, und ein Bild, den Tafelgrimur, wie wir Kinder ihn nannten, Hallgrimur Petursson auf der Kanzel mit seinen Jesustafeln um sich herum; und dann natürlich das Harmonium, meinen Traum, doch das war leider noch nie in Ordnung, solange ich mich erinnern kann, weil wir keinen Ofen in der Stube haben; die halbwilden Pferde sind unser Luxus. Warum haben die, die arbeiten, nie etwas? Oder bin ich Kommunistin, daß ich so frage, das Häßlichste von allem Häßlichen, das einzige, vor dem man sich hüten muß? Ich berühre mit meinem Finger das Instrument in diesem Haus, was für eine Welt der Schönheit in einem Ton, wenn er richtig neben einem anderen Ton steht; wenn es eine Sünde gibt, dann die, nicht Klavier spielen zu können; und dabei habe ich zu der Alten gesagt, ich hätte keine Sünde. Doch die größte Überraschung erlebte ich, als ich das Zimmer des Hausherrn betrat, das gleich neben der Eingangstür lag, überall, vom Fußboden bis zur Decke, nur Bücher, aber was immer ich auch aufschlug, ich konnte nichts davon verstehen; wenn es ein Verbrechen gibt, dann ist es ein Verbrechen, ungebildet zu sein.
Eine Leiche in der Nacht
Schließlich ging ich in mein Zimmer hinauf und spielte auf meinem neuen Harmonium die zwei oder drei Stücke, die ich von daheim kannte, außerdem das Stück, das nur die können, die nichts können: Dabei überkreuzen sich die Hände. Ich fand es abstoßend, wie ungebildet ich war, und holte eine dieser langweiligen Volksbildungsschriften vom Verlag Sprache und Kultur heraus, die einen hoffentlich am Ende zu einem Menschen machen, wenn man sich dazu aufrafft, sie zu lesen. So vergeht der Abend, die Leute kommen allmählich wieder nach Hause, zuerst kommt die Köchin von dem amerikanisch-smaländischen Sündenvergebungsakt, dann die mittleren Kinder, jedes für sich, schließlich das Ehepaar, bald ist alles still; doch der, auf den ich mit warmem Essen im Backofen warte, kommt nicht; die Uhr ist drei, und ich wandere durch das Haus, um mich wachzuhalten, schlafe aber schließlich in einem der tiefen Sessel ein. Gegen vier Uhr klingelt es an der Haustür, und ich gehe mit schlaftrunkenen Augen hin und mache auf. Draußen stehen zwei Polizisten, die einen waagrechten Menschen zwischen sich halten. Sie grüßten förmlich mit guten Abend, fragten, ob ich hier wohnte und ob sie rasch eben eine kleine Leiche in die Diele schaffen dürften.
Das kommt ganz darauf an, sagte ich. Wessen Leiche ist das?
Sie sagten, das würde sich früh genug herausstellen, warfen die Leiche auf den Fußboden, legten die Hand an die Mütze und wünschten genauso förmlich gute Nacht, wie sie gegrüßt hatten; ihr Auto setzte sich in Bewegung, sie waren weg, und ich schloß die Tür.
Drittes Kapitel
Das Haus hinter den Häusern
Hinter den größten Häusern in der Stadtmitte steht ein kleines Haus, das man von keiner Straße aus sehen kann; keinem würde einfallen, daß es existiert. Wer es nicht kennt, würde sich nicht davon abbringen lassen, ja, würde sogar schwören, daß dort kein Haus ist. Aber es steht dennoch dort, ein geriffeltes Holzhaus, nur ein Stockwerk mit Satteldach, schon fast am Zusammenbrechen vor Alter, ein Überbleibsel des alten Handelspostens Reikevig. Engelwurz und Eisenhut, Rainfarn und Ampfer breiten sich nach Belieben auf dem Grundstück aus, an manchen Stellen ahnt man gerade noch den verfallenen Lattenzaun, der keine Schafe mehr abhalten würde, zwischen diesem hoch aufgeschossenen Unkraut, das grün und saftig ist, obwohl wir schon längst Herbst haben. Ich hätte nie gedacht, daß ich dieses Haus finden würde, aber schließlich fand ich es.
Zuerst schien es, als sei kein Lebenszeichen an dem Haus zu entdecken, doch schaute man genauer hin, sah man an einem Fenster einen schwachen Lichtstreif. Ich suchte den Eingang, das Haus stand nämlich schräg versetzt zu den übrigen Häusern, und endlich fand ich die Haustür, sie war an der Rückseite, der Brandmauer eines großen Gebäudes gegenüber, wahrscheinlich war die Straße damals, als das Haus gebaut wurde, auf dieser Seite verlaufen. Ich öffnete die Tür und kam in einen dunklen Gang. An einer Stelle drang ein Lichtstrahl durch eine Ritze zwischen Tür und Pfosten, dort klopfte ich. Einen Augenblick später ging die Tür auf, und in der Öffnung steht ein schlanker Mann, dessen Alter sich kaum bestimmen läßt, es sei denn daran, daß jedes zweite Haar schon anfängt, grau zu werden, und mir kam es irgendwie so vor, als würde er mich kennen, als er mich mit diesen klaren, ausdrucksvollen Augen ansah, die liebenswürdig und zugleich spöttisch unter dichten Augenbrauen hervorblickten. Ich zog meinen Fäustling aus und begrüßte ihn, und er bat mich, hereinzukommen.
Ist es hier? fragte ich.
Ja, hier ist es, sagte er und lachte, als machte er sich lustig über mich oder vielmehr über sich selbst, aber durchaus freundlich. Ich zögerte hineinzugehen und zitierte in fragendem Ton die Worte aus der Zeitungsanzeige:
»Anfangsgründe des Orgelspieles nach zehn Uhr abends«?
Das Orgelspiel, sagte er und sah mich noch immer lächelnd an. Das Orgelspiel des Lebens.
In seinem Zimmer brannte ein Kohlefeuer im Ofen, er benützte nicht die Fernheizung der Stadt. Das einzige Inventar waren eine Menge grüner Pflanzen, von denen manche Blüten trugen, und ein armseliges Sofa mit drei Beinen und zerschlissenem Bezug; ein kleines Harmonium in einer Ecke. Die Tür zu einem zweiten Zimmer stand halb offen, und von dort drangen Parfümdüfte heraus; die zur Küche war ganz offen, dort stand ein Tisch mit ein paar lehnenlosen Stühlen und Hockern; und das Wasser im Kessel kochte. Die Luft war ein wenig dumpf von den Blumen, und der Ofen schien zu rauchen. An einer Wand hing das farbig gedruckte Bild einer Kreatur, die ein Mädchen hätte sein können, wenn sie nicht bis auf die Schultern herab gespalten gewesen wäre; sie war völlig kahlköpfig, mit geschlossenen Augen und ihrem eigenen Profil in der einen Gesichtshälfte, und küßte sich selbst auf den Mund; sie hatte elf Finger. Ich starrte fasziniert auf das Bild.
Sind Sie ein Bauernmädchen, fragte er.
Ja, sicher, sagte ich.
Wozu wollen Sie Harmonium spielen lernen?
Ich sagte zuerst, daß ich immer Musik im Radio gehört hätte, doch als ich mir die Sache genauer überlegte, fand ich die Antwort zu allgemein, deshalb korrigierte ich mich und fügte hinzu: Ich will in unserer Kirche daheim im Nordland spielen, wenn sie fertig ist.
Darf ich Ihre Hand sehen, sagte er, und ich erlaubte es ihm, und er betrachtete meine Hand und sagte: Sie haben eine hübsche Hand, aber sie ist zu groß für die Musik – er selbst hatte eine schmale Hand mit langen Fingern, die sich weich anfühlte, aber irgendwie ganz unbeteiligt und ohne Strom, so daß ich nicht einmal rot wurde, als er meine Finger betastete; aber es war mir auch nicht unangenehm.
Mit Verlaub, welcher Glaube soll in dieser Kirche bei Ihnen daheim im Nordland verkündet werden, fragte er.
Oh, ich denke, eigentlich gar kein besonders interessanter Glaube, sagte ich, es wird wohl dieser gewöhnliche alte lutherische Glaube sein.
Ich weiß nicht, was interessanter sein sollte, als ein Mädchen zu treffen, das dem lutherischen Glauben anhängt, sagte er. Das ist mir noch nie passiert. Bitte, nehmen Sie Platz.
Luther, sagte ich zögernd, während ich mich hinsetzte. Ist das nicht der unsere?
Ich weiß nicht, sagte der Mann. Ich habe nur einen Menschen gekannt, der Luther las, das war ein Psychologe, der ein wissenschaftliches Werk über das Obszöne schrieb. Luther gilt nämlich als der obszönste Verfasser der Weltliteratur. Als vor einigen Jahren ein Traktat von ihm über den armen Papst übersetzt wurde, konnte es aus Anstandsgründen nirgends gedruckt werden. Darf ich Ihnen Kaffee anbieten?
Ich nahm dankend an, sagte allerdings, das sei nicht nötig, und fügte hinzu, vielleicht ließe ich es sein, für den Schlingel Luther zu spielen, wenn er ein so unanständiger Mensch gewesen sei, und würde mich dazu entschließen, für mich selber zu spielen, aber das Bild dort, sagte ich, denn ich mußte es immer wieder ansehen: was soll das sein?
Finden Sie es nicht wundervoll? sagte er.
Ich finde, so etwas könnte ich auch selbst machen – wenn. Mit Verlaub, soll das ein Mensch sein?
Er antwortete, einige sagen, es sei Skarphedinn, nachdem man ihm mit der Axt Rimmugygur den Kopf bis auf die Schultern herab gespalten hatte; andere sagen, es sei die Geburt der Kleopatra.
Ich sagte, Skarphedinn könne es wohl kaum sein, denn der starb bekanntlich mit der Axt neben sich bei dem Mordbrand an Njall. Aber wer ist Kleopatra? Ist das nicht die Königin, die Julius Cäsar heiratete, kurz bevor er ermordet wurde?
Nein, das ist die andere Kleopatra, sagte der Organist, die, mit der sich Nabeljon bei Waterloo traf. Als er sah, daß die Schlacht verloren war, sagte er »merde«, zog seine weißen Handschuhe an und traf sich in einem Haus dort in der Nähe mit einer Frau.
Durch die halboffene Tür, aus dem inneren Zimmer, hörte man eine Frauenstimme folgende Worte sagen: Er sagt nie die Wahrheit. Und heraus stolzierte eine große, schöne Frau, stark geschminkt, in Seidenstrümpfen, mit Belladonna in den Augen, roten Schuhen und einem so ausladenden Hut, daß sie sich schräg durch die Türöffnung schieben mußte. Auf dem Weg nach draußen küßte sie den Organisten zum Abschied aufs Ohr und sagte zu mir, wie um zu erklären, weshalb er nie die Wahrheit sagte: Er steht nämlich über Gott und den Menschen. Und ich gehe jetzt zum Ami.
Der Organist zog ein weißes Taschentuch heraus, wischte sich lächelnd die rote Feuchtigkeit vom Ohr und sagte: Das war sie.
Zuerst dachte ich, sie wäre seine Frau oder zumindest seine Braut, doch als er »das war sie« sagte, wußte ich nicht genau, was er meinte, denn wir hatten gerade über die Frau gesprochen, die Nabeljon besuchte, als er sah, daß die Schlacht verloren war.
Aber während ich darüber nachdachte, kam noch eine zweite Frau durch dieselbe Tür, durch die die erste gekommen war, diese zweite war uralt und hinkte, sie trug ein schmuddeliges Flanellnachthemd, ihr graues Haar war zu zwei dünnen Zöpfen geflochten, und sie hatte keinen einzigen Zahn mehr. Sie brachte eine Käserinde und einen Teelöffel auf einem geblümten Dessertteller, legte mir diesen Leckerbissen in den Schoß und nannte mich meine Liebe, sagte, ich solle zugreifen, erkundigte sich nach dem Wetter. Und als sie sah, daß ich mit der Käserinde und dem Teelöffel meine Schwierigkeiten hatte, tätschelte sie mich voller Mitleid mit dem Handrücken auf beide Wangen, sah mich unter Tränen an und sagte: Mein armes Mädchen. Diese Worte des Mitleids wiederholte sie immer wieder.
Der Organist ging zu ihr hin, küßte sie und führte sie mit inniger Zärtlichkeit in ihr Zimmer zurück, nahm mir dann den Dessertteller samt Käserinde und Teelöffel ab und sagte:
Ich bin ihr Kind.
Zwei Götter
Er breitete ein Tuch über den Tisch in der Küche und stellte ein paar Tassen mit Untertassen darauf, die meisten paßten nicht zusammen, dann brachte er einige altbackene, verhutzelte Blätterteigstückchen, die in Streifen geschnitten waren, ein paar zerbrochene Zwiebäcke und Zucker, aber keine Sahne; ich merkte es am Duft, daß er nicht am Kaffee sparte. Er sagte, ich solle die einzige Tasse, zu der es eine passende Untertasse gab, nehmen. Ich fragte, ob er Gäste erwarte, da er den Tisch für so viele deckte, aber er sagte nein, nur zwei Götter hätten versprochen, sich um Mitternacht bemerkbar zu machen. Wir fingen an, Kaffee zu trinken. Wie eine gastfreundliche Frau auf dem Land bot er mir immer wieder das armselige Gebäck an und lachte über mich, als ich ihm den Gefallen tat, davon zu probieren.
Wie sehr wollte ich diesen Mann näher kennenlernen, mich lange mit ihm unterhalten, ihn über viele Dinge aus dieser Welt und aus anderen Welten befragen; ganz besonders aber über ihn selbst, wer er war und warum er so war, wie er war; aber ich wußte nicht, was ich sagen sollte. Da knüpfte er wieder an unser früheres Gesprächsthema an: Wie gesagt, ich habe tagsüber keine Zeit, aber spät abends oder früh morgens sind Sie willkommen.
Ich fragte, mit Verlaub, welcher Tätigkeit gehen Sie tagsüber nach?
Er sagte: Ich träume.
Den ganzen Tag, fragte ich.
Ich stehe spät auf, sagte er. Wollen Sie eine Grammophonplatte hören?
Er ging in das innere Zimmer, und ich hörte, wie er das Grammophon aufzog, die Nadel wurde auf die Platte gesetzt, und dann begann die Musik. Zuerst dachte ich, das Grammophon sei nicht in Ordnung, denn man hörte nur ein Krachen und Plumpsen, Klappern und Rasseln, doch als der Organist wieder zu mir herauskam, mit treuherziger Miene und stolz, als ob er selbst das Stück komponiert hätte, glaubte ich zu wissen, daß alles so war, wie es sein sollte; trotzdem kam ich ins Schwitzen: immer wieder die verschiedensten schrillen Laute, die aus dem Brummen aufstiegen, und ich verstand plötzlich, wie einem Hund zumute ist, der hört, wie auf einer Mundharmonika geblasen wird, und anfängt zu jaulen: Ich hätte am liebsten schreien wollen; und ich hätte zumindest laut gestöhnt und das Gesicht verzogen, wenn der Organist mir nicht andächtig still und strahlend am Tisch gegenübergesessen hätte. Nun also, fragte er, als er das Grammophon abgeschaltet hatte.
Ich sagte, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Fanden Sie nicht, Sie hätten das auch selbst machen können, fragte er.
Doch, das kann ich nicht leugnen – wenn ich ein paar Blechdosen gehabt hätte und ungefähr zwei Kochtopfdeckel; und eine Katze.
Er sagte lächelnd: Es ist ein Merkmal großer Kunst, daß der, der nichts kann, glaubt, er könnte das selber machen – wenn er dumm genug wäre.
War das etwa schön? fragte ich. Oder habe ich eine so häßliche Seele?
Unsere Zeit, unser Leben – das ist unsere Schönheit, sagte er. Jetzt hast du den Tanz der Feueranbeter gehört.
Und während er das sagte, wurde die Haustür aufgemacht, und es begann eine lange Reise den Flur entlang, bis ein Kinderwagen ins Zimmer gefahren kommt, geschoben von einem jungen Mann, dem Gott Nummer eins.
Dieser fleischgewordene Geist war groß und wohlproportioniert und auf seine Weise gutaussehend, er trug einen Mantel mit Fischgrätmuster und eine sorgfältig gebundene Fliege, wie sie nur die Leute in der Stadt zustande bringen, die Leute auf dem Land lernen das nie, er war ohne Kopfbedeckung, sein lockiges, in der Mitte gescheiteltes Haar hatte den Glanz und Duft von Brillantine. Er nickte mir zu und starrte mir ins Gesicht, seine Augen hatten etwas Glühendes, Stechendes, und er lächelte mich hämisch an, wie man jemanden anlächelt, den man umbringen will – später; und ließ seine schönen Zähne sehen. Er schob den Kinderwagen in die Mitte des Zimmers und stellte zwischen den Blumen einen flachen, dreieckigen Gegenstand ab, der in Papier eingepackt und mit Bindfaden verschnürt war. Dann kam er zu mir, reichte mir seine feuchtkalte Hand und murmelte etwas, das sich wie Jesus Christus anhörte, und er schien nach Fisch zu riechen; vielleicht hat er Jens Kristinsson gesagt; ich jedenfalls grüßte ihn auch und stand auf, wie es die Frauen auf dem Land tun. Dann schaute ich in den Kinderwagen hinein, und dort schliefen echte Zwillinge.
Das ist der Gott Brillantine, sagte der Organist.
Du lieber Himmel, mit diesen süßen Kindern so spät unterwegs zu sein, sagte ich. Wo ist denn ihre Mama?
Die ist draußen in Keflavik, sagte der Gott. Heute ist Amiball.
Kinder halten viel aus, sagte der Organist. Manche Leute glauben, es schade Kindern, wenn sie ihre Mutter verlieren, aber das ist ein Mißverständnis. Selbst wenn sie ihren Vater verlieren, macht ihnen das nichts aus. Hier ist Kaffee. Mit Verlaub, wo ist der Atomdichter?
Er ist im Cadillac, sagte der Gott.
Und wo ist Zweihunderttausend Kneifzangen, sagte der Organist.
F.F.F., sagte der Gott. New York, thirty-fourth street, twelve fifty.
Keine neuen metaphysischen Entdeckungen, keine großen mystischen Visionen, keine theologischen Offenbarungen? fragte der Organist.
Nicht die Bohne, sagte der Gott. Nur dieser Oli Figur. Er behauptet, er habe Verbindung zum Lieblingssohn der Nation. Der Rotz läuft ihm aus der Nase. Wer ist dieses Mädchen?
Du, der du ein Gott bist, sollst nicht nach Menschen fragen, sagte der Organist. Das ist ungöttlich. Es ist eine Privatangelegenheit, wer man ist. Und eine noch privatere Angelegenheit, wie man heißt. Nie fragte der alte Gott, wer ist dieser Mensch und wie heißt er.
Hat sich Kleopatra von ihrem Tripper erholt, sagte der Gott.
Was heißt erholt, sagte der Organist.
Ich habe sie im Krankenhaus besucht, sagte der Gott. Sie war übel dran.
Ich weiß nicht, was du meinst, sagte der Organist.
Krank, sagte der Gott.
Man kann nicht krank genug werden, sagte der Organist.
Sie schrie, sagte der Gott.
Schmerz und Glück sind zwei Dinge, die sich so ähnlich sind, daß man sie nicht voneinander unterscheiden kann, sagte der Organist. Die größte Lust, die ich kenne, ist es, krank zu sein, vor allem schwer krank.
Da hört man, wie in fanatisch gottesfürchtigem Ton an der Tür gesagt wird: Ich wünschte, ich würde endlich Krebs bekommen.
Der Mann war noch so jung, daß sein Gesicht elfenbeinfarben war und nur schwachen Flaum auf den Wangen hatte, das Jugendbildnis eines ausländischen Genies, Postkarten wie diese hängen auf den Bauernhöfen über dem Harmonium, und man kann sie in Saudarkrokur kaufen, eine Mischung aus Schiller, Schubert und Lord Byron, mit knallroter Krawatte und dreckigen Schuhen. Er blickte mit dem fürchterlich angestrengten Blick eines Schlafwandlers um sich, und jedes Ding, ob tot oder lebendig, hatte für ihn ein entsetzliches Geheimnis. Er reichte mir seine schmale Hand, die so weich war, daß ich glaubte, ich könnte sie zu Brei drücken, und sagte:
Ich bin Benjamin.
Ich sah ihn an.
Ja, ich weiß, sagte er. Aber ich kann nichts dafür: Dieser kleine Bruder, das bin ich; dieses schreckliche Geschlecht, das ist mein Volk; diese Wüste – mein Land.
Sie haben die Heilige Schrift gelesen, sagte der Organist; und der Heilige Geist hat sie beim Lesen nach den Regeln unseres Freundes Luther erleuchtet: Sie haben das Göttliche ohne Vermittlung des Papstes gefunden. Bitte, nimm dir eine Tasse Kaffee, Atomdichter.
Wo ist Kleopatra, sagte der Atomdichter Benjamin.
Reden wir nicht davon, sagte der Organist. Nehmt euch Zucker in den Kaffee.
Ich bete sie an, sagte der Atomdichter.
Und ich muß auch mit ihr sprechen, sagte der Gott Brillantine.
Glaubt ihr denn, sie würde mit zwei Göttern herumtändeln wollen, sagte der Organist. Sie braucht ihre dreißig Männer.