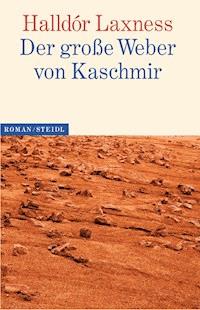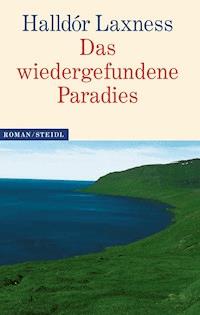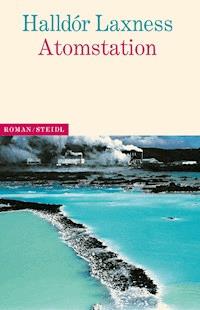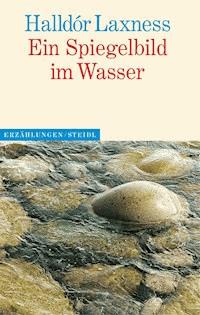Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
AIfgrimurs Leben hätte trauriger kaum beginnen können. Einen Vater gibt es nicht, und die Mutter läßt den Säugling auf der Durchreise nach Amerika an seinem Geburtsort zurück: auf dem Hof des Seehasenfischers Björn. Dort wächst AIfgrimur in einer armseligen, aber vollkommenen Welt auf, zwischen mittellosen Durchreisenden und kauzigen Dauermietern, zwischen den Versen und Chorälen der Ersatzgroßmutter und dem ewigen Ticken der alten Standuhr. Der Junge, der seine Gesangskunst auf dem Friedhof zum besten gibt, fühlt sich von dem Sänger Gardar Holm angezogen. Im Ausland gefeiert, ist Holm, der "singende Fisch", der ganze Stolz Islands. Den Bewunderern im eigenen Land aber verweigert er eine Probe seiner Kunst. Als das Konzert schließlich doch stattfindet, nimmt es einen überraschenden Verlauf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Halldór Laxness Das Fischkonzert
Roman
1. Ein merkwürdiges Tier
Ein kluger Mensch hat gesagt, abgesehen vom Verlust der Mutter sei kaum etwas gesünder für kleine Kinder als der Verlust des Vaters. Und obwohl es mir fernliegt, diesen Worten uneingeschränkt zuzustimmen, wäre ich doch der letzte, der ihnen direkt widersprechen wollte. Ich selber würde diese These ohne Groll auf die Welt formulieren, oder besser gesagt, ohne den Schmerz, der dem Klang dieser Worte innewohnt.
Doch was man auch von dieser Ansicht halten mag, es war nun eben mein Schicksal, ohne Eltern auf dieser Welt dazustehen. Ich möchte nicht behaupten, daß dies ein Glück für mich gewesen sei, das wäre übertrieben. Aber ein Unglück kann ich es auch nicht nennen, zumindest nicht, was mich selbst betrifft; und zwar deshalb, weil ich einen Großvater und eine Großmutter bekam. Dagegen könnte man mit gutem Grund sagen, es sei vor allem ein Unglück für meinen Vater und meine Mutter gewesen, nicht etwa, weil ich ihnen ein vorbildlicher Sohn geworden wäre, ganz im Gegenteil; sondern deshalb, weil Kinder nun einmal für Eltern nützlicher sind als Eltern für Kinder; doch das ist eine andere Sache.
Um eine lange Geschichte kurz zu machen, ist nun davon zu berichten, daß südlich vom Friedhof in unserer zukünftigen Hauptstadt, dort, wo der Hang gegen das Südende des Teiches zu allmählich flach ausläuft, genau an der Stelle, wo Gudmundur Gudmunsen, der Sohn des Jon Gudmundsson im Gudmunsenladen, dann ein stattliches Haus errichtete, daß dort einmal ein kleiner, aus Grassoden gebauter Hof mit zwei Giebeln stand; die beiden Holzgiebel blickten nach Süden zum Teich hin. Dieser kleine Hof hieß Brekkukot. Auf diesem Hof wohnte mein Großvater, der selige Björn von Brekkukot, der manchmal im Frühjahr Seehasen fischte, und bei ihm die Frau, die mir nähergestanden hat als die meisten Frauen, obwohl ich weniger über sie wußte, meine Großmutter. Dieses kleine Erdhaus war eine kostenlose Herberge für jeden, der davon Gebrauch machen wollte. Zu der Zeit, als ich im Entstehen begriffen war, gab es dort in dem kleinen Haus einen großen Andrang von solchen Leuten, die man heutzutage Flüchtlinge nennt; sie fliehen aus dem Land; sie machen sich unter Tränen aus ihrer angestammten Heimat auf, weil es ihnen zu Hause so schlecht geht, daß ihre Kinder nicht erwachsen werden, sondern sterben.
Und eines Tages geschah es, wie ich später erfuhr, daß dort eine junge Frau eintraf, von irgendwoher aus dem Westland; oder aus dem Nordland; oder sogar aus dem Ostland. Diese Frau war wegen ihrer Armut und Verlassenheit auf dem Weg nach Amerika, auf der Flucht vor denen, die in Island herrschten. Man hat mir erzählt, daß die Reise der Frau von den Mormonen bezahlt worden sei, und wie ich aus zuverlässiger Quelle erfahren habe, sollen einige der besten Männer in der Neuen Welt dieser Gemeinschaft angehören. Diese Frau aber, die ich eben erwähnte, macht nicht viel Federlesens, sondern bringt ein Kind zur Welt, während sie sich dort in Brekkukot aufhält und auf das Schiff wartet. Und als die Frau ihr Kind geboren hat, sieht sie den Knaben an und sagt dann:
Dieser Junge soll Alfur heißen.
Ich würde ihn Grimur taufen, sagte da meine Großmutter.
Dann nennen wir ihn Alfgrimur, sagte meine Mutter.
Und das einzige, was mir diese Frau außer Leib und Seele gegeben hat, ist dieser Name: Alfgrimur. Wie alle vaterlosen Leute in Island wurde ich Hansson genannt. Dann ließ die Frau mich nackt, mit diesem sonderbaren Namen, in den Armen des seligen Seehasenfischers Björn von Brekkukot zurück und ging ihrer Wege. Diese Frau kommt nicht mehr in unserer Geschichte vor.
Und nun beginne ich dieses Buch dort, wo unsere alte Uhr daheim in der Stube in Brekkukot steht und tickt. In dieser Uhr war eine silberne Glocke. Ihr Schlag hatte einen hellen Klang, und man konnte ihn nicht nur im ganzen Haus bei uns hören, sondern auch oben auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof aber gab es auch eine Glocke, die war aus Kupfer; und von dieser Glocke tönte ein tiefer Klang herab, bis zu uns ins Haus herein. So konnte man in diesem Erdhaus bei manchem Wetter zwei Glocken gleichzeitig schlagen hören, eine aus Silber, die andere aus Kupfer.
Unsere Uhr hat ein verziertes Zifferblatt, und mitten in den Verzierungen kann man die Worte lesen, daß Herr James Cowan, der im Jahre 1750 in Edinburgh lebte, diese Uhr verfertigt hat. Die Uhr war zweifellos für ein anderes Haus als das in Brekkukot bestimmt gewesen, denn man hatte ihren Sockel entfernen müssen, damit sie in unserer niedrigen Stube stehen konnte. Diese Uhr tickte langsam und würdevoll, und ich ahnte schon früh, daß auf andere Uhren kein Verlaß sei. Die Taschenuhren der Leute kamen mir wie Kleinkinder vor, die noch nicht sprechen können, im Vergleich zu dieser Uhr. Die Sekunden der Uhren anderer Leute waren wie emsige Insekten, die mit sich selber um die Wette rannten, die Sekunden der Standuhr bei meinem Großvater und meiner Großmutter waren wie Kühe und bewegten sich stets so langsam, wie man überhaupt gehen kann, ohne ganz stehenzubleiben.
Es war immer dasselbe, wenn in der Stube laut gesprochen wurde, konnte man die Uhr nicht hören, dann schien sie gar nicht zu existieren; war es aber wieder still und der Besuch gegangen und der Tisch abgeräumt und die Tür geschlossen, dann fing sie wieder an und ließ sich nicht beirren; und wenn man genau genug hinhörte, kam bisweilen ein singender Ton zu dem Ticken dazu; oder ein ganz schwaches Echo.
Wie kam es, daß ich die seltsame Vorstellung hatte, in dieser Uhr wohne ein merkwürdiges Tier, und das sei die Ewigkeit? Eines Tages war mir plötzlich klar, daß das zweisilbige Wort mit der gedehnten zweiten Silbe, das sie beim Ticken sagte, das Wort e-wig, e-wig sei. Kannte ich denn dieses Wort?
Eigenartig, daß ich einfach so die Ewigkeit entdeckte, lange bevor ich wußte, was ewig war, und sogar noch bevor ich den Satz gelernt hatte, daß alle Menschen sterblich seien, ja, während ich selber in Wirklichkeit in der Ewigkeit lebte. Es war, als entdecke ein Fisch plötzlich das Wasser, in dem er schwimmt. Ich sprach darüber mit meinem Großvater, als ich einmal allein mit ihm in der Stube war.
Verstehst du die Uhr, Großvater, sage ich.
Wir hier verstehen uns nur teilweise auf diese Uhr, sagte er. Wir wissen nur, daß sie Tage und Stunden und sogar Sekunden anzeigt. Aber der Bruder des Großvaters deiner Großmutter, dem diese Uhr fünfundsechzig Jahre lang gehörte, er sagte mir, ihr vormaliger Besitzer habe ihm erzählt, sie hätte den Neumond angezeigt, ehe sie einem Uhrmacher in die Hände fiel. Alte Leute in der Familie deiner Großmutter behaupteten, diese Uhr könne Heiraten und Todesfälle ankündigen. Doch das glaube ich nicht so ganz, mein Junge.
Darauf sage ich: Warum sagt die Uhr immer e-wig, e-wig, e-wig.
Da mußt du dich verhört haben, Kind, sagte mein Großvater.
Gibt es denn keine Ewigkeit? fragte ich.
Nur so, wie du es im Abendgebet deiner Großmutter gehört hast und von mir in der Sonntagspostille, mein Junge, antwortete er.
Sag einmal, Großvater, sagte ich da. Ist die Ewigkeit ein Tier?
Gewöhn dir nicht an, Unsinn zu reden, mein Junge, sagte Großvater.
Sag einmal, Großvater, kann man sich denn auf andere Uhren als unsere Uhr verlassen?
2. Gutes Wetter
Wenn ich nicht in der Stube bin und einem merkwürdigen Tier in der Uhr zuhöre, spiele ich oft draußen im Gemüsegarten. Die Grasbüschel zwischen den Steinen auf unserem Hofplatz reichten mir bis zur Taille, und Ampfer und Rainfarn waren so groß wie ich, die Engelwurz noch größer. In diesem Garten wuchs größerer Löwenzahn als anderswo. Wir hatten ein paar Hühner; die legten Eier, die nach Fisch schmeckten. Diese Hühner gackerten, wenn sie frühmorgens neben dem Haus herumpickten; das war ein angenehmer Vogelgesang, und ich schlief dabei schnell wieder ein; und manchmal gackerten sie auch mitten am Tag, wenn sie in ihrem Stall herumstolzierten, und ich verfiel bei diesem Vogelgesang und dem Duft des Rainfarns wieder in Träume. Ich möchte auch nicht versäumen, unseren Schmeißfliegen für ihren Anteil am Zauber des Hochsommers zu danken; sie waren so blau, daß sie im Sonnenlicht grünlich schillerten; und der selige Ton des Erdendaseins, den sie hervorbrachten, wollte nie enden.
Aber ob ich nun im Gemüsegarten, auf dem Hofplatz oder zwischen Haus und Hütte spielte, mein Großvater war immer irgendwo in der Nähe, schweigsam und allwissend. Stets war irgendwo eine Tür offen oder angelehnt, am Hauseingang oder an der Hütte, am Verschlag für die Netze oder am Kuhstall, und er war dort drinnen und pusselte an etwas herum; manchmal entwirrte er ein Netz auf der Gartenmauer; oder er hämmerte etwas; er war immer beschäftigt, aber er schien doch nie direkt zu arbeiten. Er gab durch nichts zu erkennen, daß er wußte, daß der Junge in der Nähe war, und ich dachte auch nicht an ihn, irgendwie spürte ich aber immer unwillkürlich, daß er dort im Hintergrund war. Ich hörte, wie er sich in langen Abständen schneuzte und dann wieder eine Prise nahm. Seine schweigende Anwesenheit auf jeder Handbreit Boden des kleinen Grundstücks von Brekkukot, – das war, als liege man vor Anker; die Seele hatte in ihm die Sicherheit, die sie begehrte. Noch heute kommt es mir oft so vor, als sei irgendwo neben mir oder hinter mir eine Tür angelehnt; oder sogar direkt vor mir; und mein Großvater stehe dahinter und hantiere mit etwas herum. Deshalb finde ich es auch nur gerecht, daß ich, wenn ich von meiner Welt spreche, zuallererst etwas über meinen Großvater berichte.
Der selige Björn von Brekkukot war in diesem Teil der Welt geboren und aufgewachsen; sein Vater hatte hier in Brekkukot Landwirtschaft betrieben, damals, als zum Hof noch die Wiesen auf der Südseite des Teiches gehörten, wo später Torf für diese zukünftige Hauptstadt gestochen wurde. Damals gab es hier dänische Gouverneure. Doch zu Beginn meiner Geschichte hatten wir schon einen einheimischen Landesstatthalter, der Königlicher Ratgeber genannt wurde, weil er dem König unterstand, genauso wie das damalige Althing, das diesen Namen eigentlich gar nicht verdiente. Als mein Großvater geboren wurde, wohnten nur knapp zweitausend Menschen in dieser Hauptstadt. In meiner Kindheit waren es schon fast fünftausend geworden. Als mein Großvater ein Kind war, galten in dieser Stadt nur wenige Beamte etwas, die entweder die Herrschaftsleute oder die Obrigkeit genannt wurden, und dann noch ein paar ausländische Kaufleute, hauptsächlich Juden aus Schleswig und Holstein, die Plattdeutsch sprachen und sagten, sie seien Dänen; damals durften nämlich Juden in Dänemark selbst keinen Handel treiben, sondern nur in den dänischen Herzogtümern und in Island. Die übrigen Bewohner des Ortes waren Häusler, die fischten und oft mit vielen anderen zusammen eine Kuh besaßen oder einige Schafe hielten. Sie hatten kleine Ruderboote, und es kam vor, daß sie Segel benutzten. Als mein Großvater ein Kind war, versorgten sich alle selber mit Fisch, ausgenommen die Herrschaftsleute und Kaufleute, die ohnehin vor allem Fleisch aßen. Doch als der Ort wuchs, und sich so etwas wie ein Stadtleben mit einer gewissen Arbeitsteilung zu entwickeln begann, und es bereits Handwerker und Hafenarbeiter gab, die keine Möglichkeit hatten zu fischen, und unter den Leuten schon ein wenig Geld im Umlauf war, da fing der eine oder andere an, sich seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, daß er für die Kochtöpfe seiner Mitmenschen fischte. Einer, der sich auf diese Weise sein Brot verdiente, war mein Großvater. Er war keiner von denen, die ihr Gewerbe als Großunternehmen betrieben; er fischte nicht zusammen mit anderen, denen ein Anteil am Fang zugestanden hätte. Er gehörte nie zu den Leuten, die große Mengen von Stockfisch produzieren, um sie bei den Kaufleuten abzuliefern; und Silber und Gold in einer Truhe horten; und dann plötzlich auf den Gedanken kommen, sich Bauernhöfe oder Grundstücke zu kaufen, oder einen Anteil an einem Fischkutter, wie es damals gerade in Mode kam. Gewöhnlich ruderte er frühmorgens hinaus, wenn gutes Wetter war, entweder von der Grof oder von der Bot aus, und hatte ein oder zwei Gehilfen auf seinem Boot dabei, und legte gleich irgendwo draußen vor den Inseln seine Netze aus, höchstens daß sie bis auf Svid hinausruderten. Wenn er zurückkam, standen meine Großmutter und ich mit einer Flasche Kaffee in einem Strumpf und einer Scheibe Schwarzbrot in einem roten Taschentuch am Landeplatz. Dann zog mein Großvater mit dem Fang auf einer Schubkarre los und verkaufte ihn in der Stadt gegen Barzahlung, auf der Straße oder an den Türen der Leute. Während der Fischsaison im Winter und ebenso im Spätsommer fing er hauptsächlich Dorsch und Schellfisch, manchmal Scholle und Heilbutt; andere Fische wurden nicht hergezeigt. Was nicht sofort verkauft wurde, nahm Großvater daheim aus und hängte es draußen in der Hütte auf Stangen und machte Stockfisch daraus. Im Frühjahr hörte er mit dem Fischen, wie man es nannte, auf und verlegte sich auf den Fang von Seehasen. Er fing sie draußen im Tang, entweder im Skerjafjördur oder draußen beim Grandi. Ich weiß nicht, ob allgemein bekannt ist, daß beim Seehasen das Weibchen Grauquappe heißt und das Männchen Rotbauch. Der Rotbauch ist einer der farbenprächtigsten Fische, die man kennt, und dementsprechend wohlschmeckend; die Grauquappe hingegen gilt als weniger gut und wird meist eingesalzen. Die Männer, die Seehasen fangen, werden nie Rotbauchfischer genannt, sondern immer Grauquappenleute, und so einer war mein Großvater. Im Südwestland sagt man, der Frühling sei gekommen, wenn es wieder mehr Rotbauch gibt und die lohroten Segel der Franzosen draußen in der Bucht leuchten. Ab Mitte März war mein Großvater morgens, wenn die Leute aufstanden, immer schon mit seiner Schubkarre in der Stadt, um frischen Rotbauch zu verkaufen. Leute, die so dicht am Land fischen, werden in Island für gewöhnlich nicht Fischer genannt – ich bezweifle, daß mein Großvater in seinem Leben je das offene Meer gesehen hat. Und man konnte ihn auch nicht einen Fischerbauern nennen, nur weil er mit einem Gehilfen im Tang herumruderte oder einen Steinwurf vom Strand entfernt Netze auslegte. In anderen Ländern würde man jemanden, der frühmorgens auf einem kleinen Boot hinausrudert und den Fisch schon an die Haustüren bringt, wenn die Leute aufstehen, einen Fischer oder Fischersmann heißen. Mein Großvater sah auch tatsächlich ein wenig wie die Fischer auf ausländischen Gemälden aus, nur daß er nie Stiefel oder gar Holzschuhe trug, sondern stets die einheimischen Mokassins, die man isländische Schuhe oder dünne Schuhe nennt und selber aus alaungegerbtem Leder macht; und wenn er bei Regen oder unruhiger See fischte, zog er immer Überhosen und eine Jacke an, beide aus Leder, das mit Tran eingefettet war. Wenn er in der Stadt unterwegs war, trug er diese grünen dünnen isländischen Schuhe und blaue Wollsocken mit einem weißen Rand oben, die meine Großmutter strickte; und wenn es naß war, zog er die Socken über die Hosenbeine; so viel Schmutz aber auch auf den Straßen sein mochte, nie sah man die kleinste Spur davon an den Schuhen oder Socken meines Großvaters; und er hatte einen Backenbart wie holländische oder dänische Fischer auf Bildern, und langes, weißes, gelocktes Haar, das unten gerade abgeschnitten war; und wenn er nicht seinen Südwester trug, hatte er einen breitkrempigen schwarzen Hut von der Sorte auf, die man in Deutschland Theologenhüte und in Dänemark Künstlerhüte nennt, mit niedrigem, eingedelltem Kopf und rotem Seidenfutter; und dieser Hut war nie neu, soweit ich mich erinnern kann, und er wurde auch nie alt, und immer hatte er dieselben Dellen; doch einmal wehte es ihn meinem Großvater vom Kopf, und da ließ er meine Großmutter zwei Bänder daranmachen und band den Hut von da an unter dem Kinn fest, wenn es windig war.
In unserer Hütte, in deren einer Hälfte die Fischfanggeräte aufbewahrt wurden, hingen bis weit ins Frühjahr hinein halb getrocknete Grauquappen; dort wurde auch Seewolf, Heilbutt und Schellfisch gedörrt. Manchmal kochte mein Großvater Lebertran auf einem offenen Feuer an der Südseite der Hütte. Der ranzige Geruch der Grauquappen und der Dunst von Leber, Tran und Tranrückständen vermischten sich mit dem Duft des sprießenden Grases; und des Rainfarns und der Engelwurz; und dem Torfqualm aus dem Schornstein bei Großmutter; aber bevor die Fliegen ihre Eier legten, mußte der Stockfisch gesäubert werden, denn dann wurde die Hütte leer gemacht. Jeder Stein in der Wand unseres Hauses glitzerte von Fischschuppen, und ebenso die Latten der Hütte und die Torfstücke in unserem Torfstapel an der Nordseite der Hütte. Es glitzerten auch Schuppen in der Schlammpfütze, die sich zwischen Hütte und Haus bildete, wenn es naß war; und jedes Ding auf unserem Grundstück war mit Leber und Tran verschmiert, von dem hölzernen Kreuz an, das sich an unserem Gartentor hinter dem Haus waagrecht um seine Achse drehte. Am Südende des Grundstücks, so weit von den übrigen Gebäuden entfernt, wie es möglich war, stand der Schuppen meines Großvaters; auch der war in zwei Räume unterteilt, und der eine Teil hatte einen Bretterboden, dort wurden allerhand Vorräte aufbewahrt; denn bei uns war es üblich, alles, was man für den Haushalt brauchte, halbjährlich einzukaufen; Fleisch salzten wir für das Jahr in einem Faß ein. Im anderen Teil des Schuppens aber waren unser Pferd Grani und unsere Kuh Skjalda zu Hause. Der Trangeruch und der Rauchqualm bei uns war deshalb nicht nur mit dem Duft des Grases vermischt, sondern auch mit dem von Pferd und Kuh.
Und der Sommertag vergeht.
Wie ich nun an diesem Sommertag dort in unserem Gemüsegarten sitze und spiele, und die Fliege summt, und die Hühner gackern, und der Verschlag für die Netze meines Großvaters halb offensteht und die Sonne mit solcher Helligkeit am wolkenlosen Himmel leuchtet, wie eine Sonne in diesem Erdenleben nur eben leuchten kann, da sehe ich, wie ein Mann zu Fuß an der Kirchhofmauer entlang kommt und sich schrecklich abmüht mit der Last auf seinen Schultern, einem prall gefüllten Doppelzentnersack. Der Mann zwängte sich mit dem Sack durch unser Drehkreuz, das nur etwa eine Elle breit war, es konnte also kein Zweifel daran bestehen, daß er zu uns wollte. Ich erinnere mich allerdings nicht mehr daran, ob ich ihn damals schon kannte, doch danach erkannte ich ihn immer, wenn ich ihn sah. Es war einer von denen, die man Gelegenheitsarbeiter nannte, oder Gehilfen, und ruderte manchmal mit meinem Großvater hinaus und half ihm, den Fisch auszunehmen; er besaß ein kleines Haus drin im Skuggahverfi, was aber mit meiner Geschichte nichts zu tun hat, und hatte eine große Familie zu versorgen. Ich glaube, er wurde Jon von Steinbaer genannt. Ich berichte hier von seinem Erlebnis, weil es mir seitdem immer wieder in den Sinn kommt und meine Geschichte irgendwie unvollständig wäre, wenn ich nicht davon erzählte. Ich möchte jedoch, bevor ich die Geschichte erzähle, die Leute nachdrücklich davor warnen, zu glauben, es gehe dabei um wichtige Neuigkeiten oder den Stoff zu einem Heldenlied. Nun legt der Mann dort zwischen Haus und Hütte den Sack ab, setzt sich darauf und wischt sich mit dem Ärmel den Schweiß aus dem Gesicht. Er spricht mich, den Jungen, an und fragt:
Ist der Bootsführer Björn, dein Großvater, zu sprechen?
Als mein Großvater aus dem Verschlag für die Netze herausgekommen war und auf dem Platz zwischen Haus und Hütte stand, wo die Sonne auf die Fischschuppen schien, erhob sich der Gast von dem Sack, fiel neben seiner Last auf die Knie, nahm seinen Hut ab und drehte ihn hin und her, senkte den Kopf und sprach:
Ich habe dir heute nacht diesen Torf gestohlen, Björn, aus deinem Torfstapel hier an der Nordseite der Hütte.
Soso, sagte mein Großvater. Das war eine böse Tat. Und dabei ist es kaum eine Woche her, seit ich dir einen Sack Torf geschenkt habe.
Ja, ich habe auch die ganze Nacht kein Auge zugemacht vor Gewissensqual, sagte der Dieb. Ich hatte nicht einmal Lust auf meinen Kaffee heute morgen. Ich weiß, ich werde keinen frohen Tag mehr haben, bis du mir vergeben hast.
Tja, das ist schmerzlich, sagte Björn von Brekkukot; aber versuch doch wenigstens wieder auf die Beine zu kommen, während wir miteinander sprechen; und den Hut aufzusetzen.
Ich glaube, ich werde nie in meinem Leben wieder aufstehen können, sagte der Dieb. Und schon gar nicht den Hut aufsetzen.
Mein Großvater nahm würdevoll eine Prise, – tja, man kann nicht erwarten, daß dir leicht ums Herz ist nach einer solchen Tat wie dieser, sagte er. Darf ich dir eine Prise anbieten?
Danke für das Angebot, sagte der Dieb, aber ich glaube, ich habe sie nicht verdient.
Nun ja, wie du meinst, armer Kerl, sagte mein Großvater. Aber bei einer solchen Sache muß ich nachdenken. Komm doch bitte mit ins Haus und trink eine Tasse Kaffee, während wir miteinander sprechen.
Sie ließen das Diebesgut zwischen Haus und Hütte zurück und gingen hinein. Und die Sonne schien auf den Sack Torf.
Sie gingen in die Stube.
Nimm Platz und sei fröhlich, sagte mein Großvater. Der Dieb legte seinen verbeulten alten Hut unter den Stuhl und setzte sich.
Tja, das ist vielleicht ein Wetter, sagte mein Großvater: Ich glaube, seit Sommeranfang hat man jeden Tag hinausrudern können.
Ja, sagte der Dieb. Das ist wirklich ein Wetter.
Ich habe noch selten solchen Frühjahrsschellfisch gesehen wie in diesem Frühjahr, sagte mein Großvater: rot, wenn man ihn schneidet; und duftend.
Ja, herrlicher Schellfisch, sagte der Dieb.
Und wie das Gras auf den Wiesen wächst! sagte mein Großvater.
Tja, das kann man wohl sagen, sagte der Dieb. Wie das wächst!
Meine Großmutter bediente sie. Sie unterhielten sich weiter über das Wetter zu Wasser und zu Lande, während sie den Kaffee schlürften. Als sie den Kaffee getrunken hatten, stand der Dieb auf und bedankte sich mit Handschlag. Er hob seinen Hut vom Boden auf und machte Anstalten, sich zu verabschieden. Mein Großvater begleitete ihn wieder vor das Haus hinaus, und der Dieb drehte unentwegt seinen Hut zwischen den Fingern.
Willst du mir vielleicht noch etwas sagen, bevor ich gehe, Björn? sagte der Dieb.
Nein, sagte mein Großvater. Du hast etwas getan, was Gott nicht vergeben kann.
Der Dieb seufzte tief auf und sagte leise: Tjaja, lieber Björn, ich danke dir herzlich für den Kaffee, auf Wiedersehen, und Gott sei allezeit mit dir.
Leb wohl, sagte mein Großvater.
Doch als der Gast eben mit seinem Hut durch das Drehkreuz ging, rief mein Großvater hinter ihm her: Ach, nimm doch den Sack dort mit, und das, was drin ist, armer Kerl. Mir kommt es, Teufel noch mal, nicht auf einen Sack Torf an.
Der Dieb drehte im Drehkreuz um, kam zurück und reichte meinem Großvater noch einmal zum Dank die Hand, brachte aber kein Wort heraus; er fing an zu weinen, als er den Hut aufsetzte. Dann schulterte er wieder den Sack Torf, schob sich mit ihm durch das Drehkreuz und ging denselben Weg zurück, den er gekommen war, bei diesem schönen Wetter.
3. Ein besonderer Fisch
Nun ist davon erzählt worden, daß mein Großvater ein rechtgläubiger Mann war, obwohl ihm nie eingefallen wäre, Gott darum zu bitten, sich die Menschen zum Vorbild zu nehmen, entsprechend jenem seltsamen Wunsch des Vaterunsers, wo es heißt: vergib uns, so wie wir vergeben. Mein Großvater sagte einfach zu Jon von Steinbaer: Gott kann dir nicht vergeben, aber mir, Björn von Brekkukot, kommt es, Teufel noch mal, nicht darauf an. Ich habe deshalb den Verdacht, daß mein Großvater für die meisten Dinge, die im Leben eines Fischers vorkommen konnten, einen besonderen Tarif hatte.
Um dies zu verdeutlichen, will ich jetzt ein wenig davon sprechen, wie man bei uns über die Fischerei dachte, oder besser gesagt von der Moral im Hinblick auf Fisch. Man kann sagen, daß die Ansichten meines Großvaters über den Fischfang nur sehr beschränkt in Einklang standen mit jener Gesellschaft, die sich in meiner Jugend draußen vor dem Drehkreuz von Brekkukot so rasant entwickelte; allerdings war es noch nicht so weit, daß wir diese Gesellschaft, die um uns herum zu brodeln begonnen hatte, tatsächlich bemerkten. Zumindest kann ich behaupten, daß ich mit einer Bewertung des Geldes aufgewachsen bin, die von der Notierung der Banken weit entfernt ist.
Ich glaube, unsere Notierung beruhte darauf, daß mein Großvater davon überzeugt war, wenn Leute mehr Geld ihr eigen nennen, als es dem Durchschnittsverdienst eines arbeitenden Menschen entspricht, dann müsse es unrecht erworben oder Falschgeld sein; und deshalb stünden alle großen Geldsummen in Widerspruch zur gesunden Vernunft. Ich erinnere mich daran, daß ich ihn immer wieder sagen hörte, er nehme nie mehr Geld an, als er verdient habe.
Aber was hat man verdient, wird manch einer fragen; wieviel steht einem zu; wieviel darf ein Fischer annehmen? Hier, so ist zu befürchten, läßt sich nur schwer eine befriedigende Antwort finden. Heutzutage müßte jeder, der die Wertnotierung der Bank ablehnt, mehrmals täglich auf eigene Verantwortung komplizierte moralische Geduldsspiele lösen. Aber diese kniffligen Fragen schienen meinem Großvater keine Schwierigkeiten zu bereiten oder Sorgen zu machen. Probleme, die den meisten Menschen als Beginn langwieriger Verwicklungen erscheinen würden, löste er buchstäblich ohne nachzudenken, mit derselben Sicherheit, mit der ein Schlafwandler sich irgendwo in der Mitte einer hundert Meter hohen Felswand vorwärtsbewegt; ja, ich möchte fast sagen, mit derselben Mißachtung der Naturgesetze, mit der ein Gespenst durch Wände hindurchgeht.
Ich war noch nicht alt, als ich bemerkte, daß manche Fischer schlecht auf meinen Großvater zu sprechen waren, weil er den frischen Fisch manchmal billiger verkaufte als andere; sie sagten, es sei gemein, anderen Leuten mit niedrigeren Preisen Konkurrenz zu machen. Doch wieviel ist ein Seehase wert? Und was ist ein Pfund Schellfisch wert? Oder die Scholle? Diese Frage läßt sich vielleicht am ehesten damit beantworten, daß man sagt: Was kosten Sonne, Mond und Sterne? Ich vermute, mein Großvater hat dies für sich, im Unterbewußtsein, so beantwortet, daß der richtige Preis, zum Beispiel für einen Seehasen, der Preis sei, der verhindert, daß sich bei einem Fischer mehr Geld ansammelt, als er zum Leben braucht.
4. Was ist die Bibel wert?
Nun habe ich dies und das vom Fisch erzählt, aber noch nicht begonnen, über die Bibel zu sprechen. Ich kann dieses Thema nicht verlassen, ohne kurz zu erwähnen, welchen Wert die Bibel bei uns hatte.
Mein Großvater, Björn von Brekkukot, war kein Bücherfreund, ich erinnere mich nicht daran, daß er jemals ein anderes Buch las als die Hauspostille des Bischofs Jon Vidalin; es sei denn, man rechnet auch dazu, daß er bisweilen einen Blick auf die Anzeigen in der Zeitung Foldin warf. Diese Lesung aus Vidalins Postille fand immer sonntags am frühen Nachmittag statt. Er las meistens richtig vor, manchmal auch falsch, aber nie wirklich gut, und beachtete dabei vor allem zwei Dinge: beim Vorlesen schleppend genug zu sprechen; und außerdem nie die Zahlen auszulassen, wenn unter Angabe von Buch, Kapitel und Vers auf eine Stelle in der Heiligen Schrift verwiesen wurde, bisweilen mehrmals in einem Satz. Dabei löste er die Abkürzungen nie auf, sondern sagte zum Beispiel Mark, Röm, Kor und Hab; er sprach die Zahlen, die stets bei den Belegstellen angegeben waren, auch nie als Ordnungszahlen aus und kümmerte sich weder um Kommas noch um andere Zeichen, die zwischen den Zahlen standen; statt zum Beispiel Erster Brief an die Korinther, dreizehntes Kapitel, fünfter Vers zu lesen (geschrieben: 1.Kor. 13,5.), las er eins Kor einhundertfünfunddreißig. Und er wich, wie gesagt, nie von dieser eigentümlichen Art des Vorlesens ab, deren sich die Leute hier früher für religiöse Texte bedienten, diesem gleichförmigen, weihevollen Ton in hoher Stimmlage, der am Satzende um eine Quart tiefer wurde; diese Art des Vorlesens hatte nichts Weltliches an sich und ähnelte ein wenig der Sprechweise mancher Geistesgestörter. Den Künstler, der sich auf diesen Ton versteht, gibt es heute nicht mehr in Island.
Ich kann beim besten Willen nicht sagen, welche Gedanken meinem Großvater, Björn von Brekkukot, bei diesen Verweisen der Postille auf alte Sonderlinge aus den Ländern am östlichen Mittelmeer durch den Kopf gingen, wozu bei Meister Jon Vidalin dann noch die gründlich systematisierte Theologie deutscher Provinzler kam. Viele würden eine geistige Betätigung wie sein Vorlesen für eine hohle Formalität halten. Ich kann beschwören, daß ich ihn niemals über etwas sprechen hörte, das in der Postille stand, noch habe ich andere fromme Übungen von seiner Seite bemerkt als dieses sonntägliche Vorlesen. Es ist mir auch nicht gelungen, jemanden ausfindig zu machen, der sich daran erinnern kann, daß Björn von Brekkukot sich in theologischen, moralischen oder philosophischen Dingen jemals auf die Lehren der Postille berufen hat. Es ist mir ein Rätsel, ob mein Großvater alles ernst nahm, was dort stand, oder gar nichts. Hat er alles geglaubt, war er wie jene Theologen, die die Theologie irgendwo in einer verschlossenen Kapsel in ihrem Gehirn aufbewahren; oder vielleicht noch eher wie jene Reisenden, die ein Fläschchen Jodtinktur in ihrem Gepäck mit sich führen und darauf achten, daß der Stöpsel dicht schließt, damit nichts auslaufen und die Sachen ruinieren kann. Ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, daß mein Großvater, Björn von Brekkukot, in allen wichtigen Dingen kein anderer Mensch geworden wäre, auch wenn er in heidnischer Zeit hier gelebt hätte; oder irgendwo auf der Erde zu Hause gewesen wäre, wo man keine Postille liest, sondern an den Stier Apis, den Gott Ra oder den Vogel Kolibri glaubt.
Aus dem, was jetzt gesagt wurde, wird deutlich, daß wir keine Büchernarren waren. Das Bücherlesen wurde bei uns hauptsächlich von Gästen besorgt, die selber Bücher mitbrachten. Manchmal waren das Geschichten, die sie laut allen Leuten vorlasen, oder sie trugen sogar Rimur vor. Oft ließen Schlafgäste Bücher bei uns zurück, manche bezahlten damit die Übernachtung, und auf diese Weise ist unsere Bibliothek entstanden, diese kleine, bunt zusammengewürfelte Sammlung. Darauf werde ich später zurückkommen. Obwohl also verschiedene Bücher bei uns liegengeblieben waren, entdeckte man erst, als Thordur der Täufer zu uns kam, daß wir keine Bibel hatten; und damit bin ich endlich bei dem Thema angelangt, über das ich sprechen wollte.
Es ist allgemein bekannt und braucht eigentlich gar nicht erwähnt zu werden, daß nach alter isländischer Taxe die Bibel soviel kostet wie eine Kuh, und zwar eine, die im Herbst kalbt, oder wie sechs ungeschorene Mutterschafe mit ihren Lämmern. Der Preis steht auf dem Titelblatt jener Bibel, die im Jahre 1584 in einem entlegenen Tal zwischen hohen Bergen im Nordland gedruckt wurde, und bekanntlich haben die Isländer nie an eine andere Bibel geglaubt als an diese; diese Bibel ist mit kunstvollen Vignetten und Holzschnitten versehen und wiegt fünf Pfund und sieht wie eine Rosinenkiste aus. Dieses Buch war stets in allen besseren Kirchen in Island vorhanden.
Es geschah einmal wie so oft im Sommer, daß ein Gast in Brekkukot anlangte; er sagte, er sei mit dem Dampfschiff hergekommen. Er war dann in den darauffolgenden zwei oder drei Sommern jeweils für ein paar Wochen unser Gast. Ich kann mich gut daran erinnern, wie dieser Mann den Weg am Friedhof entlang gegangen kam, in einem Pastorenrock, wie man die Gehröcke in Island nannte, und mit einem steifen Hut von der Art, die man Halbtönnchen nannte, zum Unterschied von den Ganztönnchen, wie die Zylinder genannt wurden. Dieser Mann hatte einen Guttaperchakragen, der hinten zusammengehakt war. Das war Thordur der Täufer, oder wie er sich selber nannte: Thordur der Baptist. Was mich aber vermuten ließ, daß hier schon wieder ein Torfdieb unterwegs sei, war der seltsame Umstand, daß dieser Mann im Gehrock, der in allem das Aussehen eines besseren Herrn hatte, auf seinem Rücken einen Sack trug, der prall mit etwas gefüllt war, das ich für Torfstücke hielt; doch um es gleich zu sagen: Was er auf dem Rücken trug, war kein Torf, sondern lauter Bibeln; anderes Gepäck hatte er nicht. Ich will keine Vermutungen darüber anstellen, was die Gründe dafür waren, daß ein Herr im Gehrock, der mit dem Dampfschiff aus dem Ausland gekommen war, schnurstracks nach Süden zu uns in dieses Erdhaus am Rande der zivilisierten Welt gelaufen kam, wo Löwenzahn auf dem Dach wuchs, statt im Hotel d’Islande Quartier zu nehmen, wo er gut zu den Vornehmen und Ausländern gepaßt hätte.
Thordur der Täufer war ein stattlicher, würdevoller Mann, mit einem Gesicht, das aussah, als ob das Kinn mit einem Kraftakt von unten her angesetzt worden sei, während die überaus wohlgeformte Adlernase dem Kinngrübchen zustrebte. Wenn er nicht gerade eine Rede hielt, war sein Mund so fest geschlossen, daß sich die Lippen nach innen stülpten und nicht zu sehen waren; auf der Oberlippe, die das Weichste und Unbedeutendste an dem ganzen Mann war, saß ein kurzer, außerordentlich sorgfältig gestutzter Schnurrbart. Die Augen kniff er zusammen, so daß sie Ähnlichkeit mit einem Sieb hatten.
Was es mit seinem Beinamen der Täufer auf sich hatte, wußten wir in Brekkukot nie so genau, und wir machten uns auch keine Gedanken darüber; wir sahen auch nicht, daß er je irgendeinen Menschen getauft hätte. Es hieß, er habe in Schottland und Kanada Mitglieder einer religiösen Gemeinschaft kennengelernt und sich ihnen angeschlossen und werde von ihnen bezahlt; doch diese Bezahlung kann nicht sehr üppig gewesen sein, da er in einer der wenigen kostenlosen Herbergen, die es in diesem und im letzten Jahrhundert auf der Welt gab, Zuflucht suchte. Es war wahrscheinlich seine Aufgabe, das Wort jenes Herrn, der an die Baptisten glaubt, in seiner Heimatstadt zu verkünden. Ich zweifle überhaupt nicht daran, daß Thordur beim Sprechen von göttlicher Eingebung angetrieben wurde, wenn das einem Menschen je möglich war. Seine Inspiration und seine Begeisterung beim Predigen waren so, daß er sich nie darum kümmerte, ob dort, wo er predigte, jemand in der Nähe war, ich möchte sogar fast vermuten, daß er es lieber hatte, wenn keiner da war; es kam wohl auch selten vor, daß er Zuhörer hatte, es sei denn, ein paar Burschen versteckten sich in einer Tonne in seiner Nähe, um herauszufinden, was ein so trefflicher Gottesmann mit solcher Leidenschaft ohne Zuhörer predigte. Ich hatte leider weder den Verstand noch die Reife, und vielleicht auch nicht die nötige Neugierde, um der Botschaft Thordurs des Täufers auf den Grund gehen zu wollen, wie ich auch nicht versuchte, die Postille meines Großvaters zu verstehen. Es ist nun einmal so, daß die Isländer seit jeher für ihre Gleichgültigkeit bekannt sind, und es mag sein, daß Thordur seine Landsleute gut kannte und selbst sehr isländisch war; denn geschah es, daß Leute, einzeln oder zu mehreren, auf ihn zu schlenderten, wenn er allein auf einem leeren Platz stand und predigte, dann drehte er sich stets um und wandte dem hochverehrten Publikum seine Kehrseite zu: Diese Methode schien ihm am erfolgversprechendsten, wenn es darum ging, die Isländer zu überzeugen. Ich kann mich daran erinnern, daß ich ihn eines Abends bei eisigem Nordwind und Sprühregen unten am Hafen sah, wo er mit Überzeugungskraft einer Schubkarre, die dort umgekehrt auf der Erde lag, eine Predigt hielt. Er stampfte mit beiden Füßen, um seinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen, und schlug zur Unterstützung seiner Lehre auf die Bibel ein, was das Zeug hielt, und geiferte in verschiedene Richtungen. Er predigte gegen jenes unangemessene und schändliche Vorgehen, das darin besteht, Kinder zu taufen:
Das steht nirgends in diesem heiligen Buch geschrieben, sagte er und schlug auf das Buch; weder mit einem Wort noch mit einem Buchstaben, weder mit einem Strich noch mit einem Punkt steht in der Heiligen Schrift geschrieben, daß man unschuldige Kinder taufen soll. Jeder, der behauptet, es stehe irgendwo in der Heiligen Schrift geschrieben, daß man unschuldige Kinder taufen soll, tut dies auf eigene Verantwortung – und trägt die Folgen.
Als Thordur der Baptist seine baptistische Pflicht hier draußen in Island getan hatte, war es seine Aufgabe, nach Norwegen zu fahren, um eine Zeitlang dort zu predigen. Und es beweist, wie stark sich die Isländer und die Norweger voneinander unterscheiden, daß Thordur kaum in Bergen an Land gegangen war, als sich eine große Schar von Menschen um ihn drängte, um seiner Botschaft zu lauschen, so daß häufig Polizei oder sogar Infanterie aufgeboten werden mußte, um zu verhindern, daß Alte und Gebrechliche zu Boden getrampelt wurden, oder daß Gruppen von Anhängern und Gegnern dieses Gesandten des Herrn einander umbrachten in der Hitze des Gefechts.
Außer dem geringen Priestergehalt, das Thordur vermutlich von den Schotten und Kanadiern erhielt, um die Isländer und Norweger von der Kindertaufe abzubringen, hat dieser Baptist, wie ich glaube, nichts anderes gehabt als jene Bibeln, die er in einem leinenen Sack auf dem Rücken von Land zu Land trug. Zumindest wußte niemand davon zu berichten, daß Thordur jemals etwas anderes von Wert besessen hätte.
Nun kam der Tag heran, an dem der Täufer Island verlassen und nach Norwegen reisen sollte, um allen Menschen, die in jenem Lande die Kindertaufe praktizieren, das Höllenfeuer anzudrohen.
Wenn er sich zuvor auf seinen Sommerfahrten einen Monat oder sechs Wochen lang in Brekkukot aufgehalten hatte, hatte er stets versucht, das Nachtlogis mit einer Bibel zu entgelten, aber Björn, mein Großvater, hatte ein solches Geschenk stets mit der Erklärung zurückgewiesen, daß es in Brekkukot nicht üblich sei, den Leuten dafür, daß man sie übernachten lasse, Kostbarkeiten abzunehmen. Dagegen hatte mein Großvater bei diesen früheren Gelegenheiten ein unansehnliches frommes Traktätchen als Ehrengabe von Thordur dem Baptisten nicht zurückgewiesen. Doch nun war Thordur es leid, kleine Geschenke zu machen, und wollte sich nicht mehr damit zufriedengeben, bei seiner Abreise ein kleineres Geschenk als eine Bibel zurückzulassen: Wenn du diesen Herbst keine Bibel von mir annimmst, Björn, sagte er, dann muß ich davon ausgehen, daß du dich nicht mehr als meinen Freund betrachtest; und ich sähe mich dann außerstande, dich jemals wieder zu besuchen.
Ich weiß nicht, wie edel deine Bibeln sind, mein Junge, sagte Björn von Brekkukot. Zu meiner Zeit gab es das nicht, daß Bibeln mit läusekleinen Buchstaben und im Klopapierformat gedruckt wurden.
Mein christliches Gewissen bürgt dafür, daß die Bibel, die ich mitgebracht habe, gut und echt ist, rechtmäßig herausgegeben nach den Originalsprachen von der Bibelgesellschaft in London.
In – was? sagte mein Großvater.
London, sagte der Baptist.
Was ist das? sagte mein Großvater.
Das ist die Hauptstadt des Britischen Reiches, sagte der Baptist.
Das mag schon sein, sagte mein Großvater. Ich weiß nichts davon. Die rechte Bibel hier in Island ist vom seligen Bischof Gudbrandur zu Holar im Nordland übersetzt und gedruckt. Diese Bibel habe ich mit meinen eigenen Augen hier in der Domkirche gesehen. In ihr steht, daß sie eine Kuh kostet. Das ist unsere Bibel.
Thordur der Täufer sagte: Und ich bleibe dabei, daß meine Londoner Bibel eine autorisierte Bibel ist, auch wenn sie nur fünfundsiebzig Öre kostet.
Glaubst du etwa, der Bischof Gudbrandur habe uns hier in Island betrogen, als er den Preis für die Bibel auf den Wert einer Kuh festsetzte? Nein, mein Junge, die Bibel, die der Bischof Gudbrandur herausgab, hatte den richtigen Preis. Wenn die Bibel früher so viel wert war wie eine im Herbst kalbende Kuh, dann ist sie das immer noch. Eine Bibel, die ein halbes Huhn kostet – pfui.
Mein Seelenheil, das für meine Bibel bürgt, ist es dann vielleicht einen Dreck wert? sagte Thordur der Täufer.
Da mische ich mich nicht ein, sagte der Großvater; du mußt selber sehen, wie du da herauskommst, guter Mann. Und wir sind gleich gute Freunde, ob es mit dir nach oben oder nach unten geht.
Unser Thordur der Täufer wollte am nächsten Morgen mit dem Dampfschiff abreisen. Als mein Großvater nun am Abend die Uhr für die Woche aufziehen will, findet er doch tatsächlich eine dieser billigen Bibeln des Mannes im Uhrengehäuse.
Mein Großvater nahm die Bibel aus der Uhr, ohne ein Wort zu sagen. Das muß zu der Zeit gewesen sein, als unsere Skjalda zum ersten oder zweiten Mal kalben sollte. Und am nächsten Morgen, als der Täufer die Leute im Haus zum Abschied geküßt hatte und mit den restlichen Bibeln, die er noch für die Norweger in seinem Sack hatte, hinausgegangen war und schon das Drehkreuz erreicht hatte, wer steht da außerhalb des Kreuzes auf dem Weg und wartet mit einer Kuh an einem Strick? Björn von Brekkukot, mein Großvater.
Wie gut, daß ich dich treffe, da kann ich dich auch zum Abschied küssen, sagte der Täufer.
Gott gebe dir einen guten Tag, mein Junge, sagte mein Großvater. Und da du eine edle Bibel zurückgelassen hast, wie du selbst sagst, will ich dir jetzt eine edle Kuh geben, denn ein Geschenk fordert stets ein Gegengeschenk.
Ja, du hast schon immer gern einen Spaß gemacht, lieber Björn, sagte der Baptist, der durch das Drehkreuz getreten war und nun meinen Großvater küssen wollte, bevor er weiterging; doch der ließ ihn nicht an sich heran.
Wir küssen uns erst, wenn wir quitt sind, sagte mein Großvater.
Der Gegenwert der Heiligen Schrift schaute schnaubend nach Süden ins Moor und schlug sich in der Morgenstille mit dem Schwanz.
Mein Schiff fährt bald, sagte der Täufer.
Hier ist der Strick der Gefleckten, sagte mein Großvater.
Darauf küßten sie einander und mein Großvater legte dabei dem Täufer den Strick in die Hand. Mein Großvater trat durch das Drehkreuz. Und als der Täufer die Kuh einen Steinwurf weit geführt hatte, ließ er den Strick los. Er lief, so schnell er konnte, auf die Stadtmitte zu.
Da zog mein Großvater die Londoner Bibel aus seiner Hosentasche und sagte zu mir, du hast flinke Beine, mein Junge, lauf Thordur dem Täufer nach und gib ihm sein Buch.
Der Täufer war schon alt und kurzatmig, so daß ich ihn bald eingeholt hatte. Ich gab ihm sein Buch und er steckte es schweigend ein; dann ging er weiter zum Schiff.
5. Zwei Frauen und ein Bild
Ich habe nun über alles, was sich draußen und drinnen bei uns in Brekkukot benennen läßt, geschrieben, aber über meine Großmutter habe ich noch kaum ein Wort gesagt, und dabei war sie beileibe keine Nebenperson im Haus. Wollte man sie hingegen mit dem Herzen des Hauses vergleichen, so könnte man über sie dasselbe sagen, was man im allgemeinen über gesunde Herzen sagt, nämlich daß jeder, der ein solches Herz in der Brust trägt, gar nicht wahrnimmt, daß er ein Herz hat.
Und nachdem erzählt wurde, wie immer wieder Leute in Brekkukot willkommen geheißen wurden, finde ich, daß es an der Zeit ist, etwas über die Frau zu sagen, die diesem Hauswesen vorstand, auch wenn es nicht viel ist. Ich sage, auch wenn es nicht viel ist, denn ich kannte diese Frau nicht. Ich war zum Beispiel schon halb erwachsen, als mir durch einen Zufall deutlich wurde, daß sie möglicherweise eine Lebensgeschichte hatte, wie andere Menschen. Was ich hier über sie erzählen kann, ist in Wirklichkeit, wie wenig ich von ihr wußte.
Wahrscheinlich ist es dennoch vor allem sie gewesen, die mich erzogen hat, soweit ich erzogen worden bin; zumindest denke ich, daß sie mehr als viele andere dazu beigetragen hat, mich in etwa zu dem zu machen, was ich bin; aber erst später, als ich älter geworden war, schenkte ich ihr so viel Aufmerksamkeit, daß ich sie wahrzunehmen glaubte. Eines schönen Tages fand ich ganz einfach, daß sie mir vielleicht am nächsten stand von allen Menschen, obgleich ich weniger über sie wußte als über andere Leute und sie schon seit geraumer Zeit in ihrem Grab lag. Es ist beileibe kein Kinderspiel, von einem Menschen sprechen zu wollen, über den man so wenig weiß, der einem aber so nahesteht.
Sie war eine sehr schlanke und schwächliche Frau; sie muß jedoch, als ich sie kennenlernte, in einem Alter gewesen sein, das die meisten Menschen gar nicht erreichen, selbst wenn sie ganz besonders kräftig und gesund sind; und sie lebte danach mindestens noch ein Vierteljahrhundert lang. In meiner Erinnerung ist sie immer gebückt und zahnlos; sie hüstelt und hat gerötete Augenlider, denn sie steht im Rauch der offenen Feuerstelle in der Küche von Brekkukot, wie sie zuvor in anderen ärmlichen Häusern gestanden hat. Manchmal konnte etwas Ruß in den Runzeln ihres Gesichts sein; und sie wackelt ein klein wenig mit dem Kopf, wenn sie einen mit ihren milden Augen ansieht. Ihre Hände waren lang und knochig.
Meine Großmutter hatte eine Verwandte, die wahrscheinlich anderthalb Jahrzehnte jünger war, auch wenn sie früher alterte und sich nicht so gut hielt, das war Kristin im Küsterhaus, die Wirtschafterin des alten Küsters selig, droben auf der Anhöhe, ganz am nördlichen Ende des Friedhofs. Einmal, wie so oft, ging ich mit meiner Großmutter die selige Kristin, die Küsterin, besuchen. Der Weg führt über den Friedhof. Es war zu der Zeit des Jahres, als die Fliegen in ihrem Element waren. Die alten Frauen unterhielten sich in jenem seltsam fernen Ton, der wie das Heulen einer Boje draußen vor Engey klingt; oder wie eine Geige im Nordland auf Langanes; bei diesem Ton kann man gut einschlafen. Als wir aber Kaffee getrunken hatten, und ich meinte, ich könnte heute nicht noch einmal einschlafen, und darauf wartete, daß meine Großmutter sich allmählich verabschiedete, damit ich das blanke Zehnörestück bekäme, das die selige Kristin mir immer zum Abschied zu geben pflegte, weil ich ein so guter Junge war, da setzte ich mich ans Fenster, das auf den Friedhof hinaus ging, von wo aus man über den Skerjafjord bis zum Keilir sehen konnte, und fing an, zum Zeitvertreib Fliegen zu töten. Wenig später verabschiedeten wir uns und ich bekam mein glänzendes Zehnörestück von Kristin. Doch als wir auf dem Heimweg über den Friedhof gehen, sagt meine Großmutter zu mir:
Es gibt etwas, das man nie tun darf, mein alter Freund, denn es ist häßlich.
Was ist das, Großmutter? fragte ich.
Nie in den Häusern anderer Leute Fliegen töten, sagte meine Großmutter.
Hat Tante Kristin ihre Fliegen so gern, fragte ich.
Nein, sagte meine Großmutter, aber das Küsterhaus ist ihr Zuhause.
Ich war sehr froh, daß meine Großmutter mich nicht in Gegenwart von Tante Kristin zurechtgewiesen hatte, die mir das Zehnörestück mit der Begründung schenkte, daß ich ein so guter Junge sei.
Nachdem ich nun unversehens diese beiden Frauen zusammengeführt habe, darf ich es nicht mehr auf die lange Bank schieben, etwas ausführlicher über das zu berichten, was mir am interessantesten erschien an ihrer Verwandtschaft. Bei beiden Frauen hing nämlich in der Stube ein Bild, das sich von den anderen Bildern, die dort hingen, unterschied. Das Vorhandensein der anderen Bilder war Zufallssache. Bei uns hing zum Beispiel ein Bild mit zwei Engeln, die aufrecht fliegend einen Blumenkranz trugen; und eines mit einem Mädchen, das für Sunlichtseife Reklame machen sollte; außerdem der Kirchenlieddichter Hallgrimur Petursson, einer der griesgrämigsten Menschen, die ich je auf einem Bild gesehen habe; und schließlich gab es einige Bilder von isländischen Auswandererfamilien, die in Brekkukot gewohnt hatten, während sie auf ein Schiff nach Amerika warteten; diese Leute hatten es, wie man sagt, »zu etwas gebracht« in Amerika, was darin besteht, Steine zu schleppen, Baumwurzeln auszugraben und Gräben zu ziehen; und dann mit Schlips und Kragen beim Photographen zu posieren. In ähnlicher Weise war es vom Zufall abhängig, was bei Kristin im Küsterhaus hing. Aber das Bild, von dem ich jetzt erzählen will, war etwas Besonderes. Es war die Photographie eines jungen Mannes, der aufschaute, und sie zeigte ihn im Profil. Er schien zu träumen und in weiter Ferne irgend etwas Wunderbares zu sehen; insbesondere verlieh jedoch seine Kleidung dem Bild einen Hauch des Fremden, das mit unserem Leben hier nichts zu tun hatte: ein gestärkter weißer Kragen, eine leuchtende Hemdbrust und ein Frack mit langen Schößen und glänzendem Seidenrevers; dazu kam noch eine Rose im Knopfloch. Um so merkwürdiger war das Wissen, das ich schon früh erlangte, daß nämlich dies der Sohn Kristins im Küsterhaus war, und damit ein Verwandter von uns in Brekkukot, Georg Hansson, der »nunmehr«, wie die beiden Frauen sagten, Gardar Holm hieß.
Aber ob es nun an diesem Tag war oder an irgendeinem anderen, als ich das Bild von Gardar Holm betrachtete, ich kann mich einfach nicht zurückhalten und frage meine Großmutter:
Ist Gardar Holm irgendwo zu Hause? Oder ist er vielleicht nur ein Engel?
Der kleine Gorgur, sagte sie. Nein, er ist eigentlich nirgends mehr zu Hause, der Ärmste.
Warum ist er nicht bei seiner Mutter, unserer Tante Kristin im Küsterhaus geblieben, sagte ich.
Er ist auf Reisen gelandet, sagte sie.
Wie hat er das gemacht, fragte ich.
Es ist das Unglück, das schuld daran ist, daß die Leute auf Reisen gehen, sagte meine Großmutter.
Was für ein Unglück, fragte ich.
Darüber sprechen wir nicht, mein alter Freund, sagte sie. Er war ein braver Junge, Kristins kleiner Gorgur, als er hier auf dem Friedhof spielte; und dir ähnlich. Aber er ist auf Reisen gelandet.
Ich schwieg lange und dachte über dieses Unglück nach, das schlimmer war als alles Unglück, mit dem man in Brekkukot vertraut war; und fragte schließlich: Warum geht man überhaupt auf diese Reisen, Großmutter?
Sie antwortete: Die Leute geraten in Not und verlassen Haus und Hof; oder man nimmt ihnen ihr Zuhause weg; manche verlieren den Verstand; einige sehen nur noch Amerika; oder die armen Leute haben etwas Schlimmes getan und werden über Gebirge und Einöden, Gewässer und Sandwüsten geschickt, um ins Gefängnis zu kommen.
Bist du nie auf Reisen gegangen, Großmutter, fragte ich schließlich nach langem Zögern.
Sie blickte angestrengt auf ihre Stricknadeln hinunter, um nachzusehen, ob sie eine Masche verloren hatte, und sagte dabei: Doch, ich habe eine Reise gemacht; ich bin einmal vom Osten, aus dem Ölfus, hierher nach Reykjavik gereist. Wir kamen über die Hellisheide.
War das furchtbar schlimm, Großmutter, fragte ich.
Sprechen wir nicht darüber, alter Freund, sagte sie: Das ist schon längst vergessen.
Es verging eine lange Zeit, bis ich den Mut aufbrachte, wieder den unglücklichen Gardar Holm zu erwähnen. Doch schließlich sagte ich, als ich einmal allein mit unserer Tante Kristin im Küsterhaus war:
Warum ist denn Gardar Holm immer auf Reisen?