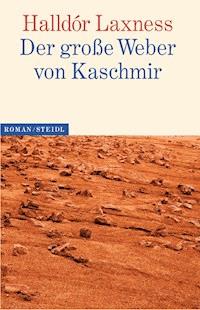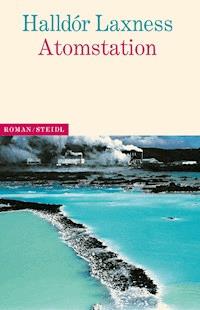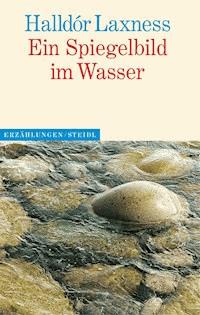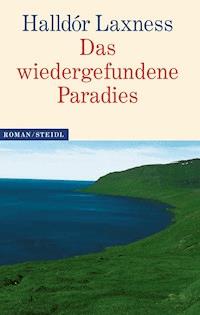
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Bauer Steinar lebt mit seiner Familie in einer kargen Gegend Islands. Sein besonderer Stolz gilt der Bewahrung der isländischen Tradition. Steinar schenkt dem Dünenkönig sein ihm überaus wertvolles Pferd und folgt dessen Einladung nach Kopenhagen. Hier überzeugt ihn der Mormonenbischof Theoderich von seiner Lehre und lockt ihn ins Gelobte Land Utah. Hier meint Steinar, die bessere Welt gefunden zu haben, die er gesucht hatte. Erlöst seine Familie nachkommen, doch Steinars Frau überlebt die lange Reise nicht; seine Tochter wird von Theoderich zur Frau genommen. Halldor Laxness zeichnet in diesem Roman den Lebensweg eines mutigen und aufrechten Mannes. Am Ende muss er feststellen, dass das Lebensglück des einzelnen nicht vom Erlangen der ewigen Wahrheit abhängig ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Halldór Laxness Das wiedergefundene Paradies
Roman
Aus dem Isländischen von Bruno Kress
1. Roß der Lüfte und des Wassers
In der ersten Zeit Christian Wilhelmssons, der als drittletzter ausländischer König dieses Land regierte, wirtschaftete auf dem Hof Hlidar in der Gemeinde Steinahlidar ein Bauer namens Steinar. So hatte ihn sein Vater nach dem Gestein taufen lassen, das in dem Frühjahr, als er zur Welt kam, vom Berg herabstürzte. Steinar war verheiratet und hatte zu Beginn unserer Erzählung einen Sohn und eine Tochter im Kindesalter. Den Hof Hlidar hatte er geerbt.
Zu jener Zeit, in der die Geschichte beginnt, standen die Isländer in dem Ruf, das ärmste Volk Europas zu sein. Den gleichen Ruf hatten auch ihre Väter, Großväter und Ahnen bis in die Vorzeit hinab; sie selber aber glaubten, daß vor vielen Jahrhunderten hier in Island ein goldenes Zeitalter geherrscht hätte: Damals waren die Isländer keine Bauern und Fischer wie heute, sondern Helden und Skalden von königlichem Geblüt, die Waffen, Gold und Schiffe besaßen. Wie andere Knaben in Island lernte auch der Sohn des Bauern von Hlidar früh, ein Wikinger und königlicher Gefolgsmann zu sein. Aus Brettern schnitzte er sich Äxte und Schwerter.
Das Gehöft Hlidar war so gebaut, wie es seit undenklichen Zeiten bei mittelgroßen Höfen üblich war: eine Leutestube ohne Zimmerdecke, ein Flur und eine kleine gedielte und verschalte Gästestube mit einem Bett. Einige andere giebelförmige Bretterwände sahen in der üblichen Reihenfolge zum Hofplatz, ganz wie es damals bei Bauerngehöften Brauch war: Gerätehaus, Trockenschuppen, Kuhstall, Pferdestall, Schafbockstall; schließlich eine kleine Werkstatt. Hinter den Gebäuden ragten im Herbst die Heuschober auf, waren aber im Frühjahr verschwunden. Solche von außen mit Gras bewachsenen Gehöfte standen zu jener Zeit an tausend Stellen in Island unten an den Berghängen. Das Gehöft, bei dem wir jetzt eine Zeitlang verweilen werden, zeichnete sich durch den Umstand aus, daß der Bauer durch kunstvolle Pflege wettmachte, was ihm an äußerer Pracht mangelte. Nicht einen Tag lang wurde ein Schaden an den Gebäuden, ein Fehler an den Gerätschaften oder irgendwelcher Verfall in und außer dem Hause geduldet, vielmehr sprang man hinzu und besserte aus; ein so achtsamer Mann war dieser Bauer Tag und Nacht. Er hatte großes handwerkliches Geschick gleichermaßen für Holz wie für Eisen. Es war schon lange Brauch, jungen künftigen Bauern die Wiesen- und Hausmauern in Hlidar an den Steinahlidar zu zeigen und sie ihnen zur Nachahmung zu empfehlen. Diese Steinmauern waren so sorgfältig geschichtet, daß sie die größten Kunstwerke jener Gegend darstellten. An den Steinahlidar erheben sich Gehöfte auf Wiesengründen unterhalb von Felsen, die vor zwanzigtausend Jahren Meeresküste waren. In den Felsschrunden bildete sich Erdreich, und dort siedelte sich Vegetation an, die das Gestein mürbe macht und es zerbröckelt; in den Regenstürmen im Frühjahr und Herbst wird dann Erde aus den Gesteinsspalten gespült, und Felsbrocken stürzen auf die Ländereien. Dieses Gestein verdirbt auf einigen Anwesen jedes Jahr die Haus- und Wildwiesen, zerstört mitunter die Häuser. Der Bauer von Hlidar hatte im Frühjahr alle Hände voll zu tun, Steine von seiner Hauswiese und seinen Wildwiesen aufzusammeln, und das um so mehr, als er gewissenhafter war als die meisten anderen. Er mußte sich bei dieser Arbeit oft niederbeugen und sich mit einem schweren Stein im Arm wieder aufrichten; doch Lohn gab es dabei nicht, es sei denn die Freude, die man empfindet, wenn man sieht, wie ein Schadstein sich genau in eine Mauer fügt.
Man sagt, daß Steinar von Hlidar einen Schimmel besessen habe, den man für besser hielt als andere Pferde dort im Osten. Dieses Pferd war ein Wundertier, wie es auf jedem Gehöft eins geben muß. Es bestand kaum ein Zweifel daran, daß es ein übernatürliches Pferd war, und zwar schon von seiner Fohlenzeit an, als man es plötzlich an der Seite einer grauen, ziemlich alten Stute laufen sah, die lange mit anderen Pferden in den Bergen gewesen war. Um diese Zeit weidete sie draußen auf den Ufern des Haffs, nachdem man sie in der Mittwinterzeit im Stall gehalten hatte; keiner wußte, daß sie trächtig wäre. Sollte hierzulande jemals eine unbefleckte Empfängnis stattgefunden haben, dann in diesem Fall. Es geschah in Schneeböen neun Tage vor Sommeranfang; Schneefälle zu dieser Zeit heißen Rabenschauer. Keine Blume; kein Sauerampfer an der Hauswand, geschweige denn ein Regenpfeifer; kaum daß man einen Eissturmvogel sich herüberschwingen sah, der nachschauen wollte, ob die Berge noch dastünden – und plötzlich war ein neues Geschöpf geboren, noch ehe der Frühling selbst geboren war. Dieses kleine Pferd lief so leichtfüßig neben der alten Grana, daß keine Rede davon sein konnte, daß es die Füße aufsetzte. Und dennoch, diese kleinen Hufe standen nicht nach hinten, und das deutete darauf hin, daß das Fohlen wenigstens kein Neck von seiten beider Eltern war. Aber da die Stute keinerlei Anzeichen von Trächtigkeit gezeigt hatte, wovon sollte da dieses Elfengeschöpf leben? Man ging zur alten Grana, brachte sie nach Hause und fütterte sie mit gutem Heu; und das junge Wasserpferd bekam Butter, die allein dazu taugte, die nicht vorhandene Stutenmilch zu ersetzen. Und während der ganzen Zeit, in der Heu und frisches Gras knapp sind, wurde dem jungen Neck weiter der Klumpen aus dem Butterfaß gegeben.
Als dieses Pferd größer wurde, entwickelte es sich schön und bekam einen geschwungenen Hals mit langer Mähne; es war hinten schmal und doch lendenschön, etwas hochbeinig; es hatte prächtige Hufe, seine Augen funkelten, es sah scharf und fand den Weg, es trabte gut und weich, galoppierte am besten von allen Pferden. Es bekam den Namen Krapi nach dem Schneewetter, das in diesem Frühjahr geherrscht hatte; und danach wurden die Jahre nach dem Geburtsjahr Krapis gezählt: im Frühjahr, als Krapi einen Winter, zwei Winter, drei Winter alt wurde und so weiter. An den Felswänden haben sich an manchen Stellen Schluchten mit Talstrecken am oberen Ende gebildet. Manchmal gingen dort viele Pferde von den Höfen an den Hlidar in einer Herde; man nannte die Stelle »oben an den Rändern«; ein andermal waren sie auf den Flußufern oder den Wiesengründen am Meer. Infolge der bevorzugten Behandlung, die Krapi durch die Leute von Hlidar zuteil wurde, hatte es die Gewohnheit, allein oben vom Berg oder draußen von den Wiesengründen angetrabt zu kommen; es blieb erst zu Hause auf dem Hofplatz stehen, rieb sich am Türpfosten und wieherte ins Haus hinein. Es brauchte dann kaum lange auf einen Klacks Butter zu warten, wenn welche da war. Manch einer liebte es, seine Wange an die Nüstern des Pferdes zu legen, die weicher als jede Mädchenwange waren; doch Krapi machte sich nichts aus langen Liebkosungen. Wenn das Pferd bekommen hatte, was es wollte, trabte es den Hofweg hinaus, ging dann in Galopp über, als ob es scheute, und hielt nicht eher an, als bis es seine Herde wiedergefunden hatte.
In jener Zeit waren auf Island die Sommer lang. Des Morgens und des Abends waren die Hauswiesen so grün, daß sie rot waren, und am Tage war die Ferne so blau, daß sie grün war. In diesem sonderbaren Spektrum, das allerdings niemand bemerkte oder um das sich niemand kümmerte, war Hlidar an den Steinahlidar weiterhin eines jener Gehöfte im Südland, auf denen sich nichts Bemerkenswertes ereignete, nur daß der Eissturmvogel noch immer vor der Bergwand flatterte, wie einst, als der Urgroßvater hier Bauer war. Auf den Vorsprüngen und in den Schrunden des Gesteins wuchsen Fetthenne und Wurmfarn, Engelwurz, Blasenfarn und Mondraute. Die Steine rollten wie sonst herab, als ob der herzlose Bergriese Tränen vergoß. Wenn es das Glück will, kann auf einem Gehöft in einem Menschenalter ein gutes Pferd geboren werden; auf manchen nicht in tausend Jahren. Draußen vom Meer, über Sandwüsten und Wiesenmoore, tausend Jahre dasselbe Brausen. Der Austernfischer kommt am Ende der Heuernte, wenn er ausgebrütet hat, in roten Strümpfen und mit einem schwarzen Seidenumhang über dem weißen Hemd, stolziert vornehm auf der geräumten Wiese, flötet, fliegt weg. Alle diese Jahrhunderte hindurch fühlte sich der Hund Snati groß und erhaben, wenn er des Morgens an der Seite des Hirten hinter den Melkschafen herging und die Zunge heraushängen ließ. An stillen Sommertagen dringt der Schall vom Dengeln der Sensen von den nächsten Gehöften herüber. Es bedeutete Regen, wenn sich die Kühe auf der Weide hingelegt hatten, besonders wenn sie alle auf der gleichen Seite lagen; war hingegen eine Trockenperiode zu erwarten, dann brüllten sie bei Sonnenuntergang elfmal hintereinander. Immer dieselbe Geschichte.
Als Krapi drei Winter alt geworden war, legte der Bauer Steinar dem Pferd eine Leine um den Hals, damit man es leichter einfangen konnte, und ließ es mit den Arbeitspferden auf den Weiden beim Gehöft gehen. In diesem Sommer gewöhnte es sich an den Zaum und lernte, neben einem zweiten Pferd beim Ritt zu laufen. Im nächsten Frühjahr ging der Bauer daran, es an Sattelzeug zu gewöhnen und es zuzureiten. Er sprengte mit dem jungen Pferd über die Wiesengründe in die helle Nacht hinaus. Und wenn nach Mitternacht der Hufschlag näher kam, dann war es ungewiß, ob alle im Haus gleich fest schliefen. Es konnte vorkommen, daß ein kleines Mädchen im Unterrock herauskam, mit frischer Milch in einem Eimer. Auch ein junger Wikinger in kurzem Hemdchen war da, der nie ohne seine Streitaxt unter dem Kopfkissen schlief.
»Gibt es ein besseres Pferd in der ganzen Gemeinde?« fragte er.
»Es dürfte nicht leicht zu finden sein, mein Lieber«, sagte sein Vater.
»Ob es nicht doch ganz bestimmt von einem Neck abstammt?« fragte das junge Mädchen.
»Ich glaube, alle Pferde sind halbe Elfenwesen«, sagte ihr Vater, »besonders gute Pferde.«
»Kann es dann am Himmel galoppieren wie das Pferd in der Erzählung?« fragte der Wikinger.
»Daran ist nicht zu zweifeln«, sagte Steinar von Hlidar, »wenn Gott überhaupt reitet. Tja, ich glaube es.«
»Ob jemals wieder ein solches Pferd hier in der Gemeinde geboren wird?« sagte das Mädchen.
»Das weiß ich so genau nicht«, sagte ihr Vater, »doch wird es vielleicht noch eine Weile dauern. Auch das durfte auf sich warten lassen, daß in der Gemeinde ein kleines Mädchen geboren wird, das ein so helles Licht im Hause ist wie mein Töchterchen.«
2. Große Herren begehren das Pferd
Jetzt begab es sich unter großem nationalem Erwachen, daß das bewohnte Island das tausendjährige Jubiläum seines Ursprungs feierte, und aus diesem Grunde sollte im kommenden Sommer auf Thingvellir an der Öxara ein Fest stattfinden. Dazu erging die Bekanntmachung, daß zu dem Fest König Christian Wilhelmsson aus Dänemark zu erwarten sei; zu seinem Anliegen bei der Feier würde es gehören, den Isländern offiziell die Selbstverwaltung zu gewähren, auf die sie allerdings schon lange Anspruch erhoben hatten, die ihnen aber stets von den Dänen verweigert worden war; doch von dem Tage an, an dem Christian landete, sollten wir eine selbstverwaltete Kolonie des Königs von Dänemark mit einer Verfassung sein. Diese Nachrichten wurden in jedem Bauernhaus des Landes freudig aufgenommen, da sie Vorboten noch besserer Ereignisse zu sein schienen.
Hier nehmen wir den Faden unserer Geschichte wieder auf. Eines Tages im Frühsommer, kurz vor der Heuernte, stieß der Hund in Hlidar an den Steinahlidar ein wütendes Gebell aus. Snati sträubte furchterregend sein Fell wegen des Pferdegetrappels, das vom Weg her zu hören war, und sprang auf das Hausdach, was er immer tat, wenn ihm etwas dringlich schien; er bellte wie einst der Höllenhund. Kurz darauf ritten mit Pferden wohlversehene Gäste auf den Hof Hlidar an den Steinahlidar; der öffentliche Weg führte nach dem Brauch dieser Gegenden über den Hofplatz. Auf dem Lande war es immer ein Ereignis und beschleunigte den Herzschlag der Leute, wenn Snati auf das Dach sprang; es war ein Zeichen dafür, daß keine Bettler unterwegs waren.
Zu einem Erzähler gehört es, seine Helden bekannt zu machen, ehe sie auf dem Schauplatz erscheinen. Zwei bessere Herren ritten mit mehr als genug Pferden und Pferdeknechten auf den Hof. Bezirksvorsteher Benediktsen war der Anführer; doch gehört es nicht zu dieser Geschichte, seine Geschäfte aufzuführen; Behörden haben auf dem Land allerlei zu tun. Dieser Bezirksvorsteher war kaum länger als zwei Winter im Amt, er war ein junger Mann und direkt nach dem Examen hierhergekommen. Die Bevölkerung hielt ihn für einen Dichter, und bei besseren Leuten der Gegend, die mit der Mode mitgehen wollten, stand er im Ruf eines Idealisten. Bis zu dieser Zeit hatte es in Island keine Idealisten gegeben, und alte Leute kannten das Wort nicht, sie waren der Meinung, dieser Bezirksvorsteher sei nicht vom Schlage früherer Bezirksvorsteher, sondern ein unsicherer Kantonist. Der andere Gast, Kommissionär Björn von Leirur, hatte klein angefangen und frühzeitig Begabung und Fähigkeiten, die er anderen vorauszuhaben glaubte, dafür eingesetzt, nicht hinter Kühen herlaufen oder Fische fangen zu müssen. Er ging jung nach Bakki in die Kaufmannslehre und verbrachte in seiner Jugend mit seiner Herrschaft einige Jahre in Dänemark; er kehrte zurück, wurde Bezirkssekretär bei dem alten Bezirksvorsteher in Hof und bekam von ihm verödete Gehöfte draußen am Meer, die Häuslereien Baeli, Hnuta, Svad und noch andere mit ähnlich geringschätzigen Namen. Er legte sie zu einem Anwesen zusammen und baute ein großartiges Gehöft, machte dann eine Geldheirat und hielt viel Gesinde. Damals war er schon lange nicht mehr Sekretär beim Bezirksvorsteher. Hingegen hatte er viele Aufträge von Bezirksvorstehern übernommen und bereiste jetzt im Auftrage von Schotten das Land, um für sie Pferde und Schafe gegen Gold aufzukaufen. Björn von Leirur führte oft Gold in festen Ledertaschen mit sich, die an den Tragsätteln befestigt waren. Er kaufte an den Küsten des Südlands gestrandete Schiffe, einmal auf Auktionen, ein andermal durch Verträge mit den Behörden, und gelangte so zu Reichtum, den die Bauern bestaunten. Er war stets zur Stelle, wenn Leute ihren Grundbesitz verkaufen mußten, weil es ihnen an Geld fehlte oder sie einen großen Verlust erlitten hatten oder ihnen sonst ein Unglück zugestoßen war. Er hatte jetzt an vielen Stellen, nah und fern, sogar in entlegenen Landesteilen, Höfe aufgekauft. Wohin er kam, wählte er die besten Pferde aus und bezahlte in Gold, was verlangt wurde. Er war ein unermüdlicher Reisender, kühn angesichts von Gefahren, und da er zuverlässigere Pferde als die meisten anderen besaß, war er um so entschlossener, große Ströme auf schwimmenden Pferden zu überqueren, gleich ob bei Tage oder bei Nacht. Doch obwohl Björn von Leirur jetzt alt zu werden begann, gelang es ihm nie, innerhalb der Gemeinde das Vertrauen zu gewinnen, das notwendig war, um das Mandat der Bauern zu erhalten; seine Beliebtheit war um so größer und sein Ruhm um so herrlicher, je weiter er sich von seiner heimatlichen Umgebung entfernte. Björn von Leirur bemühte sich um die Freundschaft des Bezirksvorstehers Benediktsen, seit der in diesen Landstrich gekommen war, schenkte ihm Pferde, Kühe und Höfe und war ihm ergeben. Es geschah nicht selten, daß Björn denselben Weg wie der Bezirksvorsteher hatte, wenn dieser in Amtsgeschäften durch die Gemeinden ritt. Dabei führten sie oft übermütige Gespräche mit Bauern und Gesinde und lachten laut; doch hatten sie fast nie größere Mengen Schnaps bei sich, dafür um so mehr mit Kognak angefeuchteten Schnupftabak.
Steinar von Hlidar baute an seinen Wiesenmauern, während die Hauswiese mähreif wurde; er brachte einen um den anderen Stein in die richtige Lage, wie es ihm seine Augen zu verlangen schienen. Nach der Sitte guter Hausherren ging er seinen Gästen entgegen und begrüßte den Bezirksvorsteher ehrerbietig. Björn von Leirur hingegen begrüßte er nach Bauernbrauch mit einem Kuß.
»Ja, zum Teufel, du bist ein tüchtiger Kerl«, sagte Björn von Leirur und klopfte dem Hlidarbauern auf die Schulter, »immer dabei, die Steine zurechtzulegen. Immer alles noch schöner aussehen lassen. Immer dabei, sich zu vergnügen.«
Der Bezirksvorsteher betrachtete die schnurgerade Kante der Mauer und sagte lobend: »Ja, Mann, was würden Sie nicht alles aus Stein hervorbringen, wenn Sie in Rom zu Hause wären wie der alte Thorvaldsen.«
»Oh, ich wäre undankbar gegen Gott, wenn ich die Mühe scheute, den richtigen Stein für den richtigen Spalt zu finden. Doch das ist nicht so leicht getan, mein liebes Himmelslicht. Vielleicht gibt es nur einen Spalt in der ganzen Mauer, wo dieser hier hineinpaßt. Eins ist sicher, ich habe niemals die beneidet, die vielleicht bessere Vergnügungen kennen als ich. Die schönsten Teile dieser Mauern baute jedoch nicht ich, sondern mein Urgroßvater selig, der hier nach den großen Vulkanausbrüchen im vorigen Jahrhundert, als alle Mauern einstürzten, alles wieder neu errichtete. Wir in diesem Jahrhundert haben weder das Auge noch das Geschick, Mauern zu schichten wie die Alten; außerdem arbeitet die Zeit für sie und läßt das Gestein in der Mauer sich mit Gottes Hilfe setzen, nur daß ab und zu einmal von den Nachfahren ein Handschlag hinzukommt. Bis es wieder Vulkanausbrüche gibt.«
»Ich habe sagen hören, daß du nie ja oder nein sagst, Hlidarbauer«, sagte der Bezirksvorsteher. »Bei passender Gelegenheit möchte ich ausprobieren, ob das stimmt.«
Der Bauer kicherte leise und gab Antwort: »Das habe ich nun eigentlich nicht bemerkt, mein Lieber«, sagte er und folgte der Sitte echter Steinahlidarleute, mit einem großen Herrn wie mit einem Bruder oder eher noch wie mit einem Gemeindearmen zu sprechen, nicht so sehr, weil man ihn wegen seiner Vorzüge schätzte, sondern weil man in ihm eine göttliche Persönlichkeit sah. »Als ob es in dieser Welt nicht egal ist, ob du ja oder nein sagst, hehehe, und kommt jetzt bitte zum Haus, Freunde, seht hinein und trinkt einen Schluck Wasser.«
»Erzähl mir etwas vom deinem grauen Fohlen, das der Bezirksvorsteher und ich uns auf dem Wiesengrund angesehen haben. Ein schönes Tier; woher stammt es?«
»Das beste wäre, die Kinder danach zu fragen«, sagte der Bauer. »Sie glauben, daß es aus dem Haff gestiegen ist. Oft scheint mir, daß die lieben Kinder im Vergleich zu uns Erwachsenen viel mehr vom Dasein haben. In der Tat ist es in gewisser Hinsicht ihr Pferd.«
Der Bezirksvorsteher war nicht aus dem Sattel gestiegen, doch Björn von Leirur führte sein Pferd am Zügel, als er mit dem Bauern den Hofweg entlangging. Die Kinder standen schon draußen auf dem Hofpflaster. Björn von Leirur küßte sie und schenkte jedem nach guter Leute Brauch eine Silbermünze. »Hier sehe ich ein Mädchen, das ich zur Frau haben will, wenn es groß ist, und einen Jungen, den ich zum Verwalter haben möchte«, sagte er, »doch was wollte ich denn eigentlich sagen, lieber Steinar? Ja, zum Teufel, du bist ein tüchtiger Kerl, daß du dieses hübsche Fohlen besitzt. Mann Gottes, was willst du mit einem solchen Pferd? Willst du es mir nicht verkaufen?«
»Als ob ich mich auf so etwas einlasse, solange die Kinder es für ein Wasserpferd halten. Ich denke, wir sollten damit warten, bis es ein gewöhnliches Pferd geworden ist wie schließlich die meisten Pferde und die Kinder nicht mehr klein sind.«
»Das ist recht von Ihnen«, sagte der Bezirksvorsteher. »Nie das Märchen seiner Kinder verkaufen. Ich denke, Björn von Leirur hat genug, um sich damit zu amüsieren; soviel ich weiß, hat er seit Weihnachten zwei große Schiffbrüche gehabt. Außer all den besseren Bäuerinnen und Bauerntöchtern in den westlichen Bezirken.«
»Unser neuer Bezirksvorsteher hat manchmal eine etwas komische Redeweise«, sagte Björn von Leirur. »Man sagt, er könne dichten.«
»Bauer«, sagte der Bezirksvorsteher, »wenn Sie dieses Pferd ablassen, dann verkaufen Sie es mir; mir fehlt im nächsten Sommer gerade so ein Pferd, wenn ich nach Süden reite, um den König zu empfangen.«
»Ich habe noch keinen Beamten gekannt, der nicht aus einem Klassepferd in einem Jahr eine Schindmähre gemacht hätte«, sagte Björn von Leirur. »Doch das sollst du wissen, mein lieber Steinar, der du mich gut kennst: wenn ich einmal ein gutes Pferd erworben habe, dann mache ich daraus ein noch besseres Pferd.«
Der Bezirksvorsteher steckte sich, im Sattel sitzend, eine Pfeife an und sagte dabei: »Ja, du verkaufst sie für Goldgeld nach England, wo sie geblendet und in die Kohlenbergwerke gebracht werden. Das Pferd kann sich glücklich preisen, das hier in Island zur Schindmähre wird, statt dir in die Hände zu fallen.«
»Schämt euch was, Kinder«, sagte Steinar von Hlidar.
»Veranschlage, was du willst«, sagte Björn von Leirur. »Wenn du Bauholz brauchst, dann bitte! Kupfer und Eisen habe ich mehr als genug, und Silber wie Mist. Komm her und guck hier hinein, was du da siehst!«
Er nahm eine große lederne Börse aus seinem Mantel. Der Bauer Steinar ging zu ihm hin und sah nach.
»Was würden wohl meine Kinder sagen, wenn ich wirklich unser Elfenpferd für Gold verkaufte?« sagte der Bauer.
»Recht so!« sagte der Bezirksvorsteher. »Gib nicht nach!«
»Wenn du kein Gold willst, dann gebe ich dir eine frühkalbende Kuh«, sagte Björn von Leirur. »Zwei, wenn du willst.«
»Ich habe keine Zeit mehr für diese verdammte Trödelei«, sagte der Bezirksvorsteher.
»Es ist nun einmal so, mein Lieber: wenn die Welt in den Augen unserer Kinder nicht mehr voller Wunder ist, dann ist nicht mehr viel übrig«, sagte Steinar. »Ob wir nicht noch ein bißchen warten?«
»Reit mit dem Grauen nach Leirur, wenn du in guter Stimmung bist, wir wollen ihn uns beide ansehen und weiter miteinander sprechen. Es war schon immer mein Lebensinhalt, gute Pferde zu betrachten«, sagte Björn.
»Reit nie mit dem Grauen nach Leirur«, sagte der Bezirksvorsteher, »auch nicht, wenn er dir eine Kuh bietet. Du kommst am Abend mit ein paar Schusternadeln zurück.«
»Ach, halt den Mund, Bezirksvorsteher! Mein lieber Steinar von Hlidar kennt mich gut genug, um zu wissen, daß ich bei niemandem zweimal nach einem Pferd nachfrage. Und wir küssen uns trotzdem, ob du mir ein Pferd verkaufst oder nicht.«
Dann ritten die Gäste vom Hof.
3. Beginn der Romantik in Island
Das Volksleben in Island war noch nicht so romantisch geworden, daß Leute vom Lande an Feiertagen im Sommer Reittouren ähnlich den Waldausflügen in Dänemark unternommen hätten, wie es später der Fall war. In jener Zeit hielt man es auf dem Lande noch für unangebracht, sich mit irgendeiner Sache nur deswegen abzugeben, weil sie amüsant war. Vor mehr als hundert Jahren hatte der Dänenkönig Vergnügungen in Island mit einer Verordnung abgeschafft. Der Tanz sei des Teufels, hieß es, und war damals seit vielen Generationen auf dem Lande nicht mehr geübt worden. Man hielt es nicht für anständig, daß unverheiratete junge Leute einander zu nahe kämen, außer höchstens, um uneheliche Kinder zu kriegen. Das ganze Leben sollte nützlich und gottgefällig sein. Dennoch hatte das Jahr seine Feste.
Eines der großen Feste des Jahres war die Pferchzeit mit der Lammabsetzung, wenn man die Lämmer entwöhnte und von den Mutterschafen trennte. Es fiel auf die Zeit um die Johannismesse, wenn die Sonne auch des Nachts scheint. Gott wohlgefällige Dauerläufe hinter Schafen her wurden Tag und Nacht veranstaltet, und die Luft erzitterte von schrillem Geblök, denn Schafe blöken sich in den Schlaf. Die Zunge hing den Hunden Tag und Nacht aus der Schnauze, und viele konnten nicht mehr bellen. Nachdem die Lämmer einige Nächte lang von den Mutterschafen getrennt gehalten worden waren, wurden sie schließlich in die Berge getrieben. Das nannte man auf die Lämmerberge gehen. Es war für alle eine festliche Prozession, nur nicht für die Lämmer.
Es wurde die ganze Nacht getrieben, die längste Zeit am Fluß hinauf, von Stufe zu Stufe, bis sich das Hochland auftat, unbekannte Berge mit unbekannten Seen dazwischen, und in ihnen spiegelte sich ein unbekannter Himmel. Das war die Welt der Wildgänse, und mit ihnen sollten sich die Lämmer den Sommer über in die Leckerbissen der Einöden teilen. Hier konnte man den Hauch der Gletscher verspüren, so daß Snati niesen mußte.
Die Bewohner einiger Höfe an den Hlidar verabredeten sich für den Lämmerauftrieb. An diesem Ritt durften manchmal auch Frauen teilnehmen; treue Mägde hatten sich seit dem vorigen Jahr auf diese Herrlichkeit gefreut, denn das Einerlei der Männer war nichts im Vergleich zu dem der Frauen; schließlich ein paar junge Leute und halbwüchsige Kinder. Zur Stelle war auch der Bursche mit dem strohblonden Haar aus Drangar, der eine Saison lang unten in Thorlakshöfn zum Fischfang gewesen war und auf dem Heimweg vom Fischfangplatz nach der Saison in Hlidar an den Steinahlidar hereingeschaut hatte. Er wohnte ein paar Gehöfte weiter nach Osten, wo sich einige Felsen aus dem Gestein herausgelöst hatten. Es war das Konfirmationsjahr der kleinen Steina. Und um die Tatsache, daß sie ein großes Mädchen geworden war, feierlich zu begehen, hatte ihr Vater sie ohne viel Worte auf das Reitpferd Krapi gesetzt; das war vorher nie geschehen. Er war sich dessen sicher, daß das Pferd nicht mit ihr davonlaufen würde, da das Tempo von bekümmerten Lämmern bestimmt wurde.
Die Liebe – was wir heute darunter verstehen – war damals noch nicht nach Island importiert worden. Die Menschen paarten sich ohne Romantik nach einem unausgesprochenen Naturgesetz und gemäß dem deutschen Pietismus des Dänenkönigs. Das Wort Liebe war allerdings in der Sprache bewahrt, ein Überbleibsel aus grauer Vorzeit, als die Wörter etwas ganz anderes bedeuteten, vielleicht in bezug auf Rosse gebraucht wurden. Dennoch setzte die Natur das ihre durch, wie weiter oben gesagt, denn wenn sich einem jungen Mann und einem jungen Mädchen keine Gelegenheit bot, sich heimlich anzublicken, sei es während der langen deutschen Predigten über den Pietismus oder auf den Schafsammelplätzen, wo das Gejammer lauter ist als sonstwo auf der Welt, dann blieb es nicht aus, daß sie sich im Sommer beim Heubinden zufällig berührten. Und obwohl nur der Monolog der Seele allein erlaubt war, und der Volksdichter sich in einem Gedicht selbst nicht näher kommen durfte als durch die Behauptung, er spotte des Schicksals, wird dennoch angenommen, daß die Leute alles an der rechten Stelle gehabt haben, damals wie heute. Mit einem unauffälligen Zeichensystem und täuschender Redeweise war es möglich, in ganzen Gegenden natürliches Menschenleben aufrechtzuerhalten. Die Tochter des Bauern von Hlidar sah während des ganzen Lämmerauftriebs diesen Burschen nicht an, sondern blickte immerfort in die entgegengesetzte Richtung. Sie saß auf dem Grauen so sicher, als ob sie nie ein anderes Pferd geritten hätte.
Als sie so weit auf das Hochland gekommen waren, daß Snati zu niesen begann, lag da ein großer Binnensee gegen die aufgehende Sonne, und ein geheimnisvoller kühler Hauch atmete ihnen entgegen. Der Bursche ritt plötzlich an ihre Seite und sagte:
»Wurdest du nicht im Frühjahr eingesegnet?«
»Ich war ein halbes Jahr über das Alter hinaus. Ich hätte voriges Jahr angenommen werden sollen, doch dann wäre ich ein bißchen zu jung gewesen.«
»Als ich auf dem Weg vom Fischfang bei euch vorbeikam und dich sah, traute ich meinen Augen nicht.«
»Ach, ich bin jetzt sicher ein schrecklich großes und häßliches Trampel. Das einzig Gute ist, daß ich im Innern noch klein bin.«
»Ich habe auch noch Zeit, klüger zu werden, obwohl ich viel gelernt habe, als ich auf See war«, sagte er.
»Ich glaube noch an vieles, was vielleicht nicht wahr ist«, sagte sie, »und verstehe das andere nicht.«
»Hör mal«, sagte er, »du solltest mir erlauben, schnell einmal auf dem Grauen zu reiten – wir sind hier hinter einem Hügel, wo Steinar von Hlidar, dein Papa, nichts sehen kann.«
»Pfui, was muß ich hören! Als ob ich nichts anderes zu tun hätte, als dir hier auf der Hochfläche das Pferd zu überlassen, wo Seen sind. Wo es doch ein Wasserpferd ist!«
»Ein Neck?« fragte er.
»Weißt du das nicht?« sagte sie.
»Soweit ich sehe, stehen seine Hufe nicht nach hinten.«
»Ich habe auch immer gesagt, daß es nur von einer Elternseite her ein Neck ist«, sagte das Mädchen. »Paß auf, ich glaube, es wird nach uns gerufen.«
»Ich rede später mit dir; bald. Ich komme dich besuchen«, sagte er.
»Ach, tu das nicht, um Gottes willen, ich bekäme Angst. Und dann kennst du mich überhaupt nicht. Und ich kenne dich auch gar nicht.«
»Ich meinte nicht, daß ich gleich komme«, sagte er. »Nicht heute und nicht morgen. Und auch nicht übermorgen. Vielleicht, wenn du siebzehn Jahre alt bist. Dann bin ich schon lange mündig. Ich hoffe, daß ihr dem Björn von Leirur dieses Pferd noch nicht überlassen habt, wenn ich komme.«
»Ich müßte mich so schämen, daß ich mich in einer Truhe verstecken würde« – und damit wendete sie das Pferd von dem Burschen ab, so daß sie ihn nicht anzusehen brauchte, auch dauerte es keinen Augenblick, bis ihre Väter sie eingeholt hatten.
»Wir müssen aufpassen, daß die letzten der Herde nicht zurückbleiben, meine Lieben«, sagte ihr Vater.
Der andere Bauer sagte: »Ich sollte mich sehr irren, wenn ihnen nicht etwas Gutes in den Sinn gekommen ist.«
4. Das Pferd und das Schicksal
Lämmerauftrieb zur Sommersonnenwende, dazu ein Pferd vom Geschlecht der Wassergeister und eine Brise vom Gletscher – wer in seiner Jugend eine solche Reise gemacht hat, dem wird sie später immer wieder im Traum erscheinen, auch wenn es ein langes Leben wird; zuletzt mit der wortlosen Leere verlorener Hoffnung und nahen Todes. Sie ritt Krapi nur dieses eine Mal. Warum nicht alle Zeit nach diesem Tag?
»Voriges Jahr, Steinar, sprach ich mit Ihnen darüber, ob Sie mir den Grauen, gleich gegen welche Bedingung, ablassen würden, jetzt, diesen Sommer, wenn ich nach Süden reite, um den König zu sehen. Es hat schon was für sich, wenn man an einem solchen Tage wohlberitten nach Thingvellir kommt, nicht nur gegenüber den anderen Bezirken, sondern auch gegenüber den Dänen selbst.«
Steinar von Hlidar kicherte seiner Gewohnheit gemäß.
»Oft habe ich die Pferde des Bezirksvorstehers bewundert«, sagte er. »Das sind zuverlässige Tiere und geeignet für Flüsse, das ist Arbeit und kein Pfusch. Über den König will ich nichts sagen, doch es würde mir Spaß machen, den Bezirksvorsteher hierzulande zu sehen, der besser beritten wäre.«
»Ja oder nein?« sagte der Bezirksvorsteher. Er hatte es eilig, wie Beamte überhaupt, und hatte keine Zeit, sich Ausflüchte anzuhören.
»Hm«, sagte Steinar von Hlidar und schluckte seinen Speichel hinunter. »Dazu ist erst einmal zu sagen, Freund, daß das Pferd, von dem du sprichst, ein im höchsten Grade unerprobtes Tier ist und nicht einmal ganz gezähmt. Es ist nun mal so, daß es das Märchenpferd der Kinder geworden ist; und wenn überhaupt, dann ist es soviel wert, wie es in ihren Augen wert ist, solange sie jung und klein sind.«
»Es ist lebensgefährlich, Kinder auf ungezähmte Pferde zu setzen«, sagte der Bezirksvorsteher. »Man muß sie auf alten Kleppern festbinden.«
»Bisher habe ich sie allerdings wenig auf ihm reiten lassen«, sagte der Bauer, »doch wenn das zu sagen gestattet ist – ich weise stets auf Krapi hin, wenn ich ihnen Geschichten von erhabenen Pferden erzähle, etwa vom Pferd Grani, auf dem Sigurd der Drachentöter ritt, als er auszog, um mit Fafnir zu kämpfen; oder von dem Pferd Faxi des seligen Hrafnkell Freysgodi, jenem Pferd, in das der Gott Freyr mit dem Spruch einging, daß, wer es auch ritte, außer dem Goden selbst, dafür das Leben einbüßen sollte; und dann vergesse ich auch nicht den Sleipnir, der achtfüßig die Milchstraße entlanggaloppierte, so daß die Sterne herabstürzen; oder aber ich erzähle ihnen, daß das Pferd der Neck sein könnte und hier aus dem Haff gestiegen ist.«
Der Bezirksvorsteher steckte sich eine Pfeife an.
»Es hat keinen Sinn, mir mit Geschichten aus dem Altertum zu kommen«, sagte er. »Ich kann meine Geschichten selber machen, Freund. Ihr Bauernkerle beachtet nicht, daß Sigurd der Drachentöter mitsamt dem Drachen und dem ganzen Pumpwerk längst in der Hölle gelandet ist. Doch Björn von Leirur kann euch abluchsen, was er will, sogar die Seele, wenn eine da wäre und er sie haben wollte.«
»Oh, ich hätte nun gerade nicht daran gedacht, meinen guten Björn von Leirur mehr als ein angemessenes Stück auf unserem Krapi reiten zu lassen, obwohl ich meinerseits Björn alles Gute gönne«, sagte Steinar von Hlidar.
»Der Tag könnte kommen, Freund, an dem dieses Pferd für wenig weggeht und an dem du bereust, es mir verweigert zu haben«, sagte der Bezirksvorsteher und stieg in den Sattel.
Der Bauer Steinar von Hlidar lachte wieder mit seiner dünnen Stimme, wie er da auf der Steinplatte vor der Tür stand. »Das weiß ich wohl, daß es manchem nie gepaßt hat, wenn ein armer Mann ein schönes Pferd besaß; ich begreife auch, daß ihr deshalb gehörig euren Spaß mit mir treibt, ihr großen Herren. Damit muß man sich dann abfinden, Freund. Es ist sicher wahr, daß man vielleicht nur noch kurze Zeit zu warten braucht, bis dieses Pferd anderen Pferden nichts mehr voraus hat; und vielleicht ist dieser Tag schon da, obwohl ich es nicht wahrhaben will.«
Wiederum erwies es sich: Je mehr man in Steinar von Hlidar bohrte, um so gutmütiger wurde das Gekicher dieses Bauern. Und das Ja, das ihm sowieso von allen Wörtern am fernsten lag, entfernte sich nur noch mehr, bis es in die Unendlichkeit entschwunden war, wo das Nein wohnt.
Doch Steinar von Hlidar konnte sich auch einen Spaß erlauben wie die Großen. Es fehlte nicht an Leuten, die hämisch grinsten, als sich herumsprach, er hätte es sowohl dem Bezirksvorsteher wie Björn von Leirur abgeschlagen, ihnen ein Pferd für den Ritt nach Thingvellir zu verkaufen, doch verlauten lassen, er wolle gegen Ende der Heuernte selbst hinreiten und den König begrüßen.
Nun war schon längst festgelegt, welche besseren Leute aus der Gegend im Gefolge des Bezirksvorstehers nach Süden reiten sollten; überflüssig zu bemerken, daß Steinar von Hlidar nicht zu ihnen gehörte. Doch machte es ihm offensichtlich nichts aus, allein zu reiten.
Es war nicht zu bestreiten, etwas war an diesem Pferd, das von anderen Pferden abstach und sie in den Schatten stellte: etwas in der Gangart, in der Haltung, im Blick und in allen Reaktionen, was jedenfalls darauf hindeutete, daß es nicht ganz stimmte, wenn man behauptete, das Pferd sei stehengeblieben, seit es das Geweih verloren habe; seine Entwicklung wäre gänzlich abgeschlossen, obwohl es den vollkommensten Fuß der Welt ausgebildet habe, mit nur einer Zehe in einem angewachsenen Schuh. Zumindest überragte dieses Pferd, wie der Papst auf seine Art, nicht nur andere Pferde, sondern auch seine ganze Umgebung, Wiesen, Seen, Berge…
Es stand außer Zweifel, daß Steinar von Hlidar mit diesem Pferd zum König reiten wollte, oder wie er sich aus gewohnter Bescheidenheit gegenüber seinen Nachbarn ausdrückte: »Mein Krapi will nach Thingvellir, um mit dem Hlidarbauern im Sattel den König zu begrüßen.« In der Gemeinde fehlte es jedoch nicht an Spaßvögeln, die diesen Satz umdrehten und sagten, der Schimmel von Hlidar wolle auf seinem Besitzer nach Thingvellir reiten, um den König zu sehen.
Obwohl Krapi zu Hause auf dem Hofplatz brav wie ein Kind war und sich am Rand der Hauswiese in Hlidar mit der Leine um den Hals wohl fühlte, war es ein ganz anderes Pferd, wenn es auf die Weide sollte. Zu Hause benahm es sich wie ein vorbildlicher Gefangener, der jegliche Belohnung verdient hat, sogar die, daß man ihn schnellstens freigibt. Im Freien tat es, was es wollte. Wenn es mit anderen Pferden auf den nahe gelegenen Grasflächen an den Sandblößen weidete und man es holen wollte, so schwebte es wie ein Windhauch seinen Verfolgern davon; und je mehr sie sich ihm zu nähern versuchten, um so weiter entfernte es sich; und je schneller sie sich heranmachten, um so mehr glich es dem Wind und flog über Geröll und Morast, Wasserläufe und Erdlöcher wie über ebene Wiesengründe; und wenn ihm die Sache über wurde, nahm es Kurs auf den Berg. So war es auch an jenem Tag, als Steinar von Hlidar mit dem Zaum hinter dem Rücken auf die Wiese ging und das Pferd mit List in seine Gewalt bringen wollte, am Tage vor seiner Abreise. Das Pferd lief fort und drehte den erhobenen Hals hin und her, als ob es scheu geworden wäre, lief dann auf abenteuerlichen Pfaden den steilen Hang hinauf und war über den Bergesrand verschwunden. Das bedeutete, daß jetzt der Bauer mit seinen Leuten den Berg nach Pferden absuchen und sie hinabtreiben mußte, bis das Pferd in einem Sammelpferch gefangen werden konnte. Als die Leute von Hlidar das Pferd bis über den Bergesrand verfolgt hatten, sahen sie, wie es allein ganz oben auf einer Anhöhe stand und sich gegen den Himmel abhob; es sah zu den Gletschern hinüber und wieherte laut.
»Wiehere nur gut und lange die Gletscher an, mein Lieber«, rief da der Bauer Steinar dem Pferd zu, »denn es kann sein, daß du jetzt für eine Weile eine andere Aussicht bekommst.«
Die Staubwolken vom Ritt der noblen Herren und großen Leute hatten sich auf allen Reitpfaden an den Steinahlidar gelegt, das Pferdegetrappel hatte sich weiter im Süden mit dem anderer nobler Herren und königlicher Beamter vereinigt. Beamte sollten den König empfangen, wenn sein Schiff im Hafen von Reykjavik einlief, Bezirksvorsteher und Althingsabgeordnete waren von Amts wegen erste Gäste bei den bevorstehenden Feiern in der Hauptstadt zu Ehren des Königs. An einem ruhigen Spätsommerabend, an dem nur die eine oder die andere Seeschwalbe am Wege schlief und ein Austernfischer auf den Hauswiesen umherstolzierte, inmitten der Stille, die bei den zu Hause Gebliebenen eintritt, wenn die Herren zum Fest geritten sind, sattelte der Bauer von Hlidar an den Steinahlidar sein Pferd und ritt allein fort. Der Hund Snati war eingeschlossen worden. Die Frau stand auf der Steinplatte vor der Tür und wischte sich die Pflichttränen ab, als sie ihren Mann den Hofweg hinausreiten sah; die beiden Kinder standen links und rechts neben ihr und hatten den Kopf des Pferdes umarmt und ihm zum letzten Mal das duftende Maul geküßt. Sie wichen nicht vom Hofplatz, bis endlich ihr Papa an den Geröllhalden vorbei und im Westen hinter dem Berg Hlidaröxl verschwunden war.
5. Heilige Steine mißhandelt
In der Brandschlucht auf Thingvellir, wo man einst Menschen auf den Scheiterhaufen führte, hatte sich an diesem Spätsommerabend am Tage vor der Ankunft des Königs eine kleine Schar von Bauern in der Dämmerung zusammengefunden. Das Gestein unten am Fels ist größtenteils mit Kissenmoos überzogen, und auf einen mannshohen, halbbemoosten Felsbrocken war ein Mann geklettert, um zu seinen Landsleuten über eine wichtige Sache zu sprechen. Eine kleine Gruppe neugieriger Besucher war dorthin gewandert, um zu hören, was es auf dieser Versammlung Neues gäbe. Der Bauer Steinar von Hlidar gehörte zu denen, die sich dazugesellten. Er hatte seine Reitpeitsche in der Hand.
Von weitem hörte es sich für den Bauern ganz so an, als trage dieser Mann etwas aus der Bibel vor, doch fand er es sonderbar, daß an diesem Ort niemand jenes andächtige Gesicht machte, das man sonst bei einem solchen Vortrag zu sehen pflegt. Hingegen trugen dort nicht wenige Leute eine ziemlich geringschätzige Miene zur Schau, und einige hielten mit ihrem Mißfallen über das Gesagte nicht hinter dem Berg. Man fiel dem Redner oft ins Wort, manche riefen ihm Schimpfwörter zu – und nicht immer anständige –, andere schrien und lachten. Doch der Redner blieb die Antwort nicht schuldig und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, obgleich er von Natur nicht sehr wortgewandt war.
Der Mann war anscheinend im gleichen Alter wie der Hlidarbauer; er war grobschlächtig und hochschultrig, doch ziemlich mager, und sein Gesicht war ein wenig abgezehrt, auch wohl blatternarbig und vom Schicksal gezeichnet. Seine Erscheinung zeugte von ungewöhnlicher Erfahrung. In jener Zeit hatten die meisten Isländer unter dem Backenbart volle Wangen, und ihre Lebensnöte waren so natürlich wie der Kummer der Kinder; selbst alte Männer hatten den Gesichtsausdruck von Kindern. Damals hatten viele Leute in Island eine fahle Gesichtsfarbe; je nach Witterung und Ernährungszustand überzog das Gesicht ein kaltes Blaurot oder eine blauschwarz getönte Röte. Dieser Mann hingegen war leicht graubraun im Gesicht, Gletscherwasser oder aufgewärmtem Kaffee mit Magermilch darin nicht unähnlich. Er hatte dichtes, krauses Haar, und seine Kleider waren ihm zu groß; doch er war kein Schwächling.
Worüber sprach dieser Mann in Thingvellir an der Öxara außerhalb der Tagesordnung der großen nationalen Gedenkfeier, als allen guten Bauern im Lande ob des Anbruchs besserer Zeiten die Brust schwoll?
Steinar von Hlidar fragte, wer dieser Pfarrer sei, und bekam zur Antwort, es sei ein Irrgläubiger.
»Na so etwas«, sagte Steinar von Hlidar. »Es ist nicht ausgeschlossen, daß ich so einen Mann sehen möchte. So viele auch in Hlidar vorbeikommen, die meisten wußten über den Allmächtigen Bescheid. Mit Verlaub, Leute, was ist der Irrglaube dieses Mannes?«
»Er ist aus Amerika hierhergekommen, um die Offenbarung eines neuen Propheten gegen Luther und den Papst zu verkünden«, antwortete der Mann, den Steinar angeredet hatte. »Der Prophet soll Joseph Smith heißen. Sie haben viele Frauen. Aber die Bezirksvorsteher haben die Bücher des Mannes mit der Offenbarung verbrannt. Er ist hierher nach Thingvellir gekommen, um den König aufzusuchen und die Erlaubnis zu erwirken, neue Ketzerbücher herzustellen. Sie tauchen die Leute bei der Taufe unter Wasser.«
Der Bauer Steinar trat näher. Die Versammlung war auf dem Punkt angelangt, wo von einer geordneten Darlegung nicht mehr die Rede sein konnte. Die Verkündigung des Fremden hatte die Leute so aufgebracht, daß der Irrgläubige kaum Gelegenheit bekam, einen Satz zu sagen, ohne daß die Zuhörer aufschrien, um seine Ansichten auf der Stelle zu widerlegen oder genauere Erklärungen zu verlangen. Einige waren bereits so zornig, daß sie kaum mehr genug höhnische Worte für den Irrgläubigen fanden.
»Welche Beweise hat der Kerl, den du nanntest, dafür, daß man unter Wasser tauchen soll?« schrie ein Dazwischenrufer.
»Wurde der Erlöser vielleicht nicht untergetaucht?« sagte der Mann, der die Rede hielt. »Glaubst du, der Erlöser hätte sich untertauchen lassen, wenn der Herr die Kindertaufe annimmt? In der Bibel wird stets untergetaucht. Kindertaufe gibt es nicht in Gottes Wort, no Sir! Es kam niemandem in den Sinn, unvernünftige Kinder mit Wasser zu besprengen, nicht vor dem dritten Jahrhundert zu Anfang des Großen Abfalls, als unaufgeklärte und gottlose Menschen damit anfingen, Kinder zu taufen, die einem Götzen geopfert werden sollten; yes Sir. Sie hielten sich für Christen, doch opferten sie dem Teufel Saturnus. Später griff natürlich der Papst diese Unsitte auf wie den ganzen übrigen Irrglauben; und Luther nach ihm, obwohl er sich rühmte, es besser zu wissen als der Papst.«
Einer fragte: »Kann Joseph Smith Wunder tun?«
Der Redner fragte dagegen: »Wo sind die Wunder Luthers? Und wo sind die Wunder des Papstes? Ich habe nichts davon gehört. Hingegen ist das ganze Leben der Mormonen ein einziges Wunder, seit Joseph Smith zum ersten Mal mit dem Herrn sprach. Wann sprach Luther mit dem Herrn? Wann sprach der Papst mit dem Herrn?«
»Gott sprach mit dem Apostel Paulus«, sagte ein theologisch Gebildeter.
»Pah, das war ein ziemlich kurzes Gespräch«, sagte der Redner. »Und Gott würdigte den Mann nur dieses eine Mal eines Blickes. Hingegen sprach der Herr mit Joseph Smith nicht einmal und nicht zweimal und nicht dreimal, sondern hundertdreiunddreißigmal, die Hauptoffenbarungen nicht mitgezählt.«
»Die Bibel ist Gottes Wort hier in Island«, sagte der aufrechte Theologe, der vorher gesprochen hatte; doch darauf gab der Redner schnell eine Antwort:
»Glaubst du«, sagte er, »daß Gott sprachlos geworden war, als er die Bibel zu Ende diktiert hatte?«
Ein witziger Zwischenrufer meinte so: »Vielleicht nicht sprachlos, aber wenigstens baff bei dem Gedanken daran, daß Joseph Smith kommen und die Geschichte verhunzen würde.«
»Sprachlos oder baff, darüber will ich mich mit dir nicht streiten, guter Mann. Ich glaube zu verstehen, daß du annimmst, Gott sei allerwegen verstummt; und Gott habe bald zweitausend Jahre lang den Mund nicht aufgetan.«
»Ich glaube zumindest nicht, daß Gott mit einem Narren spricht«, sagte der Mann.
»Nein, das stimmt«, antwortete der Irrgläubige, »er spricht sicher eher mit Chorbauern und Bezirksvorstehern und dann vielleicht mit dem und jenem Pfarrer. Es sei mir gestattet, noch das eine hinzuzufügen, weil ihr nach Wundern gefragt habt: was für ein Wunder habt ihr dem entgegenzusetzen, als Gott Joseph den Weg zu den goldenen Tafeln im Hügel Cumorah zeigte und dann in einer unmittelbaren Offenbarung die Mormonen in das verheißene Land führte, welches ist Gottes Wohnung und das Reich der Heiligen der letzten Tage im Salzseetal?«
»Sieh da«, sagte der Zwischenrufer, »ist jetzt Amerika mit seiner Allerweltssammlung von Verbrechern und Landstreichern zum Reich Gottes geworden?«
Jetzt mußte der Mormone seinen Speichel ein- oder zweimal herunterschlucken.
»Ich gebe zu«, sagte er schließlich, »es kann manchmal passieren, daß einem hier in Island die Zunge am Gaumen klebenbleibt und daß ungebildete Leute wie ich sich alle Mühe geben müssen, sie loszubekommen. Das eine möchte ich euch jedoch sagen, weil ich weiß, daß ich aus voller Überzeugung spreche: Alles, was der Erlöser und die Heiligen des Papstes wollten und nicht konnten, und wenn auch alle eure Könige im Luthertum hinterdreinklapperten, das vollbrachten Joseph Smith und sein Jünger Brigham Young, als sie gemäß dem ausdrücklichen Gebot und Befehl Gottes uns Mormonen in die Gottesstadt Zion führten, die auf die Erde herabgekommen war; und über jenem Land scheint das Licht der Herrlichkeit; dort ist Gottes Freudental und das Tausendjährige Reich auf Erden. Und weil dieses Tal hinter den Gebirgen, Steppen, Wüsten und Strömen Amerikas liegt und weil zweitens Amerika die goldenen Tafeln des Herrn bewahrte, die Joseph fand, ist dieses Land schon genug gepriesen, wenn nur sein Name genannt wird.«
»Und von allen Schwindlern und Vagabunden in Amerika ist Joseph der Tafelkönig der schlimmste gewesen«, rief einer von achtzehn.
»Wo ist euer verheißenes Land?«
»Im Himmel.«
»Aha, konnte ich mir denken. Ist das nicht schrecklich weit oben im Luftmeer?«
Ein anderer sagte: »Es wäre ganz schön, diese goldenen Tafeln zu Gesicht zu bekommen. Du hast wohl nicht zufällig eine Scherbe davon mit? Ja, und wenn du auch nur ungefähre Tafeln über den Boden in Zion hättest!«
»Im Salzseetal ist es gang und gäbe, daß ein Bauer zehntausend Mutterschafe und dazu noch anderes Vieh besitzt«, sagte der Mormone. »Wie sieht es in deinem Tausendjährigen Reich aus?«
Es war offensichtlich, daß sich das überhebliche Wesen der Männer bei der Schilderung der Viehzucht im verheißenen Land etwas legte.
»Unser Erlöser ist unser Erlöser, gelobt sei Gott!« bekannte ein gottesfürchtiger Mann, wie um sich gegen diesen großen Schafbesitz zu wappnen.
»Ja, ist Joseph vielleicht nicht Joseph?« sagte der Mormone. »Das möchte ich doch annehmen, auch wenn ich nicht studiert habe. Joseph ist Joseph. Gelobt sei Gott!«
»Das Neue Testament legt Zeugnis ab für uns«, rief der mit dem Predigerton. »Wer an Christus glaubt, glaubt nicht an Joseph.«
»Jetzt hast du gelogen!« sagte der Mormone. »Wer an Christus glaubt, der kann an Joseph glauben. Nur wer an das Neue Testament glaubt, kann an die goldenen Tafeln glauben. Und wer das Neue Testament ein Schwindelbuch nennt, zurechtgemacht von Vagabunden, und fragt: Wo ist die Urschrift?, der kann auch nicht an Joseph glauben. Solch ein Mensch wird dir sagen, daß er das Neue Testament mit den Tafeln des Joseph auf eine Stufe stellt. Solch ein Mensch sagt: Wie die Bekannten des Erlösers das Neue Testament zusammenlogen, so logen Josephs Bekannte die goldenen Tafeln zusammen. Solch ein Mensch will dir beweisen, daß der Erlöser und Joseph beide unredliche Männer waren. Liebe Brüder, die Leute, die so sprechen, wie ich es jetzt geschildert habe– mit denen sprechen wir Mormonen nicht. Mit ihnen haben wir nichts gemein.«
»Ich glaube so viel verstanden zu haben, Freund«, sagte ein wohlhabender Bauer, »daß du uns eben erzählt hast, wieviel Schafe dir gehören. Hast du zehntausend gesagt, wie? Willst du uns jetzt nicht sagen, wieviel Frauen du hast?«
»Wieviel Frauen hatten sie in der Bibel? Zum Beispiel Männer wie Salomon, der doch mindestens ein ebenso großer Chorbauer war wie du!« sagte der Mormone. »Und erlaubte vielleicht Luther nicht dem Landgrafen von Hessen, mehr als eine Frau zu haben? Und wozu wurde der Papismus in England abgeschafft? Nur damit König Heinrich viele Frauen haben konnte.«
»Aber wir hier sind Isländer«, sagte eine Stimme aus der Schar.
»Ja, die Isländer haben schon immer Vielweiberei getrieben«, sagte der Mormone.
Das verschlug verschiedenen guten Leuten den Atem.
Einige schrien: »Das lügst du!« Andere forderten den Mormonen auf, seine Behauptung zu beweisen.
»Nun ja, sie taten es wenigstens, als ich noch hier war«, sagte der Mormone. »Nur in der Weise, daß es einem Mann freistand, viele Frauen zu Huren zu machen, statt sie durch den Ehekontrakt in den Ehrenstand zu erheben, wie wir Mormonen es tun. Die Mormonen lassen nicht vor ihren Augen hoffnungsvolle Mädchen in Elend und Schande verkommen, wenn diese die Tölpel nicht ehelichen wollen, die sich ihnen gerade bieten. Viele tüchtige Mädchen sind hingegen bereit, gemeinsam einen guten Mann zu haben, statt sich mit irgendeinem Jammerlappen zu begnügen: Wir im Salzseetal wollen keine Frauen zu Huren, alten Jungfern, entehrten Müttern und Witwen werden lassen, die dann in die Fänge schlechter Männer geraten. Damals, als ich in Island aufwuchs, waren die Gemeinden voll von solchen Frauen. Für Kinder wurden Vaterschaften und für Frauen wurden Heiraten festgelegt, je nachdem, wessen Ansehen in diesem oder jenem Fall gerettet werden mußte. Ich bin selbst in Vielweiberei gezeugt und geboren. Man hielt mich für den Sohn eines Pfarrers. Bei den Beamten, die lange Inspektionsreisen zu machen hatten, war es Brauch, daß sie bei Frauen lagen, wie sie wollten, verheirateten und unverheirateten. Meine Mutter verschlug es auf die Westmännerinseln, und dort ging sie an der Verachtung anderer zugrunde; ich wurde aufs Festland gebracht und in ihrer Heimatgemeinde aufgezogen. Ein Ziehkind, meistens ein uneheliches Kind, das war in Island nicht gerade eine angesehene Person. Mir wurden immer nur am ersten Sommertag die Kleider gewechselt und die Haare geschnitten. Da wurde der Sack genommen, auf dem der Hund den Winter über im Eingang gelegen hatte; er wurde an der Hausecke ausgeklopft, eine Halsöffnung wurde ausgeschnitten und ich hineingesteckt. In Island hat es stets Vielweiberei gegeben, und so wird sie in der Tat ohne Rücksicht auf Frauen und Kinder getrieben. Und dennoch war es zu meiner Zeit nicht einmal so schlimm wie einst, als die Nebenfrauen der Polygamisten wegen Kindeszeugung hier auf Thingvellir in einem Pfuhl ertränkt wurden. Bei uns im Salzseetal hingegen…«