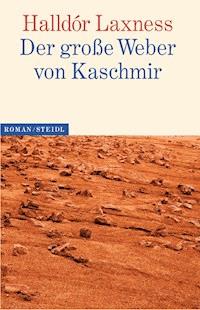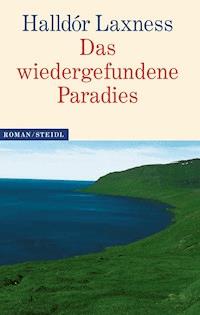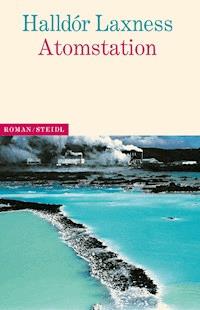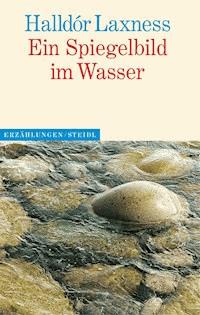
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die zentralen Themen, die Halldór Laxness in seinen Romanen behandelt hat, sind auch in seinen Erzählungen zu finden. Seine Geschichten zeugen von der Beobachtungsgabe und Fabulierfreude des isländischen Schriftstellers. Dieses Buch versammelt realistische und mystische, „heimische“ und exotische Geschichten. Hier vereinen sich große und kleine Welt, alltägliches Leben und träumerisches Abenteuer zu einem einzigartigen Erzählkosmos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Halldór Laxness Ein Spiegelbild im Wasser
Erzählungen
Die Beerdigung der Lauga in Gvendarkot
An einem Frühlingstag, einem herrlich warmen und hellen Frühlingstag mit Seewind und Vogelgezwitscher, da wurde Lauga beerdigt, Lauga in Gvendarkot.
Einige Nachbarn versammelten sich im Innern des halbverfallenen kleinen Gehöfts, und der Hausherr und die Hausherrin, ein alter Mann und eine alte Frau, wichen von einer Ecke in die andere aus und husteten, denn sie hatten es auf der Lunge; die Töchter des Gemeindevorstehers boten Kaffee und Gebäck an auf Rechnung der Gemeinde.
Obwohl es keine große Feier war, so hatte sich doch noch nie zuvor so viel Geschäftigkeit, so viel Aufregung und Interesse auf Lauga konzentriert, nicht einmal, als sie das Kind bekam. Ich war im Konfirmandenalter, als dies geschah, und selbst bei ihrer Beerdigung dabei. Weil ich aber mit keinem der Trauergäste etwas gemeinsam hatte, saß ich abseits und kaute auf einem Streichholz, das einzige Kind. Ich war oft mit einem Leckerbissen von meiner Großmutter zu Lauga geschickt worden. Und stets, wenn Lauga mir schon auf Wiedersehen gesagt und Gott um seinen Segen für meine Großmutter gebeten hatte, sprach sie diese unmotivierte Prophezeiung aus, die einzige Andeutung von Witz, über die sie verfügte: Ob der Wind jetzt nicht bald von Südosten weht! Doch nun war der Winkel leer, in der die alte Lauga gesessen hatte, ja, man hatte sogar den weißen Schimmel abgewaschen: Lauga war jetzt beim lieben Gott und prophezeite keinen Südostwind mehr. Und meine Großmutter hatte mich ein letztes Mal zu ihr geschickt, diesmal, um sie zu Grabe zu tragen.
Die Bäuerinnen saßen eng beieinander in der Mitte des Raumes und sprachen über Herbstwolle und Frühjahrswolle. Die Bauern sprachen über Gemeindeangelegenheiten, froh, daß Lauga tatsächlich tot war. Jetzt gehörte es der Vergangenheit an, daß einer der Gemeinderäte einen Witz machen konnte über Lauga, indem er sagte, solche Leute seien ihr Leben lang nichts als Leichengeruch. Ja, noch in diesem Frühjahr hatten sie sich auf der Gemeindeversammlung wegen Lauga gestritten, darüber, wieviel sie esse, wie schmutzig sie sei, wie nutzlos sie sei, was sie allerdings schon immer gewesen war, zu absolut nichts nütze, verdammt unnütz, keiner hatte sie für weniger bei sich aufnehmen wollen. Gott sei Dank, jetzt war sie tot, man brauchte sich nicht mehr wegen Lauga zu streiten; und die Leute mußten etwas anderes finden, um darüber Witze zu machen.
Der Kaffee war gut und die Kuchen süß und weich wie Honig. Daß Lauga der Anlaß dafür sein sollte! Alle ließen sich noch einmal einschenken.
Ein junger Bursche in der Nähe des Eingangs zog seine Pfeife heraus und rauchte; er war nach Reykjavik gereist, um dort etwas zu lernen, und deshalb rauchte er die ganze Zeit und machte sich die Nägel sauber.
Der Sarg wurde hereingetragen: ein stabiles Behältnis, sauber geschreinert, unbenutzt. Einen Augenblick lang erfüllte der Duft des rohen Kiefernholzes den stickigen Raum, doch bald war er im Tabaksqualm des jungen Burschen untergegangen.
Dort lag jetzt Lauga, die Bedürftige, in einem sauberen Nachthemd vom Gemeinderat, denn sie war tot. Sie war von Geburt an blind und konnte nicht einmal einen Stall ausmisten; als Gemeindearme geboren; mit Hunger, zerlumpten Kleidern, Schlägen groß geworden; ihr ganzes Leben lang zum Gotterbarmen; als Gemeindearme gestorben. Nie ein freundliches Wort, nie einen Freund außer dem Hund und der Katze, denn so wenig sie auch zu essen bekam, immer gab sie ihnen etwas davon ab. Trotzdem hat der Hund Strutur nicht viel verloren. Wahrscheinlich versteht er nicht einmal, daß Lauga tot ist, und hat schon vergessen, daß es sie gegeben hat.
Die Spaßvögel waren die anderen Lebewesen, für die Lauga einen Gewinn darstellte: Sie vertrieben sich so manches Mal die Zeit damit, sie zu verspotten.
Nie kam Lauga auf die besseren Höfe, sie wurde immer bei den Kleinbauern untergebracht; sechzig Jahre lang atmete sie Küchendunst, Stallgeruch und anderen Gestank ein. Während sie in Bjarnarkot war, ließ man sie in einer leeren Box im Stall schlafen, und dort zwischen den Kühen geschahen Abenteuer, ja, dort bekam Lauga ein Kind. Doch das Kind bekam nie einen Vater. Der Bauer leistete einen Eid. Es hatte sich so manch einer an Lauga heranmachen können in der Dunkelheit. Am schlimmsten war, daß man ihr das Wurm wegnahm und an einen anderen Ort der Qualen brachte, wo es zu seinen Vätern versammelt wurde. Ja, am schlimmsten, denn kurz darauf bekam Lauga die Fallsucht und begann, Blut zu speien, und wurde völlig invalide. Ich kann mich daran erinnern, wie sie meine Hand nahm, wenn ich ihr eine Kleinigkeit von meiner Großmutter brachte, wie sie meine Handfläche abtastete, vom Handgelenk bis zu den Fingerspitzen, was für ein Händedruck, zitternd, jammernd, rufend. Es tut mir in der Seele leid, wenn ich daran denke, wie arm sie war, wie wenig gut der Herrgott zu ihr war.
Da keine Leichenpredigt gehalten werden sollte, hatte die Frau des Gemeindevorstehers eine Art Andacht im Haus der Verstorbenen haben wollen: Lauga war schließlich keine Heidin gewesen. Und der Pfarrer sprach nun über die Kümmernisse und Nöte des menschlichen Lebens. Über Gott sprach er, wie unergründlich sein Ratschluß sei, wie unerforschlich seine Wege. Und er sprach über die himmlische Seligkeit, über das Licht in den göttlichen Hallen, über die Engelsstimmen, über das Blut des Lamms, das von Sünde reinwäscht.
Die Leute warteten voller Ungeduld darauf, in den Sonnenschein und den Seewind hinausgehen zu können. Der alte Mann und die alte Frau husteten weiter draußen auf dem Flur. Die Bauern nahmen Schnupftabak und schneuzten sich, rülpsten und spuckten aus. Und die Bäuerinnen verschränkten die Arme vor der Brust und setzten eine feierliche Miene auf, um das Gähnen zu unterdrücken. Der junge Bursche stand am Eingang und rauchte unentwegt seine Pfeife und machte sich die Nägel sauber. Ich hatte das Zündholz schon völlig zerkaut und starrte geistesabwesend auf den Pfarrer.
Als ich nach Hause kam, und seitdem immer wieder, standen mir die Tränen in den Augen wegen Lauga. Nicht, weil ich um sie trauerte, sondern beim Gedanken an die unendliche Armut, die ihr im Leben zuteil wurde. Daß ihr nicht das Glück vergönnt war, irgend jemandem etwas zu geben, das mit einer Träne entgolten würde, an dem Tag, an dem sie begraben wurde!
Der Hund Strutur stand auf der Mauer des Gemüsegartens und schnupperte mit der Schnauze dem Trauerzug nach, als dieser vom Hofplatz ritt. Wahrscheinlich hat ihm der Seewind den Leichengeruch vor die Nase getragen.
Die Geschichte von den Leuten in Kalfakot
Erster Teil
Man sagt, die Frau des Thordur in Kalfakot sei eine wahre Kindermaschine. Die Eheleute in Kalfakot haben jetzt schon neun Kinder.
Selbstverständlich wissen die Eheleute nie, wie sie diese ganze Schar kleiden sollen. Am meisten drückt der Schuh jedoch im Winter, wenn es kalt ist, im Sommer macht es weniger aus. Bei gutem Wetter können die Kinder draußen wie drinnen halbnackt herumlaufen. In der winterlichen Kälte sitzen die Kinder von Kalfakot hinten in der Küche um die offene Feuerstelle herum, in Asche, Ruß und Rauch, unleidlich und kränkelnd. Die Frau kocht. Meistens gibt es Brei.
Es lohnt sich nicht für Kleinbauern, viel Fleisch zu essen. Alles wird im Herbst zum Schlachten verkauft, und man nimmt dafür Hafermehl und Seehasen. Rosinenbrei sieht man nicht einmal an Festtagen, es gibt ja auch nur wenige Feiertage, und bei Kleinbauern ist jeder Tag dem andern gleich.
Bei starkem Frost und Schneesturm reicht die Wärme des Herdfeuers nicht aus für die Kinder; dann müssen sie den lieben langen Tag im Bett bleiben und sich zwischen den Mahlzeiten vor Langeweile hin und her wälzen. Zur einen Mahlzeit gibt es Seehasen, zur anderen Brei.
Doch wenn der Frühling kommt, gehen die Söhne und Töchter des Thordur hinaus in das gute Wetter. Dann hüten sie mit ihrem Vater droben am Berg das Vieh und laufen den ganzen Tag und kommen erst gegen Abend nach Hause, mit wunden Füßen, todmüde und ausgehungert. Sie bekommen einen Klacks Brei vorgesetzt, oder überhaupt nichts, denn im Frühjahr gibt es oft wenig zu essen in Kalfakot, nicht einmal etwas Schlechtes, das man den Kindern vorsetzen kann.
Zwar gibt es zwei Kühe auf dem Hof, aber sie werden im Frühjahr immer klapperdürr aus dem Stall gezogen und fangen erst an, sich wieder zu erholen, wenn es auf die Heuernte zugeht, geschweige denn, daß sie ordentlich Milch geben. Aber dessen ungeachtet werden sie morgens und abends gemolken, und während die Frau melkt, stehen die Kinder daneben und kraulen die Kühe. Nach dem Melken trinken sie gierig jeden Tropfen; dann schlecken sie den Boden des Melkeimers aus. Und da steht der Eimer sauber und glänzend, als sei nie Milch in ihm gewesen.
Am Abend trotten die Kühe in den Stall, jede in ihre Box, sie stöhnen und rülpsen und legen sich dann hin, das Maul voller Vorverdautem zum Wiederkäuen.
Es ist ein Jammer, daß die Kinder des Thordur in Kalfakot kein Gras fressen können, sagen die Leute.
Eines Frühlingsabends kam der älteste Sohn von Kalfakot durch das Moor gewatet und wollte zum Pfarrhof; er sollte dem Verwalter etwas ausrichten. Er war zerlumpt und schmutzig, die Hosen zerrissen, die Jacke konnte aus den Tagen Thjalar-Jons stammen, Flicken über Flicken, ein gestrickter Flicken auf einem Tuchflicken und ein Tuchflicken auf einem Lodenflicken, und der ursprüngliche Stoff der Jacke war fast völlig verdeckt von Geflicktem und Gestopftem. Sicher besaß kein Mensch auf der Welt außer ihm eine so häßliche Jacke! Eine dicke Lehmschicht bedeckte die immer wieder gestopften Strümpfe bis hinauf zu den Knien, denn der Junge war durch Morastlöcher gewatet. Die Schuhe waren zerschlissen, und die Flicken hingen hinten lose herab, bei jedem Schritt quoll das Wasser über die oberen Ränder heraus. Doch dies war nun einmal der Sohn des Thordur von Kalfakot, und man mußte es diesen Leuten nachsehen, daß sie nicht fein angezogen waren. Zum Beispiel dieser Snorri: Er hätte im letzten Jahr eingesegnet werden sollen, doch da konnte man es sich nicht leisten, »den Jungen auszustaffieren«, wie Thordur sagte, und er mußte deshalb noch ein Jahr uneingesegnet bleiben. Ein neues Geschwisterchen bekam er aber im selben Frühjahr.
Daran hapert es nicht in Kalfakot, sagten die Leute. Man verübelte den Eheleuten dieses Benehmen; Thordur wurden von allen Seiten Vorhaltungen gemacht. Dagegen läßt sich eben nichts tun, sagte Thordur in Kalfakot.
Dieses Frühjahr war es dann mit Müh und Not gelungen, den Jungen einzusegnen, auch wenn er keineswegs anständig angezogen war. Jetzt war er fünfzehn und spazierte hier herum.
Vier Rotschenkel hatten ihn vom Moor draußen bis weit die Anhöhe hinauf begleitet. Sie schrien ununterbrochen um die Wette, aber so gern er es auch gewußt hätte, er verstand nicht, was sie von ihm wollten, ob sie ihn tadelten oder segneten. Schließlich kehrten zwei von ihnen um und flogen wieder hinunter ins Moor, die anderen begleiteten ihn noch ein Stück weit. Es waren wohl zwei Pärchen, die im Moor daheim waren.
Plötzlich war er wieder allein, und die Rotschenkel waren davongeflogen; man hörte auf der Ostseite des Tales eine Kuh muhen, und dann wurde als Antwort fünfmal hintereinander auf der Westseite gebrüllt. Es ist ein Zeichen dafür, daß trockenes Wetter kommt, wenn sich die Kühe abends bei Windstille etwas zurufen.
Der Tag neigte sich seinem Ende zu, und die Schatten wurden länger. Kein Lufthauch bewegte ein Blatt, doch gegen Abend wurde es ein klein wenig kühler. Dort flußaufwärts tummelten sich Fohlen auf den Wiesengründen. Man sah kaum ein Schaf auf der Weide, denn das Vieh war nach dem Sortieren den Berg hinaufgetrieben worden. Überall bellten Hunde, doch man sagte ihnen, sie sollten das Maul halten, die Mutterschafe mit ihren Lämmern am Pferch durften nicht verängstigt werden. Heute nacht sollten die Lämmer von den Mutterschafen getrennt werden. Wahrscheinlich würde niemand vor Mitternacht schlafen gehen können.
Dort stand der Pfarrhof, ein großes Holzhaus mit zwei Reihen von Fenstern übereinander, und hob sich von den Berggipfeln in der Ferne ab. Dieses Haus hatte dem Jungen stets einen Schrecken eingejagt.
Schüchternheit überkam ihn, noch bevor er durch die Umzäunung auf die Hofwiese gelangt war. Dann fiel ihm ein, daß er eigentlich das Gras auf der Hofwiese des Pfarrers nicht zertreten durfte. Aber er hatte nicht rechtzeitig daran gedacht, und jetzt war es zu spät, um auf den Weg hinunterzugehen. Er versuchte, leicht aufzutreten und sich zu beeilen, bevor ihn jemand sah, und gelangte mit heiler Haut auf den Hofplatz. Die Vorderseite des Hauses ragte senkrecht und furchteinflößend vor dem Jungen auf. Dort war die Vordertür, der Eingang für bessere Leute, und er beeilte sich, unauffällig daran vorbei hinter das Haus zu gehen, zum Kücheneingang. Er klopfte dreimal, einmal für jedes göttliche Wesen der Heiligen Dreieinigkeit; denn so soll man anklopfen, nicht mit mehr und nicht mit weniger Schlägen.
Kurz darauf stand der Verwalter in der Tür, und da hatte der Junge keine Angst mehr, denn er wußte, daß der Verwalter freundlich mit den Leuten sprach und weder lachte noch einem die Worte im Mund verdrehte, und deshalb mochte er den Verwalter.
Der Junge trug sein Anliegen in wenigen Worten vor und verabschiedete sich. Er hatte sich schon wieder auf den Weg gemacht, und die Flicken schlappten aufs neue, und das Wasser quoll wieder über die Ränder der Schuhe heraus, als gerufen wurde:
Snorri!
Er schaute zurück, Snjolfur stand immer noch in der Tür. Er war es, der gerufen hatte.
Hör mal! Komm her, Junge. Die kleine Aslaug, meine Tochter, will dir einen Schluck Milch zu trinken geben.
Der Junge ging zum Kücheneingang zurück.
Ihr wart doch zusammen in der Konfirmandenstunde, nicht wahr?
Ja, das stimmte. Im letzten Jahr. Sie war damals eingesegnet worden.
Das Mädchen brachte einen großen, blaugeblümten Krug. Sie trug eine rote Bluse und einen kurzen Rock, war hochgewachsen und ziemlich gut entwickelt, hatte helle Haut, rote Wangen und hochgewölbte Augenbrauen, ihre Wimpern waren ziemlich dunkel, die Augen blau und die Nase schmal und gerade und ein klein wenig sommersprossig.
Sie betrachtete Snorri, zunächst ein bißchen scheu, doch die Scheu wurde bald vom Mitleid verdrängt, sie sagte bitte schön und reichte ihm den Krug. Er setzte den Krug an den Mund und leerte ihn und mußte husten. Dieses Lebenselixier erquickte jede Faser seines Körpers; er stand da wie ein neuer Mensch und bedankte sich.
Ade, sagte das Mädchen; sie reichte ihm ihre saubere Hand und verschwand darauf im Innern des Hauses; sie hatte einen dicken, goldgelben Haarzopf im Nacken. Er spürte, daß es seltsam angenehm war, zu sehen, wie sie sich bewegte; er hatte noch nie zuvor ein solches Gefühl verspürt; wahrscheinlich war er bis jetzt immer ein Narr gewesen. Er stand eine Weile still und sah ihr nach; und das war der wunderbarste Augenblick, den er je erlebt hatte, voller Wonne; es fehlten ihm die Worte, um das zu erklären.
Dann machte er sich wieder auf den Weg. Als sein Blick aber auf seine Füße hinabfiel, und auf seine Hosen und seine Jacke, da sah er, daß er sicher der schmutzigste und zerlumpteste Mensch auf der Welt war! Und wahrscheinlich der häßlichste. Er legte sich in einer Senke auf die Erde, und die Tränen standen ihm in den Augen.
Und als er aufs Moor hinauskam, da schien es ihm, als könne er die Sprache der Rotschenkel viel besser verstehen!
Alle wußten, daß Thordur in Kalfakot einer von den Männern war, die man lieber nicht zu nahe an sich herankommen ließ, denn er stammte von Schafsdieben ab, soweit sich seine Familie zurückverfolgen ließ, und es hatte schon oft geheißen, er mache krumme Finger. Alle wissen, daß die Veranlagung zum Stehlen genauso im Blut liegen kann wie eine göttliche Begabung.
Einmal im Spätsommer, als es elf Kinder geworden waren, geschah es, daß es am Essen fehlte, denn die Kuh, die im Sommer kalbte, bekam das Kalbefieber und gab überhaupt keine Milch. Seit dem Frühjahr hatten sich die Kinder darauf gefreut, daß die Kuh kalbte, und die Frau hatte ihnen frische Butter, Quark und sogar Molkenkäse versprochen. Endlich kalbte die Kuh, und dann ging es so.
In Kalfakot gab es keine anderen Nahrungsmittel als das, was die im Herbst kalbende Kuh und die wenigen Milchschafe gaben, und ein bißchen gesalzenen Seehasen und Brei, doch es waren viele Münder zu stopfen, und die Kinder klagten unablässig über Hunger. Das ging Tag für Tag so, nie hatten die Eltern eine ruhige Minute vor der Essensquengelei der Kinder: Von früh bis spät wollten die Kinder etwas zu essen haben, kaum war das Mittagessen vorbei, wollten sie mehr haben.
Es ist unglaublich, wie lang eure Gedärme sind! sagte Thordur in Kalfakot.
Ein fremdes Mutterschaf war seit der Zeit um den Johannistag immer wieder auf die Hofwiese in Kalfakot gekommen. Es säugte ein prächtiges Lamm, einen dicken und schönen Widder. Die Kinder hatten das Mutterschaf mehr als tausendmal von der Hofwiese gejagt, doch es kam stets zurück. Selbst wenn man es weit den Berg hinaufgetrieben hatte, war es, als ob es sogleich wieder samt seinem Lamm auf der Hofwiese aus dem Boden wüchse; die Kinder konnten dieses Schaf nicht begreifen und glaubten schließlich, daß es ein Elfenschaf sei. Eines Abends in der sechzehnten Woche des Sommers fing einer der Söhne des Thordur an, nach Fleisch zu verlangen. Bis nach dem Zubettgehen quengelte er und wollte Fleisch haben. Der ganzen Familie war das Wasser im Mund zusammengelaufen, ehe er aufhörte. Tags darauf machte er weiter, und jetzt stimmten die jüngeren Kinder mit ein; sie sangen dort im Chor von Fleisch und wieder Fleisch. Dabei war das der reine Unsinn, denn die Schafe waren noch im Gebirge, und bis zur Schlachtzeit waren es noch mehr als vier Wochen.
Thordur in Kalfakot war einsilbig, aber er räusperte sich oft, als sei er im Begriff, den Kindern zu sagen, sie sollten still sein, doch dann wurde nichts daraus, daß er etwas sagte. So ging es einige Abende lang.
Dort lagen die Kinder auf ihren Betten, zerlumpt und schmutzig, dürr und häßlich, und schrien nach Fleisch. Thordur saß wie taubstumm da und blickte sie an, selbst mager und erschöpft, und fingerte an seinem Bartflaum herum. Er hatte die Stirn in Falten gelegt, und sein Blick war ernst. Denn Thordur in Kalfakot war unvorsichtig wie Steinn Bollason, er war einer von denen, die Gott um Kinder gebeten hatten und nichts als Kinder bekommen hatten, hundert Kinder.
Die Frau gab keinen Mucks von sich, was auch geschah. Man hörte sie nicht einmal atmen, diese Frau. Sie drehte allen und allem den Rücken zu, stets bis über die Ohren mit der Hausarbeit beschäftigt.
Snorri schwieg. Wenn eines der Kinder etwas taugte, dann war es am ehesten der Erstgeborene, denn er war nicht schon bei der Geburt gebrechlich, mager und kraftlos, wie die jüngeren Kinder, sondern wurde erst mit dem Heranwachsen immer schwächlicher.
Am nächsten Sonntagmorgen bekamen die Kinder Fleisch, das schmackhafteste Lammfleisch auf der Welt. Und was für ein herrlicher Duft im ganzen Haus.
Woher kommt dieses Fleisch, Papa? fragten die Kinder.
Das kommt vom Himmel herab, antwortete Thordur von Kalfakot.
Wer schenkt es uns? fragten die Kinder.
Der Herr Jesus im Himmelreich hat es uns geschickt, antwortete Thordur in Kalfakot.
Wie gut er immer ist! sagten die Kinder und verschlangen das Fleisch wie hungrige Wölfe. Dann nagten sie die Knochen ab, die Diebswelpen. Thordur aß nichts von dem Fleisch, und die Frau auch nicht.
Willst du nicht ein Stück Fleisch vertilgen, Snorri? sagte Thordur.
Nein.
Der Vater sah ihn eine Weile bekümmert und traurig an, dann löffelte er wieder seinen Quarkbrei.
Den ganzen lieben langen Sonntag lief das Mutterschaf auf der Hofwiese hin und her und blökte wie verrückt, manchmal lief es auf das Grasdach des Hauses hinauf, um zu blöken. Es hallte von den Felsen oberhalb des Hofes wider, denn es war windstill; ein Wunder, wenn man dieses ganze Blöken nicht auf den Nachbarhöfen hören konnte.
Am Abend hetzte Thordur den Hund auf das Mutterschaf. Das Schaf lief, so schnell es konnte, und der Hund hinterher, die Zähne am Hinterbein des Schafes. Er trieb es weg, weiter hinunter in die Gemeinde, und das Schaf blökte und lief.
Später wurde dies und jenes bekannt über dieses Mutterschaf. Es gehörte einem Großbauern im Süden der Gemeinde, Thordur in Kalfakot hatte sein Lamm gestohlen und aufgegessen. Er wurde festgenommen und gestand das Verbrechen ein. Das Lamm und das Mutterschaf hatten den ganzen Sommer bei ihm auf der Hofwiese gestanden, deshalb meinte er, er sei gar nicht auf unredliche Weise zu dem Lamm gekommen. Doch dieser Einwand nützte wenig, denn niemand hatte ihn darum gebeten, das Lamm auf seiner Wiese weiden zu lassen, geschweige denn es ihm geschenkt. Er hatte nun einmal das Lamm gestohlen, daran gab es nichts zu rütteln.
Und alle wußten, daß die Veranlagung zum Schafestehlen bei Thordur in Kalfakot in der Familie lag, soweit man sie zurückverfolgen konnte.
Der Schafsdieb von Kalfakot wurde nach Reykjavik gebracht, dort sollte er seine Schuld gegenüber der Gerechtigkeit mit einigen Monaten Gefängnisaufenthalt begleichen. Einen Monat, nachdem er festgenommen wurde, brachte seine Frau ein Kind zur Welt.
Obwohl Thordur in Kalfakot immer ein erbärmlich armer Tropf gewesen war, der seine Angehörigen nie hatte richtig ernähren können, wurde es erst jetzt wirklich schlimm, nachdem die Frau und die Kinder auf sich selbst gestellt waren.
Auf dem Hof wurde gehungert. Alles war durcheinander. Als der Winter kam, wurden die jüngsten Kinder krank. Obwohl Snorri und die älteren Kinder sich den lieben langen Tag plagten und abrackerten, schien dies keine Wirkung zu haben. Keine Arbeit wurde richtig gemacht. In Kalfakot fehlte jemand, der Anordnungen gab. Das mußte man Thordur lassen: Er war fleißig und verrichtete alle Arbeiten auf dem Hof sehr gewissenhaft; es war erstaunlich, wie er trotz allem immer ohne fremde Hilfe über die Runden gekommen war.
Im Advent verlangte die Frau in Kalfakot Armenunterstützung. Dies erregte große Besorgnis in der Gegend, und alle besseren Bauern ahnten Schlimmes. Natürlich konnte man der Frau die Unterstützung nicht versagen, denn sonst wären bis Weihnachten alle auf dem Hof verhungert. Doch damit war jetzt eingetreten, was man schon seit langem befürchtet hatte: Die Leute von Kalfakot fielen der Gemeinde zur Last.
Im März kam Thordur wieder nach Hause. Er hatte eine Tüte mit Gebäck und Rosinen dabei, die er den Kindern schenkte. Nun ging es vergnügt zu. Er war dick und rund, und sein Bart war gewachsen; die Haare waren geschnitten, und es war fast so, als würden die Kinder verlegen, so vornehm und würdevoll war ihr Papa geworden.
Und vieles hatte er gesehen, vieles gab es zu erzählen. Sie konnten sich nicht daran erinnern, daß er jemals so lustig gewesen wäre wie jetzt. Es war ihm dort sehr gut gegangen, wo er gewohnt hatte, die Leute waren freundlich zu ihm gewesen, nie hatte es ihm am Essen gefehlt, und oft hatte er Sachen gegessen, die in Kalfakot als Leckerbissen galten. Wie war es ihnen daheim ergangen?
Nun ja. Die Kinder waren eine Zeitlang krank gewesen, doch dann wieder gesund geworden, Gott sei Dank. Das Geld für das Schlachtvieh wurde alles zur Bezahlung der Schulden vom letzten Frühjahr beim Kaufmann in der Stadt verwendet, wie er es selbst bestimmt hatte, ehe er fortging. Deshalb war es ihnen bis Weihnachten nicht eben gut gegangen, und die Frau hatte keinen anderen Ausweg gesehen, als mit dem Gemeindevorsteher zu sprechen.
Thordur hatte mit niedergeschlagenen Augen dagesessen, doch als er dies hörte, ließ er seinen Blick über die ganze Kinderschar schweifen, von einem Gesicht zum anderen; zuletzt sah er die Frau an, aber er räusperte sich nicht, geschweige denn, daß er etwas sagte. Es kam ihm nicht zu, irgend jemandem Vorwürfe zu machen. Seine Frau hatte gebettelt. Er gestohlen.
Im April, als es anfing zu tauen, fiel die Küche in sich zusammen; es war nicht möglich, irgend etwas für die Kinder zu wärmen, und die Milch, die eine der beiden Kühe gab, war die einzige Nahrung. Die Kinder lagen heulend in ihren Betten. Dann wurde die Frau krank.
Doch Thordur war jetzt durch nichts umzubringen und konnte sich alles versagen, ganz gleich, ob es Essen oder Trinken war, denn er hatte inwendiges Fett, seit er aus dem Gefängnis zurückgekommen war. Innerhalb von zwei Tagen baute er mit Snorri die Küche wieder auf. Am Abend des zweiten Tages rissen zwei der Kinder aus. Nach zweistündigem Fußmarsch kamen sie auf dem Pfarrhof an und erzählten, was daheim geschehen war.
Schrecklich, schrecklich! sagte der Pfarrer und trommelte sich mit den kleinen, dicken Fingern auf den Schmerbauch.
Aber es war Thordur in Kalfakot, der im darauffolgenden Herbst seine Schulden bei der Gemeinde auf Heller und Pfennig beglich!
Zweiter Teil
Eine Abendstunde im Pfarrhof Anfang Februar. So heftige Schneestürme wie in der letzten Zeit hat es seit Menschengedenken nicht mehr gegeben. Das sagen die Leute zwar in jedem Jahr, wenn es am schlimmsten ist. Doch die letzten Tage waren wirklich kein Zuckerlecken; die Schafhirten wissen, wovon sie sprechen.
Seit Tagen schon tobt der Sturm ums Haus und rüttelt am Dach. Und so gut auch der Ofen im Studierzimmer beheizt wird, die Eisschicht taut nur in der Mitte des Fensters auf. Der Pfarrer sitzt am Ofen, die Füße beinahe in der Glut. Das Buch liegt unberührt auf seinem Schmerbauch, er raucht eine lange Pfeife und nickt immer wieder ein.
An diesem Abend sitzt der Pfarrer dort in der gewohnten Weise und trommelt mit den kleinen, dicken Fingern auf seinen Bauch. Der Verwalter sitzt am Schreibtisch und blättert in Büchern; Aslaug sitzt am Harmonium und spielt.
Stellen wir uns einmal vor, sagt der Pfarrer feierlich, stellen wir uns vor, wir wären alle draußen bei diesem Wetter.
Was wäre dann? läßt sich Aslaug vom Harmonium vernehmen.
Wir würden sterben, sagt der Pfarrer.
Denk lieber an jene, die jetzt draußen bei diesem Wetter um ihr Leben kämpfen, Pfarrer Kjartan, antwortet der Verwalter.
Ob heute abend tatsächlich irgend jemand im Land draußen ist?
O ja, wahrscheinlich sogar viele.
Sie müssen dann mit dem Tod spielen, sagt das Mädchen.
Vermutlich ist es eher der Ernst des Lebens, der sie hinaustreibt, mein Kind.
Der Ernst des Lebens ist schrecklich, sagt der Pfarrer.
Wohl dem, der aus Erfahrung spricht, Pfarrer Kjartan.
Ich kenne es, mein lieber Snjolfur, ich kenne es! Ach, sprechen wir nicht davon. Wir wollen lieber Gott dafür loben, daß wir ein Dach über dem Kopf haben und im Warmen sitzen.
Aber die anderen, von denen Papa sagt, daß der Ernst des Lebens sie hinaustreibt ins Unwetter, sollten sie dann Gott verfluchen?
Ach, fang nicht an, mit mir zu disputieren, Asa! sagt der Pfarrer, spiel lieber ein Lied von Bellman.
Da geht die Tür auf, und einer der Knechte sagt, es sei ein Besucher gekommen, der den Pfarrer sprechen wolle.
Ein Besucher! - sie wiederholten alle das Wort. Der Pfarrer wird blaß und fragt: Snjolfur, was kann das sein?
Tja, jetzt kannst du dich darauf verlassen, daß du irgendeiner alten Frau das Abendmahl spenden mußt, oder das kranke Kind in Hvammur taufen.
Gott steh mir bei! Warum machen die Leute nicht eine Nottaufe!
Draußen hörte man Schritte, als ob jemand auf Hufen ginge; bald stand der Besucher unter der Tür. Die Sache war so dringend, daß er keine Zeit gehabt hatte, sich den Schnee abzuklopfen, ehe er zum Pfarrer hineinging, und nun stand er hier mitten im Zimmer, weiß wie ein Schneemann vom Scheitel bis zur Sohle, mit hartgefrorenen Schuhen. Er hatte zwei Mützen, die nur den oberen Teil des Gesichts freiließen, auf dem Kopf. Um die Schultern und die Brust hatte er ein riesiges Umschlagtuch gewickelt. Die Überhosen waren aus Sackleinen und stocksteif gefroren. Es war kaum zu glauben, daß sich im Innern dieses Eiszapfens lebendiges Fleisch und Blut verbergen sollte. Doch durch die Öffnung der Mützen konnte man Augen und eine wettergegerbte Nase erkennen. Und als er die steifgefrorenen Mützen vom Kopf gezogen hatte, kannten alle das Gesicht. Es war Snorri, der älteste Sohn aus Kalfakot.
Er trat zu allen hin und begrüßte sie mit Handschlag.
Du meine Güte, Snorri! Warum gehst du bei diesem Unwetter aus dem Haus? fragte der Pfarrer.
Ich wollte fragen, ob Sie nicht einen Arzt holen lassen könnten.
Einen Arzt, jetzt? Für wen? Ist daheim bei dir jemand krank?
Ja, es war jemand krank bei ihm daheim. Mama hatte vorgestern abend Wehen bekommen, Papa wollte die Hebamme holen, doch die hatte sich bei diesem Wetter nicht hinausgewagt. Als Papa nach Hause kam, hatte er Schmerzen und mußte sich hinlegen. Er war schwer krank.
Und deine Mutter, hat sie das Kind zur Welt gebracht?
Ja, sie hat zwei Kinder zur Welt gebracht. Und ich glaube, sie liegt im Sterben.
Du lieber Gott! Und die Zwillinge?
Denen geht es jetzt gut, sagte Snorri in Kalfakot, denn sie wurden tot geboren.
Eine Zeitlang war es still wie in einem Grab. Schließlich sah der Verwalter dem Pfarrer ins Gesicht.
Der Ernst des Lebens, sagte er.
Schrecklich, schrecklich, sagte Pfarrer Kjartan.
Aslaug starrte hingerissen den Jungen aus Kalfakot an. In Gedanken erlebte sie seinen schweren Gang mit, weg von zu Hause, von den todkranken Eltern, den leidenden oder verstorbenen Geschwistern, in beißendem Frost, durch Schneetreiben und Dunkelheit.
Sie stand auf.
Snorri, sagte sie. Setz dich an den Ofen, ich werde dir die Schuhe ausziehen.
So sprach sie zum Sohn des Diebes in Kalfakot. Und doch war kein Mädchen schöner als sie.
Ob es nicht möglich ist, nach einem Arzt zu schicken? fragte Snorri.
Er machte sich am selben Abend wieder auf den Weg nach Hause.
Nichts konnte ihn aufhalten. Geh nicht, geh nicht, sagten die Leute. Doch er ging hinaus in den Schneesturm und die Nacht, er war zu sehr den Elementen verwandt, um vor ihnen zurückzuweichen.
Auch am folgenden Tag ließ der Sturm kaum nach, doch der Frost war nicht mehr so streng. Keine Möglichkeit, nach einem Arzt zu schicken. Am zweiten Tag hörte der Sturm auf, und nun wurde jemand losgeschickt, ob es nun zu spät war oder nicht. Denn man konnte nicht damit rechnen, daß der Arzt vor morgen abend in Kalfakot sein würde, so schwierig war es, vorwärts zu kommen.
Am dritten Tag war Frost und klares Wetter. Gegen neun Uhr morgens nahm Snjolfur seine Skier und machte sich auf den Weg nach Kalfakot hinüber. Alles war weiß, leer und tot und weiß. Die Februarsonne ging über der Schneedecke auf, und ihre Strahlen spielten auf der kalten Pracht.
Er glitt rasch zu den Tälern hinüber, auf und ab, man konnte Hügel und Senken nicht mehr erkennen. Droben im Tal lag tiefer Schnee. Und dort war Kalfakot. Dort war das Schloß des Thordur. Schneesturm und Frost der letzten Tage hatten es neu errichtet. Es sah aus wie eine Schneewehe, und nicht wie eine menschliche Behausung, denn man konnte keinen einzigen dunklen Fleck erkennen, weder vor einem Fenster noch vor der Tür. Die Schneewehe dort war makellos.
Was ist bloß geschehen? fragte sich Snjolfur. Sind alle tot?
Nicht eine Schaufel Schnee war vor dem Eingang weggeräumt. Snjolfur stieg aufs Dach des Wohnhauses und fand den Schornstein. Er drückte den Schnee durch die Öffnung hinunter und spähte von oben in die Küche hinab. Keine Glut auf der Feuerstelle. Ist dort jemand? rief er. Totenstille. Alter Rußgeruch stieg ihm in die Nase.
He, he, he! Ist jemand im Haus!
Dieselbe Totenstille.
Doch kurz darauf begann irgendwo in der Nähe ein Hund zu bellen. Snjolfur stieg vorsichtig auf den Hofplatz hinunter. Das Hundegebell kam aus dem Stall. Und durch den Türspalt sah er weiße Reißzähne und eine schwarze Schnauze, die knurrte und bellte. Von den warmen Kühen drang Dampf heraus. Dies war das erste Lebenszeichen, das er bemerkte, dann hörte er ein Wispern menschlicher Stimmen. Er riß die Tür mit Gewalt auf. Der Hund sprang heraus und fletschte die Zähne.
Guten Tag miteinander!
Die Kinder saßen zusammengekauert in den leeren Boxen und hielten einander an den Händen. Snorri saß in der Kälberbox und wandte der Tür den Rücken zu; er schnitzte an einem Stück Holz.
Die Kinder erschraken, als sie die Stimme eines Fremden hörten, und starrten ihn entgeistert an, als er hereinkam.
Was macht ihr hier? Wie geht es?
Es dauerte lange, bis Snjolfur eine schlüssige Antwort bekam. Als er mit Snorris Hilfe den Eingang zum Wohnhaus freigeschaufelt hatte, sah er die Toten: Thordur und seine Frau und die totgeborenen Zwillinge. Die Kinder hatten nicht einmal daran gedacht, ihnen Nase, Mund und Augen zu schließen. Die Widerwärtigkeit selbst, eine dürre schwarze Katze, saß auf einem der Betten, gähnte und leckte sich das Maul.
Snjolfur betrachtete die ausgemergelten Leichen. Und die Kinder standen in einer Reihe am Eingang und hatten die Finger in den Mund gesteckt. Sie weinten nicht, sie starrten nur. Sie hatten keine Tränen mehr. Unter ihren Augen waren schwarze Ringe.
Ist es lange her? fragte Snjolfur.
Vorgestern abend, antwortete Sigga, die Zweitälteste. Er zuerst. Und als Mama gestorben war, gingen wir hinaus in den Stall.
Habt ihr etwas zu essen gehabt?
Wir haben Milch getrunken.
Habt ihr nichts anderes?
Doch, ein bißchen was.
Wo ist es?
Der Dichter und sein Hund
1.
So klein ist die Stadt, daß jedes Kind unter ihren Bewohnern Zeus, den Hund des Dichters, kennt. Sie kamen beide vor einem Jahr aus dem Ausland. Der Dichter hat es durch seine Dichtkunst zu Ruhm gebracht, und Zeus hat sich wegen seines Herrn Beliebtheit erworben.
Ihre Wohnung liegt im ersten Stock eines Hauses in der Hauptstraße. Der Dichter sitzt oft dort, bisweilen mit düsterer Miene, denn es gibt viele Prüfungen in der Welt der Gedanken. Und auf einem Schaffell an der Tür schläft sein Hund, zuverlässig in seiner Treue.
Bisweilen spazieren sie durch die Straßen; Männer lüften den Hut vor dem Dichter. Frauen und Kinder streicheln den Hund, und er wedelt mit dem Schwanz und lächelt so freundlich, wie es nur Hunde können.
Zeus ist schottischer Abstammung; sein Fell ist langhaarig und zottig, und sein Gesichtsausdruck voller Freundschaft, so daß ihm alle die lange Schnauze streicheln wollen; er ist reinlich und höflich wie ein guter Schotte, ein Artistokrat unter den Hunden.
Wenn der Dichter zu einer Gesellschaft eingeladen ist, nimmt er Zeus immer mit, ob das nun den guten Sitten widerspricht oder nicht. Alle heißen Zeus willkommen. Er setzt sich hin und gibt Pfötchen, und auf dieselbe Weise dankt er für die Bewirtung; er macht kaum Fehler. Zum Abschied gibt er Pfötchen. Er weiß, daß es sein Herr so will. Und die Freude Zeus’ besteht darin, nach dem Willen seines Herrn zu handeln.
Zeus hat mit dem Bürgermeister und dem Kreisarzt und anderen Honoratioren der Stadt zu Tisch gesessen. Er bellte nicht
und schmatzte nicht, sondern nahm dankbar den einen oder anderen Bissen von den Gästen entgegen und fraß ohne Gier. Manchmal warf er seinem Herrn einen Seitenblick zu, als wolle er fragen, ob er auch alles recht mache. War die Mahlzeit beendet, ging er zu den Gastgebern und gab zum Dank Pfötchen. Ein guter Hund ist kaum zu übertreffen, sagen die Leute, ohne darüber nachzudenken, wie wahr sie sprechen.
Einem Hund kann schwerlich größeres Glück zuteil werden als das, dessen sich Zeus erfreut: Er ist seinem Herrn ein Trost in schweren Stunden, die Kinder und die Frauen liebkosen ihn. Die Tochter des Bürgermeisters, ein Mädchen, das so stolz ist, daß es keinen Mann in weniger als drei Ellen Abstand duldet, hat Zeus gestreichelt. Die Kinder des Arztes haben ihn umarmt und geküßt, obwohl sie nicht mit den Nachbarskindern spielen dürfen, weil die einen Hafenarbeiter zum Vater haben.
2.
Soweit bekannt war, vergaß Zeus nur einmal seine guten Manieren. Das war auf dem großen Fest beim reichen Grossisten, wo alle Gläser zerschlagen wurden, nachdem der letzte Trinkspruch ausgebracht war. Als das Gläserzerschmettern in vollem Gange war, begann er zu bellen und zu wüten wie eine wilde Bestie und wollte die Leute beißen.
Doch auf eben diesem Fest war Zeus Zeuge, wie sein Herr, erhitzt von den lieblichen Weinen, der Tochter des Grossisten die Hand küßte.
Es fügte sich so, daß das junge Mädchen und der Dichter hinter der Palme saßen und miteinander sprachen, während die Musik spielte. Zeus lag auf dem Boden zu Füßen seines Herrn und hatte die Schnauze auf die ausgestreckten Vorderpfoten gelegt. Zwei weiche Finger strichen über seinen Nacken, und als er aufschaute, traf ihn ein freundlicher Blick, der des Mädchens. Zeus wedelte mit dem Schwanz und lächelte, und das Mädchen sagte zum Dichter:
Schön ist Ihr Hund, Meister Arinbjörn, man kann beinahe Hochachtung haben vor so einem stattlichen Tier. Tiere haben immer viel von dem, der sie aufzieht; ich glaube, daß er das eine oder andere von Ihnen gelernt hat.
Zeus ist mein bester Freund. Und obwohl wir nicht dieselbe Sprache sprechen, verstehen wir einander wie taubstumme Zwillinge. Ich könnte Ihnen viel von Zeus und mir erzählen. Aber die Leute finden Hundegeschichten langweilig.
Nein, ganz und gar nicht, mir machen Hunde so unerhört viel Freude, ich liebe Hunde einfach, und ganz besonders Terrier, sagte das Mädchen. Doch, Sie sollten mir eine Geschichte von Ihrem Hund erzählen.
Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Der Hund hier ist die Hälfte von mir selbst.
Der Dichter erzählte ihr trotzdem eine Geschichte; er sprach, als erzählte er den Inhalt einer neuen Tragödie; seine Erzählung war farbig, einfühlsam, innig.
Es war neulich, er war tief in Gedanken versunken zu Hause gesessen, er neigte so sehr dazu, vor sich hinzustarren und nachzudenken: Ich habe große Ähnlichkeit mit einem Menschen, sagte er, der auf den Grund des Meeres hinabtaucht, um nach versunkenen Schätzen zu suchen, und der dann, wenn er wieder an die Oberfläche heraufkommt, auf der einen Seite ein Ungeheuer hat, und auf der anderen eine halbverweste Wasserleiche. Ja, das Meer ist schrecklich: Wer es kennt, wagt nie mehr, auch nur einen Finger hineinzutauchen.
Es war an diesem Tag. Er dachte über das Leben und den Tod nach, über Gott und die Menschen, über die Bibel und den Koran, über den Gang der Sonnensysteme und den Lauf der Dinge - und alles, was von Anbeginn der Welt kränkliche Gehirne in den Wahnsinn getrieben hat, fügte er hinzu und lächelte. Er versuchte, dem Mädchen verständlich zu machen, wie er schließlich zu folgendem Schluß gekommen war: In Wirklichkeit sei das Universum bloß Leere und Dunkelheit, abgesehen von diesen ewig leidenden Menschenseelen, die samt ihren Einbildungen geschaffen und vernichtet werden wie jedes andere unbedachte Werk des Zufalls.
Arme Kreatur, sagte ich, du bist wie eine Rose auf einem Grab und kommst nur an die Oberfläche, um zu sterben. Ja, der Einsiedler wird von manch einem trüben Gedanken verfolgt, fügte er hinzu, wie eine Bitte um Nachsicht dafür, daß er sich über den Jammer der Tiefen ausließ, hier an diesem Ort, bei Sonatenklang hinter einer Palme, zwischen Gold und Glas.
Ich saß lange da, wie gelähmt von einem Alptraum, fuhr er dann fort. Mein Gesichtsausdruck muß den bitteren Schmerz in meinem Innern, den Weltschmerz, zu erkennen gegeben haben, denn was, glauben Sie, hat mich zum Tag, zum Lichtstrahl mitten in der tiefen Nacht wiedererweckt? Zeus kam zu mir und leckte meine Hand. Es war, als würde über die Leeren meiner Seele »es werde Licht« gerufen; der Hund hatte meine Hand geleckt, und es geschah ein Wunder: Als wir beide hinausgegangen waren, da schien mir wieder alles, was der Herr geschaffen hatte, sehr gut zu sein.
Ja, ein Hund ist kaum zu übertreffen, sagte das Mädchen wie die anderen.
Auf diese Weise geschah es.
3.
Hier überspringen wir einen ganzen Sommer mit Vogelgezwitscher und Ständchen, Liebesabenteuern, Ausflügen in Gottes schöne Natur, und noch vieles mehr überspringen wir; doch glücklicherweise wird dies in berühmten Liebesgeschichten auf das genaueste beschrieben, und wer nicht wagt, seiner eigenen Phantasie zu vertrauen, kann dort nachschlagen.
Nun wird es Herbst, die Luft ist kalt, nachts fällt Reif. Die Pflanzen verwelken, die Blumen verlieren ihre Blätter und legen sich auf die Erde; die Schmeißfliegen richten sich oben in Kirchtürmen zum Überwintern ein. Schwermut überkommt die Menschen, und manche legen sich ins Bett, wenn der Herbst kommt.
Hier sitzt der Dichter in seinem Zimmer und hat den Kopf in die eine Hand gestützt; Zeus leckt die andere. Der Gesichtsausdruck des Dichters ist vom Herbst gezeichnet; möglicherweise läßt er sich vom Hund die Hand lecken, um sich an den Lichtstrahl mitten in der großen Nacht zu erinnern.
Auf dem Flur hört man leichte Schritte; es wird nicht angeklopft, sondern die Tür geht auf, und man betritt das Zimmer des Dichters. Es ist die Verlobte, schön und geschmückt, in einem neuen Pelzmantel, die Verlobte in all ihrer Herrlichkeit. Sei gegrüßt, mein Herzblatt!
Der Verlobte springt auf, als sei er mit einem Male vom Enthusiasmus des Frühlings erfüllt. Doch die Verlobte weicht einen Schritt zurück, als habe sie Angst vor seiner ausgestreckten Hand und seinen liebenden Lippen.
Arinbjörn! sagte die Verlobte. Glaubst du, ich küsse dich, wenn du ganz naß vom Gesabber des Hundes bist? Wasch dich auf der Stelle!
Ich bin nicht naß vom Gesabber des Hundes, antwortete der Dichter, doch er gehorchte und wusch sich das Gesicht und dann die Hände, wie Pilatus, damit keine Gefahr bestand, daß er die Verlobte mit Hundestaupe ansteckte. Sie schwieg währenddessen, räusperte sich nur mit entfernter Stimme, wie ein Bauchredner oder ein Handwerker auf dem Dach eines Hauses. Sie betrachtete kritisch ein altes Bild an der Wand, ein Bild, das sie übrigens im Frühjahr gelobt hatte, kurz nach dem Fest mit den vielen Trinksprüchen, in den guten Tagen. Als er sich gewaschen hatte, wollte der Dichter sie auf den Schoß nehmen, doch ihre Miene war frostig, und irgend etwas stimmte nicht; schließlich sagte sie:
Ich muß es dir jetzt sagen, ein für allemal, wenn wir jemals als Ehepaar gemeinsam unter einem Dach wohnen sollen, dann tust du gut daran, so schnell wie möglich deinen widerlichen Hund erschießen zu lassen. Ich hätte keine Lust, mit einem Mann verheiratet zu sein, der seine Tage vor allem damit verbringt, sich von Hunden ablecken zu lassen. Ich finde, wir haben uns schon oft genug auf Gesellschaften unmöglich gemacht wegen dieses Hundes, den du immer mitschleppst; ich habe dazu keine Lust mehr.
Bedenke, was du sagst, Soffia. Du weißt, daß Zeus schon seit Jahren mein allerbester Freund ist, in Tagen des Hungers wie des Überflusses, in Kummer und in Freude. Versuche dir vorzustellen, wie niederträchtig es wäre, wenn ich meinen besten Freund erschießen ließe - und der Dichter streichelte wehmütig seinen Hund.
Ja, ich werde versuchen, es mir vorzustellen, sagte sie. Ich danke dir; jetzt weiß ich, daß du mich nie so lieb gehabt hast wie diesen Hund; deswegen ist es am besten, wenn du ihn behältst! Ich gehe. Adieu!
Sie ging auf die Tür zu.
Doch der Dichter ließ sie nicht gehen. Mit uralten, kernigen Worten, glühend von Inspiration, Liebe und Reue, erzählte er ihr die alte Geschichte. Ohne sie könne er nicht leben, auch wenn ihm die ganze Welt gehörte, sie liebe er, liebe er, liebe er; alles, was er habe, werde er opfern, selbst seine Dichtkunst; Soffia, Soffia, Soffia.
Gut, aber du mußt den Hund erschießen lassen.
Soffia, ich muß…; gut, ich werde Zeus wegschaffen, wenn du versprichst - wenn du es zur Bedingung machst für deine Liebe, ich werde den Hund wegschaffen.
So einigte man sich. Kuß.
4.
Es schien, als hätte Zeus verstanden, daß man sich um sein Schicksal stritt. Seine Miene verriet die Verzweiflung, die nur Hundegesichter ausdrücken können, als er vor die Füße seines Herrn kroch, nachdem die Verlobte gegangen war.
Lange starrte der Dichter auf seinen Hund. Schließlich fingerte er flüchtig an seinem Fell herum und seufzte.
Meine Liebe ist mir trotz allem wichtiger als deine Treue. Und zweifellos wird es damit enden, daß ich wegen meiner Liebe deine Treue enttäuschen muß.
Und der Dichter richtete sein Schreibzeug her, nahm eine Feder zur Hand und verfaßte einen Artikel über das Leid.
Die Verzweiflung des Hundes wurde nicht weniger, nachdem sich der Dichter an seinen Schreibtisch gesetzt hatte. Er wimmerte und zitterte, legte seine Pfoten auf die Knie seines Herrn, sah ihm ins Gesicht, bat ihn um Gnade, wie nur eine stumme Kreatur bitten kann, ein Beben durchfuhr seinen haarigen Körper.
Hund, du störst mich! Geh!
Dann wies der Dichter dem Hund die Tür, gab ihm zum Abschied einen Fußtritt und schlug die Tür zu.
Am Abend traf er seine Verlobte, und sie gingen Arm in Arm südwärts am Teich entlang. Er war philosophisch und sprach vom Sinn des Lebens. Sie langweilte sich.
Er dachte, es würde sie freuen zu hören, daß er den Hund weggejagt hatte. Doch sie antwortete: Du hattest keine andere Wahl.
Weiter wurde die Angelegenheit nicht diskutiert. Als es Zeit war, schlafen zu gehen, und der Dichter zu seiner Wohnung zurückkehrte, lag Zeus zitternd auf der Türschwelle. Es war kalt, der Hund hatte Hunger.
Weg, Hund, weg! sagte der Dichter; dann ging er hinein und legte sich schlafen. Er hatte keine andere Wahl.
5.
Einige Tage vergingen.
Und dann wurde dem Dichter allmählich klar, was geschah: Der Himmel wollte sich nicht des Hundes erbarmen; der Hund wollte lieber auf seiner Türschwelle verhungern, als draußen in der Welt auf sich selbst gestellt zu sein.
Nun hatte der Dichter das Glück, einen Kapitän zu kennen, der in einem ärmlichen Viertel am Hafen wohnte, und eines Abends schlenderte er mit seinem Hund dorthin. Der Dichter behandelte den Kapitän mit solch unverdienter Ehrerbietung, daß der Mann kaum wußte, wie ihm geschah, und ganz durcheinanderkam.
Zum Abschied schenkte der Dichter ihm seinen Hund, und obgleich der Seemann eigentlich am liebsten gerufen hätte: Verdammt noch mal, ich will keinen Hund, so bedankte er sich und wünschte dem Dichter alles Gute.
Und passen Sie auf, daß er Ihnen nicht wegläuft, sagte der Dichter.
Da können Sie Gift darauf nehmen, sagte der Kapitän.
Wenn Sie auf Fischfang gehen, sollten Sie das Hundchen mitnehmen, sagte der Dichter.
Da haben Sie recht, sagte der Kapitän.
Und er hatte den Hund am Hals.
Nun fuhr der Kapitän wenige Tage später auf Fischfang. Er war vierzehn Tage auf See und hatte den Hund dabei. Den Matrosen gefiel Zeus sehr gut, denn er hatte ein gewinnendes Wesen; sie gaben ihm einen besseren Namen und nannten ihn Bobbi. Doch Zeus verstand sich nicht auf die Seefahrt, er litt an Übelkeit und Appetitlosigkeit und wollte nicht auf den neuen Namen hören. Es erwies sich als unmöglich, ihn als Spielzeug zu benützen oder ihn dazu zu bringen, sich putzig zu benehmen, er stand stundenlang an Deck und starrte über die Reling hinaus und sah nichts als Meer. Er wedelte selten mit dem Schwanz und lächelte nie. Deshalb hatten sie bald keinen Spaß mehr an ihm. Und wenn er den Männern bei der Arbeit im Weg war, neigten sie dazu, auf ihn zu treten. Und dann sagten sie: Hau ab, verfluchter Köter!
Sie waren sich einig darüber, daß dieser Hund ein hoffnungsloser Fall war und daß der Dichter ihn sicher habe loswerden wollen.
6.
Der Kapitän hatte den Hund satt und schenkte ihn dem Koch.
Der Koch versuchte, ihn zu füttern und zu mästen, doch der Hund wollte kaum etwas fressen und wurde immer dünner; da glaubte der Koch, der verdammte Hund sei wählerisch und daran gewöhnt, daß man ihm alles vorkaute. Und als sie das nächste Mal an Land kamen, schenkte er den Hund einem Bekannten, der ein Taugenichts war.
Der Taugenichts meinte, er habe das große Los gezogen, als er den Hund des Dichters bekam, und versuchte überall, mit Zeus Staat zu machen. Er taufte ihn Pegasus, denn er glaubte sich daran zu erinnern, daß Pegasus seinerzeit ein Hund gewesen sei, und dann schrie er auf der Straße lauthals: Pegasus, Pegasus, Pegasus.
Doch der Taugenichts wurde zum Gespött der Leute, und keiner würdigte den Hund eines Blickes. Zeus hatte jetzt auf die Bewohner der Stadt dieselbe Wirkung, die der Mond hätte, wenn die Sonne vom Firmament verschwunden wäre. Er hatte nicht mehr den Abglanz der Berühmtheit des Dichtkünstlers. Und der Taugenichts mußte erkennen, daß ihm der Hund keineswegs zu größerem Ansehen verhalf.
Da geschah es an einem kalten Tag, als er spazierenging und kein Geld hatte, daß er rein zufällig einen Verwandten traf. Ihre Begegnung endete damit, daß ihm sein Verwandter den Hund abkaufte, für eine Krone und fünfundzwanzig Öre, mehr hatte er leider nicht bei sich. Der Verkäufer ging, nachdem der Handel abgeschlossen war, in ein Café und saß dort lange, wie die feinen Leute, trank Kaffee und las Zeitung. Die Rechnung belief sich auf insgesamt eine Krone, Rest fünfundzwanzig Öre, die er als Trinkgeld gab; alle sollten sehen, daß er auch ein feiner Mann war. Von ihm wird nichts mehr erzählt.
Der neue Besitzer hatte den Hund unter anderem in der Absicht gekauft, seine Vermieterin zu ärgern. Dieser Mann gab sich als Hafenarbeiter aus, war jedoch in Wirklichkeit ein Trunkenbold und Dieb, der ständig Schwierigkeiten mit der Polizei hatte. Er wohnte in einem kleinen Haus am Stadtrand, wo er von einer übellaunigen alten Frau versorgt wurde.
Wer hätte gedacht, daß es noch schlimmer werden könnte, sagte die Alte: Jetzt war auch noch ein Hund dazugekommen.
Der neue Besitzer nannte Zeus ganz einfach Mori und liebte ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Er gewährte Mori die gleichen Rechte wie sich selber, sie aßen das gleiche Essen und schliefen im selben Bett, und der Mann verwöhnte den Hund um so mehr, je mehr die Alte ihn verwünschte und verfluchte. Doch als der gerade angefangen hatte, sich an den neuen Herrn zu gewöhnen, brach das Unheil herein.
Eines Tages kam die Polizei zu Besuch bei seinem Herrn, und nach einem längeren Handgemenge zerrten sie ihn fort ins Gefängnis. Am selben Tag prügelte die Alte den Hund aus der Hütte hinaus. Das war im tiefsten Winter bei eisigem Schneesturm.
7.
Nun heben die schlechten Tage an. Herrenlos und heimatlos irrte der arme Hund durch Straßen und über Plätze, hungrig, dürr und von Wind und Wetter zerzaust. Er schlich sich in Hinterhöfe, schnüffelte an den Mülltonnen herum und kratzte alles Eßbare aus der gefrorenen Erde hervor. Andere Hunde scharten sich um ihn, gestriegelt und wohlgenährt, sträubten das Fell, gingen auf ihn los und erwiesen sich als die Stärkeren und wollten ihn zerfleischen. Die Gassenjungen warfen nach ihm, wenn sie aus dem verharschten Schnee einen Stein lösen konnten. Die erwachsenen Leute aber hatten so viel zu tun, daß sie keine Zeit hatten, sich um herrenlose Hunde zu kümmern.
Eines Tages trottete Zeus an einem der großen Häuser der Stadt vorbei. Der herrenlose Hund blickte aufmerksam um sich, ehe er zweifelnd vor diesem Haus stehenblieb. Oh, doch. Er kannte dieses Haus. Hier hatte er einmal mit seinem Herrn an einer Gesellschaft teilgenommen, aber das war jetzt schon lange her. In einem Zustand vollkommenen Glücks war er hier durch die Zimmer gestreift; alles war ein einziges Lächeln; die Welt, in der er lebte, war erfüllt von Strahlen der Sympathie und sanft dahinplätscherndem Plaudern; weiße Hände streichelten seinen Pelz; er bekam alle möglichen Leckerbissen. Und der beste Strahl ging von den Augen seines Herrn aus. So war es damals.
Der Hund stand noch immer draußen auf der Straße und betrachtete das Haus, so wie ein Reisender eine zweifelhafte Furt betrachtet. Schließlich faßte er einen Entschluß und spazierte in die Vorhalle hinein.
Drinnen hörte man, daß von außen an der Tür gekratzt wurde, und die Hausherrin öffnete selbst, um nachzusehen, was es damit auf sich hatte. Und da war es nur ein Köter!
Er sah ihr direkt ins Gesicht, die Demut leuchtete aus seinen braunen Hundeaugen; er wedelte mit dem Schwanz, sein ganzer Körper bebte vor Ehrfurcht und Bitten. Und ein kleines Mädchen erschien in der Türöffnung und sagte: Nein, so etwas, das ist ja Zeus, der Hund des Dichters!
Was für ein Unsinn, sagte die Hausherrin. Der Dichter hat ihn schon längst hergegeben. Dann holte die Hausherrin einen alten Spazierstock, und im nächsten Augenblick ging ein dröhnender Schlag auf den zottigen, abgemagerten Körper nieder, das Tier heulte laut auf, doch sie schlug weiter!
Der Hund schlich wimmernd auf die verschneite Straße hinaus. Es war klirrender Frost. Die Hausherrin ging wieder in ihr Zimmer zurück und schürte das Feuer.
Das wäre ja noch schöner, sagte sie, wenn unsere Haustür herrenlosen Hunden offenstünde!
8.
Selbstverständlich fand die Tochter des Grossisten einen wirkungsvolleren Anlaß, die Verlobung mit ihrem Liebsten zu lösen, als beim ersten Versuch, von dem wir wissen, wie er mißglückte. Für die Geschichte von Zeus spielt es keine Rolle, was der Anlaß war.
In seiner Verzweiflung ist der Dichter im Ausland herumgereist, ohne Verlobte, ohne Hund, allein. Er ist nach Hause zurückgekehrt und sitzt wieder wie früher in seinem Zimmer in der Hauptstraße und brütet vor sich hin. Sein Pessimismus ist gewachsen, Weltschmerz erfüllt die Seele des Dichtkünstlers bis in die hintersten Winkel; nichts scheint ihn aus seinem Alptraum aufwecken zu können. Nicht einmal ein Hund leckt seine Hände, nicht einmal ein Hund erinnert ihn an die helle Seite des Lebens. Dieser Mann scheint schon seit langem davon überzeugt zu sein, daß die Geschichte von der Sonne am Himmel leeres Gewäsch sei und die Helligkeit des Tages ihre Wurzel in der Unzulänglichkeit des Auges habe.
Ich Narr habe an die Treue der Frau geglaubt! sagt er. Edle Stadt, du zitterst vom Gesang der Leiern und funkelst Tag und Nacht im Lichterglanz, und tausend Dichter preisen die Herzen deiner Frauen in den schönsten Gedichten. Wehe, selbst die Herzen deiner Frauen sind nicht soviel wert wie die Treue eines Hundes. Ich wünschte, mein Zeus wäre hier!
An einem Wintermorgen gegen neun Uhr, als der Dichter eben aufgestanden war und aus dem Haus gehen wollte, bemerkte er, daß etwas vor seiner Tür lag, etwas Großes, Dunkles, Zottiges, halb von Schnee bedeckt. Und als der Dichter es abtastete, spürte er, daß es ein Tierkörper war, und so abgemagert, daß man die Rippen zählen konnte. Das Tier gab kein Lebenszeichen von sich, doch es war noch lauwarm, konnte also noch nicht lange tot sein.
Heidbaes
1.
Leben wir nicht auf einem Vulkan?
Droben in den Gebirgstälern wohnen Philosophen.
Der Vulkan Ketill steht seit tausend Jahren drohend über der Gemeinde und hat seine Drohungen immer wieder wahrgemacht: Lava ist über blühende Gegenden geflossen, es hat Asche auf das Land geregnet. Das Spiel des Berges ist blutiger Ernst: Mißjahre, Hunger und Seuchen.
Dennoch sind erstaunlich wenige geflohen. Kommen wir in tausend Jahren hier herauf in die Täler, und versuchen wir, die Philosophen ausfindig zu machen. Philosophen? Meinen Sie diese alten Denker, die vor Zeiten hier gewohnt haben sollen? Nein, selbst ihre Gräber sind verschwunden.
Doch der Berg Ketill wird noch tausend Jahre lang stehen, und noch tausend Jahre dazu, ein dunkelgrauer Unhold, den neue Zeiten weder zurückdrängen noch zersetzen, so viele neue Zeiten hat er erlebt, ein Fels, dem nur der Ozean der Ewigkeit etwas anhaben kann.
2.
Die Geschichte spielt droben an der Brust des Landes, droben bei den Einöden und Gletschern, den Lavafeldern, Gebirgspässen und Sandwüsten, den Bergen, unter denen das Feuer lodert.
Eine halbe Tagereise oder weniger vom Vulkan Ketill entfernt steht der Hof Hrauntun, freundlich und hübsch, mit fünf roten Holzgiebeln zum Hofplatz hin, und wenn das Kind auf dem Hofplatz steht, sieht es den Hahnenfuß vom leuchtend grünen Grasdach herablächeln, den Löwenzahn und das Vergißmeinnicht.
Hier wohnt eine Witwe, die Gunnhildur heißt, und sie hat eine Tochter namens Astridur, und Astridur wurde im Frühjahr achtzehn, und dann kam ein junger Knecht auf den Hof; sie erinnerte sich nicht daran, daß sie je zuvor einen jungen Knecht gehabt hatten.
Er hieß Helgi und war ein außerordentlich tüchtiger Arbeiter. Er arbeitete vom frühen Morgen bis tief in die Nacht hinein, man sah ihn nie schlafen, und er war nie müde, und wenn er sich Ruhe gönnte, nahm er stets ein Buch zur Hand und las, es war immer dasselbe Buch, das einzige, das er besaß, die Saga von dem starken Grettir Asmundarson, der auf der Insel Drangey erschlagen wurde.
Helgi war groß und breitschultrig, hatte blondes Haar und blaue Augen, wie sie selbst, und große, schwielige Hände, und abends, wenn er sich wusch, sah Astridur seine nackten Arme, wie kräftig sie waren. Er war ein schweigsamer Mann; in den seltenen Fällen, in denen er etwas sagte, sprach er über die Verrichtungen auf dem Hof, die Schafhaltung und die Arbeit im Kuhstall.
Wenn Astridur ihm gegenüber auf die Isländersagas zu sprechen kam, oder auf die Gedichte von Kristjan Jonsson und den Eid von Thorsteinn Erlingsson, dann erzählte er eine Episode aus dem Leben Grettirs, in wenigen und oft schlecht gewählten Worten, um nicht ganz stumm zu bleiben. Trotzdem wurden sie gute Freunde, Astridur und Helgi. Dann begann die Frühjahrsarbeit.
3.
Es war eines Abends, als sie über die Hofwiese zum Haus zurückgingen und den ganzen Tag gearbeitet hatten. Der Gletscher war von weißlichen Nebelschleiern verhüllt. Die Berge waren wie eine große Nachtviole, alle außer dem Ketill. Ab und zu durchbrach das Zwitschern eines Vogels die Stille. Der Rauch aus den Schornsteinen stieg gerade empor und verschwand.
Sie setzte sich am Hofbach nieder, um ihren Schuh zu richten, er setzte sich auch und sah versonnen hinauf zu den Bergen.
Als Grettir geächtet war, hielt er sich einen Winter lang in der Nähe dieser Berge auf. Er senkte den Blick und sah die undeutlichen Spiegelbilder von Astridur und sich im Bach zu ihren Füßen.
Er und sie.
Dann blickte er auf und lachte.
Warum lachst du? sagte sie.