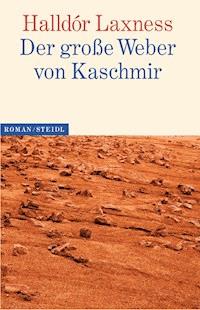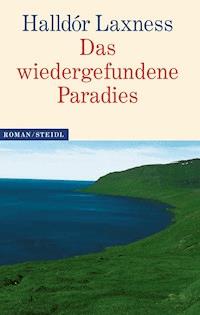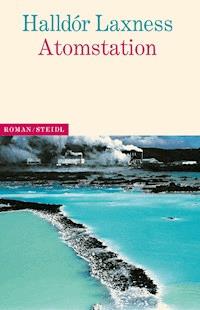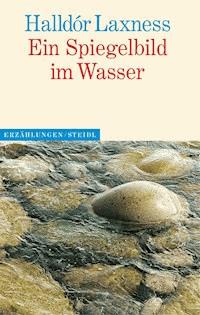Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Pfarrhaus in nordischer Gletschereinsamkeit ist der Schauplatz dieses ironisch-weisen Romans des isländischen Nobelpreisträgers Halldor Laxness. Ein junger Theologe, vom Bischof zur Aufklärung mysteriöser Vorfälle dorthin entsandt, sieht sich mit Reden und Taten konfrontiert, die er nicht versteht. Die bodenständige Esoterik der Einheimischen lässt sich mit seinem Tonbandgerät nicht einfangen, und die frappierende, humane Logik des Lebens am Gletscher ist so offenbar, dass sie leicht übersehen werden kann. Es ist dieselbe Logik, die auch die Sagas und die Poesie regieren. Laxness setzt ihr mit diesem Roman aufs neue ein Denkmal: Das abgeschiedene Haus am Firn, er zeigt es und als unbemerkten Nabel der Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Halldór Laxness Am Gletscher
Roman
1. Der Bischof will jemanden schicken
Der Bischof ließ Unterzeichneten gestern abend zu sich kommen. Er bot mir eine Prise an. »Danke, davon muß ich niesen«, sagte ich.
Bischof: »Na so was! Noch billiger geht es nicht. Früher schnupften alle jungen Theologen.«
Unterzeichneter: »Och, ich bin nicht gerade ein großer Theologe. Ich verdiene diese Bezeichnung kaum.«
Bischof: »Ich kann Ihnen leider keinen Kaffee anbieten, meine Frau ist nicht zu Hause. Sogar Bischofsfrauen bleiben abends nicht mehr zu Hause: Das ist der gesellschaftliche Verfall. Ja, mein Bester, Sie sind ein prächtiger junger Mann. Ich habe ein Auge auf Sie, seit Sie voriges Jahr für uns das Protokoll der Synode geführt haben. Es war fabelhaft, wie Sie das Gewäsch der Brüder Wort für Wort mitstenographierten. Wir hatten noch nie einen Theologen, der Stenographie konnte; außerdem können Sie mit diesem Lautschreiber umgehen, oder wie das Ding heißt.«
Unterzeichneter: »Wir nennen es Tonband. Lautschreiber ist besser.«
Bischof: »Ach, dieser ganze Grammophonismus heutzutage, Herr du mein Gott! Können Sie auch Fernsehen machen? Das ist noch großartiger. Fast wie im Kino: Nach zwei Minuten bin ich eingeschlafen. Wo haben Sie das alles bloß gelernt?«
Unterzeichneter: »Es ist kein Problem, Bandaufnahmen zu machen. Ich bekam Übung darin, als ich Hilfskraft beim Rundfunk war. Aber mit Fernsehen hatte ich noch nie zu tun.«
Bischof: »Das macht nichts. Tonband genügt uns. Und Stenographie. Es ist doch erstaunlich, daß man solche Rattenschwänze lernen kann. Fast wie Arabisch. Man sollte Ihnen die Weihe geben. Sie haben doch selbstverständlich etwas Festes?«
Unterzeichneter: »Ich gebe stundenweise Unterricht in Sprachen und ein bißchen auch in Rechnen.«
Bischof: »Auch in Sprachen gut, ah ja!«
Unterzeichneter: »Ja, ich kann ein bißchen was in den fünf bis sechs Sprachen, die man zum Abitur braucht, und auch ein wenig Spanisch, denn ich bin einmal mit einer Gruppe nach Mallorca gefahren und habe mich darauf vorbereitet.«
Bischof: »Und die Theologie? Alles in bester Ordnung, nicht wahr?«
Unterzeichneter: »Ich denke schon. Ein großer Glaubensstreiter bin ich aber nicht.«
Bischof: »Rationalist? Ja, das haben Sie gemeint! Davor soll man sich wahrlich in acht nehmen. Ein schlechter Kerl, der Rats-Jon.«
Unterzeichneter: »Ich weiß nicht, als was man mich bezeichnen sollte. Wahrscheinlich bin ich ein ganz gewöhnlicher moderner Esel. Sonst nichts. Trotzdem habe ich keine schlechte Note in Theologie bekommen.«
Bischof: »Wollen Sie sich vielleicht nicht weihen lassen?«
Unterzeichneter: »Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.«
Bischof: »Sie sollten aber darüber nachdenken. Dann sollten Sie sich eine Frau nehmen. So ging es bei mir. Es ist auch gesund, Kinder zu haben. Dann erst beginnt man den Gang der Schöpfung zu verstehen. Ich möchte einen Mann auf Reisen schicken. Wenn es gut geht, sollen Sie später einmal eine gute Pfarrstelle bekommen. Aber eine Frau müssen Sie sich selber suchen.«
Jetzt begann ich aufzuhorchen und zu warten, doch der Bischof kam auf französische Literatur zu sprechen. »Es macht Spaß, französische Literatur zu lesen«, sagte er. »Meinen Sie nicht auch?«
Unterzeichneter: »Ich denke schon. Wenn man Zeit dazu hätte.«
Bischof: »Kommt es Ihnen nicht sonderbar vor, daß die größten Schriftsteller Frankreichs Bücher über Island geschrieben haben, die sie unsterblich machten? Victor Hugo schrieb ›Hans von Island‹ , Pierre Loti ›Islandfischer‹ , und Jules Verne krönte das Ganze mit jenem gewaltigen Meisterwerk über den Snæfellsgletscher, ›Reise zum Mittelpunkt der Erde‹ . Darin kommt Arni Saknussemm vor, der einzige Alchimist und Philosoph, den wir in Island gehabt haben. Keiner ist mehr der, der er vorher war, nachdem er dieses Buch gelesen hat. Niemals könnten unsere Leute so ein Buch schreiben, am allerwenigsten eins über den Snæfellsgletscher.«
Der Unterzeichnete war mit dem Bischof nicht ganz einer Meinung über das Buch, das in seiner Aufzählung den Schluß bildete, und er äußerte, daß er den Bericht des Schriftstellers über die Reise Phileas Foggs um die Erde höher einschätze als den über die Reise Otto Lidenbrocks durch den Krater auf dem Snæfellsgletscher.
Dabei stellte sich heraus, daß es dem Bischof gänzlich einerlei war, was ich von französischer Literatur hielt.
Bischof: »Was würden Sie dazu sagen, wenn ich Sie bäte, nach Westen zum Gletscher zu fahren und an diesem weltberühmten Berg die größte Untersuchung seit den Tagen Jules Vernes vorzunehmen? Ich bezahle nach Beamtentarif.«
Unterzeichneter: »Bitten Sie mich nicht, Heldentaten zu vollbringen. Außerdem habe ich gehört, daß Heldentaten nicht zum Beamtentarif geleistet werden. Meine Wenigkeit taugt nicht zum Ruhm. Doch wenn ich für Sie, Herr Bischof, einen Brief oder dergleichen nach Westen zum Gletscher bringen soll, dann wird mir das nicht zuviel sein.«
Bischof: »Ich möchte Sie auf eine etwa dreitägige Reise schicken. Sie bekommen von mir eine schriftliche Instruktion. Ich möchte Sie bitten, Sira Jon Primus an meiner Stelle aufzusuchen und ihm zu sagen, er solle Ihnen gestatten zu bleiben. Es muß da im Westen etwas untersucht werden.«
Unterzeichneter: »Mit Verlaub, was muß untersucht werden?«
Bischof: »Die Seelsorge am Gletscher.«
Unterzeichneter: »Wie sollte ich unerfahrener Mensch das anstellen? Mir fällt nichts Gescheites ein.«
Bischof: »Es wäre wohl am besten, wenn Sie damit anfangen, den alten Sira Jon selbst aufs Korn zu nehmen. Zum Beispiel müssen Sie herauszubekommen versuchen, ob der Mann verrückt ist oder nicht oder vielleicht nur begabter als wir anderen. Sechs Jahre hat er an einer deutschen Universität Geschichte studiert; schließlich ist er hier bei uns als Theologe gelandet. Er war immer ein unsicherer Kantonist. Manche sagen, er habe den Glauben verloren.«
Unterzeichneter: »Soll ich mich da wirklich einmischen?«
Bischof: »Da ich so etwas wie Unterkontorist im Ministerium für Kirchenfragen bin, frage ich in erster Linie: Weshalb repariert der Mann die Kirche nicht? Warum hält er keinen Gottesdienst ab? Warum tauft er die Kinder nicht? Warum beerdigt er die Toten nicht? Warum hat er zwanzig Jahre lang sein Pfarrergehalt nicht abgeholt? Ist er vielleicht nur gläubiger als wir anderen? Und was sagt die Gemeinde? Auf drei Inspektionsreisen habe ich dem Alten befohlen, diese Dinge endlich in Ordnung zu bringen. Das Ministerium hat ihm schon mindestens fünfzig Briefe geschrieben. Natürlich kam nie eine Antwort. Es ist nicht möglich, jemand öfter als dreimal zu warnen, geschweige denn ihm zu drohen: Beim vierten Mal ist die Drohung zum Wiegenlied geworden; danach hilft nichts mehr, als den Mann stillschweigend aus dem Amt zu entfernen. Aber wo sind die Verbrechen? Das ist es! Hier muß eine Untersuchung stattfinden. Jetzt gehen Gerüchte um, daß er erlaubt hat, eine Leiche auf den Snæfellsgletscher zu schaffen. Was ist das für eine Leiche? Das ist eine unerhörte Schande. Bitte ermitteln Sie das. Wenn es eine Leiche ist, dann wollen wir sie in die Ortschaft transportieren und in geweihter Erde begraben. Und wenn es etwas anderes ist, was ist es dann? Vorvoriges Jahr schrieb ich an den sogenannten Kirchenvorsteher; ich habe vergessen, wie er heißt. Die Antwort kam gestern nach sage und schreibe anderthalb Jahren; die guten Leute haben es wirklich nicht eilig. Was sind das für Weihnachtsmänner! Fühlt man sich jetzt am Gletscher mitverantwortlich? Gegen uns hier! Kommt mir vor wie eine Freimaurerloge. Und der hier ist genauso verrückt wie Sira Jon Primus. Ich glaube, es ist unerläßlich, daß Sie ihm auch ein bißchen auf den Zahn fühlen. Hier ist sein Wisch.«
Der Bischof reichte mir ein abgegriffenes Stück Papier, das kaum mit der Post gekommen sein konnte, sondern offenbar von Gehöft zu Gehöft weitergereicht und in vielen Gemeinden in den Taschen von Leuten zerknittert worden war. Dennoch verriet der Brief eine geistige Einstellung, wenn man sich so ausdrücken darf, die mehr Gewicht besitzt, als es den Anschein hat, und deren Argumente dort ankommen, wo sie zu Hause ist, die aber an anderen Orten wenig gilt. Während ich den Brief überflog, ließ der Bischof seinem Unmut freien Lauf. »Weiter soll er Anglern und Ausländern erlaubt haben, sozusagen vor der Nase der Kirche ein scheußliches Bauwerk zu errichten – bestellen Sie ihm von mir, er soll es sofort abreißen lassen! Außerdem muß er sich endlich von seiner Frau scheiden lassen. Ich habe gehört, daß er vor gut dreißig Jahren geheiratet hat, lange bevor ich Bischof wurde, und daß er sich noch immer nicht von seiner Frau hat scheiden lassen, obwohl sie nie mit ihm das Bett geteilt hat. Statt dessen soll er eine Weibsperson bei sich haben, die, man höre und staune, Stößeldora genannt wird! Will man etwa mit dem Christentum Schindluder treiben?«
Brief des Kirchenvorstehers Tumi Jonsen zu Brun am Gletscher an den Bischof. Hauptinhalt: Schreiber des Briefs bittet um Entschuldigung wegen Schreibfaulheit, Altersgebresten u.a.m.; er wolle jetzt endlich den Brief des Bischofs von Island beantworten, der ihm vorvoriges Jahr ordnungsgemäß zugestellt worden sei und der Fragen über das Christentum am Gletscher enthalte. Weiter auch Fragen, was an dem Gerücht zutreffend sei, daß der Gemeindepfarrer seinen Amtspflichten nicht recht nachkomme und sich die Amtshandlungen verzögerten; item, ob in den vergangenen Jahren ein sonderbarer Transport eines rätselhaften Kastens auf den Gletscher stattgefunden habe und so weiter. Der Kirchenvorsteher gestatte sich, nur das hervorzuheben, was seine felsenfeste Überzeugung in dieser Angelegenheit ist, daß nämlich weder in diesem Kirchspiel noch in anderen Ortschaften rund um den Gletscher jemand zu finden sei, der nicht anerkenne, daß der Gemeindepfarrer am Gletscher Sira Jon Jonsson, genannt Primus, ein gold Mensch sei (die Wörter gold und Mensch jedes für sich geschrieben, so daß klar war, daß der Briefschreiber das Wort »Gold« als Eigenschaftswort gebrauchte). Kein Geschöpf in dieser Ortschaft würde einen Tag ohne Sira Jon sein wollen. Die ganze Gegend wäre bekümmert, wenn einem so edlen Menschen auch nur ein Haar gekrümmt würde. Gewiß wird mitunter gesagt, daß unser Gemeindepfarrer nicht voreilig in Amtsgeschäften ist, doch ich wage in gewissenhafter Verantwortung als Kirchenvorsteher zu behaupten, daß alle in Ehren unter die Erde kommen und es am Ende darüber still ist wie in anderen bewohnten Gegenden hierzulande. Wenn andererseits hier in der Gegend ein Hausgerät nicht mehr zu gebrauchen ist, weil hierzulande ebenso wie in anderen Ländern nur noch der reine Schund hergestellt wird, dann zeigt sich, was an Sira Jon dran ist. Ganz gleich, was nun unbrauchbar geworden ist, Werkzeuge oder Maschinen, Kellen oder Messer, sogar zersprungene Tonkrüge – in den Händen Sira Jons wird alles neu oder sogar besser als neu. Ich fürchte, daß es für manch einen Reiter oder Autofahrer hier in der Gegend ein großer Verlust wäre, wenn Sira Jon sein Amt verlöre, ein Mann an der Straße, der stets bereit ist, Pferde zu beschlagen, sei es bei Tage oder bei Nacht, und ein Künstler, der für andere an defekten Motoren herumbastelt, so daß sie schließlich doch noch gehen. Zum Schluß, das stimmt, unsere Kirche ist in ziemlich schlechtem Zustand, wenn man auch in der Tat nur wenig darüber klagen hört; doch man sagt, der Herr sei groß. Darüber mache ich weiter keine Worte. Euer Hochwürden liebender, eifriger Diener Tumi Jonsen, Brun am Gletscher.
2. Vertreter des Bischofs – abgekürzt Vebi
Als es soweit gekommen war, daß Unterzeichneter die Reise in Erwägung zog, sagte der Bischof: »Zuerst muß man wollen; der Rest ist Technik.«
Unterzeichneter fuhr anstandshalber fort, darüber zu klagen, daß er zu jung sei und zu wenig Einfluß habe, um die Amtsführung ehrenwerter Greise zu überwachen oder das Christentum in Gegenden zu reformieren, in denen selbst die Worte des Bischofs keine Beachtung fänden. Was für eine »Technik« kann man von einem dummen Jungen in solch schwieriger Lage erwarten? Was soll ich sagen, was tun?
Bischof: »So wenig wie möglich sagen und tun. Die Augen offen halten. Über das Wetter sprechen. Fragen, wie der Sommer im vorigen und im vorvorigen Jahr war. Sagen, daß der Bischof Rheuma habe. Wenn Leute Rheuma haben, fragen, wo es sie quält. Nicht versuchen, etwas in Ordnung zu bringen – das ist unsere Angelegenheit im Kirchenministerium, sobald wir wissen, was los ist. Wir bitten um einen Bericht, das ist alles. Egal, was für irrige Ansichten und Märchen die Leute vorbringen, Sie sollen sie nicht bekehren. Nichts und niemand reformieren. Ihnen gestatten zu sprechen, nicht dagegen reden. Und wenn sie schweigen, worüber schweigen sie? Notieren, was wichtig ist, ich umreiße das alles in der schriftlichen Vollmacht. Den Rahmen nicht selber erweitern. Sachlich schreiben. Wir wollen nichts Amüsantes vom Westland hören, wir lachen hier in Reykjavik auf unsere eigenen Kosten. Soviel wie möglich in der dritten Person schreiben. Akademisch, ja, aber in Maßen. Vom Tonband lernen.«
VeBi (hernach Vebi geschrieben): »Wenn der Pfarrer ständig an alten Motoren herumbastelt oder Kasserollen repariert und die Leute zu beerdigen vergißt, so daß die Leichen auf den Gletscher gebracht werden – nein, weiter kann man die Narrenstreiche nicht treiben.«
Bischof: »Ich bitte um Tatsachen. Das übrige ist meine Sache.«
Vebi: »Soll ich nicht einmal sagen, was ich von der Sache halte?«
Bischof: »Nein, nein, nein, lieber Freund. Uns ist ganz gleich, was Sie davon halten. Wir fragen, was Sie sehen und hören, nicht, was Sie davon halten. Meinen Sie, daß wir hier solche Wickelkinder sind, daß man für uns denken und schlußfolgern, uns übers Töpfchen halten muß?«
Vebi: »Aber wenn sie anfangen, mir die Hucke voll zu lügen?«
Bischof: »Ich bezahle das Band. Aber aufpassen, daß sie nicht durch Sie lügen. Daß Sie nicht selbst lügen!«
Vebi: »Irgendwie muß ich doch überprüfen, was sie sagen.«
Bischof: »Nichts überprüfen. Wenn die Leute lügen, nun denn. Wenn sie irgendeinem Irrglauben anhängen, dann um so besser! Vergessen Sie nicht, daß es nur wenige gibt, die ein wenig die Wahrheit sagen; keinen, der viel, geschweige denn einen, der die reine Wahrheit sagt. Gesprochene Worte sind eine Tatsache für sich, seien sie nun wahr oder gelogen. Wenn Menschen sprechen, dann enthüllen sie sich selbst, ob sie nun lügen oder die Wahrheit sagen.«
Vebi: »Und wenn ich sie bei einer Lüge ertappe?«
Bischof: »Über niemanden im Bericht schlecht sprechen. Denken Sie daran, daß das, was man Ihnen vorlügt, vielleicht sogar wissentlich vorlügt, oft aufschlußreicher ist als eine wahre Geschichte, die man aufrichtig erzählt. Verbessern Sie nichts, geben Sie sich nicht mit Auslegungen ab. Das ist unsere Angelegenheit. Wer vor diesen Leuten bestehen will, der möge darauf achten, daß er nicht selber vom Glauben abweicht.«
3. Bericht über die Reise von der Hauptstadt zum Gletscher
Ich fuhr mit dem Linienbus und hatte meine Sachen in einem Seesack. Schlußtag der Fischfangsaison 11.Mai. Diese Zeit heißt »zwischen Heu und Gras«, vom Gesichtspunkt des Schafes aus gesehen: Die Heuvorräte sind erschöpft, aber das Gras sprießt noch nicht. Dann ist es oft traurig bestellt um die Wiederkäuer; der Frühling war in Island schon immer die Zeit, in der Mensch und Tier verhungerten.
Die wenigen, die zu dieser Zeit des Jahres unterwegs sind, sind ungefähr ebenso merkwürdige Leute wie der Unterzeichnete selber; sie sind mürrisch und unwirklich, schlüpfen an einer unerwarteten Stelle aus dem Wagen und verschwinden querab im Wiesenmoor, als wohnten sie dort in einem Sumpfloch; oder der Fahrer hält unbegreiflicherweise irgendwo im freien Gelände und wirft etwas durch das Fenster; gewöhnlich fällt es in eine Pfütze: ein Zeitungsbündel, ein Beutel, ein Paket.
Die Berge rechts vom Weg sind oben schwarz. Einzelne Schneewehen; auf den Hängen verdorrtes Gras; das große Wiesenmoorgelände zwischen Gebirge und Strand kaffeebraun. Doch ein sonderbar heller Glanz auf Flüssen und Seen begleitet den Reisenden, wenn auch der Himmel bedeckt und der Zweck seiner Reise vielleicht wenig erfreulich ist. Um diese Zeit steht die Sonne hoch, und die Nächte werden nicht so dunkel, daß es der Rede wert wäre; doch noch sind sie nicht ganz hell. Die Schafe scheinen mir noch ziemlich schwerfällig, wie sie da im Wiesenmoor nach etwas suchen; doch bald wird es für sie besser werden. Die Vögel hingegen sind zu Wasser und zu Lande lebhaft, sie finden eher Nahrung als andere Geschöpfe. Eistaucher sind schon auf den Seen und schwimmen lange unter Wasser, sie finden also etwas; Schwäne zu zweit auf den Teichen, so weiß, daß sie leuchten, oder in einer Schar am Ufer, wo sie sich putzen. In einer Gemeinde fliegt eine Seeschwalbe landeinwärts und wieder hinaus zum Meer. »Komisch, nur diese eine Seeschwalbe«, sagt jemand, »sonst sieht man sie immer bloß zu Tausenden.« Da ruft eine Frau schrill dazwischen, daß es ein Erkundungsvogel sei, von anderen Seeschwalben ausgeschickt, um nachzusehen, ob das Land noch aus dem Meer emporrage.
»Woher weiß die Frau das?« wird gefragt.
»Das kann sich doch jeder selber sagen«, erwidert die Frau, »denn heute ist erst der elfte, und die Seeschwalbe kommt nie vor der Kreuzmesse am vierzehnten.«
Frage: »Wer kann behaupten, daß alle Seeschwalben außer dieser am vierzehnten kommen?«
Die Frau: »So steht es in der Zeitung.«
Die Raubmöwe ist ein düsterer Vogel; sie fliegt bei Windstille so, wie ein Stück Papier im wütenden Sturm davonsaust, ohne die Flügel merklich zu bewegen. Sie läßt die Luft arbeiten und steuert nur; manchmal tut sie so, als hätte die Kraft sie verlassen oder als hätte sie die Kunst des Fliegens verlernt, und flattert und flattert, bis sie mit dem weißen Bürzel nach oben zur Erde fällt; am Boden fängt sie dann an, sich abzurackern; es ist, als seien ihre Flügel gebrochen oder ausgerenkt; sie verhaspeln sich fortwährend, wenn sie zu trippeln versucht, so daß sie sich halb überschlägt. Was hat dieses sonderbare Getue zu bedeuten? Soll das vielleicht nur die Weibchen in Versuchung führen?
4. Abend am Gletscher
Wir sind am Gletscher; der Fahrer sagt: »Hier müssen Sie aussteigen.« Auf der anderen Seite der Straße, nach dem Meer zu, hinter einem grünen Wiesenhügel, ist ein grasfreier, mit Schotter bedeckter Platz. Dort steht ein alter Schuppen, etwa zwei mal drei Meter groß, mit Wellblech verkleidet. Er ist verschlossen. Abend; Nebel hat sich auf die Bergränder gelegt. Außer dem Schuppen gibt es keine Anzeichen menschlicher Behausungen, nur eine morsche, in die Erde eingelassene Holzbank aus drei Planken an der einen Seite neben der Schuppentür. Unterzeichneter setzt sich auf die Bank, den Seesack neben sich, und nimmt die Karte heraus. Der Nebel ist überall vom Gebirge herabgekommen und nirgends dunkler als da, wo nach der Karte der Gletscher sein soll. Es nieselt. Der ergrünende Wiesenhügel leuchtet in der Dämmerung; hier und dort ragen Lavazacken aus ihm empor.
Als ich wieder an der verschlossenen Schuppentür rüttelte, sah ich über der Tür ein Brett, auf das vor langer Zeit mit Ruß oder Teer Buchstaben gemalt worden waren; obwohl die Schrift ausgeblichen und verstaubt und das Brett morsch war, konnte man diese Worte entziffern: »Hier werden Primuskocher repariert.«
Der Weg zum Pfarrsitz führte im Halbkreis um den Wiesenhügel. Dicht am Weg stand ein angepflocktes Kalb, äußerst elend, dickbäuchig, mit Durchfall, faltig, mit zottiger Stirn; es ließ den Kopf hängen, brüllte nicht. Der Gast stand auf dem Hofplatz. Die Längsseite des Hauses war dem Meer zugekehrt, und die Hauswiese erstreckte sich bis zu den Küstenfelsen, über denen weiße Vögel schwebten.
»Ist das der Bischof?« fragte eine Frau und trat in die Tür.
Vebi: »O nein, leider nicht. Aber ich bringe einen Brief aus Reykjavik.«
Die Frau: »Sie sind so gut wie der Bischof, und Sie wurden durch ein Telegramm angekündigt. Bitte treten Sie ein. Der Pfarrer ist aber nicht zu Hause.«
Es war ein langer Gebäudekomplex, aus vielen einzelnen Bauten bestehend; ein länglicher Vorbau von Osten nach Westen, aus Holz, mit Wellblech verkleidet; Fenster und Tür auf der Seite, die zum Meer hin lag. Daran schlossen sich unförmige hölzerne Schuppen an, die allmählich in eine unendliche Zahl baufälliger oder bereits zerfallener Grassodenhütten übergingen; die entferntesten verwuchsen mit den grünen Hügeln auf der Hauswiese. Diese Architektur, eine Hütte an der anderen, erinnerte ein wenig an die Vermehrung der Korallen oder die eines Kaktus. Die Frau führte mich in das Besuchszimmer. Dann verschwand sie.
Ich wartete. Alle Türen standen offen. Feuchte Zugluft kam herein, und das schrille Geschrei der Meeresvögel von den Felsen erfüllte das Haus. Es dämmerte. Die Außentür war aus den Angeln; eine Zimmertür führte zum Flur; sie knarrte durchdringend, wenn man sie zu bewegen versuchte. Das Zimmer war einst hellblau gestrichen gewesen, doch die Farbe war abgeblättert, und darunter war dunkelrote Farbe von einem noch älteren Anstrich, und in den dunkelroten Flecken hatten sich andere Flecke gebildet; diese inneren Flecke waren giftgrün. Im Zimmer stand ein riesig langer Tisch mit Holzbänken an beiden Seiten. Alles aus unbearbeiteten Planken, mit Vierzöllern zusammengenagelt; das Mobiliar des Hauses bestand aus Kommode, Schreibtisch und Sekretär, alles in mehr als verkommenem Zustand. Es war nicht leicht, sich vorzustellen, was aus den Schubladen geworden sein mochte, denn sie waren samt und sonders aus den Möbeln verschwunden. Als der Vertreter des Bischofs eine Stunde lang dagesessen hatte, begann er in der feuchten Kälte zu frieren. Was sollte Ihr Vertreter mit sich anfangen? Sollte er vielleicht die Frau suchen und ihr sagen, ihm sei kalt? War er denn in dieses unbekannte Haus gekommen, um über sein Los zu klagen? Er gelangte zu dem Ergebnis, daß er kein Recht hätte zu klagen. Er war zu nichts anderem hierhergeschickt worden, als nach Tatsachen zu suchen. Wenn er heute nacht unversorgt hier aufbleiben müßte, so war das eine Tatsache für den Bericht, so gut wie jede andere. Es ist ebenso unwissenschaftlich wie unredlich, einen wissenschaftlichen Prozeß aus moralischen Gründen mittendrin abzubrechen, zum Beispiel, weil man kalte Füße bekommen hat.
Ihr Vertreter hatte die erste Stunde damit verbracht, den Reisebericht des Tages stenographisch hinzukritzeln, hörte jedoch wegen der Kälte damit auf. Auch war es zum Schreiben nicht mehr hell genug, und daher bricht der Bericht bei den Raubmöwen in der Gemeinde Kolbeinsstadir ab. Er stand auf, räkelte sich, kämpfte ein bißchen mit der knarrenden Tür, ging hinaus in Richtung auf das Meer; gelangte an den Rand der Felswand. An vielen Stellen war sie vierzig Klafter hoch, an manchen sicher sechzig. Diese kohlschwarzen Felsen waren wie mit Schnee bedeckt, so dicht gedrängt saßen die weißen Vögel im nächtlichen Dunkel darauf. Auf einem nur handbreiten Felssims wohnten viele Familien. Es war eine Kolonie von Dreizehenmöwen.
5. Das Kapitel über Stößeldora und den Elfenwidder
Es ist 00.00 Uhr. Mitternacht. Wahrhaftig, kommt einem da nicht so etwas wie Kaffeeduft aus dem Haus entgegen! Drinnen hat man ein Tuch über den Tisch gebreitet und Gebäck hingestellt, sehr unterschiedlich nach Farbe und Form; ich glaube behaupten zu dürfen, daß es Hunderte von Einzelstücken auf ungefähr zwei Dutzend Tellern waren. Doch wurde das Maß erst voll, als die Frau drei Kriegstorten auftischte, so genannt, weil sie im Krieg modern wurden. Jede maß etwa zwanzig Zentimeter im Durchmesser und war etwa sechs bis acht Zentimeter hoch. Schließlich brachte die Frau Kaffee herein und schaltete das Licht ein, eine nackte Fünfzehn-Watt-Birne, die an einem Kabel von der Decke hing.
Die Frau sagte entschuldigend: »Jetzt will ich doch das da einschalten, obwohl wir es auf dem Hof hier kaum tun. Das da wurde Sira Jon vor ein paar Jahren aufgezwungen, als es nach den neuen Gesetzen auf jeden Hof geleitet wurde, ob die Leute es haben wollten oder nicht.«
Unterzeichneter wußte zuerst nicht genau, was »das da« war, das man nicht beim Namen nennen durfte. Allmählich ging mir auf, daß die Frau über elektrisches Licht sprach.
Vebi: »Es ist nicht nötig, meinetwegen das elektrische Licht anzuschalten. Eine Kerze genügt.«
Die Frau: »Das kann man Bischöfen kaum zumuten.«
Am Ende jedoch knipste die Frau das Licht aus, das man nicht beim Namen nennen durfte, und steckte eine Kerze an; das war in der Tat viel feierlicher als die nackte Fünfzehn-Watt-Birne. Die Frau goß Kaffee in die Tasse des Gastes und bat ihn, sich zu bedienen, postierte sich dann an der Tür, sah streng aus. Der Kaffee schmeckte nach Erde, und wenn ich die Wahrheit sagen soll, so sank mir der Mut, als ich so vielerlei Gebäck um so schlechten Kaffee versammelt sah. Mir kam es so vor, als ob die Frau mit jenem Pflichtgefühl auf mich aufpaßte, aus dem heraus man nachsieht, ob das Vieh das frißt, was man ihm gibt. Sie war eine ehrbare, doch wortkarge Frau. Vielleicht wünschte sie sich ewiges Schweigen und fühlte sich unwohl an Körper und Seele, wenn sie zuerst angesprochen wurde; es war besser, vorsichtig zu Werke zu gehen. Vielleicht war nur ein kleines Gitter um sie herum wie um ein Denkmal auf einem Platz. Eine saubere Frau. Kaum viel älter als sechzig. Gedrungen, ein wenig plump.
Vebi: »Vielleicht ist der Pfarrer schon im Bett?«
Die Frau: »Das ist mir nicht bekannt.«
Vebi: »Mit Verlaub, sind Sie nicht die Frau des Hauses?«
Die Frau: »Bisher wurde ich nicht dafür gehalten.«
Vebi: »So viele Kuchen habe ich noch nie auf einmal gesehen. Haben Sie alle diese Kuchen selber gebacken?«
Die Frau: »Wer denn sonst? Die hier nennen mich ja Stößeldora.«
Vebi: »Ein sonderbarer Name.«
Frl.Stößeldora: »Die hier sind wohl der Ansicht, daß ich den Stößel im Mörser etwas kräftig handhabe.«
Vebi: »Das ist doch sehr nett gedacht.«
Frl.Stößeldora: »Manches wird hier in der Gemeinde mit scheelen Augen angesehen. Große Damen, die eine Rührmaschine haben, reden abfällig über meinen Mörser. Was ist Kardamom, ehe er unter dem Stößel gewesen ist, sage ich. Bitte, langen Sie zu.«
Vebi: »Entschuldigen Sie, ist die Pfarrersfrau selbst nicht zu Hause?«
Frl.Stößeldora: »Ich weiß nicht. Ich denke, sie ist vielleicht nicht anwesend. Hätte der Bischof mit ihr zu sprechen?«
Vebi: »O nein. Ich frage nur so.«
Frl.Stößeldora: »Ja, eben. Man könnte versuchen, in Nedratradkot weiter im Osten nachzufragen. Es soll dort manchmal im Frühjahr nicht geheuer sein, sagen die hier.«
Vebi: »Sie sind doch die Wirtschafterin, nicht wahr?«
Frl.Stößeldora: »Ich bin bloß so hier. Ich gehöre zum Pfarrhof.«
Vebi: »Waren Sie schon hier, als Sira Jon hierher zog?«
Frl.Stößeldora: »Ja, ich bin von hier oben aus den Bergen.«
Vebi: »Oben aus den Bergen?«
Das Fräulein rang nach Luft, schloß die Augen und sog eine Art Luxus-Ja tief in die Lunge, sagte sozusagen ja im Ansaugtakt.
Vebi: »Oben aus den Bergen – ist das ein besonderes Geschlecht?«
Frl.Stößeldora: »Ich stammte nicht aus einem besonderen Geschlecht. Das tun andere.«
Vebi: »Keine besonderen Neuigkeiten hier in der Gegend?«
Frl.Stößeldora: »Es geschieht nicht gerade viel bei denen hier. Keinem passiert je etwas. Keiner hat etwas gesehen.«
Vebi: »Ihnen ist auch nichts passiert? Haben Sie nie etwas gesehen?«
Frl.Stößeldora: »Nichts Nennenswertes.«
Vebi: »Vielleicht etwas, was Sie nicht nennenswert finden. Zum Beispiel: Haben Sie nie ein Pferd besessen?«
Frl.Stößeldora: »Nein, Gott sei Dank. Zum Glück haben andere Pferde besessen, nicht ich.«
Vebi: »Wem gehört das Kalb?«
Frl.Stößeldora: »Das Kalb! Das da, das am Verrecken ist? Ich weiß nicht, wozu man mir so etwas schenkt. Außer ab und zu einmal Kaffee gibt es hier nichts, um ein Kalb zu füttern, und altes Gebäck, das ich in den Kaffee brösele. Hingegen halte ich nicht hinter dem Berge damit, daß mir einmal etwas passiert ist. Ich sah etwas. Aber nur dieses eine Mal.«
Vebi: »Es scheint besser zu gehen, als ich zuerst dachte.«
Frl.Stößeldora: »Natürlich erzähle ich das keinem einzigen Menschen.«
Vebi: »Tja, das ist nun wieder nicht so gut.«
Frl.Stößeldora: »Ich will in die Küche gehen und noch einmal Kaffee aufbrühen.«
Vebi: »Danke, das ist ganz unnötig. Ich pflege nie mehr als eine halbe Tasse zu trinken. Mir scheint aber, daß diese Kanne mindestens anderthalb Liter faßt.«
Es war nicht zu verhindern, daß das Fräulein wieder mit der Kanne in die Küche ging, um sie aufzufüllen, obwohl sie noch ziemlich voll sein mußte. Während der Vertreter des Bischofs im Zimmer allein war, konnte er die Augen nicht von den drei Kriegstorten lassen, die mit allerlei Köstlichkeiten reich gefüllt waren und zusammen sechzig Zentimeter Durchmesser hatten. Mir trat der Schweiß auf die Stirn.
In der Hoffnung, daß mit einiger Geduld etwas Lehrreiches aus dem Fräulein herauszuholen sei, ließ ich mir wider alle Gewohnheit die dritte Tasse eingießen. Das half. Das Kaffeetrinken des Gastes hatte eine befreiende Wirkung auf diese gehemmte Frau. Ihre Reaktionen wurden menschlicher, und vor Gott und den Menschen kapitulierend, unterzog sie sich jener seelischen Demütigung, die darin besteht, daß man eine Geschichte erzählt. Sie kam wieder auf jene eine Sache zurück, die ihr einst zugestoßen war, auf jenes eine Mal, als sie etwas gesehen hatte. »Es war vor fast fünfzig Jahren«, sagte sie, »aber ich weiß es noch so genau, als ob es gestern gewesen wäre. Darf ich dem Herrn Bischof ein Stück Torte abschneiden?«
Vebi: »Das ist wirklich ganz unnötig. Doch, hm, danke.«
Frl.Stößeldora: »Soll ich nicht ein Stück von dieser hier abschneiden? Kommt gar nicht in Frage, damit die Köter in den Teerbuden zu füttern.«
Der Gast bat sie inständig, nur von einer Torte ein Stück abzuschneiden, am liebsten von der mit der Zuckerkruste, denn sie war nicht so feucht wie die anderen, auch quollen aus ihr nicht so viel Sirup und Dosenfrüchte heraus. Dann schnitt sie mir ein Stück ab, das für sieben Personen genug gewesen wäre, und legte es auf meinen Teller.
Frl.Stößeldora: »Ich war ein junges Ding wie andere auch. Man schickte mich in irgendwelchen Angelegenheiten nach Bervik. Statt unten am Meer den Weg entlangzugehen, folgte ich oben den Schafpfaden über die Gletscherhügel. Dort gibt es viele schöne Mulden voller Moos und Beerenheide. Und wie ich nun so einen Hügel hinaufging, sah ich dort plötzlich einen braunen Widder ganz allein stehen, kein anderes Schaf weit und breit; er sah mich von unten aus der Mulde an; seine Hörner waren künstlich gerichtet. Ich habe mich mein Lebtag nicht so gefürchtet, ein sprachloses Menschenkind, ein schutzloses Mädchen; denn ich wußte, daß es hier am Gletscher weder diesen noch einen anderen Widder mit künstlich gerichteten Hörnern gab. Er schimmerte wie Gold. Mein ganzes Leben lang habe ich bei keinem einzigen Schaf ein solches Vlies gesehen. Mir kam es vor, als würde ich zu Stein. Ich konnte den Blick lange nicht von diesem wunderschönen Tier lassen, von dem ich wußte, daß es weder in den Gemeinden im Inneren noch in den Küstengemeinden, noch überhaupt in Island existierte. Er stand ganz still und sah mich an. Mir ist, als stünde ich noch heute dort und er sähe mich an. Was sollte ich tun? Zuletzt hatte ich doch so viel Verstand, aus seinem Blickfeld zu verschwinden. Ich lief in einem großen Bogen vom Hügel hinunter und die Senken entlang bis hinab ans Meer, und dann war ich auf der Straße, Gott sei Dank.«
Vebi: »Ein Elfenwidder?«
Die Frau atmete die Antwort im Falsett ein, sicher noch immer mit klopfendem Herzen. »Ich weiß es nicht.«
Vebi: »Ist man der Sache je auf den Grund gekommen?«
Frl.
6. Morgen am Gletscher
Ihr Vertreter war früh auf. Bei der Helligkeit war an Schlaf nicht zu denken, schon deshalb, weil in der blaßblauen Kammer, die mir Fräulein Stößeldora in der Nacht nach beendigtem Kaffeetrinken zum Schlafen angewiesen hatte, kein Vorhang vor dem Fenster hing; es war übrigens schon fast Morgen, als ich endlich ins Bett kam.
Die Kammer lag auf der rechten Seite des Korridors, wenn man durch die Außentür kam, gegenüber dem Besuchszimmer. Die Tür hing nur noch in einer Angel, man band sie hinter sich mit einer Schnur zu. Es war deutlich, daß sie vergangenen Winter zugenagelt worden war und im Herbst wieder zugenagelt werden würde.