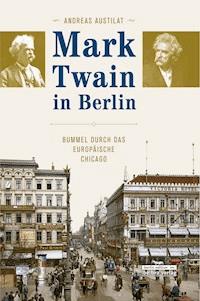9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Beim Blick in den Spiegel ist er mit der Frage konfrontiert: Wer ist das mit den grauen Schläfen und den tiefen Falten? Und: War‘s das jetzt eigentlich? Oder kommt da noch was? Witzig und pointiert wagt sich Andreas Austilat genau dahin, wo es wehtut im Leben des Alterspubertiers. Mitten hinein in Männergruppen, Fallschirmsprünge und Kettensägenkurse, in Paartherapie, Dating-Fiaskos und echte Liebe. Und am Ende ahnt er: Widerstand ist zwecklos. Wer sich einfach mal entspannt, hat gewonnen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
»Mit fünfzig fängt man ja schon mal an, Bilanz zu ziehen, wie es so gelaufen ist bisher. Das Leben an sich. Man muss Optimist sein, wenn man mit fünfzig noch glaubt, jetzt wäre Halbzeit. Nein, keine Frage, die Kurve zeigt nach unten. Die ganz großen Lebensentscheidungen, Frau, Haus, Kinder, sind längst alle getroffen. Natürlich kenne ich Leute, die glauben, sie könnten dann noch einmal von vorne anfangen …«
Autor
Andreas Austilat, geboren 1957, ist Reporter beim Tagesspiegel in Berlin. Regelmäßig erscheint dort seine beliebte Kolumne »Austilat spart« über die Wechselfälle des Lebens. Er ist verheiratet, hat Sohn und Tochter und wohnt in Berlin.
Von Andreas Austilat ist bei Goldmann außerdem erschienen:»Hotel kann jeder«»Vom Winde gesät«
Andreas Austilat
Auch das geht vorbei
Das Trostpflaster für den Mann ab 50
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe Februar 2020
Copyright © 2020 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagfoto: FinePic®, München
Redaktion: Antje Steinhäuser
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
KF · Herstellung: kw
ISBN: 978-3-641-24889-5V001
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Der Hahn tropft
2 Verlierer wie wir
3 Das Kettensägenmassaker
4 Pizza Studente
5 Zeit, die Reißleine zu ziehen
6 Paarberatung im Fliesenmarkt
7 Nestflucht
8 Farbenspiele in der Badewanne
9 »Papa! Was machst du denn hier?«
10 Ein ganzes Leben in sechs Alben
11 Der Triathlon
12 Tanz auf dem Tisch
13 Ein neues Projekt
Danke
Vorwort
Dieses Buch beruht auf vielen wahren Begebenheiten, eigenen Erlebnissen, Beobachtungen und Erzählungen anderer. Die handelnden Figuren sind erfunden. Sollte es Ähnlichkeiten mit echten Personen geben, gar jemand glauben, sich darin wiederzuerkennen, dann ist das keineswegs ein Zufall: Die auftretenden Charaktere sind in vielerlei Hinsicht typisch und kommen einem insofern womöglich vertraut vor.
1 Der Hahn tropft
»Das Wasser!«, schallte ihre Stimme von unten, der Vorwurf darin war unüberhörbar. »Komme schon«, murmelte ich auf dem Weg zum Bad. Meine Tochter Sophie stand am Fuß der Treppe, ein Handtuch über der Schulter. Fehlte nur noch, dass sie mit dem Fuß aufstampft, wie früher. Aber das machen Sechzehnjährige natürlich nicht. Jedenfalls stimmte irgendetwas mit der Dusche nicht. Wir hatten nur noch die Wahl zwischen ganz kalt oder brutal heiß.
Warum das so war? Ich hatte keine Ahnung. Ob es mit der extremen Hitze draußen zusammenhing? Es war nicht mal halb neun in der Früh, und selbst der Hund sah aus, als schien er zu schwitzen. Eigenartig, dachte ich, Hunde können gar nicht schwitzen. Dann fiel mir wieder ein, dass er vergangenen Sonntag neben dem Grill gestanden hatte und auch nicht weggelaufen war, als ihm das Fett aus den Bratwürsten über den Rand des Grills auf den Schädel tropfte. Immer noch klebten ihm die Kopfhaare in Strähnen zusammen. Was ihn nicht zu stören schien, im Gegenteil, wahrscheinlich mochte er die leichte Bratenfettnote, die selbst nach sechs Tagen wie eine Fahne hinter ihm herwehte. Man sollte den Hund vielleicht mal draußen unter den Rasensprenger stellen. Ging aber nicht, ich hatte nämlich ein Rasensprengverbot ausgesprochen. Wir müssen sparen, weil ich wohl wieder keine Gehaltserhöhung bekommen würde. Eine hohe Wasserrechnung liefe meinen Bemühungen da sehr zuwider.
Der Frühling war in diesem Jahr ausgefallen, der Sommer dauerte nun schon eine gefühlte Ewigkeit. Keine Frage, das musste der Klimawandel sein. Wahrscheinlich war der Durchlauferhitzer eines seiner ersten Opfer. Er kannte kein Mittelmaß mehr, keinerlei Dazwischen. Sollte das unser aller Schicksal sein? War der Durchlauferhitzer ein Beispiel dafür, dass auch Maschinen Gefühle entwickeln, sich am Ende der Natur unterwerfen müssen? In Gedanken entwarf ich einen Werbespot für einen Durchlauferhitzerhersteller, das Gerät trieb auf einer Eisscholle, die nicht kleiner wurde, weil der Heißwasserbehälter so gut isoliert war. Werbung ist mein Beruf.
»Das ist nicht schlecht!«, sagte ich laut.
»Papa, wovon sprichst du?« Sophie starrte mich an, während ich immer noch die Klinke der Badezimmertür in der Hand hielt. Erst jetzt schaute ich richtig hin. In ihrem Mundwinkel klebte noch ein wenig Marmelade. Das war wohl nicht der richtige Zeitpunkt, mit ihr über philosophische Fragen zu diskutieren. Sie wollte duschen. Und zwar lauwarm. Du liebe Zeit. Ist es nicht das Vorrecht der Jugend, sich in Extremen auszuprobieren? Lauwarm kann man doch später noch haben. In meinem Alter zum Beispiel. Wenn man nicht mehr so wild ist. »Warum duschst du nicht einfach mal eiskalt?«, sagte ich.
»Manchmal bist du echt komisch«, erwiderte sie, ließ mich stehen und ging in ihr Zimmer.
Natürlich wusste ich das mit der Dusche schon länger. Ich hatte gehofft, das Problem würde sich von alleine erledigen. Aber meine Tochter erwartete von mir, dass ich das jetzt richtete. So wie ich immer alles gerichtet hatte, wie früher zum Beispiel, als Maxi, ihr schwarzes Kaninchen, mit seinen Nagezähnen ihrer Lieblingspuppe den Zeh abgebissen hatte und sie zu mir gekommen war, um mich zu bitten: »Mach das wieder ganz.«
Die Kleine. Das heißt, Sophie war gar nicht mehr klein. Sechzehnjährige sind viel schwieriger zu beeindrucken als Kleinkinder. Sind sie noch kein Jahr alt, reicht es doch, den Lichtschalter an- und auszuknipsen, schon ist man so etwas wie Gott. Ein Mann mit magischen Kräften, Herr über Licht und Dunkelheit. Daran muss ich immer denken, wenn mir Markus von seinem Nachwuchs erzählt, von vollen Windeln und Schreibabys. Und dass er selbstverständlich Erziehungszeit genommen hat, als Noah zur Welt kam. Markus ist mein Kollege und war mit vierundvierzig spät gebärend. Jetzt tat er auf einmal so, als lägen Jahrzehnte zwischen uns. Was für ein Unsinn, ich bin Anfang fünfzig. Außerdem blieb Markus nur zwei Monate zu Hause, und er hatte dort auch nicht etwa den Laden alleine geschmissen, wie er uns heute in der Kantine glauben machen wollte, wenn er seine neuerworbenen erzieherischen Fähigkeiten zum Besten gab. Sogar wenn die Webdesignerin aus dem ersten Stock vom Stillen erzählt, will er mitreden. Und natürlich hatten es junge Eltern nie so schwer wie heute, seit sein Noah auf der Welt war. Alles sei ja so teuer. Wenn ich dann mal einwende, das sei nur der Anfang, hört er mir gar nicht zu. Er glaubt ganz fest, ich als alter Vater könne das nicht beurteilen. Außerdem sei sein Noah einzigartig, er könne nämlich schon sprechen, er sagt Mama und Papa und Babamm, wenn er Luftballon meint. Wahrscheinlich steckte auch ein bisschen Kalkül dahinter. In meinem Job gilt man jenseits der dreißig schnell als weniger kreativ, weil irgendwie in Routinen verfangen. Also geben sich alle so jung wie möglich und zwängen sich in viel zu enge Hosen.
Nun, ich kann versichern, da kommt noch eine ganze Menge mehr auf Markus zu. Ich weiß das, denn ich habe zwei Kinder, Florian heißt der Junge und Sophie das Mädchen. Sophie ist in der Pubertät, Florian schon drüber. Die sagen nicht Babamm zu Luftballon, die kommen mit den binomischen Formeln, Futur II in Französisch und dem Frauenbild bei Heinrich von Kleist. Und es mag ja sein, dass so ein Beutel Windeln nicht billig ist. Aber hat eigentlich irgendjemand, der sich gerade darüber Gedanken macht, wie man einem Vierjährigen Radfahren beibringt, eine Vorstellung davon, was ein Auslandsaufenthalt für einen sechzehnjährigen Oberschüler in Amerika kostet? Ich weiß es, denn Sophie plant seit Wochen genau das. Oder ein Führerschein. Und das, obwohl ich mit Anfang fünfzig gerade in einer Phase stecke, in der die großen Gehaltssprünge ausbleiben.
Das mit ihrer Puppe und dem Kaninchen damals war der erste Fall, in dem ich Sophies Vertrauen enttäuschen musste. Natürlich konnte ich keinen neuen Zeh modellieren. Stattdessen zog ich der Puppe eine Socke an und behauptete, sie hätte kalte Füße. Funktionierte leider nicht wirklich. Meine Tochter fand die Puppe fortan gruselig, verstieß sie, und ich wusste, dass Sophie mir insgeheim Vorwürfe machte. Dabei war ich gegen das Kaninchen gewesen. Kaninchen sind längst nicht so kuschelig, wie man gemeinhin glaubt. Und in seinem letzten Lebensmonat hat Maxi Tierarztrechnungen für zweihundert Euro aufgehäuft. Das meiste ging für seine Zahnbehandlung drauf. Das hat Maxi auch nicht gerettet, aber welcher Vater will seiner Tochter schon erklären, dass das liebe kleine Kuscheltier mit den traurigen braunen Knopfaugen keine Operation mehr bekommt? Weil sich das nicht mehr lohnt.
Jedenfalls war das mit der Dusche im Winter nicht wirklich ein Problem gewesen. Ich hatte da eine Theorie entwickelt. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass das Wasser aus dem gefrorenen Erdreich vorgekühlt ins Haus gekommen war. Da hatte es der Durchlauferhitzer ganz einfach nicht geschafft, das eisige Nass zum Kochen zu bringen. Jetzt macht er das im Handumdrehen, selbst wenn man ihn nur auf der kleinsten Stufe einschaltet. Er kann gar nicht anders. Ich löste zwei Schrauben, die den Gehäusedeckel an seinem Platz hielten. Drinnen sah ich ein mysteriöses Wirrwarr aus Röhren und Spulen. Ich hängte den Deckel wieder in seine Verankerung. »Was kann es Schöneres geben, als im Sommer kalt zu duschen«, murmelte ich vor mich hin.
»Mann, Papa!« Meine Tochter stand wieder in der Badezimmertür, verdrehte die Augen, während sie gleichzeitig mit einer Hand ein Bündel ihres Langhaars hielt und mit der anderen die Bürste darüber hinwegführte. »Wenn du das nicht hinkriegst, hol halt einen Klempner.«
Ich war nicht mehr ihr Held. Genauso gut hätte ich sagen können: »Lass uns einfach eine Socke über den Brausekopf ziehen.« Sie hielt ganz offensichtlich einen fremden Profi für zuverlässiger als mich. Ich musste irgendwie von dem Thema Dusche wegkommen. »Was hast du denn da für ein Armband am Handgelenk?«, fragte ich im Gegenzug und zeigte auf ein neongelbes Kunststoffbändchen an ihrem Unterarm, das allerdings nicht mehr ganz frisch war. »Weißt du doch, vom Hurricane.« Das war ein Festival, das sie besucht hatte, drei Tage lang, irgendwo am Rand der Lüneburger Heide. Unsere Tochter hatte ein halbes Jahr lang genervt und aufgezählt, wer dort alles hindurfte, offenbar die halbe Schule. Erst im Nachhinein hatte sich herausgestellt, dass es sich eigentlich nur um ihre beste Freundin handelte. Aber da war es schon zu spät, da hatte sie mir schon die Eintrittskarte abgeschwatzt, hundertachtzig Euro. Ich hatte auch nicht vergessen, dass sie dafür eigentlich den Schuppen streichen wollte. Wozu sie leider noch nicht gekommen war. »Hurricane war vor einem Monat«, sagte ich, statt sie an den Schuppen zu erinnern, »und du trägst das Band immer noch.« Ich erzählte ihr von Wolfgang Petry, einem Sänger, der früher ungefähr hundert solcher Bänder am Handgelenk getragen hatte. »Das ist Wahnsinn«, sang ich vor mich hin, der einzige Song von Wolfgang Petry, der mir einfiel. Meine Tochter blieb unbeeindruckt. Sie kannte Wolfgang Petry nicht, und meinen Einwand, dass häufiges Duschen gar nicht gut für prähistorische Armbänder von hohem zeitgeschichtlichem Wert wäre, fand sie kein bisschen lustig. »Mann, Papa«, sagte sie noch mal.
Ich schraubte den Deckel wieder fest. »An der Elektronik liegt es nicht«, behauptete ich. Was einigermaßen kühn war, denn meiner Theorie vom Einfluss der Jahreszeiten auf die Wasserversorgung fehlte bislang der Beweis. Aber irgendetwas musste jetzt passieren. Und wieso sollte ich das nicht hinkriegen? Ich halte mich durchaus für einen praktisch veranlagten Menschen. Schließlich hatte ich mal als Student in den Semesterferien auf dem Bau gearbeitet. Das war zwar schon ein paar Jahre her, aber meine Güte.
»Weißt du eigentlich, dass dein Vater an der Stadtautobahn mitgebaut hat?« Da bin ich stolz drauf, immer wenn ich unter der Autobahnbrücke durchfahre, erzähle ich, wie ich die Rohre der Leitungen unter der Fahrbahn angestrichen habe. Die sieht man zwar nicht mehr, aber ich weiß, dass sie da sind. »Ich stand auf dem Gerüst, ganz oben.« Meine Tochter schien mir gar nicht zuzuhören. »Habe ich dir mal erzählt, wie ich da runtergefallen bin?« Sie drehte sich einfach wieder um und ging in ihr Zimmer. Da hing ein neuer Sticker an ihrer Tür: »New York – Berlin.« Der dürfte von ihrem Bruder sein. Florian, inzwischen neunzehn, hatte vor zwei Jahren ein Austauschjahr in den USA verbracht. Und bald schon würde sie dran sein. Du liebe Zeit, wenn ich daran denke, was das gekostet hatte, wurde mir ganz schwindelig. Außerdem, mein kleines Mädchen allein in Amerika? Das wollte ich eigentlich nicht. Durfte ich natürlich nur denken, nie sagen.
Klempner lasse ich grundsätzlich ungern bei uns rein. Es gibt diesen Sanierungsstau, weshalb unser Haus hier und da womöglich den Anschein erweckt, ein wenig marode zu sein. Einmal in der Woche reißt irgendwo im Haus ein Rollladengurt, worauf der Rollladen mit lautem Krachen auf dem Fensterbrett aufschlägt und für Verdunkelung sorgt, bis ich das Ding wieder geflickt habe. Die Fenster müssten auch dringend gestrichen werden. Und die Regenrinne ist undicht. Mit der Leiter komme ich aber nicht dran, habe ich schon probiert. Dafür ist das Haus abbezahlt. Auch darauf bin ich stolz. Mit fünfzig fängt man ja schon mal an, Bilanz zu ziehen, wie es so gelaufen ist bisher. Das Leben an sich. Man muss ja schon ein ziemlicher Optimist sein, wenn man mit fünfzig noch glaubt, jetzt wäre Halbzeit. Nein, keine Frage, die Kurve zeigt seit einiger Zeit nach unten. Die ganz großen Lebensentscheidungen, Frau, Haus, Kinder, ich habe sie längst alle getroffen. Natürlich kenne ich Leute, die glauben, sie könnten dann noch einmal von vorne anfangen. Mein eigener Vater zum Beispiel hat mit fünfzig eine neue Familie gegründet. Weshalb ich einen jüngeren Halbbruder habe, der vergleichsweise früh zum Halbwaisen wurde. Bastian steht altersmäßig genau zwischen mir und unseren Kindern. Vielleicht sehe ich mich deshalb manchmal als so eine Art Ersatzvater für ihn, was unsere Beziehung nicht leichter macht. Aber abgesehen davon – würde ich wirklich noch einmal von vorne anfangen wollen?
Warum auch, es läuft super. Außer dass ich seit geraumer Zeit beobachte, dass am Monatsende nichts übrig bleibt. Obwohl das Haus abbezahlt ist. Was mich ein wenig besorgt stimmt. Früher konnten wir uns eindeutig mehr leisten. Was würde als Nächstes kommen? Womöglich die Pleite, wenn es mir nicht gelänge, das Ruder herumzureißen?
Auch deswegen bin ich gegen den Klempner. Wenn ich einen Klempner ins Haus lasse, würde der wahrscheinlich behaupten, die Rohre müssen raus. Und überhaupt, wer erhitzt sein Wasser schon elektrisch? Mit einem Durchlauferhitzer. Der muss auch raus. Und dann würde er mir vorrechnen, wie viel ich spare, wenn wir alles neu machen. Wobei er mir nicht sagen würde, dass es dreißig Jahre dauert, bis ich das wieder drin hätte. Dreißig Jahre. Dann bin ich achtzig. Ja, in meinem Alter fängt man an, solche Berechnungen anzustellen. Wenn ich lese, das Berliner Pergamonmuseum wird 2024 fertig, denke ich ganz automatisch daran, wie alt ich dann sein werde. Verdammt, der Tag ist nicht mehr fern, da werde ich mich fragen, ob ich bei großen Bauvorhaben noch das Ende erlebe.
»Hast du dir mal angeguckt, was Möbius jetzt für ein Bad haben?« Siggi und Charlotte Möbius sind unsere Nachbarn. Und meine Frau stellt mir Siggi immer als leuchtendes Vorbild hin, weil er handwerklich so begabt ist. Angeblich. In Wirklichkeit ist er Freiberufler und den ganzen Tag zu Hause. Seine Frau hat einen guten Job in einer Bank. Das heißt, Siggi tut also nichts, außer am Gartenzaun zu stehen und mir mit guten Ratschlägen auf die Nerven zu gehen.
»Siggi hat das alles selbst gefliest«, sagte meine Frau, »sieht super aus.«
»Dafür ist unser Bad vintage«, versuchte ich ein wenig Wind aus der Debatte zu nehmen.
Meine Frau steht auf Vintage. Was bedeutet, dass sie unser Haus mit altem Zeug dekoriert. Unser Küchenschrank zum Beispiel ist Jahrgang 1910 und zur Hälfte abgebeizt. Leider nur zur Hälfte. Daniela, so heißt meine Frau, hat eine Menge Vorzüge. Einer ihrer Nachteile ist, dass sie gern ein neues Projekt beginnt, bevor sie das alte zu Ende gebracht hat. Ich sage dazu nichts. Ich meine, es gibt schlimmere Hobbys, als bei eBay-Kleinanzeigen vergammelte Möbel zu ersteigern und sie dann auf noch älter zu trimmen. Neulich zum Beispiel, da fuhren wir nach Lindow im Brandenburgischen, weil Ronnie, er hieß wirklich so, eine Kommode zu verkaufen hatte. Für zwanzig Euro. So sah die Kommode dann auch aus. Die war nicht antik, die war von irgendeiner Resterampe und keine zwanzig Euro wert. Aber weder meine Frau noch ich trauten uns, das Ronnie auch zu sagen. Ronnie sah nämlich nicht so aus, als ob er es lässig nehmen würde, wenn jemand seine Kommode schlechtmachte. Außerdem hätten wir uns damit eingestanden, den ganzen Weg für nichts gefahren zu sein. Achtzig Kilometer, und das war nur die Tour hin.
»Was ist eigentlich aus Ronnies Kommode geworden?«, fragte ich, um mal ein bisschen von mir abzulenken.
»Ich weiß gar nicht, was du hast«, sagte Daniela, »war doch ein toller Ausflug. Früher haben wir das öfter gemacht, heute sitzen wir am Wochenende zu Hause.«
Kam es mir nur so vor, oder nörgelten in letzter Zeit alle an mir rum? Der Ausflug bestand doch darin, dass wir im Nieselregen um einen See liefen, von dem man mir vorher versprochen hatte, das wäre in einer Stunde zu schaffen. Es wurden zwei, und ich saß anschließend in nassen Klamotten in einem Restaurant, in dem es penetrant nach Fisch roch. Die Maräne war allerdings lecker. Jedenfalls hatten wir schließlich fünfzig Euro für das Essen ausgegeben, zwanzig Euro für die Kommode und Sprit für hundertsechzig Kilometer verfahren. Auf dem Rückweg hatten wir dann noch eine Reifenpanne. »Gut, dass das jetzt passiert«, hatte meine Frau behauptet, »stell dir mal vor, wir wären auf dem Weg in den Urlaub liegengeblieben.« Ich weiß nicht, was dann anders gewesen wäre. Auf einer Bundesstraße vierzig Kilometer vor Berlin eine Panne zu haben ist jetzt auch nicht so toll. Ich musste die blöde Kommode noch mal ausladen, um an das Ersatzrad zu kommen. Wenigstens habe ich es dann geschafft, trotz Nieselregen relativ zügig das Rad zu wechseln, macht man ja auch nicht jeden Tag. Erst der Wagen, jetzt die Dusche, es sah ganz so aus, als ob mein Leben gerade auf Verschleiß fuhr. Und dann macht man mir zum Vorwurf, dass ich keine Lust habe, am Wochenende wegzufahren. Und überhaupt, dass ich nicht mehr derselbe wie früher sei. Stimmt, ich habe dazugelernt. Und ich weiß inzwischen, dass ich meine Ressourcen schonen muss.
»Vielleicht rufst du wirklich mal einen Klempner an«, schallte es von unten hoch.
»Lass mal, ich kümmere mich drum«, rief ich zurück.
In dem Moment guckte der Junge aus seiner Tür: »Müsst ihr euch wieder streiten? Überhaupt, ihr seid immer so passiv-aggressiv.«
»Wir streiten nicht«, erklärte ich ihm, »wir unterhalten uns über eine Etage hinweg.« Was meint er eigentlich mit »immer« und wieso »wieder«? Und was bedeutet »passiv-aggressiv«? Manchmal verstand ich ihn einfach nicht mehr. »Räum bitte dein Zimmer auf«, gab ich ihm noch mit, bevor er seine Tür schloss.
Außerdem war Samstag, da kommt sowieso kein Handwerker. Und wenn, ist der nur zum teuren Wochenendtarif zu kriegen. »Ich mach es selbst«, rief ich also und bemühte mich um Überzeugungskraft in der Stimme. Ich werde einmal wieder der Held sein. Ganz so wie früher. Meine Tochter kam aus ihrem Zimmer, bürstete sich immer noch die Haare. Lag da so etwas wie Skepsis in ihrem Blick? Oder sogar ein Hauch Spott? Neulich hatte sie mal gesagt, ich sei peinlich, das hatte mich schon sehr getroffen.
»Traust du das deinem Vater etwa nicht zu?«, fragte ich.
»Eigentlich nicht«, antwortete sie, »sonst hättest du es doch schon viel früher erledigen können. Außerdem muss ich zum Hockey.«
Ich spielte am Lichtschalter herum, an, aus, an, früher war alles wirklich viel einfacher gewesen. Diese grenzenlose Verehrung, die einem kleine Kinder entgegenbringen, das war schon ein tolles Gefühl, ging mir erneut durch den Kopf. Ich weiß noch genau, wie ich mal mit meinem Sohn im Zoo war. Er muss so acht gewesen sein. Irgendwann standen wir vor dem Flusspferdhaus und sahen diese Figur: ein Flusspferd aus Bronze. Die Statue stellte Knautschke dar, über Jahrzehnte der Star im Berliner Zoo. Knautschke war das einzige Flusspferd, das den Krieg überlebt hatte. Überhaupt waren die meisten Zootiere bei Kriegsende tot, weil sie entweder den Bomben zum Opfer gefallen oder von hungrigen Berlinern verspeist worden waren. Mehr als dreißig Jahre später allerdings spielte sich im Zoo eine Tragödie ab, von der man bis dahin annehmen durfte, dass sie sich eigentlich nur die alten Griechen nach dem Genuss von reichlich Retsina ausmalen konnten.
Aus Knautschke war inzwischen ein altes Nilpferd geworden, erhaben und weise, aber eben auch nicht mehr richtig fit. Und dann erwischte es ihn ganz arg. Er bekam einen Darmverschluss. Für einen Nilpferdbullen ist das fatal, weil er mit seinem Kot das Revier absteckt. Nante, sein Sohn, kriegte jedenfalls mit, dass der Alte nicht mehr Herr im Haus ist, war seinerseits scharf auf Bulette, die seine eigene Mutter war, und brach seinem Vater im Zweikampf den Kiefer. Anschließend musste Knautschke eingeschläfert werden und steht seitdem in Bronze vor dem Nilpferdhaus. Eine kleine Tafel erzählt seine Geschichte. Ich las sie also meinem Sohn vor, und wie reagierte der gute Junge? Er war fassungslos und meinte: »Das kann gar nicht sein. Väter sind doch viel stärker als ihre Söhne.« Da war er acht. Mit fünfzehn hat mich mein Sohn dann mal im Urlaub beim Rangeln im Schwimmbad derart unter Wasser gedrückt, dass ich dachte, ich würde ertrinken. Er hatte gar nicht bemerkt, dass ich in Not war. Zum Glück blieb damals mein Kiefer heil.
Daran musste ich jetzt also denken, während ich in den Badezimmerspiegel blickte und sah, wie grau meine Haare geworden waren. Ob ich eigentlich schon das richtige Alter hatte, damit mir die Krankenkasse eine Darmspiegelung spendierte?
»Ich hol mal das Werkzeug«, verkündete ich und ging in den Keller. Auf den Keller war ich ganz besonders stolz. Wir hatten hier eine richtige Werkbank, die allerdings vor allem meine Frau nutzte. Ihr Vater hatte einen Schraubstock darauf montiert. Er ist ein ziemlich begabter Handwerker, das muss ich schon zugeben. Und zwar in allem, was anfällt, Farbe, Holz, Wasser, Strom. Natürlich hätte ich ihn jetzt um Hilfe bitten können. Aber die Blöße wollte ich mir nicht geben. Ihr Vater hatte seit unserer Hochzeit, seit zwanzig Jahren also, die Angewohnheit, mich als eine Art Lehrling zu behandeln. Neben der Werkbank stand Ronnies Kommode und harrte der Aufbereitung.
Auf dem Weg nach oben stellte mich meine Frau. »Was hast du vor?«, erkundigte sie sich mit Blick auf den Werkzeugkoffer.
»Den Durchlauferhitzer reparieren.«
»Und das kannst du?« Jetzt fing sie auch noch an.
»Na ja«, sagte ich ein wenig verunsichert, »ich denke schon.«
»Vielleicht sollten wir Toni fragen.«
Du liebe Zeit, das hätte mir noch gefehlt. Toni ist ihr Ex, ein verkrachter Elektriker, der in seinem Leben nicht mehr hingekriegt hat, als vier Kinder mit zwei Frauen zu zeugen, und der jetzt in einer Art Landkommune vor den Toren der Stadt lebt. Tonis besondere Qualitäten liegen darin, dass er tanzen kann wie ein junger Gott. Und dass er in seiner Jugend mit ziemlich vielen Mädchen zusammen gewesen war, die ich erfolglos angehimmelt hatte. Toni kommt mir nicht ins Haus, da würde ich ja lieber Siggi fragen. »Erinnerst du dich noch, wie wir Toni angerufen haben, als unser einziger Rollladenmotor nicht mehr funktionierte?« Das war ein gutes Argument. Toni hatte einen halben Tag erfolglos daran herumgeschraubt, anschließend fünfzig Euro genommen, die meine Frau ihm bereitwillig gab, weil er sich ja so viel Zeit für uns genommen hatte. Aber der Motor lief dann trotzdem nicht. »Lass mich mal machen«, sagte ich also und ging ins Bad.
Rasch war klar, dass das kleine Stellrad auf dem Deckel des Durchlauferhitzers zwei Positionen hat. Eine, bei der das Wasser nicht richtig warm wird. Und eine weitere, bei der das Wasser so heiß wird, dass alle schreiend aus der Dusche springen und aussehen wie gesottene Hummer. Damit war die Aufgabe klar umrissen: Stufe eins muss heißer werden oder Stufe zwei kälter. Ich legte den Schalter von der Brause- in die Badewannenposition und drehte den Kaltwasserhahn über der Wanne auf. Ein Rinnsal floss aus dem Rohr. So dünn, wie es war, hätte es jeden Urologen alarmiert. Vollkommen klar: Das war der wunde Punkt.
Der wunde Punkt, eigentlich nur so eine Redensart, die ich vor mich hin gebrabbelt hatte. Jetzt brachte sie mich ein wenig aus dem Konzept. Wann war ich eigentlich das letzte Mal bei der Vorsorge gewesen? Das musste das Alter sein, dass mich eine Wasserleitung derart beschäftigte. Natürlich lag der Gedanke nahe, dass die Leitung völlig verkalkt war, sie war so alt wie das Haus, also etwas über fünfzig Jahre. Wie ich also. Ich dachte an meine Herzkranzgefäße, ob die auch schon verkalkt sind? Ich versuchte, die Armatur abzuschrauben, aber es ging nicht. Vor meinem geistigen Auge sah ich sie abreißen, ein Schwall Wasser, den niemand je stoppen könnte, würde sich ins Bad ergießen. Nervös geworden legte ich mir meine Hand aufs Herz. Lief da irgendetwas unrund? Eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich auch gar keinen Grund zur Sorge. Immerhin fahre ich beinahe täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit, vierzehn Kilometer hin, vierzehn Kilometer zurück, und glaube fest daran, dass sich meine Herzkranzgefäße in Topzustand befinden. Ich halte mich sogar für ziemlich sportlich. Zu irgendetwas muss die Schinderei ja gut sein.
Die Armatur dagegen hatte ich eindeutig vernachlässigt. Ich ließ die Finger von ihr, viel zu riskant, es musste einen anderen Weg geben. Mein Blick fiel auf drei Hähne an der Wand neben dem Waschbecken, einer ungefähr in Brusthöhe, zwei weitere ganz unten, kurz oberhalb der Sockelleiste. Vermutlich ließ sich mit einem von denen der Wasserzulauf regulieren.
Ich drehte an Hahn Nummer eins, dem in Brusthöhe. Er ließ sich überraschend leicht bewegen, fiel plötzlich sogar ab. Mit einem lauten »Klong« schlug er auf einer Bodenfliese auf. Die überstand das zum Glück schadlos. Ich steckte den Hahn wieder auf den Stumpf, der jetzt aus der Wand guckte, drehte weiter. Es geschah nur nichts. Ich bewegte ihn hektisch in alle Richtungen, das Rinnsal aus dem Hahn über der Wanne wurde weder dünner noch kräftiger.
»Bist du sicher, dass du das schaffst?«, fragte meine Frau von der Tür her.
»Klar«, sagte ich, während ich versuchte, ein Silberfischchen zu erwischen, das aber in einer Ritze entkam. Unser Bad war wirklich in die Jahre gekommen. »Ich verschaffe mir erst einmal einen Überblick. Und ich weiß jetzt, dass es ein Problem mit der Wassermenge gibt, die muss neu eingestellt werden.« Mutiger geworden ging ich in die Hocke, wandte mich Hahn Nummer zwei zu, dem über der Sockelleiste. Doch der saß fest, ließ sich mit der bloßen Hand kein Stück bewegen. Das musste der richtige sein. Entschlossen griff ich zur Rohrzange.
»Und du weißt, was du da tust?« Meine Frau stand in der Badezimmertür und beobachtete mich. »Logisch, schau mal, bei dem Hahn passiert nichts, und der hier sitzt fest. Also muss das der Übeltäter sein, der verhindert, dass mehr Wasser kommt.« Mit der Zange ließ der Hahn sich drehen. »Kommt was«, rief ich einigermaßen euphorisch. Tatsächlich sprudelte Wasser aus einer von mir bislang unbemerkten Öffnung unter dem Hahn und ergoss sich über den Badezimmerfußboden. Der Strahl war schmal, aber beharrlich. Ich versuchte, das Ventil wieder zu schließen. Was mir auch gelang, wenigstens beinahe. Mit dem Finger stellte ich fest, dass es immer noch aus der Öffnung tröpfelte. Das heißt, das Tröpfeln war gerade dabei, sich zu verstetigen. Vielleicht würde alles wieder gut werden, wenn ich für einen Moment die Augen schloss? Mir wurde heiß.
»Tropft doch immer noch«, stellte meine Frau fest. Wann hatte ich eigentlich das letzte Mal »Ich liebe dich!« zu ihr gesagt? Weiß ich gar nicht, bin ich eben nicht so der Typ für. Dabei mochte ich sie wirklich gern. Eigentlich wie am Anfang, vor rund fünfundzwanzig Jahren, als wir uns kennenlernten. Sie ist auch gar nicht viel älter geworden, hat immer noch fast schwarze Haare, fast schwarze Augen und diese strahlenden Zähne. Ich mag ihr Lächeln. Ihre Art ist besonnen, in kritischen Situationen kann sie allerdings auch etwas Sarkastisches kriegen. Jetzt, aktuell in diesem Moment, ging sie mir auf die Nerven. »Sehe ich«, sagte ich ungewollt schrill. Jetzt hieß es aufpassen. »Wahrscheinlich eine poröse Dichtung.« Ich hatte meine Stimme wieder im Griff, was gut war, denn inzwischen waren auch die Köpfe von unserer Tochter und unserem Sohn in der Badezimmertür aufgetaucht.
»Was macht Papa da?«, fragte Florian in den Raum hinein.
»Er versenkt das Haus«, sagte meine Frau.
Das meine ich mit Sarkasmus. Schon erreichte das Wasser die Oberkante der Schwelle zwischen Badezimmer und Flur.
Den Rest des Wochenendes verbrachte ich damit, das Ventil abzudichten und die Sauerei zu beseitigen. Seit Montag stand ich früher auf, um die Dusche schon mal aufzudrehen. Immerhin war ich nun der Einzige, der diese ganz bestimmte Hahnposition kannte, bei der unsere Tochter die Wassertemperatur akzeptabel fand. Seit Dienstag wusste ich, dass das Ventil trotz meiner Bemühungen noch immer nicht dicht war und weiter tropfte. Seit Mittwoch versuchte ich auszurechnen, was mich teurer käme: der Klempner oder die nächste Wasserrechnung. Neben all dem verfolgt mich ein weiterer Gedanke: Läuft mein Leben eigentlich rund, oder hat es da einen Punkt gegeben, an dem ich falsch abgebogen bin? Das musste die Midlife-Crisis sein. Falls es dafür nicht schon zu spät war.
2 Verlierer wie wir
Das sah nicht gut aus. Tobi würde gleich die »Acht« versenken. Tobi trifft immer, wenn es um etwas geht. Nicht dass wir Geld einsetzen – wir spielen lediglich um die Ehre. Bescheuerter Ausdruck. Als ob ich hier meine Ehre verlieren könnte. Also schön, es geht ums Gewinnen, denn wer will schon der Verlierer sein. Tobi rieb seine Queuespitze mit Kreide ein. Ich hatte nicht auf die Uhr geguckt, aber er tat das bestimmt schon seit einer Minute. Von uns lagen noch drei Kugeln auf dem grünen Filz, das war schon ziemlich blamabel. Und er musste nur noch die Acht ins Loch bringen, dann wäre unsere Niederlage besiegelt. Die Distanz war zwar groß, aber schwierig war der Stoß eigentlich nicht. Natürlich könnte man versuchen, Tobi irgendwie nervös zu machen, ich fing an, mit den Fingern auf die Bande zu klopfen. »Den kann er«, behauptete Micha plötzlich vom Tischrand gegenüber. »Wart’s ab«, sagte ich und warf ihm einen Blick zu, den ich für böse hielt. Eigentlich wollte ich ruhig bleiben, gar nichts sagen. Aber Micha war mein Spielpartner. Warum hielt er nicht einfach die Klappe? Frank, Tobis Partner, ging schon mal rüber zur Zählscheibe. »3 : 1«, stand auf der Anzeige, 3 : 1 für die anderen. Wenn es 4 : 1 stand, würden wir das kaum mehr aufholen können.
Tobi, Micha, Frank und ich, alle um die fünfzig, kennen uns seit der Schule. Seit rund fünf Jahren treffen wir uns regelmäßig zum Poolbillard. Wir spielen immer in der gleichen Konstellation: ich mit Micha und Frank mit Tobias. Was auf den ersten Blick seltsam wirkt. Schließlich kenne ich Frank seit der ersten Klasse und damit mit Abstand am längsten. Ich weiß ziemlich viel aus seiner Vergangenheit über ihn. Zum Beispiel, dass er bei der Einschulung Hosenträger mit Verkehrszeichen drauf getragen hatte, auf die ich damals sehr neidisch war. Und dass er früher unfassbare Schweißfüße hatte. Nun ja, das war vierzig Jahre her, und er belegte im Schullandheim das Bett unter mir. Wie ich so im Bett lag, drang dieser säuerliche Gestank in meine Nase. Kann der nicht seine Füße zudecken, dachte ich. Aber es waren gar nicht seine Füße. Als ich nämlich kurz darauf gemütlich meine Hände unter das Kissen schob, hatte ich plötzlich etwas Feuchtes, Sandiges zwischen den Fingern. Franks Socken, er hatte sie mir unter das Kopfkissen gestopft. Nicht aus böser Absicht, sondern weil er nicht wusste, wohin damit. Frank tut eigentlich nie etwas aus böser Absicht. Wahrscheinlich ist er deshalb auch mein bester Freund in dieser Runde. Der wahre Grund, weshalb wir nicht miteinander spielen, ist, dass wir miteinander verwandt sind. Ich habe nämlich vor zwanzig Jahren seine kleine Schwester geheiratet. Was er mir manchmal unter die Nase reibt. Von wegen, ohne ihn hätte ich nie jemanden gefunden. Das ist natürlich grob übertrieben. Aber er war es, der seine kleine Schwester früher zu den Partys mitschleppte, am Anfang notgedrungen, später stand sie mehr im Mittelpunkt als er. So habe ich sie halt kennengelernt. Und in einem gemeinsamen Kurzurlaub wurden wir ein Paar, selbst daran war Frank beteiligt.
Jedenfalls haben Frank und ich irgendwann beschlossen, dass es blöd wäre, wenn wir zusammen spielen. Das ist ja quasi wie Inzucht. Selbst wenn wir regelmäßig gegeneinander antreten, es macht mir nichts aus, gegen ihn zu verlieren. Frank ist mir am ähnlichsten. Er ist verheiratet, hat zwei Söhne, einer knapp über zwanzig, der andere knapp drunter. Und einen Job, den er schon seit mindestens zwanzig Jahren macht. Frank arbeitet in einem internationalen Bankhaus, Wertpapierabteilung. Lustigerweise gab es schon in unserer Jugend deutliche Anzeichen dafür. Seine Eltern hatten einen Schuppen im Garten, den wir als Basis nutzten, wenn wir mal wieder mit dem Raumschiff Enterprise unterwegs waren. Einer von uns klebte sich sogar spitze Ohren an, damit er aussah wie Mr Spock. Doch eines Tages erklärte Frank, der Schuppen sei jetzt keine Raumstation mehr, sondern eine Bank.
Er hatte sich einen Haufen Geldscheine gebastelt, indem er sie auf Butterbrotpapier durchpauste. Die gab er an die anderen Kinder der Nachbarschaft aus, und wir mussten alle ein Konto bei ihm eröffnen. Kurzum, das neue Spiel hatte längst nicht den Unterhaltungswert einer Raumstation, und seine Idee hätte ihn leicht ins soziale Abseits treiben können. Weil er das neue Spiel aber mit einer derartigen Leidenschaft betrieb, folgten wir ihm alle. Ich hinterlegte sogar ein paar Matchbox-Autos bei ihm als Pfand für die Geldscheine, die er an mich ausgab. Hatte ich die eigentlich jemals zurückbekommen? Oder musste ich dafür aus »Hör zu«-Seiten gebastelte Wertpapiere bei ihm kaufen? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß nur, dass er mit Ernst bei der Sache war, und ich schätze mal, diese Leidenschaft hilft ihm heute noch. In seiner Branche geht es nämlich ziemlich ruppig zu, jedenfalls stand sein Job immer wieder auf der Kippe. Das kenne ich, meine Firma wurde in der Zeit auch ein paarmal übernommen, und nicht immer ist das so gelaufen, dass man von einer freundlichen Übernahme sprechen konnte. Aber die Kreativen haben etwas Verträgliches im Vergleich zu diesen Finanzhaifischbecken.
Frank jedenfalls, der muss gut sein, in dem, was er macht. Wenn man ihm glauben darf, und es gibt keinen Grund, das nicht zu tun, waren von den älteren Kollegen, die er von früher kannte, eigentlich alle schon weg – und wer sich der sechzig näherte, war sogar bereits in den Vorruhestand verabschiedet worden. Frank sieht im Prinzip aus wie früher. Groß und vergleichsweise schlank hält er sich sehr aufrecht, sein immer noch dunkelblondes Haar ist voll. Vor allem das macht mich immer ein kleines bisschen neidisch. Ich bin nämlich ziemlich grau inzwischen, und meine Friseurin hatte mir neulich nicht widersprochen, als ich so vor mich hin plapperte: »Wird langsam dünner.« Ich meine, eigentlich ist noch alles okay, und ich hatte erwartet, sie würde so etwas sagen wie: »Hey, ich sehe keine einzige kahle Stelle.« Sagte sie aber nicht. Seit geraumer Zeit habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht nachzuzählen, wie viele Haare morgens im Waschbecken liegen, wenn ich sie mir vorher gekämmt habe. Ob dreißig Haare noch normal sind? »Das Grau sieht toll bei dir aus, das darfst du auf keinen Fall färben«, hatte die Friseurin dann plötzlich gesagt. Immerhin. Aber ich kenne Männer, bei denen ich mir ganz sicher bin, dass sie färben. Das wirkt schon jünger.
Frank färbt nicht, da bin ich auch sicher. Und ich glaube nicht, dass er seine ausgefallenen Haare nachzählt. Er ist so etwas wie ein Abteilungsleiter in einer Abteilung, die nur aus ihm selbst besteht. Aber in all den Jahren scheint er sich nie wirklich Sorgen gemacht zu haben. Außerdem ist er für einen Banker, der schon als Kind lieber mit selbst gemalten Geldscheinen hantierte, handwerklich erstaunlich begabt. Man stelle sich nur die Sauerei vor, die wir gerade in unserem Badezimmer haben. »Frank, du bist schon cool«, sagte ich plötzlich, und das schien ihn zu überraschen, kam wohl ein bisschen unvermittelt. Er schaute mich jedenfalls an, die Hand an der Zählscheibe, und zog die Augenbrauen hoch. Das macht er bei allen möglichen Gelegenheiten. Jetzt sollte es wohl bedeuten, was ist denn mit dir los? Emotionen sind nicht so sein Ding.
Dafür bewundere ich ihn für seine Ruhe. Ich neige nämlich zur Nervosität. Und wenn ich nervös werde, muss ich auf die Toilette. Das war schon immer so. Schon als ich noch Kind war. Beim Versteckspielen in Nachbars Garten zum Beispiel. Ich war auf einen Baum geklettert und überzeugt, mein Versteck wäre super, keiner würde mich finden. Prompt musste ich aufs Klo und hangelte mich zurück auf den Boden, Versteckspiel hin oder her. Und ebenso prompt stellte mich Nachbars Collie, das blöde Vieh. Vor dem hatte ich sowieso Angst, weil der regelmäßig ausrastete. Jedenfalls schoss er plötzlich auf mich zu, und ich konnte gerade noch einen der unteren Äste ergreifen und mich hochziehen. Da hing ich nun, wie eine reife Kirsche. Der Collie – der nicht Lassie hieß, sondern Harras – benahm sich so, wie man es von einem Harras erwarten würde. Er zog die Lefzen zurück, entblößte seine gelben Reißzähne und schnappte nach mir. Die hintere Tasche meiner Jeans riss ein. Eine echte Levi’s, das war damals noch etwas Besonderes. Ich hätte also allen Grund gehabt, sauer zu sein. Stattdessen meckerte unser Nachbar, warum ich nicht einfach stehen geblieben wäre, dann hätte der Hund gar nichts gemacht. Und dann erklärte mir der Alte allen Ernstes, aus mir würde nie etwas werden, wenn es mir nicht gelänge, meine Nerven besser in den Griff zu kriegen. Fortan fürchtete ich mich vor Harras und unserem Nachbarn. Anders als Frank, der ja auch in der Nähe wohnte. Der hatte weder vor Harras Angst noch vor unserem Nachbarn.
Klack. Tobi hatte den Stoß ausgeführt. Alle schauten der Kugel hinterher. Das heißt, ich nicht, ich beobachtete Tobi. Er hatte dieses Grinsen aufgelegt. Nicht spöttisch, nicht böse, nicht geringschätzig – selbstsicher. Das trifft es. Tobi platzt schier vor Selbstsicherheit. Das ist schon immer so gewesen. Als Jugendlicher besaß er als Erster in unserer Siedlung ein Mofa. Und so blieb es. Danach hatte er ein Motorrad, und seitdem fuhr er immer die spektakulärsten Autos. Tobi ist ein Gewinnertyp.
Die schwarze Kugel traf auf die Bande – ich konnte gerade noch die Finger wegziehen – und wurde langsamer. Aber wie von der Schnur gezogen rollte sie auf ihr Loch zu. »Die verhungert«, sagte ich noch, da fiel sie auch schon rein. »4 : 1«, sagte Frank und drehte an der Stellschraube der Anzeigentafel. Tobi schaute in die Runde, hob die Hand, damit ihn alle abklatschen konnten.
»Ist aber trotzdem spannend heute«, meldete sich mein Partner Micha. Keine Ahnung, wie er darauf kam. Wir lagen 4 : 1 hinten, was sollte daran spannend sein? Aber Micha ist eben ein nicht immer leicht einzuschätzender Typ, mal behäbig, mal leicht in Wallung zu bringen. Damals in unserer Klasse war er mir gar nicht so aufgefallen. Außer im Sportunterricht, beim Fußball war Micha eine Kanone gewesen. Aber sonst? Heute arbeitet Micha im Schulamt in leitender Funktion. Eigentlich war er mal Lehrer, doch darüber spricht er nie. Micha erzählt auch nicht viel von zu Hause. Ich weiß, dass er geschieden ist und seine Kinder aus erster Ehe jedes zweite Wochenende hat. Seine Scheidung ist schon ewig lange her, er ist inzwischen neu verheiratet, ich bin nicht mal ganz sicher, wie seine neue Frau heißt, ich glaube Simone.
Ist ein bisschen blöd gelaufen damals, als Paar wurden sie von den anderen Paaren im erweiterten Bekanntenkreis nicht mehr eingeladen, und seine neue Frau ist nie in diesem Kreis angekommen. Ich glaube, die Frauen wollten sie auch gar nicht kennenlernen, weil sie zu Michas Ex hielten. Bei Tobi war das etwas anderes, der galt als belächelter Exot. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass Micha weggezogen ist. Sein Haus stand nicht weit von unserem, wir wohnen ohnehin alle im gleichen Dreh. Dann kam das Gerücht auf, man würde bei ungünstigem Wind den neuen Berliner Flughafen hören, wenn er denn einmal fertig wird. Micha rechnete fest damit, der Wert seines Hauses würde nach der Eröffnung ins Bodenlose fallen. Das ist jetzt zehn Jahre her, der Flughafen weit entfernt davon, eröffnet zu werden, und sein Haus wäre heute ganz sicher viel mehr wert. Aber wir haben Micha seitdem nie darauf angesprochen, das wäre nicht fair. Micha neigt schon eher dazu, sich Sorgen zu machen. Nicht wegen seines Jobs, er ist ja Beamter, aber wenn es um seine Gesundheit geht. Heute zum Beispiel fummelte er ständig an seinem Ohr herum.
»Was ist denn mit deinem Ohr los?«, fragte ich in der Hoffnung, es würde helfen, wenn er darüber reden konnte. »Ein Knubbel«, antwortete er.
»Es gab mal einen Trainer beim FC Barcelona, der starb an Ohrspeicheldrüsenkrebs«, mischte sich Tobi ein, während er mal wieder seinen Queue mit Kreide abschmirgelte. Er ist der Einzige von uns, der mit seinem eigenen Queue spielt und sich keinen am Tresen leiht. Er transportiert ihn immer in einem kleinen Lederkoffer und macht ein großes Theater darum, wenn er ihn auspackt. Tobi malt gern schwarz, nicht weil er ein Pessimist ist, nein, ich glaube, er weidet sich am Entsetzen anderer. Micha guckte tatsächlich schockiert und rieb ein bisschen heftiger an seinem Ohr herum. Toll, jetzt konnte er sich noch weniger konzentrieren, und unsere nächste Niederlage war gesichert.
Manchmal, nach so einem Spieleabend, fragt mich meine Frau: »Und wie geht es den anderen, was macht Micha