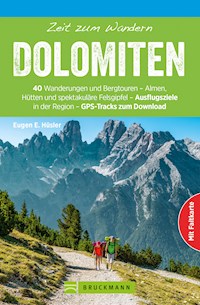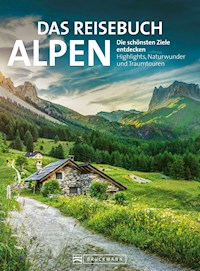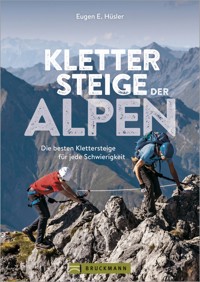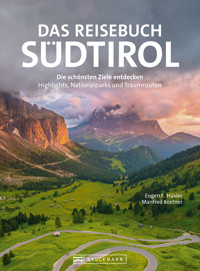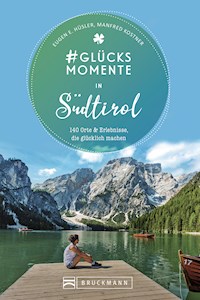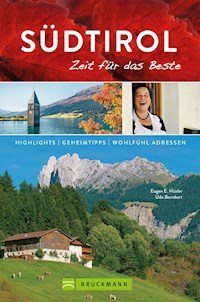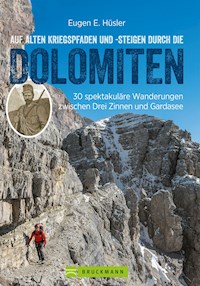
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bruckmann Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Zwischen Stilfser Joch, nördlichem Gardasee und östlich der Etsch verlief im ersten Weltkrieg die Front. Entlang der alten Kriegspfade in den Ampezzaner und Sextener Dolomiten lässt sich Südtirols Geschichte heute noch hautnah erleben. Dieser außergewöhnliche Wanderführer beschreibt 30 landschaftlich reizvolle Wanderungen auf alten Militärpfaden, zeigt die Spuren des Krieges im Gelände und erläutert die geschichtlichen Hintergründe ausführlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Pasubio-Massiv – einst Frontgebiet, heute beliebtes Wander- und Klettersteigrevier. TOUREN 27–30
Eugen E. Hüsler
AUF ALTEN KRIEGSPFADEN UND -STEIGEN DURCH DIE
DOLOMITEN
30 spektaktuläre Wanderungenzwischen Drei Zinnen und Gardasee
Exklusiv für Sie als Leser:
MIT GPS-DATEN ZUM DOWNLOAD
unter: gps.bruckmann.de
Inhalt
Kann man aus der Geschichte lernen?
Ein historischer Abriss
Der Erste Weltkrieg – eine Zeittafel
Praktische Tipps
DIE TOUREN
1Monte Tudaio (2140 m)6.15 Std.
Eine spannende Gipfelüberschreitung
2Monte Rite (2181 m)3.15 Std.
Von der Kriegsfestung zum Museum
3Am Karnischen Hauptkamm6.30 Std.
Aussicht und Rückblicke an einer alten Grenze
4Arzalpenkopf (2371 m)4.45 Std.
Wanderrunde im Rücken der Dolomitenfront
Die Franzensfeste
5Sextener Rotwand (2936 m)8.45 Std.
Ein schwer umkämpfter Gipfel
6Die »Strada degli Alpini«7.45 Std.
Eine berühmte »Straße« mit Geschichte
7Zwischen Einser und Zwölfer7.45 Std.
Wanderrunde im Zentrum der Sextener Dolomiten
8Toblinger Knoten (2617 m)/Paternkofel (2744 m)10.30 Std.
Im Banne der Drei Zinnen
Die Tiroler Kampffront
9Rund um die Drei Zinnen3.30 Std.
Ein Klassiker!
10Rautkopf (2605 m)5.30 Std.
Von Hollywood zum Drei-Zinnen-Blick
11Monte Piana (2324 m)7 Std.
Ein Eckpfeiler der Dolomitenfront
12Plätzwiese und Strudelkopf (2307 m)3.45 Std.
Im Rücken der Front
13Cristallino di Misurina (2775 m)6 Std.
Im Schatten des Cristallo
Die Dolomitenbahn
14Via ferrata Renè De Pol6.15 Std.
Klettersteig ins ehemalige Frontgebiet am Foramestock
15Sentiero ferrato Ivano Dibona6 Std.
Traumroute in den Ampezzaner Dolomiten
16Croda del Valon Bianco (2687 m)7.15–9 Std.
Die Felsenfestung über dem Fanestal
Die Kaiserjäger – des Kaisers Regimente
17Um die Tofana di Rozes6 Std.
Die Front an den Tofane
18Minenkrieg in den Dolomiten2–5 Std.
Über den Kleinen Lagazuoi
19Rund um die Cinque Torri5.45 Std.
Aus- und Rückblicke südwestlich von Cortina d’Ampezzo
20Der »Blutberg«5.45 Std.
Das Ringen um den Col di Lana
21Schützengräben am Padònkamm6.30 Std.
Die »Via ferrata delle Trincee«
22Der eisige Krieg2.30 Std.
Kampf um die Marmolada
Passstraßen in den Dolomiten
23Alta via Bepi Zac6.45 Std.
Der Krieg am Costabelakamm
24Ex-Comando Austriaco (1120 m)5.30 Std.
Von Caldonazzo auf das Lavarone-Hochplateau
25Der schönste Ausguck über dem Val Sugana?3.15 Std.
Drama um das Festungswerk Verle
26Kanonendonner0.20–2.30 Std.
Die Festungen des Kaisers
27Sentiero Franco Galli6.30 Std.
Wo Cesare Battisti gefangen genommen wurde
28Monte Pasubio (2232 m)7 Std.
Hölle im Hochgebirge
Vallo Alpino
29»Strada delle 52 Gallerie«5.00/7.45 Std.
Was für ein Weg!
30Sentiero del Sengio Alto5.45 Std.
Auf den Monte Cornetto
Register
Impressum
Tunnel an der ehemaligen Hauptkommandostraße TOUR 24
Die Hängebrücke am »Sentiero ferrato Dibona« TOUR 15
Ehemalige Artilleriestellung am Westgrat des Rautkopfs; in der Tiefe der Dürrensee TOUR 10
Im Vorfeld der Cinque Torri hatten sich die Alpini eingegraben. TOUR 19
Die Frontlinie in den Sextener Dolomiten – hier wurde einst gekämpft und gestorben: Zwölfer, Paternkofel und Drei Zinnen. TOUREN 7 bis 9
Gut erhaltene österreichische Unterkunft am Costabelakamm TOUR 23
PIKTOGRAMME ERLEICHTERN DEN ÜBERBLICK
leicht
mittel
schwierig
Gehzeit
Höhenunterschied
Weglänge
ZEICHENERKLÄRUNG ZU DEN TOURENKARTEN
Autobahn
Bundesstraße
Hauptstralße
Normale Straße
Nebenstraße
Weg
Wandertour mil Laufrichtung
Tourenvariante
Ausgangs-/ Endpunkt dor Tour
Wegpunkt
Bahnlinie mil Bahnhof
S-Bahn
U-Bahn
Seilbahn
Bushaltestelle
Parkmöglichkeit
Schifflinie
Hafen
Fähre
Schleuse
Flugplatz
Höhenpunkt
Tunnel
Landesgrenze
Randhinweispfei
Tournummer
Maftstabsleiste
(1:100 000)
Kirche/ Kloster
Burg/ Schloss/ Ruine
Museum
Turm
Leuchtturm
Windpark
Windmühle
Mühle
Einkehrmöglichkeit
Rastplatz
Übernachtungsmogl.
Jugendhcrberge
Campingplatz
Schutzhütte
Denkmal
Information
Bademöglichkeit
Reitanlage
Wildpark/Tiergehege
Höhle/Grotte
Prähist. Fundstelle
Landschaftl. Sehenswert
Sehenswert
Sehenswerter Ort
Aussichtsstelle
Quelle
Wasserfall
Weinanbau
Moorgebiet
Waldgebiet
Naturschutzgebiet
DIE TOP TEN DER INTERESSANTESTEN TOUREN:
Tour 2
Der Monte RiteFernsicht und Rückblicke, militärische und ganz andere im Gipfelmuseum von Reinhold Messner
Tour 5
Ein schwer umkämpfter GipfelDie Sextener Rotwand war östlicher Eckpfeiler der Dolomitenfront.
Tour 6
Der AlpinisteigEinst ein Frontweg, heute einer der beliebtesten Klettersteige der Dolomiten
Tour 8
Toblinger Knoten und PaternkofelGroße Tour in den Sextener Dolomiten, ganz im Banne der Drei Zinnen
Tour 11
Der Monte PianaEin Freilichtmuseum vor grandiosem Panorama
Tour 15
Sentiero ferrato DibonaEin Höhenweg der Spitzenklasse, der den ehemaligen italienischen Frontsteigen im Cristallomassiv folgt
Tour 17
Rund um die Tofana di RozesEin Wanderklassiker im ehemaligen Frontgebiet des Val Travenanzes
Tour 18
Minenkrieg in den DolomitenMuseal aufbereiteter Frontabschnitt am Kleinen Lagazuoi: auf den Berg und in den Berg
Tour 20
Der »Blutberg«Ein Sieg, der keiner war: der Kampf um den Col di Lana
Tour 28
Über den Monte PasubioDie »Hölle der Kaiserjäger«
Ein weltberühmtes Profil, gesehen aus einem Stollenloch – die Drei Zinnen (Tour 8)
Kann man aus der Geschichte lernen?
Krieg. Ein negativ besetzter Begriff, natürlich – aber auch ein alltäglicher. In vielen Ländern und Regionen unserer Welt wird im Namen von Recht und Ordnung getötet, sterben Unschuldige zu Tausenden. Seit mehr als einem halben Jahrhundert kommen diese Kriege medial aufbereitet zu uns ins friedlich gewordene, wohlhabende Westeuropa: TV, Zeitungen sorgen für den Nachrichtenfluss. Und fast scheint es, als würden sie durch die geografische Distanz, die Sicherheit suggeriert, einen Teil ihres Schreckens verlieren: Gewöhnung. Wie sonst soll man sich erklären, dass unsere Kinder begeistert »Krieg spielen«, Stunden am PC verbringen, um ihr Geschick im (virtuellen) Töten zu perfektionieren?
Der Erste Weltkrieg (1914–18) dagegen fand mitten in Europa statt; die Entfernung ist hier keine räumliche, sondern eine zeitliche. Gut ein Jahrhundert ist vergangen, und das Bild verschwimmt, auch weil es von jenem der zweiten, noch ungleich globaleren Kriegskatastrophe überlagert wird. Zeitzeugen leben keine mehr, mehr als hundert Jahre nach dem Attentat von Sarajevo. Europa ist zu einer Gemeinschaft geworden, die vom Atlantik bis ins Baltikum reicht, und die Enkel der Kaiserjäger, der Standschützen, verbringen ihren Urlaub in Italien.
Deutsche und Österreicher fahren gerne nach Südtirol, in die Dolomiten oder an den Gardasee. Und da begegnen sie heute noch den Relikten jenes Krieges, jener »unmöglichen« Front quer durch die Ostalpen: in den Sextener Dolomiten, im Cristallomassiv, an der Marmolada, auf der Hochebene von Lavarone, am Pasubio und anderswo.
Aus der Historie lernen. Ein viel zitierter Satz, den die Realität unserer Tage auch gleich wieder ad absurdum führt. Wer die steinerne Front zwischen der Donaumonarchie und Italien besucht, sich dabei informiert über geschichtliche Zusammenhänge, kommt dem unfassbaren Schrecken ein Stück weit näher: Geschichtsstunde unter freiem Himmel und dazu noch in einer der faszinierendsten Bergregionen der Welt. Trotzdem bleibt der Schrecken unbegreiflich fern, ist das tausendfache Sterben eine nicht wirklich nachvollziehbare Tatsache, bei allem Mitgefühl für jene, die den Krieg als Befehlsempfänger erlitten, manche verblendet von der heimischen Propaganda (auch das gab es damals schon), andere naiv in ihrem Glauben an »Gott und den Kaiser«.
Da wirkt der Zauber der Dolomiten wie eine stille Mahnung der Natur (der Schöpfung?), die nur heißen kann: »Nie wieder!«
Dietramszell, im Frühling 2021
Eugen E. Hüsler
Ein historischer Abriss
»Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.«
Carl von Clausewitz
Europa vor dem KriegsausbruchBereits lange vor dem Ausbruch des Krieges war der alte Kontinent zu eng geworden für Europas Autokraten. Der Union Jack flatterte über dem Suezkanal und in Indien; Belgien plünderte den Kongo, in Südwestafrika (heute Namibia) kämpften deutsche Soldaten die Herero nieder. Die Zeiten änderten sich rasend schnell: Auf den Weltmeeren waren keine Dreimaster mehr unterwegs, sondern gepanzerte, mit Dampf betriebene Schlachtschiffe, und ein immer dichteres Eisenbahnnetz verkürzte auf dem Land Reisewege für Mensch und Material. Ein Jahrzehnt nach der Erfindung der Brüder Wright war die Eroberung des Luftraums bereits eingeleitet – auch militärisch.
Aus Agrarstaaten wurden Industrienationen, aus Dörfern Städte und Bauern zu Proletariern. Das zerfallende Osmanische Reich hinterließ im Südosten Europas ein Machtvakuum; auf dem Balkan entstand als Folge ein militanter Nationalismus mit Serbien an der Spitze. Italiens junge Monarchie hatte sich die »Befreiung unerlöster Volkstumsgebiete« auf ihre Fahne geschrieben, was in der Donaumonarchie zu erheblichen Irritationen führte. Koalitionen und Interessenskonflikte allenthalben: hier die Entente cordiale, das Bündnis Frankreichs mit Großbritannien, dem das Zarenreich 1907 beitrat; dort der Dreibund, angeführt vom aufstrebenden Deutschland, dessen Kaiser Wilhelm II., nachdem er sich Bismarcks entledigt hatte, eine aggressive Außenpolitik betrieb. Auf dem Thron in Wien saß ein alter Mann, von vielen persönlichen Tragödien gezeichnet, Regent eines Vielvölkerstaates, der im Osten bis zur russischen Grenze reichte. Expansionsgelüste bestimmten allenthalben das politische Handeln, auch um den Preis regionaler militärischer Auseinandersetzungen, vor allem auf dem Balkan. Dass die Donaumonarchie 1908 Bosnien-Herzegowina annektierte in der Absicht, den russischen Einfluss auf dem Balkan einzudämmen, löste eine schwere politische Krise aus, erwies sich auch als belastend für die Beziehung zwischen Slawen und Deutschösterreichern innerhalb der k. u. k. Monarchie. So entbehrt es nicht einer gewissen Logik, dass gerade in Sarajevo jene Schüsse fielen, die letztlich den Ersten Weltkrieg auslösten, der in vier Jahren rund zehn Millionen Menschen das Leben kostete und halb Europa verheerte.
Im Ersten Weltkrieg wurden erstmals in großem Stil technische Geräte eingesetzt. Als besonders wirkungsvoll erwies sich das Maschinengewehr (Museum Tre Sassi).
Grandiose Kulisse schrecklicher Ereignisse: die Pala-Nordkette, gesehen aus einem Stollenloch am Costabela-Frontabschnitt (Tour 23)
Krieg!Auf Drängen des deutschen Kaisers erklärte Franz Joseph am 28. Juli 1914 Serbien den Krieg, was die Mobilmachung in Frankreich und Russland nach sich zog. Noch aber schien Hoffnung zu bestehen, dass ein Krieg auf dem Balkan nicht zum europäischen Flächenbrand würde. Doch das Kriegskarussell drehte sich bereits, die Armeen marschierten auf, im Osten und im Westen des Kontinents. Am 1. August erklärte Wilhelm II. dem Zaren den Krieg, zwei Tage danach auch Frankreich. Damit wurde der wichtigste Bündnispartner der Grande Nation, das britische Königreich, als Mitglied der Entente automatisch Kriegspartei. Auf der anderen Seite blieb Italien neutral, es trat – obwohl Mitglied des Dreibundes – sogar ein in Geheimverhandlungen mit den Alliierten.
Europa brannte. Im Westen kam es an der Marne zur ersten großen Feldschlacht, die mit einer Niederlage Deutschlands endete, im Osten erlitten die Truppen der Donaumonarchie bei Lemberg eine schwere Niederlage gegen die Russen, und auch die Eroberung von Belgrad mündete in ein Fiasko.
»Nieder mit dem Parlament!«In Italien gewannen die Interventisti, die den Kriegseintritt des Landes an der Seite der Entente befürworteten, an Einfluss. In der Zeitung Il Popolo d’Italia (Das Volk Italiens) hetzte Benito Mussolini, der zuvor wegen seiner Kriegstreiberei aus der Sozialistischen Partei ausgeschlossen worden war, gegen die Neutralität des Landes. Einen Kriegseintritt befürwortete auch der Schriftsteller Gabriele D’Annunzio, später eine der Leitfiguren des italienischen Faschismus. Deutschland bemühte sich um eine Übereinkunft mit Italien, doch der dritte im wackeligen Bündnis, Österreich-Ungarn – und hier vor allem die Heeresführung –, sperrte sich kategorisch dagegen, das Trentino und Julisch-Venetien abzutreten. Die Folge: Im April 1915 unterzeichnete der Außenminister in London ein Abkommen, das Italien im Falle eines Kriegseintritts die Brennergrenze garantierte. Am 23. Mai erklärte Italien der Donaumonarchie den Krieg. Oberbefehlshaber des italienischen Heeres war seit 1914 Luigi Cadorna; er verfügte über 35 Divisionen, die er gegen die k. u. k. Truppen ins Feld führen konnte: eine erdrückende Übermacht.
Obskure Hinterlassenschaft, ausgestellt in Reinhold Messners besuchenswertem »Museum in den Wolken« auf dem Monte Rite (Tour 2)
Standschützen und das AlpenkorpsDie besten Einheiten Österreichs standen fernab der Heimat an der Ostfront, wo sie im ersten Kriegsjahr bereits schwere Verluste erlitten hatten. Als letztes Aufgebot blieben in Tirol nur die Standschützen, deren Tradition bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht und die schon unter Andreas Hofer am Bergisel gegen die Franzosen gekämpft hatten. Überall im Land meldeten sich Freiwillige zur Verteidigung der Heimat. Die Jüngsten waren eigentlich noch Kinder, 15 Jahre alt vielleicht, der älteste Standschütze – über achtzig! – versah seinen Dienst an der Ortlerfront.
Diese bunt zusammengewürfelte Truppe – knapp 40 000 Mann – war militärisch kaum zu organisieren; es fehlte an fast allem, nur an einem nicht: dem unbedingten Willen, das Beste zu geben. Trotzdem hätten die Standschützen dem italienischen Ansturm kaum standhalten können, wären nicht bereits im Mai 1915 Einheiten des Deutschen Alpenkorps an der Dolomitenfront eingetroffen. Das deutsche Kaiserreich befand sich zwar offiziell noch nicht im Krieg mit Italien, doch schätzte man im Generalstab die Gefahr an der neuen Südfront als sehr hoch ein. Bayern – so war die Überlegung – ließ sich am besten in Tirol verteidigen.
Die Standschützen und die Angehörigen des Alpenkorps verstanden sich bestens, ergänzten sich auch: Ortskunde hier, Kriegserfahrung dort. Als die Deutschen im Herbst von regulären Einheiten des k. u. k. Heeres ersetzt wurden, war die Hochgebirgsfront weitgehend stabilisiert.
Dass es zu keinem Durchbruch kam, weder am Kreuzbergpass noch im Hochabtei, hatte aber noch eine andere Ursache: das zögerliche Vorgehen der Italiener. Richtig einsatzfähig war ihre Armee zwar erst ab Juni, doch vor allem überschätzte Cadorna die Feuerkraft der österreichischen Festungen ganz erheblich. Seine Strategie, die Panzerwerke zunächst einmal sturmreif zu schießen, schlug fehl. Am Hochplateau von Vézzena beispielsweise verbluteten im August 1915 über tausend »Fanti« (Infanteristen) bei einem schlecht geplanten Angriff.
Die zwölf IsonzoschlachtenLetztlich blieb die Gebirgsfront, die sich vom Ortler über rund 600 Kilometer bis zu den Karnischen und Julischen Alpen erstreckte, ein Nebenkriegsschauplatz. Die Front »versteinerte« bald, man grub sich buchstäblich ein. Und Cadorna suchte die Entscheidung ohnehin im Hinterland der Adria, am Isonzo (slow. Soča). Hier standen sich die feindlichen Armeen in zwölf Schlachten gegenüber, hier verbluteten Hunderttausende, ehe schließlich die k. u. k. Truppen – verstärkt durch deutsche Einheiten, die Giftgas einsetzten – den zahlenmäßig überlegenen, aber schwer demoralisierten Gegner vernichtend schlugen. Innerhalb weniger Tage wurde die Front vollständig aufgerollt, Cadorna musste sein Hauptquartier in Udine fluchtartig verlassen; 300 000 Italiener gingen in Gefangenschaft, Tausende warfen ihre Waffen einfach weg und desertierten.
Erinnern oder vergessen, bewahren oder verdrängen?
Bergheimat
»Neben unseren Soldaten sind die Andreas-Hofer-Gestalten der eigenartigen Formation der Standschützen bewundernswert in ihrem Ausharren bei schwerster Beschießung. Für die Anforderungen eines modernen Krieges bringen sie nur den persönlichen Mut und das Bewußtsein mit, unmittelbar den eigenen Heimatboden zu verteidigen.«
Ein deutscher Offizier in »Franz Kostners Leben für seine Dolomitenheimat«
Der weiße Tod An der Dolomitenfront kam es während des ersten Kriegsjahres punktuell immer wieder zu heftigen, teilweise auch verlustreichen Kämpfen, so am Monte Piana, dessen Nordkuppe (Monte Piano) deutsche und österreichische Truppen hielten, während sich die Alpini am Südgipfel verschanzt hatten, am Col di Lana, im Raum Kreuzbergpass und rund um das Travenanzestal. Ungewöhnlich früh eintretende heftige Schneefälle erstickten dann fast jede Kampftätigkeit im Hochgebirge. Ein neuer, ernst zu nehmender Gegner betrat die Kriegsbühne: der Winter. Auf beiden Seiten der Front war man nur unzureichend auf die alpinen Gefahren vorbereitet; der Nachschub stockte, Verbindungen wurden unterbrochen, Trägerkolonnen wurden verschüttet. Extrem schlimm war dann der Winter 1916/17, einer der schneereichsten seit Menschengedenken. Tausende von Soldaten verloren ihr Leben durch Lawinenabgänge; so fegten die Schneemassen an der Marmolada im Dezember 1916 ein Barackenlager einfach weg. Rund 300 Soldaten fanden dabei den Tod.
Der Erste Weltkrieg – eine Zeittafel
28. Juni 1914 Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich und seine Gattin werden in Sarajevo Opfer eines Attentats.
28. Juli 1914 Österreich-Ungarn erklärt Serbien den Krieg. Der Erste Weltkrieg beginnt.
5.–13. September 1914 Sieg der Franzosen in der ersten Marne-Schlacht
23. Mai 1915 Italien erklärt der Donaumonarchie den Krieg.
24. Mai 1915 Die Italiener beginnen mit der systematischen Beschießung der k. u. k. Festungswerke auf der Hochebene von Lavarone.
25. Mai 1915 Italienische Truppen marschieren in Cortina d’Ampezzo ein, nachdem sich die Österreicher auf eine weiter nördlich verlaufende Verteidigungslinie zurückgezogen haben.
23. Juni 1915 Erster Angriff der Italiener auf die k. u. k. Stellungen am Isonzo
7. Juni 1915 Die Österreicher besetzen die Nordkuppe des Monte Piana (Monte Piano), um einem möglichen italienischen Durchbruch ins nahe Pustertal zuvorzukommen.
15. Juni 1915 Erste italienische Angriffe auf den Col di Lana
18. Juni 1915 Der strategisch wichtige Hexenstein, den die Alpini kurz zuvor in ihren Besitz gebracht hatten, wird von den Österreichern zurückerobert.
10. November 1915 Cadorna startet die IV. Isonzo-Schlacht. 370 italienische Bataillone mit 1374 Geschützen stehen 155 österreichischen Bataillonen mit 626 Geschützen gegenüber.
16. April 1916 In einer kühnen Attacke vom Elfer herab erobern Alpini die Sentinellascharte.
17. April 1916 Die Italiener zünden am Col di Lana eine 5000-Kilogramm-Mine. Der Gipfel wird weggesprengt, 170 Österreicher sterben.
16. Mai 1916 Die Österreicher starten auf den Höhen über dem Val d’Astico ihre Großoffensive: 369 Geschütze nehmen die italienischen Stellungen unter Feuer. Ziel der Aktion: der Durchbruch in die Po-Ebene.
4. Juni 1916 In Weißrussland starten die Truppen des Zaren ihre Brussilow-Offensive. Die Heeresleitung der Donaumonarchie ist gezwungen, Einheiten von der Italienfront abzuziehen und nach Osten zu verlegen. Dadurch kommt letztlich die Mai-Offensive zum Erliegen.
11. Juli 1916 Die Italiener zünden am Castelletto (Tofana di Rozes) eine Mine. Einen Tag später erobern Alpini die Gipfelstellung.
23. September 1916 Die Österreicher bringen unter dem Gipfel des Monte Cimone (südöstlich des Spitz Tonezza) eine gewaltige Sprengladung zur Explosion, erobern anschließend die von den Italienern besetzte Kuppe.
13. Dezember 1916 Bei einem Lawinenabgang an der Marmolada (Col di Bousc) sterben rund 300 Soldaten.
Der Winter 1916/17 ist einer der schneereichsten überhaupt; Tausende fallen dem »Weißen Tod« zum Opfer, auf beiden Seiten der Front.
22. Mai 1917 Eine gewaltige Sprengung der Österreicher – weit über 100 000 Kubikmeter Gestein donnerten zu Tal – kann die Alpini nicht vom Martini-Band am Lagazuoi vertreiben.
10. Juni 1917 Die Italiener starten mit riesigem Truppen- und Materialeinsatz eine Offensive am Nordrand des Altipiano delle Sette Comuni. Im Mittelpunkt der verlustreichen Kämpfe steht der Monte Ortigara (2106 m), den italienische Truppen vorübergehend in ihren Besitz bringen, dann aber wieder preisgeben müssen. Auf Seiten der Österreicher wird Giftgas eingesetzt. Verluste der Italiener: 9000 Tote, 25 000 Verwundete, 3000 Gefangene.
24. Oktober 1917 Mit einem heftigen Artilleriefeuer, bei dem auch Giftgasgranaten zum Einsatz kommen, beginnt die XII. Isonzoschlacht. Sie bringt den k. u. k. Truppen bei Karfreit (Kobarid) den Sieg. In wenigen Tagen stoßen ihre Einheiten in die Oberitalienische Tiefebene vor.
3. März 1918 Deutschland und Russland unterzeichnen einen Waffenstillstand; dadurch werden große, bisher an der Ostfront eingesetzte Heeresteile für den Kampf an der Westfront frei.
15. Juni 1918 Die k. u. k. Truppen beginnen am Piave eine Offensive, die aber keinen Erfolg bringt.
9. August 1918 Gabriele D’Annunzio überfliegt Wien und wirft Tausende von Zetteln ab, in denen die Bevölkerung zum Widerstand gegen den Krieg aufgerufen wird.
4. November 1918 In der Villa Giusti bei Padua unterzeichnet die Donaumonarchie einen Waffenstillstand mit der Entente.
9. November 1918 Kaiser Wilhelm II. dankt ab. In Berlin wird die Weimarer Republik ausgerufen.
11. November 1918 Waffenstillstand zwischen Deutschland und den Entente-Mächten
Diese italienische Einheit baute am Kleinen Lagazuoi (Tour 18).
Die Maioffensive 1916 Im Frühling flammten die Kämpfe erneut auf, vor allem am Cristallo-Abschnitt, aber auch an der Marmolada, wo die Alpini den Serauta-Kamm besetzten. Zum Hauptschauplatz der Gebirgsfront sollte der Abschnitt zwischen Asiago und dem Monte Pasubio werden, wo Franz Conrad von Hötzendorf eine große Offensive plante – mit deutscher Unterstützung. Doch der Oberbefehlshaber der Westfront, Erich von Falkenhayn, verweigerte ihm die Gefolgschaft. Conrad entschloss sich zu einem Alleingang. Nach vorbereitendem Artilleriefeuer traten die k. u. k. Truppen zum Sturm an. Drei Tage später waren die italienischen Linien überrannt, Ende des Monats fielen Arsiero und Asiago – der Weg in die Po-Ebene schien frei. Doch dann erreichten Katastrophenmeldungen aus dem Osten die vorrückenden Truppen: In Weißrussland hatten zwei russische Armeen die österreichisch-ungarische Linie durchbrochen und waren innerhalb nur weniger Tage über 50 Kilometer weit nach Westen vorgestoßen (Brussilow-Offensive). Um die Front zu stabilisieren, mussten auch Truppenteile abgezogen und in den Osten verlegt werden: das Ende des viel versprechenden Vorstoßes. Die verbliebenen Truppen besetzten neue Stellungen; eine Gegenoffensive Cadornas verpuffte wirkungslos.
Franz Kostner
»Zwei alte Standschützen aus Buchenstein, die sehr ortskundig waren, machten mich aufmerksam, daß das Lager Arabba durch die vom Pitzaz regelmäßig zu Tal fahrende Lawine gefährdet sei. Auf meine Vorstellung beim Kommandanten, das Lager nach Osten zu verlegen, traf ich auf taube Ohren. Auch meine Meldung bei der Brigade, entsprechende Schritte zu unternehmen, war erfolglos. Es ist tragisch, daß zwei Tage später 21 Mann und 40 Pferde in diesem Lager unter die Lawine kamen. Wo die Weisungen der gebirgskundigen Referenten befolgt wurden, konnten in der Zukunft manche drohenden Lawinenereignisse hintangehalten und so mancher bittere Mannschaftsverlust verhindert werden.«
Aus den Erinnerungen von Franz Kostner (1877–1968), im Ersten Weltkrieg Kommandant des Standschützenbataillons Enneberg. Kostner war ein echter Selfmademan: Bergführer, Hotelier – er erwarb das Hotel Posta Zirm in Corvara, heute das erste Haus im Ort –, Fuhrunternehmer und lange Jahre auch Bürgermeister von Corvara. Zusammen mit dem Münchner Gottfried Merzbacher unternahm er 1902 eine Expedition nach Zentralasien.
Der MinenkriegAn der Hochgebirgsfront verlagerte sich das Kriegsgeschehen mehr und mehr in den Berg. Nachdem sich die Verteidigungsstellungen auf beiden Seiten als kaum einnehmbar erwiesen hatten, verfiel man auf die Idee, feindliche Positionen zu unterminieren und in die Luft zu sprengen. Eine erste größere Sprengung entschied am 17. April 1916 den Kampf um den Col di Lana, dessen Gipfel die Italiener zuvor über hundert Mal erfolglos berannt hatten. Wenig Wirkung zeigten dagegen die Sprengungen am Kleinen Lagazuoi, von denen mächtige Geröllkegel am Felsfuß übrig blieben. 35 Tonnen Sprengstoff kamen am Castelletto zur Explosion; sie zerstörten die k. u. k. Stellung teilweise, die in der Folge von den Alpini erobert werden konnte. Nach dem Rückzug der Italiener von der Dolomitenfront als Folge der Niederlage bei Karfreit (heute Kobarid, Slowenien; XII. Isonzoschlacht) konzentrierte sich der Minenkrieg auf das Pasubio-Massiv, wo Kaiserjäger und Alpini je eine Gipfelkuppe besetzt hielten. Im Spätsommer 1917 zündeten die Österreicher eine erste, 500 Kilogramm schwere Mine. Beide Seiten brachten noch mehrere Minen zur Explosion, allerdings mit mäßigem Erfolg. Auch die letzte und gewaltigste Ladung mit 50 Tonnen (!) Sprengstoff (13. März 1918) verwandelte die Frontseite der italienischen Platte zwar in einen Trümmerhaufen, blieb aber letztlich doch weitgehend folgenlos.
Die Festungen auf der Hochebene von Lavarone waren mit großkalibrigen Geschützen ausgerüstet (Tour 26).
RückzugZu einer militärischen Entscheidung kam es weder an der Dolomitenfront noch in den Bergen westlich des Etschtals oder am Karnischen Kamm. Die fiel am Isonzo, wo nach einem beispiellosen Gemetzel von insgesamt zwölf Schlachten Deutsche und Österreicher Cadornas Truppen Ende Oktober vernichtend schlugen. In der Folge zogen sich die Italiener aus den Dolomiten zurück; es gelang ihnen aber mithilfe der Alliierten, die Front am Piave und am Monte Grappa zu halten. Eine letzte Offensive der Österreicher unter Franz Conrad von Hötzendorf scheiterte, nicht zuletzt auch aufgrund heftiger Unwetter, welche das Mündungsgebiet des Piave weitgehend unter Wasser setzten.
FriedeSpätestens nach dem Kriegseintritt der USA auf Seiten der Entente war alles entschieden: In Russland regierten die Bolschewiken, die Zarenfamilie wurde in Jekaterinenburg erschossen. In der k. u. k. Armee zeigten sich Auflösungserscheinungen, Desertion und Meuterei nahmen überall zu. Österreich-Ungarn unterzeichnete in Padova einen Waffenstillstand, der einer Kapitulation gleichkam; in Deutschland kam es zu revolutionären Unruhen. Am 9. November dankte Kaiser Wilhelm II. ab und ging ins Exil. Mit dem Friedensvertrag von St-Germain fielen Südtirol und das Trentino an Italien. Endlich Friede – doch zu welchem Preis?
Die »Strada delle 52 Gallerie« (Tour 29)
Praktische Tipps
Der unmögliche Krieg! So könnte man das Geschehen zwischen 1915 und 1917 an der Alpenfront auch nennen: Kämpfen in Fels und Eis. Wer also den Spuren des Gebirgskrieges folgen will, muss gut zu Fuß sein und die Grundregeln des Alpinwanderns kennen. Aus einigen der kühn trassierten Kriegswege sind sogar moderne Klettersteige geworden, die man nur mit entsprechender Erfahrung – und Ausrüstung! – begehen darf.
Wandern
Ganz wichtig ist beim alpinen Wandern eine der Jahreszeit, dem Klima und dem Wetter angepasste Kleidung. Eine moderne, zweckmäßige Bekleidung transportiert Schweiß von der Hautoberfläche nach außen. Er bleibt also nicht auf der Haut, wo er abkühlt und feuchtet, was zu einer Erkältung führen kann. Für alle Temperaturbereiche als ideal hat sich das sogenannte »Zwiebelprinzip« erwiesen: mehrere Schichten übereinander, die an- bzw. ausgezogen werden können. So ist der Körper bei jeder Witterung angemessen geschützt: nie zu kalt, nie zu heiß!
Die alten Militärstraßen rund um das Limojoch sind heute beliebte Bikestrecken. (Tour 16)
Baumwolle besitzt zwar einen hohen Tragekomfort, speichert aber Feuchtigkeit, ist also fürs Bergsteigen weniger geeignet. Sportunterwäsche aus modernen Synthetiks gibt die Feuchtigkeit nach außen weiter, sorgt also für trockene und das heißt warme Haut. Es ist aber darauf zu achten, dass die nächste Bekleidungsschicht (Shirt oder Hemd) ebenfalls aus Kunstfasern besteht!
Socken werden in der Regel aus einer Mischfaser (Wolle/Synthetik) hergestellt, was – in Verbindung mit Polstern an den richtigen Stellen – erheblichen Tragekomfort garantiert. Links-rechts-Socken auch so anziehen!
Längst ausgedient hat die Bundhose: Bei größeren Unternehmungen ist eine lange Berghose zu empfehlen, eventuell mit abnehmbaren Beinen. Mit dabei hat man zusätzlich eine Überhose aus regendichtem Material, die gut vor Kälte (Wind) und Nässe schützt.
Fleece-Jacken oder Pullis, eventuell mit Windstoppern, sind aus der Bergsportbekleidung nicht mehr wegzudenken, so wenig wie Anoraks aus Goretex oder einem vergleichbaren Material. Sie dürfen allerdings nicht zu kurz sein und sollten eine ausrollbare Kapuze besitzen. Angenehm bei windigem Wetter ist eine Mütze.
Grundlage jeder ordentlichen Ausrüstung sind die Bergschuhe. Und die müssen passen: zum Gelände und zum Fuß. Letzteres ist besonders wichtig: Der Schuh darf auf keinen Fall zu klein (Zehen!) sein. Und die Schuhe müssen vor der Wanderung gut eingelaufen werden, sonst kann es böse Überraschungen geben (Blasen)! Ideal ist ein guter Allrounder, zum Beispiel ein leichterer Trekkingstiefel.
Das Wetter
Bergwandern ist ein Freiluftsport, und deshalb ist das Wetter für das Gelingen einer Tour besonders wichtig. Im Computerzeitalter sind Prognosen in der Regel recht zuverlässig, zumindest jene für 24 oder 48 Stunden. Früher war das ganz anders. Die vom Wetter extrem stark abhängigen Bergbauern waren damals die einzigen »Meteorologen«; sie wussten Wetterzeichen zu deuten, sahen voraus, ob am nächsten Tag Regen oder Sonnenschein zu erwarten war – überwiegend oder auch nur manchmal. Das sollten auch Wanderer vorab klären.
Leider ist aber immer wieder zu beobachten, wie unbedarft manche zu ihrer Bergtour aufbrechen. Was statistisch längst belegt ist, wird von vielen einfach nicht wahrgenommen: Das Wetter ist der größte Risikofaktor bei Bergwanderungen! Ein strahlend schöner früher Morgen bietet keine Gewähr dafür, dass es den ganzen Tag über sonnig bleibt, dass weder Gewitter noch Regen oder möglicherweise sogar Schnee drohen. Als Vorboten einer Wetterverschlechterung gelten Morgenrot, bestimmte Wolkenbilder (z. B. Föhnfische und von Westen aufziehende Federwolken) und Halo-Erscheinungen (weiter, regenbogenfarbiger Ring um die Sonne, Nebensonnen). Bilden sich bereits am Vormittag Haufenwolken, die rasch zu mächtigen Türmen anwachsen, sind Schauer, Blitz und Donner zu erwarten.
Klettersteiggehen
Sicherheit vermittelt dem Klettersteigler sein Set: zwei je etwa einen Meter lange Seil- oder Bandstücke, eine Sturzbremse und zwei Schnappkarabiner mit großer Öffnung. Diese Sets werden von zahlreichen Herstellern in unterschiedlicher Ausführung angeboten. Üblich und unbedingt vorzuziehen ist heute die Y-Form, die doppelte Sicherheit bietet, weil beide Karabiner eingehängt werden und auch beim Umhängen an einem Verankerungspunkt Sicherheit gewährleistet ist. Mit dem Klettergurt (Sitzgurt) verbindet man das Set ganz einfach per Ankerstich.
Auf manchen Klettersteigen – Gratrouten einmal ausgenommen – besteht erhebliche Steinschlaggefahr. Kluge Köpfe schützen sich – und setzen den Helm auf. Moderne Modelle weisen einen hohen Tragekomfort auf und wiegen bloß noch ein paar hundert Gramm. Auch in den oft niedrigen ehemaligen Kriegsstollen ist ein Kopfschutz sehr zweckmäßig.
Der Paternkofel – im Dolomitenkrieg hart umkämpft – ist heute durch einen Klettersteig erschlossen. (Tour 8)
Die Hüsler-Schwierigkeitsskala
Unter dem Sammelbegriff Klettersteig (Via ferrata) finden sich gesicherte Routen mit sehr unterschiedlichem Anforderungsprofil. Eine Schwierigkeitsskala erleichtert die Orientierung; sie umfasst sechs Stufen von leicht (K 1) bis extrem schwierig (K 6).
Leicht zu merken – zehn Regeln für Klettersteigler