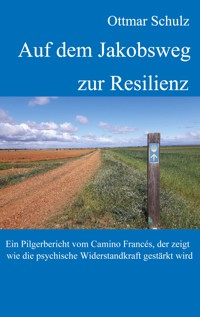
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Auf dem Jakobsweg zur Resilienz - Ein Pilgerbericht vom Camino Francés, der zeigt wie die psychische Widerstandskraft gestärkt wird Auf dem Jakobsweg Glück und Spiritualität zu erleben, d.h. emotionale Aufladungen in einer besonderen Dimension, sind einmalig schöne Erfahrungen. Der Pilger Ottmar Schulz berichtet von den persönlichen Erlebnissen seiner sechswöchigen Pilgerreise auf dem Camino Francés, beginnend in den französischen Pyrenäen bis Santiago de Compostela und an die spanische Atlantikküste zum Kap Finisterre. Dabei beschreibt er, wie auf den einzelnen Pilgeretappen die Schutzfaktoren der Resilienz beansprucht und gestärkt werden. Die täglichen Fußschmerzen, Strapazen und Belastungen des Pilgerns sind nicht nur besondere Herausforderungen für die körperlichen Kräfte, sondern bedürfen auch der inneren Widerstandsfähigkeit. Aber der Camino Francés kostet nicht nur Kraft, sondern gibt den Pilgern in vielfacher und sonderbarer Weise ungeahnte Kräfte zurück, schafft Lebensfreude, führt zur Selbsterkenntnis und stärkt so das Selbstbewusstsein und die psychische Widerstandskraft. Dieser Bericht zeigt, auf welche Weise die Resilienz durch das Pilgern gefördert wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Pilgerbericht vom Camino Francés, der zeigt
wie die psychische Widerstandskraft gestärkt wird
Text und Bilder von Ottmar Schulz
Namen und Herkunftsorte der genannten Personen wurden geändert.
Nachdruck und Verwendung von Inhalten und Bildern sind ohne Genehmigung des Autors nicht gestattet.
Die Angaben und Informationen in diesem Pilgerbericht resultieren aus verschiedenen Quellen. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die wiedergegebenen Eindrücke und Meinungen sind persönlicher, subjektiver Art und erheben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
Alle Hinweise und Ratschläge in diesem Buch sind wohlbedacht, aber allgemeiner Natur und stellen keine individuelle Beratung dar. Deshalb wird keine Garantie übernommen. Eine Haftung des Autors für jegliche Schäden ist ausgeschlossen. Wenn Unsicherheiten und Grenzen in der Selbsthilfe auftreten, ist die Suche nach professioneller Hilfe und Unterstützung geboten. Die Empfehlungen in diesem Buch können einen Besuch beim Arzt oder Psychologen nicht ersetzen.
Das Ziel: Die Kathedrale in Santiago de Compostela mit dem Grab des heiligen Jakobus
Inhalt
Vorwort
1. Übersichtskarte vom Jakobsweg
2. Grundlagen der Resilienz
2.1 Begriffserklärung
2.2 Schutzfaktoren der Resilienz
3. Motive und Vorbereitung der Pilgerreise
4. Anreise, innere Stärke und Ankunft am Startort
5. Tagesetappen und ausgewählte Beispiele für Resilienz
Etappe 1: Saint-Jean-Pied-de-Port – Burguette, 30 km
Etappe 2: Burguette – Zubiri, 18 km
Etappe 3: Zubiri – Pamplona, 22 km
Etappe 4: Pamplona – Puente la Reina, 24,6 km
Etappe 5: Puente la Reina - Estella, 23 km
Etappe 6: Estella – Los Arcos, 22,5 km
Etappe 7: Los Arcos – Logroño, 28 km
Etappe 8: Logroño – Navarette, 12,5 km
Etappe 9: Navarette – Najera, 17,3 km
Etappe 10: Santo Domingo – Belorado, 20 km
Etappe 11: Burgos – Hontanas, 32,3 km
Etappe 12: Hontanas – Carrión de los Condes, 56,5 km
Etappe 13: Carrión de los Condes – Ledigos, 24,6 km
Etappe 14: Ledigos – Sahagún, 17,1 km
Etappe 15: Sahagún – Reliegos, 32 km
Etappe 16: Reliegos – Leon, 24,8 km
Etappe 17: Leon – Villar de Mazarife, 22 km
Etappe 18: Villar de Mazarife – Astorga, 32,9 km
Etappe 19: Astorga – Rabanal del Camino, 20,7 km
Etappe 20: Rabanal del Camino – Ponferrada 32,4 km
Etappe 21: Ponferrada – Villafranca d. Bierzo, 24,8 km
Etappe 22: Villafranca del Bierzo – La Faba, 27 km
Etappe 23: La Faba – Triacastela, 27 km
Etappe 24: Triacastela – Rente, 24,5 km
Etappe 25: Rente – Castromajor, 28,8 km
Etappe 26: Castromajor – Palas de Rei, 16,9 km
Etappe 27: Palas de Rei – Boente, 21,1 km
Etappe 28: Boente – Pedrouzo, 28,6 km
Etappe 29: Pedrouzo – Santiago, 21,2 km
6. Ankunft am Zielort und dann?
Pausentag in Santiago de Compostela
7. Die Reise geht weiter – die Stärkung der Resilienz auch
Etappe 30: Santiago de Comp. – Negreira, 22,1 km
Aufenthalt in Negreira und Busfahrt nach Muxia
Regen- und Pausentag in Muxia
Etappe 31: Cée – Kap Finisterre, 14,9 km
8. Rückkehr
9. Spiritualität, gute und böse Geister auf dem Jakobsweg
9.1 Spiritualität
9.2 Gute Geister
9.3 Böse Geister
10. Fazit
10.1 Emotionale Aufladung und Selbsterkenntnis
10.2 Stärkung der Schutzfaktoren der Resilienz
10.3 Der Weg ist das Ziel
Literaturhinweise
Danksagung
Vorwort
Als kirchlich nicht gebundener Mensch habe ich mich lange Zeit gefragt, was mir die Pilgerreise auf dem Jakobsweg von Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankreich nach Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens, immerhin ein Fußweg von 805 km, eigentlich gebracht hat, außer viele schöne Erinnerungen, eine sechswöchige Befreiung vom Alltag, eine Menge Schmerzen und Strapazen sowie eine chronisch gereizte Achillessehne im rechten Fuß.
Irgendwann nach eineinhalb Jahren, nachdem ich mich retrospektiv noch einmal ausführlich mit dem Jakobsweg beschäftigt hatte, nach der Erstellung eines schönen Fotobuchs und der Lektüre von mehreren Pilgerberichten, kam ich darauf, dass ich doch etwas auf dem Jakobsweg gelernt und mich verändert hatte. Nur was genau, war mir lange Zeit nicht so recht bewusst.
Mehr Gelassenheit im Alltag hatte ich schon das eine oder andere Mal wahrgenommen, doch erst als ich mich auf meine Kenntnisse als Resilienztrainer besann, konnte ich die Veränderungen genauer identifizieren und einordnen. Es gab immer wieder Anhaltspunkte, dass meine innere Widerstandskraft gestärkt worden war. Ein Zugewinn an Resilienz war vermutlich das Ergebnis meiner Pilgerreise. Diesen Zugewinn konnte ich aber nicht direkt erfassen oder messen. Ich wollte es genauer wissen und begann mit der Analyse meines Tagebuchs und der vielen selbst aufgenommenen Bilder im Hinblick auf die bekannten Schutzfaktoren der Resilienz. So konnte ich mich wieder in die damalige Situation versetzen und schlüssige Antworten auf zwei entscheidende Fragen erhalten:
1. Welche Schutzfaktoren der Resilienz wurden bei mir durch das Pilgern gestärkt?
2. Wie bzw. durch welche Erlebnisse und in welchen Situationen wurde meine innere Widerstandskraft gestärkt?
Die Antworten und die hier vorgestellten Erkenntnisse beziehen sich auf meine Pilgerreise vom 27. April bis 2. Juni 2019 auf dem Camino Francés, der durch Nord-Spanien verläuft. Im ersten Kapitel dieses Buches werden kurz die Grundlagen der Resilienz vorgestellt, um nachvollziehen zu können, auf welche Aspekte sich die Analyse der Tagebucheintragungen Etappe für Etappe konzentrieren. Danach zeige ich im Zusammenhang mit dem Pilgerbericht und anhand von Beispielen, wo es auf dem Jakobsweg um Resilienz geht, wo es Lernprozesse und Anschlussmöglichkeiten an bereits vorhandene Schutzfaktoren der inneren Widerstandskraft gibt.
Viele beschriebene Beispiele lassen sich auch auf unseren Alltag übertragen und so als Übung für das tägliche Training der Resilienz nutzen. Natürlich ist eine Pilgerreise nicht zwingend notwendig, um die Resilienz zu stärken, aus meiner Sicht aber sehr empfehlenswert. Eine sechswöchige Auszeit, um auf Pilgerfahrt zu gehen, ist ein wahrer Luxus und bietet die Möglichkeit, viel Neues zu entdecken und sich weiter zu entwickeln. Und für alle, die den Camino bereits gepilgert sind, sei die Weisheit gesagt: Der Jakobsweg, der ein Weg zu sich selbst ist, endet nicht am Zielort in Santiago de Compostela, sondern beginnt dort erst. Ähnlich verhält es sich auch mit der Stärkung der Resilienz, die nie endet.
Viele Situationen in diesem Buch wirken aus der Rückschau und Distanz betrachtet amüsant und unterhaltend, waren es aber nicht unbedingt als sie eintraten. Falls diese beim Lesen zur Unterhaltung beitragen, umso besser, denn Freude und Genuss sollten unsere täglichen Begleiter sein.
Dieser Pilgerbericht bietet die Möglichkeit, an den Erlebnissen, Eindrücken und Gedanken eines Pilgers auf dem Jakobsweg teilzuhaben. Tauchen Sie ein in den Camino Francés, Etappe für Etappe, und pilgern Sie gedanklich mit. Jeder Tagesetappe sind Bilder vorangestellt und weitere teilweise hinzugefügt. Sie vermitteln Eindrücke von der Schönheit des Jakobsweges, aber nicht nur, denn sie zeigen auch einige herausfordernde Besonderheiten dieser Pilgerreise. So erhalten Sie die Gelegenheit, sich die beschriebenen Landschaften, Wegstrecken, Situationen und Herausforderungen noch besser vorstellen zu können.
Am Ende jeder Etappe erfahren Sie etwas über Resilienz, die psychische Widerstandskraft des Menschen, und wo es beim Pilgern auf dem Jakobsweg bzw. im Alltag Gelegenheiten für die Stärkung der psychologischen Schutzfaktoren gibt.
Mit dem alten Pilgergruß „Ultreïa“ - immer weiter, immer vorwärts - wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieses Buches, beim Pilgern auf dem Jakobsweg und der Stärkung Ihrer Resilienz.
Alles Gute und „buen camino“ wünscht
Ottmar Schulz
1. Übersichtskarte vom Jakobsweg
Der französische Jakobsweg in Nord-Spanien, Camino Francés genannt, ein Weg von 805 km Länge von den Pyrenäen bis zum Ziel Santiago de Compostela.
Quelle: www.istockphoto.com/de - lizensierte Grafik
„Wie ein Baum, dessen Äste sich im Sturm biegen und schwanken, anstatt unter Druck zu brechen, haben wir die Kraft, inmitten der Herausforderungen des Lebens flexibel und stark zu bleiben ... resilient zu sein!“
Prof. Dr. Mary Steinhardt, Universität Texas, Austin
2. Grundlagen der Resilienz
2.1 Begriffserklärung
Die Resilienz, d.h. die seelische Widerstandkraft des Menschen, ist die Fähigkeit in Krisen, bei Stress und traumatischen Erlebnissen nicht an den Belastungen zu zerbrechen, sondern aufgrund der persönlichen inneren Stärke die Belastungen auszuhalten und optimistisch und lösungsorientiert nach vorn zu blicken. Insofern kann Resilienz als das Immunsystem unserer Seele verstanden werden.
Resilient sind Menschen, die mit sich so umgehen können, dass sie auch unter Belastungssituationen handlungsfähig bleiben. Oftmals wird das Bild von Schilfgräsern oder Bäumen verwendet, welche sich bei Wind und Sturm auf das Äußerste biegen können, nicht brechen, sondern den äußeren Kräften standhalten und sich danach wieder aufrichten. Auf diese Weise soll auch die Resilienz, d.h. die psychische Widerstandskraft des Menschen, wirken.
Ursprünglich kommt der Begriff der Resilienz aus der Physik und Werkstoffkunde und bezeichnet Materialien, die sich unter Druck verformen lassen, aber nach dem Wegfall der äußeren Kraft wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehren, wie z.B. beim Auseinanderziehen eines Gummibands. Eine der bekanntesten Untersuchungen zum Thema Resilienz ist die viel zitierte Langzeitstudie der amerikanischen Psychologin Emmy Werner. Über einen Zeitraum von 40 Jahren untersuchte sie auf der Hawaii-Insel Kauai die Resilienz von teilnehmenden Kindern bis in ihr Erwachsenenalter. Das Hauptinteresse lag auf den Kindern, die in sehr schlechten Verhältnissen, den sog. Risikofaktoren, aufwuchsen, z.B. Armut, Arbeitslosigkeit, schwere Krankheit, Kriminalität, Alkoholismus und Drogensucht der Eltern, sich aber in ihrem Kinder- wie Erwachsenenleben erfolgreich behaupten konnten und nicht in die gleichen negativen Lebensweisen ihrer Eltern verfielen. Das waren ca. ein Drittel der Kinder, die dies geschafft hatten. Aber weshalb, was waren ihre Erfolgsfaktoren? Die Untersuchungen zeigten, dass die vielen persönlichen Strategien und Muster der Kinder zu sog. Resilienzfaktoren bzw. psychologischen Schutzfaktoren zusammengefasst werden konnten.
Die Forscher identifizierten sieben Faktoren, u.a. die Faktoren Akzeptanz und Unterstützung. D.h. zum einen, dass die Kinder in der Lage waren, die Probleme im Elternhaus anzunehmen, zu akzeptierten und nicht ständig dagegen ankämpften. Sie rieben sich nicht auf, verloren nicht an Kraft oder kapitulierten frustriert, sondern lernten damit zu leben. Des weiteren waren sie in der Lage, sich von anderen Menschen Hilfe und Unterstützung zu holen, welche ihre Eltern ihnen nicht geben konnten, z.B. bei den Großeltern, bei Geschwistern, Nachbarn, anderen Verwandten, dem Pfarrer der Gemeinde, den Lehrern, Trainern und anderen Personen ihres Umfelds.
Diese Ergebnisse machen Hoffnung. Sie bestätigen, dass auch unter schlechten Lebensbedingungen, den sog. Risikofaktoren, positive Biografien möglich sind. Weitere Forschung und Umsetzung der Ergebnisse haben Programme für das Training der Resilienz hervorgebracht. Es wird davon ausgegangen, dass die innere Widerstandskraft keine statische Größe ist, sondern veränderlich, d.h. zu- oder abnehmen kann. Studien belegen, dass sich die Resilienz von uns Menschen trainieren lässt.
In Bezug auf eine Pilgerreise lässt sich daher fragen, inwiefern wird die Resilienz gefördert und stellt das Pilgern ein gewisses Training für die innere Widerstandskraft dar. In diesem Sinne möchte ich meine Pilgererfahrungen analysieren und setze mich dafür ein, dass Menschen nicht an ihren persönlichen Schwierigkeiten ersticken, sondern die Schutzfaktoren der Resilienz kennenlernen, diese individuell trainieren und einsetzen, um mit den Herausforderungen im Lebens besser umgehen zu können.
2.2 Schutzfaktoren der Resilienz
Um erfolgreich im Alltag gegen Stress und in Krisen bestehen zu können, haben Forscher aus den einzelnen Ergebnissen ihrer Untersuchungen, d.h. aus den Strategien der resilienten Probanden die folgenden Schutzfaktoren der Resilienz entwickelt.
Akzeptanz
Hier geht es darum, sich mit Unveränderlichem abzufinden. Das Motto heißt „vorbei ist vorbei“. Weshalb soll ich mich noch lange Zeit nach einer Entscheidung bzw. Veränderung in meinem Leben dagegen auflehnen? „Es ist wie es ist!“ Weshalb unnötig Kraft und Zeit dafür aufwenden, wenn die Situation doch nicht mehr verändert werden kann? Ich vergeude nur Energie. Es gilt jetzt, das Neue zu akzeptieren. Resiliente Menschen akzeptieren Veränderungen, statt ständig dagegen an zu gehen. Sie sind sich bewusst, dass das Leben aus permanenten Veränderungen besteht.
Doch Akzeptanz beginnt zunächst bei uns selbst. Erst wenn wir uns selbst mit unserer eigenen Lebensgeschichte annehmen, sind wir in der Akzeptanz. Erst wenn wir unsere eigenen Stärken und Schwächen sowie Fehler akzeptieren, fällt es uns auch leichter, die Fehler und Schwächen unserer Mitmenschen anzunehmen. Dazu gehört auch, auftretende Gefühle wie Wut und Trauer anzuerkennen und diese auch zulassen zu können.
Akzeptanz ist letztendlich eine Akzeptanz des Selbst und des eigenen Lebens. Bestandteile der Akzeptanz sind die eigene Anpassungsfähigkeit, eine wohlwollende Toleranz sich selbst und anderen gegenüber sowie eine flexible Sicht auf die Umwelt, die eigene Person und den persönlichen Lebensweg.
Realistischer Optimismus
Resilienz bedeutet optimistisch im Denken und Handeln zu sein und zu bleiben, auch wenn es gerade etwas schwierig ist im Leben und eine schlechte private oder berufliche Situation vorherrscht. Optimismus bedeutet positive Ergebniserwartungen zu haben, frei nach Friedrich Hölderlin, „wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“. Es gilt, weiterhin darauf zu bauen, dass es wieder besser wird.
„Das Glas ist halb voll und nicht halb leer“, heißt es. Mit dieser veränderten Sichtweise lässt es sich leichter leben. Optimistische Menschen zeigen eine größere Handlungs- und Durchhaltebereitschaft sowie ein aktiveres Bewältigungsverhalten in belastenden Situationen. Dabei ist es wichtig, sich selbst auf etwas Positives zu fokussieren, d.h. möglichst immer positiv zu denken und positives Denken zu üben.
Hoffen dürfen wir alle. Natürlich muss das positive Denken realistisch sein. Denn in ausweglosen Situationen und bei unerreichbaren Zielen kann kein Optimismus gedeihen. Es geht immer wieder darum, sich positive Sichtweisen für Herausforderungen und belastende Situationen im Leben zu erarbeiten.
Hierfür lohnt es sich, die Haltung für einen realistischen Optimismus einzunehmen und zu bewahren.
Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitserwartung
Im Prinzip geht es darum, selbstbestimmt das eigene Leben im Griff zu haben. Aufbauend auf positiven Erfahrungen und Erfolgen aus meiner Vergangenheit weiß ich, dass ich etwas bewirken kann und die Kraft habe, das Leben positiv zu gestalten. Selbstwirksam leben heißt, sich seiner Stärken und seines Selbstwertgefühls bewusst zu sein, diese Stärken einzusetzen und mit Selbstvertrauen und Mut Probleme anzugehen.
Selbstwirksamkeit bedeutet demnach die subjektive Erwartung zu haben, Anforderungen und Belastungen des Lebens aus eigener Kraft bewältigen zu können. Durch hohe Selbstwirksamkeitserwartungen werden belastende Situationen seltener als bedrohlich erlebt, Gefühle der Hilflosigkeit seltener verspürt und häufiger aktive Bewältigungsstrategien gewählt.
Selbstwirksamkeit bedeutet aber auch Achtsamkeit zu praktizieren, sich nicht ständig selbst zu strapazieren, sondern für das richtige Maß von Anspannung und Entspannung zu sorgen.
Aufgrund der Komplexität und Bedeutung von Achtsamkeit, die ein Teil unserer Selbstfürsorge und Selbst-wertschätzung darstellt, ist sie unter dem Punkt Eigenverantwortung noch einmal genauer aufgeführt.
Netzwerkorientierung und soziale Unterstützung
Ein soziales Netzwerk beinhaltet, dass ich in der Lage bin, mit anderen zu leben und zu arbeiten. Zusammen geht vieles besser. Ich kann bewusst kommunizieren, Konflikte lösen, um Unterstützung bitten, delegieren, Netzwerke positiv gestalten, gute Kontakte zu anderen pflegen, meine Dialogfähigkeit einsetzen, anderen vertrauen und von anderen Hilfe annehmen.
Wichtig ist, dass ich meine sozialen Kompetenzen einsetze, diese ausbaue und mit anderen kooperiere. Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung können emotionale und praktische Unterstützung beinhalten. Dazu zählen einerseits Zuwendung, Trost, Verständnis und das Gefühl der Zugehörigkeit und des Rückhalts sowie andererseits alltägliche Hilfen, unter Umständen auch finanzielle Unterstützung.
Hinzu kommen der Austausch von Informationen und konkrete Hinweise für Problemlösungen. In Studien wurde nachgewiesen, dass der Schutzfaktor „soziale Unterstützung“ einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit und unser psychisches Wohlbefinden hat. Soziale Unterstützung ist somit ein Schutzfaktor gegen Belastungen, z.B. kann sie Belastungen von uns fernhalten, wenn Nahestehende helfend zur Seite stehen. Bei der tatsächlichen sozialen Unterstützung kann es aber auch zu negativen Folgen kommen, wenn sie zwar positiv gemeint ist, aber als unerwünschte Einmischung in die persönlichen Angelegenheiten empfunden wird.
Soziale Unterstützung ist aber dann besonders wirksam, wenn sie zu den aktuellen Bedürfnissen und Zielen einer Person passt. Es geht aber nicht nur um die tatsächliche soziale Unterstützung, sondern auch um die Erwartung, bei Bedarf unterstützt zu werden. Diese Erwartung hat eine schützende Wirkung, auch wenn noch gar keine Hilfe in Anspruch genommen wurde.
Lösungsorientierung
Bei der Lösungsorientierung geht es um den Umgang mit Herausforderungen und Belastungssituationen. Priorität haben nicht die Problemanalyse, das Grübeln, die Flucht vor den Herausforderungen, das Verdrängen oder der Kampf dagegen, sondern die Fokussierung auf eine angemessene Lösung und deren Umsetzung.
Dabei stehen persönliche Bedürfnisse und realistische Möglichkeiten für eine gute Lösung im Vordergrund. Ich bin mir bewusst, dass es immer mehrere Möglichkeiten gibt, Schwierigkeiten zu begegnen. Die Probleme überwältigen mich nicht, weil ich mich nicht in ihnen verliere und in der Problemanalyse stecken bleibe. Ich schaue nach vorn auf die Lösung und vertraue immer wieder auf meine eigenen Fähigkeiten, Lösungen zu finden.
Probleme betrachte ich als Herausforderungen, die ich annehme, einen Plan schmiede und die ersten Schritte einleite, frei nach dem Motto: „Loslegen und machen“. Insofern kann Lösungsorientierung als eine konstruktive Bewältigungsstrategie verstanden werden.
Hoffnung, Ziel- und Zukunftsorientierung
Hinsichtlich der Resilienz bedeutet Hoffnung, dass es die positive Erwartung gibt, Ziele zu erreichen. Diese positive Erwartung wirkt in Belastungssituationen als Schutzfaktor. Dabei ist Hoffnung kognitiv und motivational wirksam und beinhaltet zum einen die Fähigkeit, Ziele festzulegen und Wege dorthin zu finden und zum anderen die Zuversicht, diese Ziele auch erreichen zu können, und die Motivation, im Sinne der Zielerreichung zu handeln.
Hoffnungsvolle Menschen erleben weniger Belastung, sind häufig erfolgreich, wirken stärker sozial kompetent und erhalten meist mehr soziale Unterstützung. Hoffnung ist sehr stark mit Zielorientierung verknüpft. D.h. ich setze mir eigene Ziele und orientiere mich an diesen. Ich bewege mich auf sie zu, indem ich aktiv Entscheidungen hierfür treffe.
Außerdem geben mir meine Ziele zusammen mit meinem Handeln Tag für Tag einen Sinn in meinem Leben. Dadurch schaffe ich mir Zukunft. Ich bin mir bewusst, Ziele können immer wieder neu gewählt werden, um gut durch das Leben zu kommen. Ich orientiere mich einfach nach vorne und setze mir Ziele, die mich in die Zukunft tragen.
Eigenverantwortung
Ich handle eigenverantwortlich, wenn ich Situationen und eigene Bedürfnisse bewusst wahrnehme und entsprechend handle, d.h. aktiv angemessene Entscheidungen treffe. Ich weiß, ich kann mich auf mich und meine Sinne verlassen.
Ich traue mir zu, das geplante Vorgehen umzusetzen, d.h. meine Handlungsfähigkeit und meine Lernfähigkeit einzusetzen. Ich kann Situationen immer wieder neu einschätzen und selbstverantwortlich sowie flexibel auf die Umwelt reagieren. Eigenverantwortung bedeutet daher, dass ich vernünftig mit mir umgehe, meine persönlichen Belastungen ernst nehme und auf sie im Sinne einer angemessenen Lösung reagiere. Hier geht es zunächst nur um mich. Deshalb achte ich auf meine physischen und psychischen Bedürfnisse, nehme diesbezüglich Widerstände in mir war und versuche, diese aufzulösen. Ich gebe mir die Erlaubnis für mein Wohlbefinden zu sorgen.
Einen wichtigen Beitrag hierfür leisten positive Emotionen, die die Gesundheit und das psychische Wohlbefinden fördern. Deshalb nutze ich die Fähigkeit, mich über alltägliche Ereignisse zu freuen. Ich weiß, positive Emotionen stärken mein Selbstwertgefühl und meine Bewältigungsstrategien in belastenden Situationen.
Die Eigenverantwortung umfasst aber auch die Selbstwertschätzung und Achtsamkeit. Diese beziehen sich auf folgende Fragen: Wie gehe ich mit mir um? Sorge ich ausreichend für mich? Wie gehe ich mit meiner Energie um? Werde ich mir selbst gerecht? Die Antworten darauf stellen den Grad meiner Selbstwertschätzung dar, die ich mir gegenüber erbringe. Nur wenn ich mich selbst Wert schätze, habe ich ausreichend Kraft und Energie für die Herausforderungen im Leben.
Kraft und Energie erhalte ich u.a. durch Achtsamkeit. In diesem Sinn heißt achtsam sein, auf sich selbst achten und für sich selbst sorgen zu können. Durch gute Ernährung, ausreichend Schlaf und Erholungsmöglichkeiten, Erfahrungen in der Natur, Bewegung, Selbstreflexion und Selbstbewusstsein finden wir das richtige Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung in unserem Leben und kommen so in die Balance.
Auf sich selbst achten heißt, seinem Leben einen Sinn und eine Struktur geben, Prioritäten setzen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit schaffen, notwendige Pausen einhalten, auf eigene Bedürfnisse und private Zeiten achten, Termine und Gespräche gut planen sowie spontan Entspannung einlegen, z.B. bei hohen Belastungen kurze Übungen wie das bewusste Atmen durchführen.
Achtsamkeit umfasst noch viele andere Punkte, u.a. Gelassenheit und Humor sowie Klarheit in Situationen, bei Zielen und Entscheidungen zu schaffen, Zeitdruck und Ungeduld zu vermeiden, möglichst bewertungsfrei zu leben und die Gedanken nicht ständig in die Zukunft oder Vergangenheit zu lenken, sondern im Hier und Jetzt zu sein und zu leben, d.h. jeden Augenblick liebevoll wahrzunehmen und in jedem Augenblick das Leben bewusst zu genießen.
Mit diesen Schutzfaktoren haben Menschen Zeit Ihres Lebens Alltagsstress, aber auch große individuelle Krisen und Traumata bestanden. Viele Beispiele in der Geschichte zeugen von Menschen mit großer innerer Widerstandkraft, z.B. Johann Sebastian Bach, der in jungen Jahren beide Eltern verlor und später zahlreiche eigene Kinder und dennoch stabil blieb und große Werke schuf.
Ein weiteres Beispiel für große Resilienz ist Nelson Mandela, der zur Zeit der Apartheit in Südafrika 28 Jahre in Einzelhaft verbrachte und nie die Hoffnung auf Befreiung und Veränderung in seinem Land aufgab. Und nach der Befreiung war er kein gebrochener Mann, sondern ein gestärkter politischer Anführer und Präsident, der die politische Apartheit überwinden konnte und für Millionen von Südafrikanern zu einem großen Vorbild und Hoffnungsträger wurde.
Zahlreiche, verfolgte Menschen, darunter viele jüdisch Verfolgte in der NS-Zeit und die sog. „Boat People“, d.h. vietnamesische Flüchtlinge in den 1970er und 1980er Jahren, zeigen, dass trotz der schrecklichen, existenzbedrohenden Umstände die Rückkehr in ein erfolgreiches Leben durch die innere Widerstandskraft möglich ist.
Aber Resilienz haben nicht nur diese Menschen in ihren extremen Lebenssituationen bewiesen, sondern die innere Stärke zeigt sich uns auch im Alltag, d.h. bei jedem Menschen, wenn er sich gegenüber den Herausforderungen des beruflichen und privaten Lebens bewähren muss. Ich denke zum Beispiel an neue berufliche Aufgaben, denen wir uns stellen und an denen wir i.d.R. wachsen oder an Prüfungen in der Schule, die für viele Menschen ein Graus sind oder waren. Doch die meisten von uns haben diese Prüfungen bestanden und können diese als erfolgreiche Erfahrungen verbuchen, darauf aufbauen und die innere Widerstandkraft damit stärken.
Die Resilienz zeigt sich uns täglich bei allen Anforderungen des privaten wie beruflichen Lebens in unserer Selbstwirksamkeitserwartung, Akzeptanz, Selbstwertschätzung, Achtsamkeit und Eigenverantwortung, unserer sozialen Kompetenz, unserer sozialen Unterstützung und unseren Netzwerken, unserem Optimismus, unserer Hoffnung, unserer Zielorientierung und Lösungsorientierung sowie in unserem Selbstbewusstsein über unsere eigene innere Stärke. Für die Bewältigung der täglichen Anforderungen und einen Zuwachs der inneren Stärke lohnt sich der Blick auf diese Schutzfaktoren, die die seelische Widerstandskraft verkörpern, sowie eine entsprechende Reflexion und Berücksichtigung.
Der nun folgende Erfahrungsbericht soll zeigen, wie die oben beschriebenen Schutzfaktoren der Resilienz auf meiner Pilgerreise des 805 km langen Jakobsweges, dem Camino Francés, zum Tragen kamen.
3. Motive und Vorbereitung der Pilgerreise
Graffiti am Jakobsweg auf einer Mauer in Villafranca del Bierzo: „Santiago ist nicht dort. Ist in Dir.“ Was Du auf dem Jakobsweg suchst oder am Zielort in Santiago de Compostela zu finden wünscht, ist bereits in Dir. Du bist der Weg und das Ziel.
Motive
Weshalb pilgert ein Mensch über 800 km zu einem Ort, an dem eine Kathedrale mit den Reliquien eines Heiligen steht? Diese Frage ist nicht gerade leicht zu beantworten, allenfalls für religiös motivierte Menschen. Auf jeden Fall sind Hunderttausende in den letzten Jahren den Camino Frances gepilgert.
Im Jahr 2019 sind nach offizieller Zählung der katholischen Kirche 347.578 Pilger in Santiago de Compostela angekommen und haben ihre Pilgerurkunde entgegengenommen, und ich war einer von ihnen.
Über die persönlichen Motive sprechen die meisten Pilger nur ungern, und so ist dieses Thema häufig ein Tabu. Viele schieben andere Gründe vor, wenn man mit ihnen spricht. Die meisten sind nach meiner Einschätzung auf der Suche, z.B. auf Sinnsuche oder nach Antworten, wie es im Leben weitergehen soll. Viele stehen vor Entscheidungen oder wurden durch Lebensentscheidungen anderer in Situationen geworfen, die sie erst einmal verarbeiten müssen.
Und das Verarbeiten von Veränderungen braucht seine Zeit.
Die Mehrzahl der deutschen Pilger wurde meines Wissens durch Hape Kerkeling inspiriert, den Camino Francés zu laufen. An dieser Stelle kann ich nur über mich sprechen und meine Motive darlegen. Ich habe mich schon einige Jahre früher damit beschäftigt und wurde u.a. durch Paulo Coelho und sein Buch „Auf dem Jakobsweg“ angeregt.
Für mich als passionierten Wanderer – meine längste Tour vor dem Jakobsweg war der Rennsteig in Thüringen mit 169 km – galt es immer als eine sportliche Herausforderung und ein Abenteuer, diese 805 km in einem Stück zu bewältigen. Ich wollte wissen, ob ich in der Lage bin, diese sportliche Leistung zu vollbringen.
Mit der Konkretisierung und näheren Planung der Pilgerreise kamen weitere Motive für mich hinzu. Erstens die Natur zu erleben und sich mit der Natur verbunden zu fühlen, zweitens andere Menschen und Gleichgesinnte kennenzulernen, sich über Begegnungen mit Menschen zu freuen und eine gewisse Verbundenheit zu erleben, drittens das Bedürfnis nach Spiritualität und viertens hatte ich noch ein paar persönliche Fragen an das Leben, die ich für mich klären wollte.
Später auf dem Camino haben sich meine Motive durch die Pilgererfahrungen zum Teil noch einmal erweitert. Auf jeden Fall haben mich die Begegnungen mit Menschen aus aller Welt sehr beeindruckt – es sind sogar Freundschaften entstanden – und meine Motive beeinflusst.
Zusätzliche Motive kamen im Laufe der Pilgerfahrt durch die Geschichte des Jakobsweges hinzu. Ich war beeindruckt von der täglich erfahrenen, kulturell und historisch großen Bedeutung des Jakobsweges, d.h. immer mehr über den Jakobsweg zu lernen und zu wissen, dass vor mir seit vielen Jahrhunderten Millionen von Pilger diese Reise unternommen hatten.
Das zog mich in einen gewissen Bann. Dazu gehören u.a. die vielen historischen Stätten wie die Kirchen, Klöster, Hospize, Kapellen und Kathedralen. Auch viele der traditionsreichen Städte und Dörfer in den unterschiedlichen Regionen Spaniens, z.B. in Navarra, Kastilien und Galicien, sind bewundernswert und motivieren, die Strapazen auf dem Jakobsweg zu ertragen und immer weiter zu pilgern.
Zwischen den Motiven der Pilger und der Resilienz besteht natürlich auch ein Zusammenhang. Zum Beispiel laufen viele, um einen schmerzlichen Verlust in der Familie zu verarbeiten, um über Belastungen in ihrem Leben nachdenken wollen oder um für besondere Herausforderungen und Entscheidungen die nötige innere Stärke auf dem Weg zu erlangen.
Ein wichtiger Punkt dabei ist der Abstand zum Alltag, der sich durch das tägliche Gehen einstellt. Auf diese Weise ergeben sich neue Perspektiven, neue Lösungswege und Impulse für die Bewältigung der persönlichen Herausforderungen. Somit gibt der Camino einem die Möglichkeit zum Aufbau der inneren Stärke. Und durch die Erweiterung der Resilienz können die persönlichen Ziele konsequenter erreicht werden.
Darüber hinaus kann das Pilgern selbst, d.h. das einfache Leben als Pilger, die Begegnungen mit Menschen und der Umgang mit den täglichen Anforderungen auf dem Jakobsweg die Resilienz stärken. Diese Möglichkeiten der Stärkung unserer seelischen Widerstandkraft werden in diesem Pilgerbericht aufgezeigt und analysiert.
Vorbereitung
Für die Vorbereitung ist es empfehlenswert, sich ein wenig über die Geschichte des Jakobsweges zu informieren. Kenntnisse über die Geschichte und Bedeutung des Camino Francés können das Erlebnis des Pilgerns verstärken und verschönern. Primär geht es in der Vorbereitung aber natürlich um die Ausrüstung.
In der Literatur, in vielen Pilger- und Reiseführern und im Internet gibt es zahlreiche Listen, was mitzunehmen ist, woran man denken muss etc. Ich möchte hier nur die wichtigsten Dinge ansprechen, die eine gute Planung und Vorbereitung ausmachen.
Jedes Kilogramm weniger erleichtert das Tragen des Rucksacks über die weite Strecke von 800 km. Die Schultern, der Rücken, die Gelenke, die Muskeln, die Knie, die Füße und die Gesamtphysis danken es einem. Ansonsten muss der Körper mit mehr Gewicht fertig werden und u.U. leiden und zusätzliche Schmerzen ertragen.
Der zweite Aspekt für die Vorbereitung ist das Training. Ich habe acht Wochen vor der Pilgerreise mit Wanderungen von 10 bis 20 km begonnen. Jede Woche zweimal trainieren war mein Motto. Das Training hat mir unglaublich viel geholfen, z.B. zu Beginn des Jakobsweges den Aufstieg über die Pyrenäen mit 1600 Höhenmetern und 30 km Länge zu bewältigen.
Außerdem ermöglichte mir das Training, täglich meist Etappen um die 24 km zu laufen. Aber auch Ungeübte können den Camino Francés wandern, wenn sie einigermaßen fit sind. Dann fallen die Tagesetappen eventuell kürzer aus oder es werden mehr Pausentage eingelegt, je nach individuellen Möglichkeiten und Wünschen.
Ein dritter wichtiger Punkt ist die Organisation. Dazu gehört erstens ein guter Pilgerführer mit vielen Adressen von Herbergen und guten Wegbeschreibungen. Mir hat der Führer von Raimond Joos aus dem Outdoor-Verlag sehr gut gefallen und geholfen, mich überall zu orientieren und notwendige wie nützliche Informationen zu erhalten. Es gibt sicherlich noch andere gute Pilgerführer, Apps und digitale Angebote. Da ich diese aber nicht kenne, kann ich keine weiteren Aussagen dazu treffen.
Zu den wichtigen Punkten der Organisation gehören nach meinen Erfahrungen außerdem die Beschäftigung mit der Anreise, die Frage der Übernachtungen, die Überlegung eines Gepäcktransportes, der unterwegs in den Herbergen individuell buchbar ist, das Thema Essen/Proviant und das Thema Wanderstöcke.
Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Anreise (Bus, Bahn, Flugzeug) sind je nach Geldbeutel, Zeit und Präferenz in den einschlägigen Pilgerführern beschrieben. Die Frage der Übernachtung ist schon etwas schwieriger. Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Arten von Herbergen (Refugios) sowie die klassischen Privatunterkünfte in Hotels und Pensionen. Letztere aber nicht überall. Die Herbergen gibt es in fast jedem kleinen Ort und im Abstand von meistens 5 – 7 km bis auf wenige Ausnahmen auf der gesamten Strecke.
Ich musste aber erst einmal lernen, um welche Art von Herberge es sich handelt. Zunächst gibt es die öffentlichen, von den Gemeinden und Städten betriebenen Refugios. Diese können meist nicht reserviert werden. Das heißt, um hier einen Übernachtungsplatz für ca. 10 Euro zu ergattern, muss man zeitig eintreffen. Das bedeutet wiederum im Frühjahr/Sommer, dass man morgens zwischen 6 und 7 Uhr starten muss, damit man nach einer durchschnittlichen Etappe von ca. 6 Std. und ca. 25 km in der Mittagszeit ankommt. Danach füllen sich die Plätze in den Schlafsälen sehr schnell und die später Eintreffenden gehen leer aus.
Als zweites gibt es die privaten Herbergen, die sich telefonisch meistens reservieren lassen. Somit ist die Ankunft auch später möglich. Bei den privaten gibt es zum einen die vielen Privatpersonen, die Quartiere in Form einer Herberge anbieten und sich hinsichtlich der Qualität unterschiedlich stark engagieren und zum anderen ein paar Vereine, die mit freiwilligen Hospitaleros die Herbergen sehr engagiert betreiben, z.B. die „Paderborner Herberge“ in Pamplona oder der Stuttgarter Verein „Ultreia“, der in Galicien in La Faba eine Herberge unterhält.
Als drittes gibt es noch die kirchlichen Herbergen, die auch größtenteils Reservierungen annehmen und in der Regel sauber und gut in Schuss sind.
Doch in einer Herberge zu nächtigen ist nicht für jeden Menschen etwas. Ich erinnere mich immer wieder ungern an die mit 4 – 9 Etagenbetten oder mehr ausgestatteten Schlafsäle, in denen wenig Ruhe einkehrt und keine Privatsphäre herrscht. Selbst mit guten Ohropax bin ich durch entsetzliches Schnarchen am Schlafen gehindert worden, so dass ich mich entschied, überwiegend in privaten Pensionen und kleinen Hotels zu übernachten.
Eine gute Nachtruhe mit ausreichend Schlaf und gutes Essen sind die zwei wichtigsten Grundvoraussetzungen für die Bewältigung der täglichen körperlichen wie mentalen Herausforderungen des Pilgerns.
Eine gewisse Planung für die Mitnahme von guter Kost ist deshalb auch ratsam. Bananen und ausreichend Wasser sind wichtig. Weitere Verpflegung nach Gusto wie z.B. Obst, Nüsse oder Käsebrote. Auf dem Weg gibt es auch meistens zahlreiche Cafés und Bars, in denen Salate, Bocadillos (belegte Brötchen), Kuchen, Omelette, frisch gepresster Orangensaft und andere Leckereien meist zu günstigen Preisen angeboten werden.
Abends gibt es in den Bars und Herbergen fast immer ein Pilgermenu, das in der Regel aber sehr einseitig ist und aus Pommes Frites und nicht hochwertigem Fleisch besteht, ggf. ist noch etwas Salat dabei. Besser ist es, gemischten Salat zu bestellen, Fisch und andere gesunde Kost.
Abschließend ein Wort zum Thema Wanderstöcke. Ich habe es mir angewöhnt, bei längeren Touren einen Stock aus dem Wald zu holen und meinen Schritten Unterstützung zu geben. Beim Bergauf- und Bergabgehen ist eine deutliche Entlastung durch einen Wanderstock zu spüren. Auf der anderen Seite muss man ein zusätzliches Gewicht tragen. Und die meisten Etappen des Camino Francés sind Flachetappen, auf denen man nicht unbedingt einen Wanderstock braucht.
Ich habe mir vor Beginn der Reise Wanderstöcke ausgeliehen und sie ausgiebig nach dem Motto „eins, zwei oder keins“ getestet. Letztendlich habe ich mich aufgrund des Gewichts und der Stabilität dazu entschieden, nur einen Nordic-Walking-Stock eines Qualitätsherstellers mitzunehmen. Den typisch kultigen Pilgerstab gibt es natürlich auch, zum Beispiel in einem der Touristenläden am Startort in Saint-Jean-Pied-de-Port. Dort gibt es auch die gegen Regen gut schützende Pellerine, einen Umhang. Doch eine gute Regenhose und -jacke tun es auch.
4. Anreise, innere Stärke und Ankunft am Startort
Das Jakobstor in Saint-Jean-Pied-de-Port, Ankunftsort der Pilger aus Nord-Frankreich
Anreise
Für die Anreise wähle ich eine Flugreise von Hamburg nach Bordeaux. Nach der Ankunft in Bordeaux und einer Zwischenübernachtung geht es am nächsten Tag, am 26. April, weiter mit dem Zug Richtung Süden nach Bayonne.
Im Zug lerne ich die ersten Pilger kennen, Natascha und François, ein Pärchen in meinem Alter aus Quebec in Kanada. Sie spricht nur Französisch, er außerdem noch Englisch. Zum Glück kann ich mich in beiden Sprachen ganz gut verständigen. So entwickelt sich eine witzige Unterhaltung zwischen uns. Ich wechsle lustig zwischen den beiden Sprachen hin und her. Wenn François mich auf Englisch etwas fragt und ich auf Englisch antworte, übersetzt Francois es für seine Frau ins Französische. Und wenn Natascha auf Französisch fragt, antworte ich auf Französisch. Der Sprachwechsel verläuft wie ein Ping-Pong-Spiel und amüsiert uns sehr.
Leider verlieren wir uns auf dem Bahnhof in Bayonne aus den Augen, weil es hier sehr voll ist, wie auf einem internationalen Flughafen und es für den nächsten Zug nach Saint-Jean-Pied-de-Port nur 5 Min. Umsteigezeit gibt. Als ich in diesen Zug einsteige, will ich am liebsten gleich wieder raus. Er ist voller Pilger mit vielen Amerikanern, Asiaten und Europäern - unglaublich. Zum Glück kann ich noch einen Platz an einem Vierertisch ergattern, nachdem ich eine Pilgerin gebeten hatte, ihren Rucksack vom Sitz zu nehmen und ins Gepäcknetz zu legen.
Im Zug eng gequetscht rollen wir unserem Bestimmungsort entgegen. Am Tisch mir gegenüber sitzt eine Amerikanerin, die ich gleich nervig finde. Auf dem Tisch vor ihr liegt eine große Tüte Chips mit einer streng riechenden, Ekel erregenden Geschmacksrichtung, die sie genüsslich in sich reinzieht. Ich halte das nicht aus, ärgere mich und verwünsche sie zurück in ihre Heimat.
Doch später habe ich sie auf dem Camino noch ein paar Mal wiedergesehen, auch in Begleitung eines gut aussehenden jungen Franzosen. Doch davon an anderer Stelle mehr.
Innere Stärke – Hinweise zur Resilienz
Aus Sicht der Resilienz liegen in diesen ersten Erfahrungen schon vier Anhaltspunkte für das Training der inneren Stärke. Erstens die Bereitschaft, andere Pilger kennen zu lernen, zu grüßen, sich vorzustellen und mit ihnen zu kommunizieren, ermöglicht im Sinne der Resilienz, ein Netzwerk aufzubauen und diese Kontakte zu nutzen. Durch den Austausch mit anderen erhält der Pilger wichtige Informationen und Unterstützung. Er weiß sich in Gemeinschaft und kann ggf. Hilfe erhalten.
Soziale Unterstützung zum einen und soziale Kompetenz zum anderen sind wichtige Punkte für die innere Stärke. Deshalb empfiehlt es sich beim Pilgern, aufgeschlossen zu sein und offen für Kontakte und Gespräche mit Pilgern, die einem sympathisch erscheinen. Dies gilt natürlich nicht nur auf der Pilgerreise, sondern auch in unserem Alltag bezogen auf Menschen unseres Umfelds.
Zweitens der Humor. Er gehört zum Bereich der Eigenverantwortung. Wenn wir humorvoll, witzig oder lustig sind, löst sich die Anspannung und es stellt sich gute Laune ein. Ohne Humor geht es nicht im Leben. Wir geben uns Raum für lustige Ideen, werden kreativ und befreien uns vom Druck, etwas Bestimmtes darstellen oder leisten zu müssen.
Wir sind selbstwirksam, denn wir merken, dass wir Situationen positiv beeinflussen können. Durch Humor erleben wir positive Emotionen, sind gelöst, entspannen uns und stärken unsere Nerven. Stress wird abgebaut, und es macht einfach Spaß und Freude zu lachen. Die gute Stimmung aus der Situation überträgt sich auf unser Gemüt und macht das Leben leichter.
Drittens, meine Überraschung und Enttäuschung im Zug, dass dieser mit so vielen Pilgern überfüllt war, ist allein der Tatsache geschuldet, dass ich mich vorher nicht richtig informiert hatte und falschen Erwartungen nachhing. Natürlich ist der Camino Francés in Nordspanien nicht für kontemplative Einzelgänger geeignet. Ehrlich gesagt gleicht dieser Weg meinem Eindruck nach auf vielen Etappen einer touristischen Massenveranstaltung.
Auf der zweiten Tagesetappe erfuhr ich, dass es im Frühling und Sommer Tage gibt, an denen ca. 400 Pilger den Camino beginnen. Ist das nicht irre? Wie soll ein Mensch da noch zur Ruhe kommen, nachdenken, Gott oder etwas Spirituelles erleben können? Hätte ich meine Erwartungen ein wenig heruntergeschraubt, wäre mir diese erste Enttäuschung auf dem Jakobsweg erspart geblieben.





























