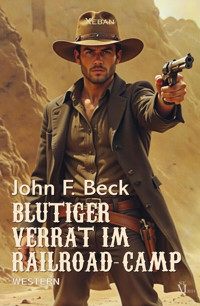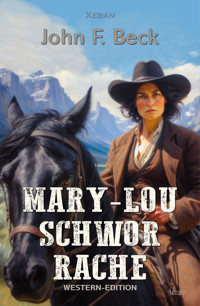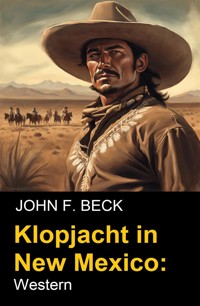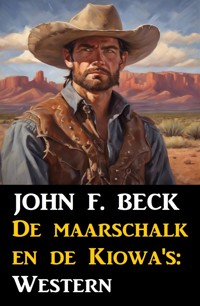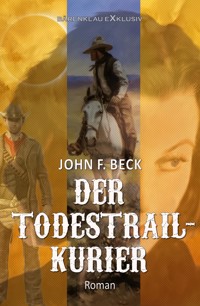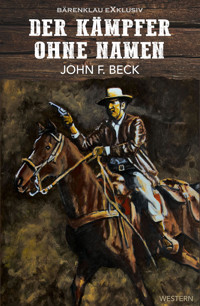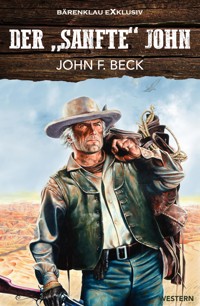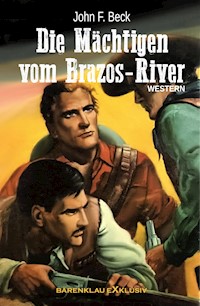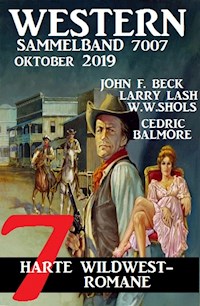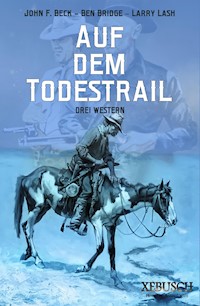
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Xebusch-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält eine kleine Auswahl unserer besten Romane beliebter Autoren der Edition Bärenklau & Bärenklau Exklusiv.
Klassiker, wiederentdeckte Kleinode der großen Westernautoren in einem Band auf 350 Seiten.
Zu »Der Todestrail-Kurier«: Ein Pony Express Reiter muss hart und tough sein. Der junge Clint Randall erfüllt alle Voraussetzungen für den Job, und er liebt ihn. Doch auf ihn wartet eine besonders harte Prüfung. Von wilden Indianern und von skrupellosen weißen Banditen gejagt und erfüllt von einem ehernen Pflichtgefühl, reitet Randall wie der Teufel. Aber dann gerät er auch noch in einen schrecklichen, falschen Verdacht. Wird es ihm gelingen, sich reinzuwaschen und das Leben seiner geliebten Susan zu retten?
In diesem Band sind folgende Westernromane enthalten:
› Der Todestrail-Kurier – von John F. Beck
› Trail in die Apacheria – von Ben Bridge
› Sein Gefährlichster Auftrag – von Larry Lash
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
John F. Beck / Ben Bridge / Larry Lash
Auf dem Todestrail
3 knallharte Western
Impressum
Copyright © by Authors/Xebusch-Verlag
Cover: © by Steve Mayer, 2022
Verlag: Xebusch. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Auf dem Todestrail
Der Todestrail-Kurier
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Trail in die Apacheria
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Sein gefährlichster Auftrag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Weitere Western-Anthologien sind erhältlich:
Das Buch
Dieser Band enthält eine kleine Auswahl unserer besten Romane beliebter Autoren der Edition Bärenklau & Bärenklau Exklusiv.
Klassiker, wiederentdeckte Kleinode der großen Westernautoren in einem Band auf über 380 Seiten.
Zu »Der Todestrail-Kurier«: Ein Pony Express Reiter muss hart und tough sein. Der junge Clint Randall erfüllt alle Voraussetzungen für den Job, und er liebt ihn. Doch auf ihn wartet eine besonders harte Prüfung. Von wilden Indianern und von skrupellosen weißen Banditen gejagt und erfüllt von einem ehernen Pflichtgefühl, reitet Randall wie der Teufel. Aber dann gerät er auch noch in einen schrecklichen, falschen Verdacht. Wird es ihm gelingen, sich reinzuwaschen und das Leben seiner geliebten Susan zu retten?
In diesem Band sind folgende Westernromane enthalten:
› Der Todestrail-Kurier – von John F. Beck
› Trail in die Apacheria – von Ben Bridge
› Sein Gefährlichster Auftrag – von Larry Lash
***
Auf dem Todestrail
3 knallharte Western
von John F. Beck, Ben Bridge und Larry Lash
Der Todestrail-Kurier
von John F. Beck
1. Kapitel
Der bärtige Prospektor trug einen blutgetränkten Kopfverband. »Wenn du weiterreitest, mein Junge, schaffst du keine zehn Meilen! Sie werden dich ebenso erwischen, wie sie droben am Battle Creek meinen Partner erledigt haben!« Sein Gesicht war noch von dem Grauen gezeichnet, das hinter ihm lag. Keuchend wies er mit seiner Sharps auf den pfeilgespickten Packsattel neben den erschöpfen Maultieren, die beim Ziehbrunnen standen. »Sie waren zwei Tage und zwei Nächte hinter mir her. Zwischen hier und Carson City wimmelte es von aufständischen Rothäuten. Da kommt kein Weißer mehr durch.« Der von den Pferdehufen aufgewirbelte Staub hing noch über der einsamen Station. Der junge Mann, an den der Bärtige sich gewandt hatte, schraubte den Verschluss seiner Wasserflasche zu. Er war mittelgroß, schlank und drahtig. Blondes Haar ringelte sich unter seinem breitkrempigen Hut hervor. Der weißgraue Staub der Alkalihochebene von Nevada bedeckte das schmale Gesicht und die einfache Reitertracht. Die Bewegungen des Jungen waren geschmeidig und zielstrebig. Seine blauen Augen blickten furchtlos.
Er nahm die Mochila, eine aus mehreren getrennten Boxen bestehende lederne Posttasche vom Sattel des Pferdes, auf dem er eben gekommen war. Der Stationshalter hatte schon ein frisches Sattelpferd bereitgestellt. Auf dessen Rücken schwang der Blonde nun die Mochila. Danach überprüfte er die Trommel seines 36er Navy Colts.
»Vielen Dank für die Warnung, Mister!«, nickte er dem Erzsucher zu. Und mit zum Abschied erhobener Hand zum Stationshalter: »Bis morgen, Ben! Drück mir die Daumen!«
Er landete mit einem gekonnten Sprung, ohne die Steigbügel zu benutzen, auf dem frischen Pony. Ein schriller Ruf, ein paar Fersenstöße gegen die Weichen, und schon galoppierte das Tier davon.
Der vor den Indianern geflüchtete Goldgräber konnte gerade noch zur Seite springen. Staub hüllte die niedrigen Gebäude ein. Als er sich verzog, war der Reiter nur mehr ein Punkt auf einer schon ziemlich weit entfernten Bodenwelle. Die Hitzeschleier schienen ihn aufzusaugen.
Das Trommeln der Hufe verhallte. Kopfschüttelnd wandte sich der Prospektor an den Stationer.
»Ich hab ja schon gehört, dass diese Burschen vom Pony Express wahre Teufelskerle sein sollen. Aber für die Paiutes wird er nur ein Weißer mehr sein, den sie wie ’nen Hasen jagen. Sie hätten ihn nicht reiten lassen dürfen, Harper.«
Harper hob die knochigen Schultern an. »Den kann nur eine gutgezielte Kugel stoppen! Für den und die anderen Jungs vom Pony Express ist der Wahlspruch von Russell, Majors und Waddell so was wie ein Gesetz, das um jeden Preis erfüllt werden muss. Die Post muss durch! Dafür reiten sie. Und es hat bis jetzt auch noch jedes Mal geklappt.«
»Bis jetzt waren die Paiutes auch nicht auf dem Kriegspfad«, brummte der Bärtige. »Nein, Harper, ich bin sicher, Sie sehen diesen verrückten Jungen nie wieder! Nicht lebend jedenfalls! Wie heißt er übrigens?«
»Clint Randall. Wieso?«
Der Prospektor spuckte in den heißen Staub. »Sie sollten den Namen zur Warnung für alle, die nach ihm kommen, auf ein Kreuz schreiben, Harper, und daruntersetzen: Gestorben für den Pony Express!«
2. Kapitel
Acht Meilen westlich der Whitehorse Station waren sie plötzlich da. Sie hielten auf dem salbeibedeckten Kamm eines langgestreckten Hügels. Viel zu nahe, dass Clint Randall noch eine Chance hatte, sein zähes Pony aus der Reichweite ihrer einschüssigen Gewehre zu manövrieren.
Sie waren zu dritt. Bronzehäutige, nur mit Lendenschurz und Mokassins bekleidete Krieger auf scheckigen Mustangs. Zwei mit erbeuteten Gewehren, einer mit Pfeil und Bogen bewaffnet. An ihren Gürteln hingen außerdem Tomahawk und Messer. Bunte Stirnbänder hielten ihr strähniges Haar. Wahrscheinlich waren es Späher, die zu einem der Kriegstrupps gehörten, die nach dem großen Council am Pyramid Lake das dünnbesiedelte Land auf der Skalpjagd durchstreiften. Sie waren jäh zur gefährlichen Bewährungsprobe für die erst Wochen zuvor gegründete Postreiterverbindung zwischen St. Joseph am Missouri und San Francisco am Pazifischen Ozean geworden.
Ein halber Kontinent lag zwischen diesen Städten. Eine Wildnis wogender Prärien, schroffer Gebirgszüge und wasserloser Wüsten, die von den Stafettenreitern der Firma Russell, Majors and Waddell in knappen zehn Tagen durchquert wurde. Für Clint Randall sah es nun jedoch so aus, als sei das Ende seines Trails bereits hier, acht Meilen westlich von Ben Harpers Whitehorse Station, gekommen.
Clints Brauner war diese Strecke in stetigem Tempo dahingejagt. Sein Fell war noch so trocken wie am Anfang. Seine kräftigen Lungen pumpten mit der Gleichmäßigkeit eines Blasebalgs. Nicht umsonst besaß der Pony Express die besten fünfhundert Pferde, die zwischen dem Old Man River und der Pazifikküste aufzutreiben gewesen waren. Pferde, die mit besonderem Kraftfutter verpflegt wurden und von denen es hieß, dass sie mühelos jedem nur von Gras ernährtem Indianermustang davonliefen.
Nur – solange zwei Gewehre und ein auf der Sehne hegender Pfeil den jungen Expressreiter bedrohten, war das kein Trumpf für ihn. Das Land um ihn war deckungslos. Zwischen Whitehorse und der nächsten Station am Simpson Rock gab es keinen Menschen, auf dessen Hilfe er rechnen konnte. Er stoppte.
Mit zusammengebissenen Zähnen blickte er starr auf die drei Paiute Krieger.
Ihre Gesichter wirkten steinern, als sie ihre Mustangs den Hang herabtrieben. Staubwölkchen wallten unter den dumpf pochenden Hufen empor. Es waren junge, kräftig gebaute Krieger, der Jüngste etwa so alt wie Clint, achtzehn im Höchstfall. Clints Brauner schnaubte nervös. Der Geruch von ranzigem Bärenfett, mit dem die Indianer ihre nackten Oberkörper eingerieben hatten, behagte ihm offenbar nicht. Clint hatte einen Kloß in der Kehle.
Sein Colt hing mit dem Kolben nach vorn an seiner linken Hüfte. Aber er wusste, dass er ein toter Mann war, wenn er jetzt die Hand nur in die Nähe der Waffe brachte. Die beiden Gewehrmündungen starrten ihn wie Todesaugen an. Der dritte Paiute ließ den Kriegsbogen sinken, als Clint wie versteinert im Sattel verharrte und die Stunde verwünschte, in der auf die Idee gekommen war, sich im Office von William H. Russell als Pony-Express-Reiter zu bewerben.
Sie kamen bis auf vier Schritte heran. Als sie die dicken Schweißtropfen auf seiner Stirn bemerkten, begannen sie zu grinsen. Clints Gedanken rasten. Bevor er etwas unternehmen konnte, trieb der Krieger mit der Kette aus Grizzlyzähnen seinen Pinto noch näher. Mit der Sharpsmündung schob er Clints Stetson nach hinten. Clints weizenblondes Haar leuchtete in der Sonne.
»Guter Skalp.« Der dünne Mund des Indianers verzog sich zu einem noch breiteren Grinsen. »Wie Skalp von Squaw …« Er schaute sich nach seinen Begleitern um. Alle drei lachten kehlig.
»Hört zu, Freunde«, keuchte Clint. »Ihr habt das Kriegsbeil ausgegraben, um eure Jagdgründe zurückzuerobern, auf denen sich die weißen Gold und Silbersucher angesiedelt haben. Ich bin keiner von denen! Ich will kein Krümchen von eurem Land, nur …«
Er verstummte, als er den Stahl der Sharpsmündung an der Kehle spürte. Die Augen des Kriegers glühten wie Kohlen.
»Kein Bleichgesicht Freund von Paiute. Du reden aus Angst vor Skalpmesser, Gelbhaar. Du Feigling.«
Sie lachten wieder. Der mit der Grizzlyzahnkette ließ das Gewehr sinken. Clint las sein Todesurteil in den Augen des Mannes. Er presste die Lippen zusammen. Jedes weitere Wort war vergeudet. Es gab nur mehr eines: den Colt ziehen, schießen und sterben! Wochenlang hatte Clint mit der Waffe geübt, aber noch nie auf einen Menschen geschossen. Der Pony Express war für ihn das große Abenteuer gewesen. Es hatte ihn mit Stolz erfüllt, zu denen zu gehören, die an der großartigen Leistung teilhatten, einen halben unbesiedelten Kontinent zu Pferd zu überbrücken. Nun, den Tod vor Augen, besaß das alles eine ganz andere Bedeutung. Ja, er hatte Angst. Die Indianer sahen es. Sie weideten sich daran. Und genau das war die Chance.
»Du Ponyreiter«, stellte der Anführer in seinem gebrochenen Englisch fest. »Du viel schnell auf Pferd. Du zeigen, wie schnell du auf Füßen. Du laufen, Gelbhaar! Wenn du schnell genug, behalten Skalp …« Grausamer Spott funkelte in seinen Augen.
Clint ballte die Fäuste. »Geh zum Teufel!«, knirschte er in jähem verzweifeltem Zorn. »Wenn ihr mich töten wollt, tut es gleich!«
Der Lauf der Sharps zuckte. Clint brachte gerade noch den Kopf zur Seite. Der Schlag erwischte seine linke Schulter mit einer Wucht, die ihn vom Pferd schleuderte. Heftiger Schmerz durchglühte ihn. Für Sekunden war er unfähig, sich zu bewegen.
Hufe stampften neben ihm. Wie von weither kam wieder die gutturale Stimme des Paiute. »Du laufen, Gelbhaar!«
Clint wälzte sich mühsam herum. Seine vom Körper verdeckte Rechte umschloss den Kolben des Navy Colts. In der Drehung riss er die Waffe unter der fransenbesetzten Antilopenlederjacke hervor. Er lag auf der linken, noch wie gelähmten Schulter, als er schoss.
Die Kugel traf den Anführer der Kundschafter mitten in die Stirn. In der hitzegesättigten Stille, die wie ein Panzer auf dem öden Land lag, klang das Krachen der Detonation wie ein Kanonenschuss. Clint stemmte sich rasch auf die .Knie, sah das Gewehr an der Schulter des zweiten Kriegers und feuerte nochmals. Der Paiute sank lautlos nach vorn auf den Pferdehals. Als der Mustang erschreckt zur Seite tänzelte, stürzte er leblos herab.
Clints Sechsschüsser war bereits ein Stück nach links geschwenkt. Die qualmende Mündung deutete auf den jüngsten Krieger, der keine Zeit mehr gefunden hatte, die Bogensehne erneut zu spannen. Die Hufe seines braunweiß gefleckten Pferdes waren wie am Boden festgeklebt. Clint und der Indianer starrten sich an.
Für die Länge eines Atemzugs flackerte die Angst in den Augen des Roten, nun ebenfalls von Clints tödlichem Blei vom Pferd gefegt zu werden. Dann versteinerte seine Miene, seine Schultern spannten sich. Clint stemmte sich hoch. Sein Finger blieb am Abzug. Mit einer heftigen Bewegung, die zeigen sollte, wie wenig er den Tod fürchtete, warf der Paiute den Bogen weg.
Dann rief er Clint etwas in seiner Stammessprache zu. Eine wilde, aber auch verzweifelte Herausforderung war in seiner Stimme. Als Clint nicht reagierte, drehte er halb den Kopf und spuckte aus. Die Hitze kam Clint auf einmal noch viel drückender vor. Der Geruch des Pulverrauchs, der noch in der stickigen Luft hing, erfüllte ihn mit Ekel.
»Hau ab!«, schrie er. »Spiel nicht den Helden, du Narr!«
In den Augen des jungen Indianers war Verständnislosigkeit. Misstrauisch zog er seinen Pinto mit gestrafften Zügeln mehrere Yards rückwärts. Er wagte nicht, Clint den Rücken zuzukehren. Erst als der Expressreiter seinen Colt halfterte, warf er jäh seinen Pinto herum und preschte davon. In einer Staubwolke verschwand er über dem Höhenkamm, auf dem die Paiutes zuvor so unvermittelt dem Weißen den Weg versperrt hatten.
Clint wusste, dass es jetzt nur mehr eine Frage der Zeit war, bis der Haupttrupp, zu dem der Krieger gehörte, seiner Fährte folgte. Aber er hatte einfach nicht auf den wehrlosen Gegner schießen können. Benommen stolperte er zu seinem Pferd. Sein Blick mied die beiden Toten, die zwischen den dürren Grasbüscheln lagen. Seine Knie zitterten. Eine Weile musste er sich am Sattelknauf festhalten. Er dachte flüchtig an die Bibel in der Satteltasche. Mister Majors hatte darauf bestanden, dass sie zur Ausrüstung jedes Expressreiters ebenso gehörte wie die Ersatztrommel für den Navy Colt.
Stattdessen griff Clint nun lieber zur Wasserflasche. Er trank, um den bitteren Geschmack in seiner Mundhöhle loszuwerden. Danach fühlte er sich ein wenig besser. Er hatte zum ersten Mal um sein Leben gekämpft. Und er würde es wieder tun, wenn man ihn dazu zwang.
Sein Ritt war kein prickelndes Abenteuer mehr, sondern eine Frage des Überlebens. Er schwang sich in den Sattel. Es wäre sinnlos gewesen, die Toten ohne Werkzeug begraben zu wollen. Die Stammesgefährten würden sich um sie kümmern – und um ihn! Clint spähte aus zusammengekniffenen Augen in die flimmernde Dunstschicht am westlichen Horizont.
Noch zwölf Meilen waren es zur Station am Simpson Rock. Dort würde er ein frisches Pferd für die letzte Tagesetappe zur Cold Spring Station übernehmen. Bereits eine halbe Stunde später entdeckte er die Staubwolke auf seiner Spur. Vor dem wolkenlosen Nevadahimmel wuchs sie rasch höher.
3. Kapitel
Die Staubwolke war auch noch da, als Clint Randall nach einem Nonstop-Galopp von zwölf Meilen den Simpson Rock erreichte. Doch von den Gebäuden am Fuß des rotschimmernden Felsmassivs waren nur mehr die rußgeschwärzten Lehmziegelmauern übrig. Rauch schwelte über den eingestürzten Trümmern. Die Korralzäune waren niedergerissen, die Pferde fort. Die skalpierten, blutüberströmten Leichen des Stationers und seines dunkelhäutigen Stallhelfers waren mit Stricken an vom Feuer versengte Pfosten gebunden.
Die Angst sprang Clint plötzlich wieder an. Aber es war nicht so sehr die Furcht um die eigene Haut, sondern die Besorgnis, dass es achtzehn Meilen westlich von hier auf der Cold Spring Station vielleicht schon ebenso aussah. Der alte Sam Jefford lebte dort ganz allein mit seiner Tochter. Nicht auszudenken, wenn die Paiutes sein Anwesen bereits ebenfalls gestürmt hatten, und Susan ihnen in die Hände gefallen war!
Hier konnte Clint nicht mehr tun, als die Toten losschneiden und sie mit einer steinbeschwerten Decke vor den am Himmel aufgetauchten Bussarden schützen. Zum Glück hatten die Paiutes weder den Brunnen zerstört noch das Wasser vergiftet. Clint kurbelte für den Braunen einen vollen Eimer herauf. Wenn er den Kopf nach Osten wandte, sah er die weißliche Staubwolke über einer der Station vorgelagerten Bodenwelle.
Die Sonne stand schon weit im Westen. Immer noch war es drückend heiß. Clint ließ das Pferd nicht zu viel saufen. Mit einem wassergefüllten Bauch würde es nicht mehr weit traben.
Das Tier war die ganze Strecke von der Whitehorse Station bis hierher wie eine gutgeölte Maschine gelaufen. Wenn es die nötige Ruhepause erhielt, würde es noch eine Menge Meilen durchhalten. Clint konnte ihm jedoch höchstens fünf Minuten zum Verschnaufen gönnen. Vielleicht war das schon zu viel. Denn seine Verfolger schienen entschlossen, das Letzte aus ihren Mustangs herauszuholen. Immerhin hatte er zwei Krieger getötet. Dass er dem dritten das Leben geschenkt hatte, zählte nicht. Sie würden es ihm als Schwäche auslegen und nicht ruhen, bis sie seinen Skalp hatten. Vielleicht war es sogar dieselbe Horde, die hier mit Tomahawk und Feuer so grausam gewütet hatte. Diese Überlegung weckte kalten Zorn in Clint.
Zugleich fühlte er sich einsamer und verlorener denn je. Wer mochte sagen, ob es zwischen den Ausläufern der Ruby Mountains und Carson City überhaupt noch eine unzerstörte Relaisstation gab! Wenn nicht, dann bedeutete dies, dass der Pony Express zu bestehen aufgehört hatte – nur Wochen, nachdem der erste Reiter am 3. April dieses Jahres 1860 aus St. Joseph am Missouri westwärts davongaloppiert war. Dann war das verwegene Postreiter-Unternehmen im Chaos eines blutigen Indianeraufstandes gescheitert.
Für Clint hatte damals alles mit einem der Plakate begonnen, die überall in den Siedlungen und Forts am Missouri die Bewerber anlockten. Der Text hatte sich ihm unauslöschlich eingeprägt.
»Junge, drahtige Burschen gesucht.
Nicht über achtzehn Jahre alt. Sie müssen erfahrene Reiter und bereit sein, ihr Leben täglich zu riskieren. Waisen werden bevorzugt. Lohn 25 Dollar pro Woche. Bewerbungen an Pony-Express-Gesellschaft, St. Joseph, Missouri.«
Clint rieb seinem Braunen den Schweiß und Staub aus dem Fell. Er musste etwas tun. Er konnte sich jetzt nicht irgendwo im Schatten ausstrecken, die Augen schließen und Kräfte sammeln, während der Tod von Osten auf seiner Fährte heranjagte. Immer wieder musste er dabei an Sam Jeffords Tochter denken.
Es wurden die längsten fünf Minuten, die Clint bisher erlebt hatte. Die Zeiger auf dem in der Sonne glänzenden Zifferblatt seiner Taschenuhr schienen sich nicht vom Fleck zu bewegen. Diese Uhr war das einzige Andenken an seine Eltern, die vor Jahren auf dem Trail nach Oregon verschollen waren. Clint hatte früh lernen müssen, auf eigenen Füßen zu stehen. Vielleicht war das mit ein Grund gewesen, dass William H. Russell seinen Namen in die Liste der Pony-Express-Kuriere aufgenommen hatte.
Nicht die Nerven verlieren, redete Clint sich ein, als das Pferd versorgt und noch immer eine Minute Zeit war. Alles würde nun von der Schnelligkeit und Ausdauer des Braunen abhängen und davon, dass es die Cold Spring Station noch gab!
Russell, Majors und Waddell hatten die Expressroute in insgesamt 190 Stationen unterteilt. Davon waren 165 sogenannte »Swing Stations«, wo lediglich die Pferde gewechselt wurden. Die »Home Stations« waren die Endpunkte der jeweiligen Tagesstrecke eines Kuriers. Dort wurden die Männer verpflegt, dort hatten sie ihre Nachtquartiere. Je nach Beschaffenheit des Geländes lagen diese »Heimstationen« siebzig bis hundert Meilen auseinander.
Clints Etappenziel war an diesem Tag Sam Jeffords Cold Spring Station, von der er am nächsten Tag mit der Gegenpost aus Fort Churchill zur Ruby Mountain Station zurückkehren sollte. Dazwischen lag »sein« Trail, an dem er jeden Strauch und Felsen kannte.
Auf die Sekunde genau war er nun wieder im Sattel. Er tätschelte dem Pferd den Hals.
»Nun zeig mal, was du kannst, Fellow. Lass deine Hufe fliegen!«
Die Staubwolke war inzwischen so nahe, dass Clint im Schein der weit im Westen stehenden Sonne die dunklen Reitergestalten in ihr erkannte. Es war mindestens ein Dutzend Krieger, die Jagd auf ihn machten. Sie entdeckten ihn sofort, als er tief auf das Pferd geduckt aus dem Schatten des Simpson Rock preschte. Auf dem von unzähligen Hufen gehämmerten Trail, der sich wie ein Faden über die gigantische Entfernung von eintausendneunhundertfünfzig Meilen hinzog, jagte er nach Westen.
Niedrige, mit Fettholzstauden und Salbeigestrüpp bewachsene Hügelwellen nahmen den einsamen Reiter auf. Eine minutenlang in der unbewegten heißen Luft hängende Staubfahne markierte seinen Weg. Es war ein Land, in dem kein Gejagter sich verstecken konnte. Erst drüben bei Cold Springs, wo die Ausläufer der Shoshone Mountains den Trail berührten, wurde das Gelände rauer.
Clints Brauner hielt das Tempo eine Stunde. Dann waren seine Flanken schweißbedeckt, die Hufe kamen immer häufiger aus dem Tritt, gelblicher Schaum tropfte von den Nüstern. Clint spähte zurück. Die verdammte Staubwolke war schon so nahe über den Kämmen, dass er das Hämmern der vielen unbeschlagenen Hufe zu hören glaubte. Aber es war nur sein eigener heftiger Herzschlag. Das Blut rauschte in seinen Ohren. Hemd und Jacke klebten ihm auf der Haut.
Er hielt, sprang ab und nahm sich nur so viel Zeit, dem Pferd mit dem wassergetränkten Halstuch die Nüstern auszuwaschen. »Du schaffst das schon, Fellow, du musst es einfach schaffen!«, redete er dem Tier gut zu. Dann war er wieder unterwegs.
Der Braune schien zu ahnen, um was es ging. Er gab sein Bestes. Clint hörte nicht auf, das Pferd zu loben und es anzufeuern. Alle paar Minuten verlagerte er sein Gewicht im Sattel, um dem Tier das Wettrennen mit dem Tod zu erleichtern.
Clints Muskeln schmerzten, sein Gesäß brannte, seine Beine wurden steif. Jeden Tag achtzig Meilen zwischen der Ruby Mountain Station und Cold Spring. Zwölf Stunden im Sattel. Das war knochenbrechender Alltag beim Pony Express, auch ohne eine Meute rachsüchtiger Paiutes im Nacken.
Die Sonne stand nur mehr wenige Handbreit über dem westlichen Horizont, als die Spitzen von zwei Felstürmen über den Kammlinien vor Clint auftauchten. Sie markierten die Senke von Cold Spring. Vier Meilen noch. Kein Rauch, der Tod und Vernichtung hieß. Doch die Erleichterung darüber zerfloss, als Clint einfiel, dass Jefford die Balken, aus denen sein Stationshaus gezimmert war, mit Kupfervitriol getränkt hatte, damit sie nicht brennen konnten.
Das Pferd war jetzt so erledigt, dass Clint jede Minute bereit war, rechtzeitig abzuspringen, damit es ihn beim Sturz nicht unter sich begrub. Aber es hielt durch. Die Felstürme ragten höher und höher vor Clint empor. Kein Rauch und auch keine kreisenden Aasvögel!
Neue Hoffnung durchpulste Clint. Eine Meile noch, dann würde die Senke mit der Quelle, dem Tümpel und Jeffords Blockhütten unter ihm liegen. Eine Meile, die er notfalls auch zu Fuß schaffen konnte, mit dem Colt in der Faust, bevor die Verfolger ihn einkreisten.
Da hörte er die Schüsse.
Es war das dumpfe Dröhnen schwerkalibriger Gewehre, das von der Cold Spring Station zu ihm trieb. Die Fetzen schrillen Geschreis vermischten sich darunter. Clint ruckte an den Zügeln. Alle Farbe wich aus seinem Gesicht.
Die Paiutes waren da! In den Hügeln vor ihm wurde erbittert gekämpft!
4. Kapitel
Die Stille nach dem plötzlichen infernalischen Lärm zerrte an Clints Nerven. Er war auf das Schlimmste gefasst, als er vorsichtig die dichtbelaubten Zweige eines Wacholderstrauchs auseinanderbog. Das Erste, was er sah, war die massiv gezimmerte Blockhütte. Die Bohlenläden, in denen Schießscharten klafften, waren geschlossen. Pfeile steckten in den feuerfest imprägnierten Balken. In die von innen verriegelte Blockhaustür hatte sich eine federverzierte Lanze gebohrt. Der Stahl eines Gewehrlaufs schimmerte in einer der Schießscharten. Clint atmete unwillkürlich auf.
Jefford und Susan lebten also noch! Der graubärtige Stationer hatte immer wieder behauptet, dass sein Stationshaus gegen jeden Indianerangriff gefeit sei. Damit schien er nun recht zu behalten. Die Hütte stand wie ein uneinnehmbares Bollwerk dort unten in der Senke. Ein knorriger Cottonwoodbaum reckte beschützend seine Äste über das Dach.
Aber dann sah Clint das zertrümmerte Schuppentor, die umgerissenen Korralpfosten und die verkohlten Überreste der Remise. Die Pferde waren natürlich weg und die lebenswichtige Quelle hinter dem Haus, deren Wasser sich in einem kreisrunden Tümpel sammelte, war für die Eingeschlossenen unerreichbar geworden. Clints Blick tastete die mit Gestrüpp und Felsklötzen bedeckten Hänge ringsum ab.
Nur zwanzig Schritte unter ihm lauerte ein Indianer hinter einem rissigen Steinblock. Ein pfeilgefüllter Köcher hing auf seinem Rücken. Er trug einen schwarzen Hut, an dem eine Krähenfeder steckte. Sein Haar war zu Zöpfen geflochten. Weiter rechts von ihm lud gerade ein anderer Krieger hinter einem Rotdornbusch seine alte Vorderladerflinte. Clints Rechte schloss sich hart um den Walnussholzkolben seines 1851er Navy Colts. Mit der Linken hielt er seinem Pferd die Nüstern zu, damit ihn kein Schnauben verriet.
Es waren ungefähr so viele Indianer, wie auf seiner Fährte ritten. Sie hatten sich ringsum auf den Hängen verteilt. Einige trugen nur Lendenschurz und Mokassins, andere waren in verwaschenes Kattun gekleidet. Wieder andere trugen die bei den Überfällen erbeutete Kleidung von Weißen. Wo ihre Mustangs standen, konnte Clint nicht feststellen. Vielleicht in der Nähe der Felsentürme, die wie Schwurfinger in den sich allmählich rot färbenden westlichen Himmel ragten. Es war jetzt auch nicht wichtig.
Im Krachen der Gewehre hatte Clint sich keine Mühe zu geben brauchen, lautlos heranzukommen. Jetzt, da jedes Geräusch wie unter einer unsichtbaren Glaskuppel erstickt war, wagte er nur mehr flach zu atmen. Cold Spring – das hatte für ihn Rettung, Sicherheit und ein ausgeruhtes Pferd bedeutet. In Wirklichkeit war er nun vom Regen in die Traufe geraten. Es würde nur mehr Minuten dauern, bis seine Jäger da waren, und sobald die um die Station versteckten Paiutes Wind von ihm bekamen, war sein Leben keinen rostigen Penny mehr wert.
An Flucht war nicht mehr zu denken. Der Braune war zu abgehetzt. Clint konnte es drehen wie er wollte, alles lief immer nur darauf hinaus, dass er hinab musste! Er wischte sich mit dem fransenverzierten Ärmel der Lederjacke über das staub- und schweißverschmierte Gesicht. Ein leises Grollen wie von einem fern heraufziehenden Gewitter kam über die Höhenzüge hinter ihm. Hufgetrappel. Die Krieger in der Senke hörten es noch nicht. Aber das konnte sich schnell ändern.
Der Donnerknall eines Schusses ließ Clint zusammenzucken. Ein Feuerstrahl zuckte aus der Schießscharte rechts von der Hüttentür. Pulverdampf quoll auf. Hinter dem Rotdornbusch gellte ein durchdringender Schrei. Der Indianer, der seine Rifle inzwischen geladen hatte, schnellte mit hochgeworfenen Armen empor, drehte sich halb und stürzte schwer zu Boden.
Wutgeheul aus einem Dutzend Kehlen brandete auf. Der Krieger mit dem Krähenfederhut richtete sich geduckt neben dem Felsblock auf und ließ die Bogensehne schwirren. Pfeile fauchten von allen Seiten auf das Blockhaus zu. Gewehre donnerten.
Jetzt oder nie!, durchzuckte es Clint. Bis die Paiutes ihre Flinten nachgeladen hatten, musste er in der Senke sein! Nur die Überraschung war seine Chance. Mit einem Satz war er im Sattel, den Colt in der Faust. Das braune Pferd mobilisierte nochmals alle Kräfte. Wie ein Rammbock durchbrach es das Gebüsch. Seine Hufe wirbelten den sonnenbeschienenen Hang hinab.
Es waren Sekunden, in denen der junge Postreiter von einer seltsamen, klarsichtigen Kälte erfüllt war, die keine Panik in ihm aufkommen ließ. Sekunden, in denen er alles wie in einem von Geschrei und Schüssen durchtobten Traum erlebte. Die Erde schien unter den hämmernden Hufen seines Braunen dahinzufliegen. Die Senkensohle raste ihm entgegen.
Der Paiute mit dem schwarzen Hut war herumgezuckt. Seine zur Schulter sausende Hand brachte im nächsten Moment einen Pfeil auf die blitzschnell gespannte Bogensehne. Clint schoss ihm im Weiterjagen eine Kugel in die Brust.
In einer Staubwolke fegte der Braune an dem Felsen vorbei. Aus den Augenwinkeln sah Clint die links und rechts von ihm aus der Deckung schnellenden Gestalten. Er machte sich so klein wie möglich auf dem Pferd. Sein Gesicht berührte die flatternde Mähne. Er hatte nicht gedacht, dass der Braune noch so laufen würde.
»Schieß, Sam! Gib mir Feuerschutz!«, brüllte er zum Haus hinüber. Ein Gewehr krachte. Dann blitzten Mündungsfeuer aus einem Colt. Pfeile schwirrten an Clint vorbei. Er spürte, wie das Pferd heftig zusammenzuckte, aber es lief weiter. Drüben beim schwarzen Trümmerhaufen, der einmal die Remise mit der Feldschmiede gewesen war, tauchten zwei, drei wie Raubkatzen aus dem Staub und Pulverrauch springende Gestalten auf.
Tomahawks und Lanzenspitzen blinkten. Die Krieger versuchten dem heranstürmenden Reiter den Weg abzuschneiden. Die Feuerstöße aus dem Blockhaus warfen zwei von ihnen nieder. Der dritte schleuderte seine Lanze nach Clint, verfehlte ihn jedoch und warf sich in Deckung, als Clint auf ihn schoss.
Clint war mitten auf dem Hof, als der Braune getroffen unter ihm zusammenbrach. Geistesgegenwärtig riss er noch die Füße aus den Bügeln. Da wurde er schon ausgehoben. Aus!, dachte er entsetzt. Der harte Aufprall presste ihm die Luft aus den Lungen. Eine dichte Staubwolke hüllte ihn ein.
Triumphgeschrei schrillte durch die Senke. Klatschend hieb eine Kugel neben dem Jungen in den Boden. Ein Pfeil strich dicht an ihm vorbei. Clint hielt noch immer seinen Colt fest. Instinktiv rollte er sich zu seinem Pferd, dessen Hufe nicht einmal mehr zuckten. Vielleicht hatte keine Kugel, sondern ein plötzlicher Herzschlag das überanstrengte Tier getötet. So oder so war es ein Ende, das der treue Vierbeiner nicht verdient hatte.
Aus der Schießscharte neben der Hüttentür wurde heftig geschossen. Trotzdem hörte Clint die helle Stimme, die verzweifelt seinen Namen rief.
Susan …
Sein Lebenswille erwachte wieder. Er stieß die Waffe hoch und schoss über den Pferdekadaver auf die hinter einer Wand aus Staub und Pulverdampf huschenden Schatten.
»Hierher, Clint, wir geben dir Feuerschutz!« Das war wieder die Stimme von Susan. Die Blockhaustür stand einen Spalt offen. Die Mündung eines Gewehrs schob sich heraus. Als der Schuss krachte, sprang Clint geduckt auf. Aber statt nur an sich zu denken, stieß er den Colt ins Holster und begann die Lederschabracke mit den Postbehältern vom Rücken des erschossenen Braunen zu zerren.
»Clint, um Himmels willen, schnell!«, gellte es aus dem Haus. Da hatte er’s schon geschafft. Keuchend schwang er sich die Mochila auf die Schulter und rannte los. Ein Pfeil streifte seinen linken Stiefel. Ein anderer blieb in einer der »Cantinas«, einer der postgefüllten Boxen der Mochila, stecken.
Der Türspalt vor Clint öffnete sich weiter. Mit einem verzweifelten letzten Satz schleuderte er sich hinein. Sofort schlug die Tür zu, ein Balkenriegel klappte herab. Draußen schmetterten Kugeln und Pfeile gegen das Holz. Das Geschrei der Paiutes klang plötzlich viel weiter entfernt. Vielleicht war aber auch die dumpfe Benommenheit in Clints Gehirn der Grund dafür.
Er taumelte gegen den Tisch, hielt sich an ihm fest und atmete stoßweise. Es dauerte eine Weile, bis er einen klaren Gedanken fassen und seine Umgebung wahrnehmen konnte. Pulverdampf vernebelte den dämmrigen Raum, in dem Clint Randall jedes Möbelstück vertraut war. Er warf die Mochila auf den Tisch und drehte sich um.
Susan lehnte noch an der Tür, bleich, mit schreckverdunkelten großen Augen. Sie trug das kastanienbraune Haar nach Art der Siedlerfrauen im Nacken verknotet. Aber in diesen Sekunden, als die Schüsse und das Geheul abermals verstummten und bleierne Stille sich ausbreitete, wirkte sie auf Clint wie ein verschrecktes Kind. Sie war keine makellose Schönheit. Ihr etwas rundliches Gesicht war von Sommersprossen übersät, die Nase ein wenig zu klein geraten.
Dennoch war sie das hübscheste Girl, dem Clint je begegnete. Sie hatte noch die Kochschürze über das einfache Kattunkleid gebunden. Wahrscheinlich waren die Paiutes gekommen, als sie gerade am Herd stand. Ihre Lippen bewegten sich nun, aber kein Ton kam über sie.
Der Mann an der Schießscharte neben der Tür ließ seinen qualmenden Colt sinken. Er hatte einen runden Tisch an die Wand geschoben. Darauf lagen zwei weitere Revolver und alles, was nötig war, diese Waffen zu laden: Schießpulver, Verdämmungspfropfen, Bleikugeln und Zündhütchen.
»Hallo, Sam!«, wollte Clint rufen. Da wandte sich der Mann um, und Clint sah, dass es nicht Susans Vater war.
Er blickte in ein eckiges, von Schweiß und Pulverschwärze bedecktes Gesicht. Der Mann war ungefähr fünfzig Jahre alt, einen halben Kopf größer als Clint und breit wie ein Schrank. Der Staub auf seinem zerknitterten Kordanzug und den klobigen Stiefeln verriet, dass er noch nicht lange in der Station war. Seine Mundwinkel waren verkniffen, und dann sah Clint auch das blutbesudelte Tuch, das er sich als Notverband um den rechten Oberschenkel gebunden hatte.
»Hallo, Postreiter, das war verteufelt knapp!« Seine heisere Stimme bewies die Anspannung, unter der er stand. Clint schaute sich beunruhigt nach Jefford um. Die Türen zu den fensterlosen Schlafkammern standen offen. Zwei Pferde streckten ihre Köpfe aus der einen. Offenbar waren sie von den Bewohnern der Relaisstation noch im letzten Augenblick vor dem Angriff hereingebracht worden. Clints Blick kehrte zu dem kreidebleichen Mädchen zurück.
»Wo ist Sam, Susan?«
Ihre Lippen zuckten heftiger. Ihre Augen begannen sich mit Tränen zu füllen. Plötzlich lief sie zu ihm. Er nahm sie in die Arme und hielt sie fest. Sie zitterte heftig.
»O Clint, ich bin so froh, dass du gekommen bist! Pa ist tot! Er wollte noch die übrigen Pferde aus dem Korral holen, als sie ihn erwischten. Es war schrecklich …« Schluchzend presste sie ihr Gesicht an seine Schulter. Sie war ein Jahr jünger als Clint, aber hier draußen in der Wildnis des Great Basin galt auch eine Siebzehnjährige schon als erwachsene Frau.
Clint wollte sie trösten, wusste aber nicht, was er sagen sollte.
Mit Jeffords Tod musste er selbst erst fertig werden. Der Mann neben der Tür war schweigend und mit verbissener Miene beschäftigt, seine drei Colts nachzuladen. Als er Clints Blick auf sich gerichtet fühlte, hielt er kurz inne.
»Sie sind Randall, stimmt’s?« Und ohne eine Antwort abzuwarten: »Mein Name ist Frank Morgan. Ich besitze eine Ranch drüben in der Nähe von Carson City. Eigentlich bin ich hier nur durch Zufall gelandet …«
»Mein Glück, schätze ich.«
Morgan zuckte mürrisch die Achseln. »Das wird sich noch rausstellen. Wenn mich nicht alles täuscht, bekommen die Kerle da draußen jetzt auch noch Verstärkung. Das sieht verdammt nicht gut für uns aus.«
Clint hörte den Lärm ebenfalls. Er zog die Unterlippe zwischen die Zähne. Seine Verfolger waren da. Er hatte wirklich keine Minute mehr verlieren dürfen. Gleichzeitig hieß das aber auch, dass die Verluste, die sie den Belagerern zugefügt hatten, bedeutungslos geworden waren.
»Verfluchtes Pack!«, schimpfte Morgan. »Das sind mindestens zwanzig Halunken, die wir nun am Hals haben! Weiß der Henker, ob ich da meine Frau und meine kleine Tochter je wiedersehe!« Erklärend fügte er hinzu: »Ich war geschäftlich drüben in Salt Lake City und hatte es so eilig, heimzukommen, dass ich nicht auf die nächste Postkutsche warten wollte! Teufel, das hab ich nun davon! Ich bin völlig ahnungslos mitten in diesen verdammten Indianeraufstand hineingeritten, genau wie Sie, Randall.«
Clint schüttelte den Kopf.
»Ich wurde auf der Whitehorse Station vor den Roten gewarnt.«
Morgan starrte ihn betroffen an. Clint dachte an den Prospektor, der ihn aufzuhalten versuchte. Er ahnte, was dem Rancher jetzt auf der Zunge lag. Clint lächelte gequält. Mit einer Kopfbewegung wies er auf die auf dem Tisch liegende Mochila. »Ich werd’ nun mal dafür bezahlt, die Post durchzubringen.«
Morgan brummte mit finsterem Gesicht: »So ähnlich hat auch Jefford geredet, ehe er hinauslief, um die Pferde zu holen! Dabei waren die Rothäute schon oben auf den Senkenrändern. Aber nein, er wollte auf keinen Fall … Achtung, da kommen diese Teufel schon wieder!« Entschlossen packte er einen der frischgeladenen Colts.
Clint schob Susan zur Seite. Er nahm sich keine Zeit, die Kammern seiner leergeschossenen Waffe nachzuladen, sondern setzte hastig die mit Patronen gefüllte Reservetrommel ein. Morgan warf ihm einen zweiten Revolver zu. Es war ein langläufiger Paterson Colt, den Clint geschickt auffing. Dann war er schon an einer Schießscharte an der Rückseite des Gebäudes.
Kriegsgeschrei gellte. Wieder kamen die Angreifer zu Fuß. Der vorderste war nur mehr wenige Yard entfernt. Ein riesiger geduckt an der Quelle vorbeihetzender Paiute, der einen lederumwickelten Schädelbrecher schwang. Sein rot und weiß bemaltes Gesicht glich einer unheimlichen Dämonenmaske. Clint schob die Mündung des Paterson in die Schießscharte, zielte und drückte ab.
5. Kapitel
Fünf Minuten später war der Angriff abermals abgeschlagen. Eine hereinpfeifende Kugel hatte Clint ein Büschel Haare über dem rechten Ohr wegrasiert. Mehr Schaden hatte der Pfeil und Bleihagel nicht angerichtet. Von einem Augenblick zum anderen war es nun wieder so still, als hätten sich die Paiutes in Rauch aufgelöst. Clint musste sich jedoch nicht erst groß anstrengen, etwas von den an den Hängen versteckten Kriegern zu entdecken. Er wusste auch so, dass sie noch immer da waren entschlossener und rachsüchtiger denn je.
Der Pulverrauch staute sich wie Nebel unter der niedrigen Balkendecke. Clints Ohren waren noch halb taub vom Krachen der Detonationen. Nach allem, was an diesem Tag bereits hinter ihm lag, war er so erschöpft, dass er mit seinen zitternden Fingern Mühe hatte, die Sechsschüsser wieder nachzuladen.
Schweigend trat Susan zu ihm und übernahm es. Sie hielt den Kopf gesenkt und Vermied es, ihn anzusehen. Es war, als hätte sie Angst, ihre eigene Hoffnungslosigkeit in seinen Augen wiederzuentdecken.
Die Sonne war untergegangen. Nur die obersten Senkenränder waren noch in ihr Licht getaucht. Im Blockhaus war es fast dunkel. Morgan humpelte durch den Raum und zündete den Docht der über dem Tisch hängenden Petroleumlampe an. Clints Herz zog sich schmerzhaft zusammen, als der am Bein verwundete Rancher sich danach ächzend auf den Stuhl an der Schmalseite des Tisches sinken ließ. Dort hatte sonst um diese Zeit immer Sam Jefford gesessen.
Clint erinnerte sich an das faltige Grinsen, mit dem der Graubärtige ihn jedes Mal aufgefordert hatte, nur ja tüchtig zuzulangen, damit er endlich mehr Fleisch auf die Rippen bekam und aufhörte, wie ein im Sattel hängendes Fragezeichen auszusehen. Augenzwinkernd hatte Jefford dabei stets seine am Herd stehende Tochter angesehen. Die Erinnerung legte sich wie eine Zentnerlast auf Clint. Er schwieg. Erst als Susan dann ein Tablett mit einem Krug Quellwasser, frischgebackenem Brot und kaltem Braten auf den Tisch stellte, wurde ihm bewusst, wie hungrig er war.
»Greif zu, Clint!«, forderte ihn das Mädchen leise auf, rührte selbst jedoch keinen Bissen an. Clint war nicht entgangen, wie auch Susan zusammengezuckt war, als Frank Morgan sich ahnungslos gerade auf Jeffords Stammplatz gesetzt hatte.
Susan übernahm wie selbstverständlich die Wache an der Schießscharte bei der Tür, während Morgan sich hungrig bediente. Mit keinem Wort hatte der Rancher bis jetzt seine Oberschenkelverletzung erwähnt. Er war ein harter, grimmiger Mann, der auch in der Anwesenheit von Jeffords Tochter kein Blatt vor den Mund nahm.
»Mit Ihrem Kollegen aus Fort Churchill können wir wohl kaum mehr rechnen, Randall«, meinte er zwischen zwei Bissen. »Der ist entweder umgekehrt, wenn er schlau war, oder die Rothäute haben ihn längst skalpiert. Was meinen Sie? Werden Ihre Leute vom Pony Express uns Hilfe schicken?«
Clint füllte einen Becher mit Wasser aus dem Krug und trank. »Das hängt davon ab, wie es auf den Stationen westlich von hier aussieht. Wenn sich überhaupt Freiwillige finden, die sich aus Carson City oder Fort Churchill herauswagen, werden sie zwischen Dayton, Carson Sink und Crustle Rock sicher alle Hände voll zu tun haben. Nein, Morgan, wir sollten uns lieber nicht auf sie verlassen. Cold Spring liegt nun mal ziemlich weit weg vom Schuss.«
»Nicht für die Paiutes!«, murrte Morgan. »Junge, Sie verstehen es aber, einem Mut zu machen!«
Clint lächelte rissig. »Ich wollte, ich könnte Ihnen was anderes erzählen. Aber ob Sie’s glauben oder nicht, Morgan, ich bin über das Märchenalter hinaus.«
»Schon gut, Randall, ’s war nicht so gemeint. Ich bin froh, dass Sie hier sind.«
»Vielleicht gibt’s doch noch ’ne Chance, wenn Dave und seine Freunde rechtzeitig kommen«, sagte Susan plötzlich bei der Schießscharte. Ihre Stimme klang gefasst. Nur Clint kannte sie so gut, dass er das unmerkliche Zittern heraushörte. Er schob den Stuhl zurück und fuhr hoch.
»Dave? Ist er denn hierher unterwegs?«
»Wer, zum Henker, ist Dave?«, wollte Morgan wissen.
»Susans Bruder«, erklärte Clint schnell. »Einer, der seine Zeit lieber in den Saloons und Spielhöllen von Carson City verbringt als hier draußen in der Wildnis. Aber das geht uns nichts an. Ich will damit nur erklären, dass es mir schwerfällt zu glauben, was Susan sagt.«
Er eilte um den Tisch herum zu dem Mädchen. Als er Susans Schultern ergriff, wurde ihm wieder bewusst, wie jung und hübsch sie war und wie verloren und verletzlich in dieser Umgebung. Er hatte schon immer den Wunsch gehabt, sie eines Tages von hier wegzubringen. Er blickte das Mädchen ernst an.
»Susan, ich bezweifle ja nicht, dass Dave sich Sorgen um euch macht, wenn er erfährt, dass die Paiutes losgeschlagen haben. Doch du weißt, wie weit Carson City weg ist. Was ich über die Freiwilligen vom Pony Express sagte, das gilt auch für Dave und seine, hm, Freunde …«
»Nein, Clint, du hast mich vorhin schon richtig verstanden: Er ist bereits unterwegs!« Zum ersten Mal erschien der Schimmer eines zaghaften Lächelns auf ihrem Gesicht. »Little Ben Neal hat gestern mit der Post aus Fort Churchill seinen Brief gebracht. Dave schreibt, dass er entweder heute oder morgen hier auftauchen wird. Er will mit seinen Freunden nach Salt Lake City oder vielleicht sogar noch weiter nach Fort Laramie hinüber und hier ein, zwei Tage Zwischenstation machen. Das heißt, er ist bereits losgeritten, bevor es zu den ersten Indianerüberfällen kam.«
Das heißt auch, fügte Clint in Gedanken hinzu, dass ihm der Boden in Carson City zu heiß geworden ist! Aber eher hätte er sich die Zunge abgebissen, als Susan gegenüber ein Wort davon erwähnt.
Die Nacht brach herein. Die Einsamkeit des weiten Landes, die das Blockhaus umgab, schien sich noch zu verdichten. Clint und Morgan griffen gleichzeitig zu den Waffen, als das klagende Geheul eines Coyoten vom Senkenrand schallte. Clint blies die Lampe aus. Diesmal übernahm er die Schießscharte an der Vorderfront. Es war Neumond. Ein Meer von Sternen bedeckte zwar das Firmament, aber ihr Gefunkel reichte nicht aus, die Senke zu erhellen. Die Konturen der Felsen und Sträucher an den Hängen ringsum waren nur zu ahnen.
»Es heißt doch, dass sie bei Nacht nicht angreifen«, murmelte Morgan unsicher.
Clint zuckte die Achseln. »Das gilt vielleicht für die Sioux und Cheyennes auf der Prärie jenseits des Felsengebirges. Doch nicht mal bei denen würd’ ich mich drauf verlassen.«
Der Coyote heulte wieder. Das Signal, was immer es auch bedeuten mochte, wurde von der anderen Senkenseite beantwortet. Gebannt spähten die Menschen in der Hütte in die fahle Dunkelheit hinaus. Susan stand dicht neben Clint. Er spürte die Wärme ihres Körpers durch das dünne Kleid. Morgans gepresste Atemzüge füllten die Schwärze im Raum. Anscheinend machte ihm seine Verletzung mehr zu schaffen, als er sich selbst eingestehen wollte.
Clint bemerkte eine Bewegung am Hang hinter der verbrannten Remise. Er vertauschte seinen Colt mit dem Volcanic Karabiner, der an der Wand lehnte, wartete aber noch. Die Pferde in der Kammer nebenan schnaubten und stampften. Für die Tiere war kein Futter im Haus, und das Wasser in dem großen Fass, das Jefford ständig in der Station aufbewahrte, war für die Belagerten so kostbar, dass sie die Pferde lieber hinausließen, als es für sie zu opfern. Verschwommene Geräusche drangen herein.
An der Rückseite krachte plötzlich einer von Frank Morgans Revolvern. Wie ein vielfaches Echo auf den Schuss antworteten von den Hängen mehrere Gewehre. Clint schoss auf die zuckenden Mündungsblitze. Da war schon wieder alles vorbei. Das Krachen verebbte. Ein hartes, bellendes Auflachen trieb in die Senke herab. Eine höhnische Stimme schrie etwas im Dialekt der Paiutes.
Clint hatte den salzigen Geschmack von Schweiß auf den Lippen. Die Stille und Reglosigkeit da draußen zerrten an seinen Nerven. Plötzlich flackerte ein Feuer zwischen den Felsen über der Senke auf. Sekunden später brannte weiter rechts ebenfalls eins und auch eins auf dem der Rückfront der Hütte zugewandten Senkenrand.
»Entweder sie wollen uns ’reinlegen oder sie haben tatsächlich vor, es sich für den Rest der Nacht da oben gemütlich zu machen«, knurrte Morgan. »Na ja, die Kerle können es sich leisten. Die haben Zeit. Ein paar Aufpasser genügen, uns hier festzunageln. Wenn wir nur nicht …«
Clint fuhr herum, als der dumpfe Aufschlag eines Körpers den Satz unterbrach. Morgan lag am Boden. Besorgt lief der Postreiter zu ihm.
»Lassen Sie nur, Randall!«, keuchte der Rancher, als Clint ihm hoch half. »Dieses verfluchte Kugelloch! Das brennt wie Feuer! Aber es geht schon wieder …«
Clint führte ihn zu einem Stuhl. Dann nahm er die Lampe vom Haken, stellte sie auf den Tisch und brannte wieder den Docht an. Susan drehte entsetzt den Kopf weg, als er das Tuch von Morgans blutbesudeltem, aufgeschlitztem Hosenbein wickelte.
»Sieht nicht gut aus, was?«, keuchte Morgan, jetzt aschfahl im Gesicht. Schweiß perlte über seine Wangen. Clint biss die Zähne zusammen. Eine schwerkalibrige Kugel hatte Morgans Oberschenkel getroffen. Der Rancher hatte sie mit einem Messer herausgeholt. Er hatte viel Blut verloren. Die Wunde war hässlich verfärbt, das Bein geschwollen. Clint hob den Kopf und blickte dem stämmigen Viehzüchter in die Augen. Morgans Grinsen verunglückte zur Grimasse.
»Ich weiß, ich hätte sie ausbrennen müssen, aber dazu ließen mir die Rothäute keine Zeit mehr.«
»Sie brauchen einen Arzt, Morgan!«
»Wem sagen Sie das!«, krächzte der Verwundete. »Fragen Sie doch mal die Paiuten, ob sie ’nen Medizinmann dabeihaben, der mir hilft.« Er nickte Susan zu, die frisches Verbandszeug aus einer der Schlafkammern brachte. »Vielen Dank, Miss.«
Clint konnte nicht mehr tun, als das Kugelloch vorsichtig säubern und einen frischen Verband darüberwickeln. Es gab keinen Whisky im Haus, mit dem er die Wunde hätte desinfizieren können. Der fromme Mister Majors von der Pony Express Gesellschaft hatte nicht nur Karten und Würfelspiel, sondern auch jeglichen Alkoholgenuss für die Angestellten der Firma für tabu erklärt.
Bei einem der Feuer über der Senke setzte plötzlich das dumpf tönende Tamtam einer Trommel ein. Kehlige Stimmen begannen einen fremdartigen Gesang. Morgan knirschte mit den Zähnen.
»Jetzt wollen sie uns wohl so richtig mürbe machen!«
Clint erhob sich. »Für sie sind wir Eindringlinge, die ihnen ihr Land weggenommen haben und schuld daran sind, dass ihre Squaws und Kinder hungern. «
»He!«, schnaubte Morgan. »Sie reden ja so, als wären Sie ein Freund dieser Wilden, Randall!«
Clint winkte ab.
»Ich werde kämpfen.«
Morgan musterte ihn aufmerksam.
»Nach allem, was ich mitgekriegt habe, glaub ich, dass Sie’s sogar schaffen.«
Clint, der sich wieder der Schießscharte zugewandt hatte, drehte sich um. »Wie meinen Sie das?«
»Ich meine, dass es noch eine Chance gibt, solange die Paiutes nicht wissen, dass wir hier drinnen zwei Pferde haben.«
»Wir sind zu dritt!«
Morgan lächelte verzerrt. »Ich hab nicht den Ehrgeiz, mit einem Pony-Express-Reiter in einem Wettrennen zu konkurrieren. Aber Sie und Miss Susan sollten es schaffen. Genauso wie Sie schon mal durchgebrochen sind, weil die Roten nicht drauf gefasst waren. Hören Sie nur, wie sicher diese Kerle ihrer Sache sind!«
Der Gesang und das Dröhnen der Trommel waren lauter geworden. Es war weithin durch die einsame Nacht zu hören. Die kehligen Stimmen und das hämmernde Tamtam ließen die Nerven der Eingeschlossenen vibrieren. Clint blickte Morgan starr an.
»Verdammt will ich sein, wenn ich mir eine Chance damit erkaufe, dass ich Sie hier vor die Hunde gehen lasse!«
»Es geht nicht nur um Sie, Randall«, erwiderte Morgan mit einem Blick auf Jeffords Tochter. Er hob eine Hand, als Susan etwas sagen wollte. »Ich weiß, Miss, Sie warten auf Ihren Bruder. Well, das tu ich auch. Nur, wer weiß, welchen Ärger Dave und seine Freunde bereits selbst am Hals haben! Wenn nicht, dann werden diese Jungs sich bestimmt ein bisschen mehr/beeilen, sobald sie von Ihnen und Randall erfahren, was hier los ist. Ich kann ja diese Burg für eine Weile auch allein verteidigen. Stimmt’s, Randall?«
»Schon möglich«, murmelte Clint nachdenklich. »Aber ich wette, Sie haben dabei noch ganz was anderes im Sinn, Morgan.«
Der breitschultrige Mann richtete sich auf. Er stützte sich dabei auf sein Gewehr. »Sie sind ein kluger Kopf, Randall. Sie haben recht. Aber ich werd’ erst damit rausrücken, wenn Sie sich zum Reiten entschlossen haben.«
Clint zögerte. Der Rancher wusste genau wie er, wie wenig Aussicht bestand, dass Dave und seine Freunde hier rechtzeitig aufkreuzten. Er sah das Gemisch aus Furcht und Hoffnung in Susans Augen. Die Anwesenheit des Mädchens gab schließlich den Ausschlag. Clint nickte. »Ich denke, wir versuchen es. Aber nun reden Sie, Morgan!«
Die Schultern des älteren Mannes strafften sich. Er wirkte erleichtert. »Machen wir uns nichts vor, Randall: Die Möglichkeit, dass ich meinen Skalp verliere, ist nun mal nicht abzuleugnen. Gerade darum ist es für mich wichtig, dass Sie und Miss Susan durchkommen. Well, ich sagte ja schon, dass ich Frau und Tochter habe. Und ich möchte nicht, dass sie, wenn ich hier Pech habe, auch noch die Aussicht auf eine einigermaßen gesicherte Zukunft verlieren. Warten Sie, Randall, ich erklär’ Ihnen gleich alles …«
Seine Hand zitterte, als er den wassergefüllten Becher an die Lippen hob und trank. Clints Herz schlug mit der Paiute-Trommel um die Wette. Morgan humpelte zu einem Wandregal und nahm ein unscheinbares, in Ölhaut gewickeltes Päckchen heraus. Während er es neben der auf dem Tisch brennenden Lampe aufstellte, sprach er weiter.
»Damals, als die Minenstädte am Fuß der Sierra Nevada wie Pilze aus dem Boden schossen, hielt ich es für eine großartige Idee, bei Carson City eine Ranch zu gründen und die Silber- und Goldsucher mit Frischfleisch von meiner Weide zu versorgen. Die Sache ließ sich auch gut an. Aber dann war ich plötzlich nicht mehr der Einzige, der auf diese Weise vom Silber-Boom profitieren wollte. Ich hatte meine Ranch als einen Ein-Mann-Betrieb aufgezogen, und nun hatte ich meine liebe Not, mit den Größeren mitzuhalten. Dann kam auch noch die Dürreperiode vor zwei Jahren, in der alle Wasserlöcher auf meinem Land austrockneten. Die Hälfte meiner Rinder ging damals drauf. Das hat mich geschafft. Ich konnte mich nur mehr mit einem Berg von Schulden über Wasser halten. Aber ich will Sie nicht mit meinen Problemen langweilen, Randall. Mein letzter Ausweg, um nicht alles zu verlieren, war, die Hälfte meines Landes an eine Minengesellschaft in Salt Lake City zu verkaufen.«
Er hatte das Päckchen aufgewickelt. Ungläubig schaute Clint auf die Banknoten. »Achttausend Dollar«, lächelte Frank Morgan rissig.
»Eine stolze Summe, die beweist, wie sicher die Minenbosse sind, Silber auf meinem Land zu finden.«
»Du lieber Himmel, und damit sind Sie ganz allein vom Großen Salzsee bis hierher geritten!«, entfuhr es Clint.
»Die Minenleute wollten mir auch lieber ’nen Scheck mitgeben. Aber ich bin nun mal ein altmodischer Bursche, der sehen und fühlen will, was er für sein Land bekommt. Dieses Geld, Randall, wird die Zukunft meiner Frau und meiner kleinen Tochter sichern. Und Sie sind der richtige Mann, es ans Ziel zu bringen!«
Sein Blick war am Gesicht des Expressreiters festgebrannt. Clint schluckte. Wenn Morgan ihm diese Verantwortung übertrug, dann hieß das, dass er für sich selbst keine Hoffnung mehr hatte.
»Ich weiß nicht, ob ich das Recht dazu habe, Morgan. Nur die Stationshalter sind ermächtigt, Post und Expressgut in Empfang zu nehmen. Unter diesen Umständen wird die Gesellschaft für den Verlust des Geldes ganz bestimmt nicht geradestehen.«
»Das erwarte ich auch nicht. Mir ist klar, dass ich alles auf eine Karte setze. Sie sind mein einziges As, Randall. Ich werde das Päckchen an meine Frau adressieren. Miss Susan wird es anstelle ihres Vaters in die Postliste eintragen und mir eine Quittung ausschreiben. Dann ist es sogar Ihre Pflicht, das Geld mitzunehmen, Randall.« Er lachte heiser, kam um den Tisch herum und legte Clint eine Hand auf die Schulter. »Aber ich zwing Sie nicht, ich bitte Sie! Ich vertrau Ihnen mit diesem Geld die Zukunft meiner Familie an. Aber ich weiß auch, dass es nirgendwo besser aufgehoben ist als bei einem Mann, der seinen Skalp riskiert, um die Posttasche aus dem Pfeil- und Kugelregen der Paiutes zu retten.«
Clint lächelte säuerlich. »Sie werden nicht darum herumkommen, für jede Unze Gewicht fünf Dollar zu berappen, Morgan. Der Pony Express ist nicht billig.« Als der Rancher nicht reagierte, blickte Clint das Mädchen an. »Er lässt uns keine Wahl, Susan. Sei also so gut und bring das Postbuch und die Waage her.«
6. Kapitel
Die Trommel war verstummt. Kein Laut drang mehr in die Senke. Clint Randall ließ den Sprungdeckel seiner Taschenuhr zuschnappen. »Es ist Zeit«, sagte er zu Susan.
Sie hatte ein Cape umgelegt und einen dunklen Schal um den Kopf geschlungen. Ihr Gesicht wirkte bleich, aber gefasst. Nur ihre Augen verrieten die Angst. Das ledergebundene Expressbuch lag noch neben der Waage auf dem Tisch. Die Mochila hing über einem Stuhl. Clint schob das dünne Päckchen mit den achttausend Dollar in die dafür bestimmte »Cantina«. Die drei anderen Boxen waren mit Vorhängeschlössern gesichert, für die nur der für den Streckenabschnitt Nevada und Utah zuständige Superintendent die Schlüssel besaß. Jetzt erst faltete Morgan die von dem Mädchen unterschriebene Quittung zusammen und schob sie in die Innentasche seiner Jacke.
Clint brachte die Pferde aus dem Nebenraum. Zum Glück hatte Jefford Sättel und Zaumzeug im Haus aufbewahrt. Die Tiere waren schon reitfertig. Die mit Tüchern umwickelten Hufe polterten dumpf auf dem Bretterboden. Clint schwang die Mochila auf den Rücken des Schwarzbraunen. Die Schabracke mit den beiden Postbehältern links und rechts besaß ein Loch fürs Sattelhorn und einen Schlitz für die hintere Sattelpausche, sodass der Expressreiter während des Rittes praktisch auf der Post saß.
Schweigend nahm Susan die Zügel der Falbstute. Morgan humpelte heran. Zwei Revolver steckten in seinem Hosenbund. Sein breitflächiges Gesicht war von dunklen Linien zerfurcht, aber er wirkte hart und entschlossen.
»Nur Mut!«, versuchte er Susan aufzumuntern. »Wie ich Randall einschätze, jagt der eher einen ganzen Indianerstamm in die Flucht, als dass er zulässt, dass eine Rothaut Ihnen ein Haar krümmt!«
Dann reichte er Clint die Hand. »Alles Glück für Ihren Trail, mein Junge! Wenn es klappt, sehen wir uns irgendwann in Carson City wieder. Und dann, verdammt noch mal, werden wir ein Fas aufmachen, dass allen die Augen überlaufen, die dabei zusehen!«
Clint lächelte dünn. »Sie wollen doch hoffentlich nicht, dass ich meinen Job beim Pony Express verliere?«
»Im Gegenteil!« Lachend klopfte der Rancher ihm auf die Schulter. Es war ein raues Lachen, mit dem er seine Besorgnis verbergen wollte. Clint hoffte, dass die Indianer nicht misstrauisch wurden, als sie die Lampe löschten. Sie warteten eine Weile, bevor sie vorsichtig die Tür öffneten.
Draußen blieb es still. Die Lagerfeuer auf den Senkenrändern waren nur mehr Gluthaufen, die wie rote Augen durch die fahle Dunkelheit leuchteten. Im Gegensatz zur Tageshitze war die Luft merklich abgekühlt. Clint und Susan hielten ihren Pferden die Nüstern zu. Clint trug seinen Navy Colt, Modell 1851, links im Holster. Den Paterson, den Morgan ihm überlassen hatte, hatte er hinter die Gürtelschnalle geschoben.
»Ich werd’ die Kerle ablenken, wenn sie merken, was gespielt wird«, flüsterte der Rancher und schob sich neben ihm zur Tür hinaus. Er zog das verletzte Bein nach. Mehr war ihm von seiner Verwundung jetzt nicht anzumerken. Bevor Clint ihn halten konnte, war er in der Dunkelheit verschwunden.
Clint und Susan führten ihre Pferde vor die Tür. Die Nacht war vom Atem einer tödlichen Gefahr durchdrungen. Vielleicht lauerten die Vorposten der Paiutes nur ein paar Schritte entfernt an den Hüttenecken und hatten schon ihre Flinten und Pfeile schussbereit. Clint half Susan in den Sattel. Er spürte, wie verkrampft sie war.
»Bleib neben mir, was immer geschieht!«, raunte er.
Sie zögerte, als er ihr einen Colt reichte. Doch dann griff sie entschlossen zu. Die Stute schnaubte leise. Mit der Gewandtheit einer Raubkatze schwang Clint sich auf sein Pferd. Sie trieben die Pferde an der Balkenwand entlang. Clints Hand lag am Paterson. Er warf einen suchenden Blick über die Schulter, aber Morgan blieb von der Dunkelheit verschluckt.
Leise mahlte der Sand unter den Hufen. Wieder schnaubte eins der Pferde. Von rechts, wo der Schuppen stand, antwortete ein metallisches Knacken. Einen Moment war Clint wie erstarrt. Dann duckte er sich.
»Jetzt!«, zischte er Susan zu.
Sie hämmerten den Pferden die Fersen gegen die Flanken. Einen Moment später schallte ein gutturaler Ruf durch die Senke. Er ging im berstenden Krachen eines Colts unter.
Morgans Waffe!
Von der Sekunde an verwandelte sich die in Finsternis gehüllte Senke in einen von Mündungsfeuern durchglühten und von Geschrei durchtobten Hexenkessel.
Für einen Augenblick hatte Clint den verzweifelten Wunsch, seinen Schwarzbraunen herumzureißen und Morgan beizustehen. Aber da war Susan. Und da waren die achttausend Dollar in der Mochila, die der Rancher ihm anvertraut hatte. Weiter, solange das Dröhnen von Morgans Sechsschüsser den wirbelnden Hufschlag übertönte und die Paiutes ablenkte!
Das Stationshaus blieb als schwarzer Klotz in der Dunkelheit hinter Clint und dem Mädchen zurück. Vor ihnen ragten die beiden Felstürme über dem mit Gestrüpp und Steinblöcken bedeckten Hang in den Sternenhimmel. An ihnen lief die Route nach Fort Churchill vorbei, die die »Swing Stations« Crustle Rock, Sand Springs, Stillwater und Carson Sink berührte. Clint und Susan lagen fast auf den Pferdehälsen. Schatten bewegten sich vor ihnen.
Plötzlich stand eine Gestalt vor Clint. Die Metallspitze einer Kriegslanze fing den matten Sternenglanz ein. Clint stieß einen wilden Schrei aus. Sein Pferd rannte den Paiute um. Clint schoss auf einen hinter einem Felsblock hervorspringenden Krieger, der mit dem Tomahawk zum Wurf ausholte. Sand und Steine spritzten unter den Hufen seines Schwarzbraunen auf. Dann riss Susans schriller Schrei den Kopf des jungen Mannes herum.
»Schieß!«, schrie er, als er sah, wie ein Indianer Susan auf der von ihm abgewandten Seite vom Pferd zu zerren versuchte. Der Feuerstrahl aus Susans Waffe beleuchtete gespenstisch das bemalte Gesicht des Kriegers. Mit ausgebreiteten Armen stürzte der Paiute zwischen die Felsen zurück.
Susans Stute wollte ausbrechen. Rasch schob Clint den Paterson in den Hosenbund, packte die Zügel und zerrte das Pferd mit. Er war in Schweiß gebadet, als sie die Felsen am oberen Senkenrand erreichten. Nicht anhalten!, durchfuhr es Clint. Nur weg, sonst ist alles umsonst!
Sie preschten einen mit Fettholzstauden und Salbei bestandenen Hang hinab. Der wüste Lärm hinter ihnen wurde schwächer. Steile, von Felsen durchbrochene Hügel schoben sich neben sie. Die Dunkelheit wurde noch dichter. Clint ließ seinem Pferd die Zügel locker, damit es sich selbst den Weg suchte. Nach einer Meile hielt er, sprang ab und nahm den Gäulen die Lappen von den Hufen.
Die Nachtluft kühlte sein schweißnasses Gesicht, als er sich aufrichtete. Die Schüsse in der Senke von Cold Spring waren verstummt. Mit einem Würgen in der Kehle dachte Clint an Frank Morgan. Der Rancher hatte das Stationsgebäude verlassen, um einen Ausbruch vorzutäuschen. Wenn er es nicht geschafft hatte, rechtzeitig ins Haus zurückzukehren …
Clint trat neben das Pferd, auf dem Susan zusammengesunken saß. »Alles in Ordnung, Susan?«
Ihr Gesicht war ein schmaler, bleicher Fleck im Finstern. Er merkte, dass sie weinte. »O Clint, ich wünschte, ich wäre nie in dieses Land gekommen, in dem jeder kämpfen und töten muss, um selbst am Leben zu bleiben!«
Clint lauschte. Zuerst war es, als hätte die Paiute-Trommel wieder zu dröhnen begonnen. Dann merkte er, dass es Hufschlag auf ihrer Fährte war. Die Indianer brauchten sich nicht aufhalten, nach ihrer Spur zu suchen. Sie wussten, dass den Flüchtenden nur eine Richtung blieb, westwärts den Ponytrail entlang. Auch Susan hatte es gehört. Sie schauderte.
»Wir schaffen es!«, rief Clint ihr zu. »Wir haben die besseren Pferde! Komm!«
7. Kapitel
Als die Sonne aufging, lagen die Felsen von Cold Spring weit hinter ihnen. Ringsum dehnte sich die Halbwüste in niedrigen, von gleißendem Licht überfluteten Bodenwellen. Dürre Grasbüschel und verstreute Dornbuschgruppen waren hier die einzige Vegetation. Im Norden stand die gezackte Silhouette einer Gebirgskette vor dem Firmament. Nach allen anderen Richtungen erstreckte sich das Land in einer geradezu erdrückenden Leere, soweit das Auge reichte. Nicht einmal Wildspuren kreuzten hier den Pony Express Trail.
Clint entschloss sich zur Rast, als er sah, wie erschöpft Susan war. Nur mehr mühsam hielt sie sich im Sattel. Doch kein Wort der Klage kam über ihre Lippen. Als Clint jedoch im Schatten eines Stachelbirnengestrüpps eine Decke für sie ausbreitete, ließ sie sich mit einem erleichterten Seufzen darauf nieder. Clint löste die Wasserflasche vom Sattel. Als er damit zu Susan trat, war sie bereits eingeschlafen.
Auch Clint war erschöpft. Doch er traute der Stille nicht, die sie umgab. Er tränkte die Pferde. Dann aß er ein bisschen von dem Brot, das sie mitgenommen hatten, trank einige Schlucke und stieg anschließend einen Hügel hinauf, um Ausschau zu halten. Sie hatten einen Bogen nach Süden geschlagen. Das hatte zwar Zeit gekostet, doch ihre Pferde hatten dabei einen guten Vorsprung herausgelaufen.
Clint kniff die Augen zusammen. Weit im Osten, wo die Sonne wie ein Ball aus glühendem Gold über den Horizont stieg, zitterte ein Staubschleier über den Hügelrücken. Clint war nicht überrascht. Er wäre es höchstens gewesen, wenn die Paiutes schon aufgegeben hätten, das ihnen knapp entwischte Wild doch noch zur Strecke zu bringen. Clint blickte zu dem schlafenden Mädchen hinunter und überlegte, wie viel Zeit er ihm wohl gönnen durfte.
Bis Crustle Rock gab es nirgendwo einen Platz, an dem sie sich verschanzen konnten, wenn die Indianer sie einholten. Und die Staubwolke über den fernen Höhen wurde verteufelt schnell größer! Clints Blick streifte die Berge im Norden. Bisher hatte er es nicht gewagt, zu weit von der Expressroute abzuweichen, in der Hoffnung, vielleicht doch noch auf Susans Bruder und seine Begleiter zu stoßen. Aber die flachen Kämme im Westen blieben wie ausgestorben, während der Staub auf Clints und Susans Fährte mit der höher kletternden Sonne zu steigen schien.