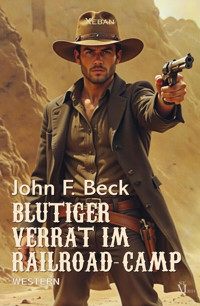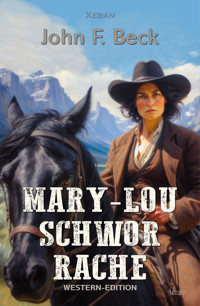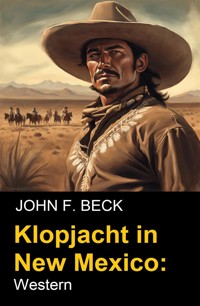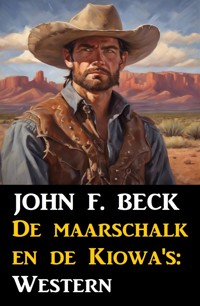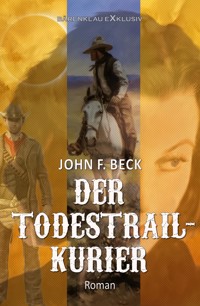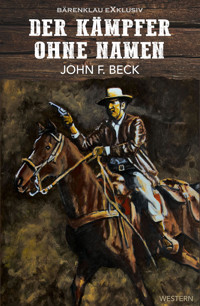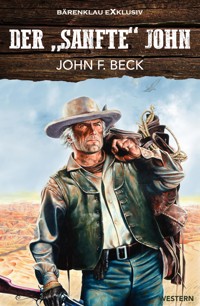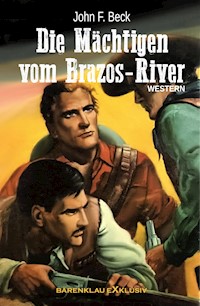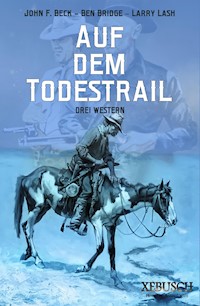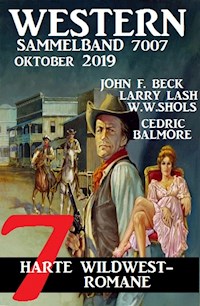5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Xebusch-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält eine kleine Auswahl unserer besten Romane beliebter Autoren der Edition Bärenklau & Bärenklau Exklusiv.
Klassiker, wiederentdeckte Kleinode der großen Westernautoren in einem Band auf mehr als 380 Seiten.
Zu »Aus Freundschaft wurde Hass«: Als Blitze und Donnergrollen die Felsen erschüttern, als Wassermassen über das Gestein vom Himmel stürzen, ist die alte Hütte am Pass für Menschen einziger Zufluchtsort. Sie glauben sich da sicher, aber die wahre Hölle entbrennt in der Hütte, denn drei von ihnen sind Banditen, die zu allem fähig sind. Wo Hass in Gewalt umschlägt, ist der Tod nicht weit. Red River Joe glaubt, in dem einstigen Freund die Redlichkeit wieder erwecken zu können, doch er hat sich getäuscht.
In diesem Band sind folgende Westernromane enthalten:
› Dein Mann muss hängen, Mary! – von John F. Beck
› Bill Warbow, der Glücksritter – von Frank Callahan
› Aus Freundschaft wurde Hass – von Glenn Stirling
› Eine Falle für die Delta Queen – von Carson Thau
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
John F. Beck / Frank Callahan / Glenn Stirling / Carson Thau
Auf dich wartet der Galgen
4 knallharte Western
Impressum
Copyright © by Authors/Xebusch-Verlag
Cover: © by Steve Mayer, 2022
Verlag: Xebusch. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Auf dich wartet der Galgen
Dein Mann muss hängen, Mary!
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Bill Warbow, der Glücksritter
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Aus Freundschaft wurde Hass
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Eine Falle für die Delta Queen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Weitere Western-Anthologien sind erhältlich:
Das Buch
Dieser Band enthält eine kleine Auswahl unserer besten Romane beliebter Autoren der Edition Bärenklau & Bärenklau Exklusiv.
Klassiker, wiederentdeckte Kleinode der großen Westernautoren in einem Band auf mehr als 380 Seiten.
Zu »Aus Freundschaft wurde Hass«: Als Blitze und Donnergrollen die Felsen erschüttern, als Wassermassen über das Gestein vom Himmel stürzen, ist die alte Hütte am Pass für Menschen einziger Zufluchtsort. Sie glauben sich da sicher, aber die wahre Hölle entbrennt in der Hütte, denn drei von ihnen sind Banditen, die zu allem fähig sind. Wo Hass in Gewalt umschlägt, ist der Tod nicht weit. Red River Joe glaubt, in dem einstigen Freund die Redlichkeit wieder erwecken zu können, doch er hat sich getäuscht?
In diesem Band sind folgende Westernromane enthalten:
› Dein Mann muss hängen, Mary! – von John F. Beck
› Bill Warbow, der Glücksritter – von Frank Callahan
› Aus Freundschaft wurde Hass – von Glenn Stirling
› Eine Falle für die Delta Queen – von Carson Thau
***
Auf dich wartet der Galgen
4 knallharte Western
von John F. Beck, Frank Callahan,Glenn Stirling und Carson Thau
Dein Mann muss hängen, Mary!
von John F. Beck
Lee Jackson ist ein guter Pokerspieler, doch damit handelt er sich auch viele Scherereien ein. Nicht lange und der Colt spricht …
1. Kapitel
Wirbelnder Hufschlag fegte aus der Nacht und verstummte stolpernd auf dem Hof der Horseshoe-Ranch.
»Helft mir! Um Himmels willen, schnell, helft mir! Sie haben mich erwischt!«, rief eine heisere Männerstimme.
Im Schlafhaus wurde es lebendig. Stimmen schwirrten durcheinander, Tritte pochten, dann flog die Tür auf. Eine breite gelbe Lichtbahn legte sich über den sandigen Hof. In ihr zeichneten sich die Gestalten von drei sehnigen Cowboys ab. Atemlos starrten sie auf den Reiter, der zusammengekauert, den Stetson tief in die Stirn gezogen, auf dem schweißbedeckten Pferd hockte.
»Jim!«, keuchte schließlich einer von ihnen. »Großer Lord! Das ist ja Jim! Jim, was ist …«
Der Reiter verlor den Halt im Sattel und rutschte auf der gegenüberliegenden Seite vom Pferd, eine Hand krampfhaft ums steile Sattelhorn gekrallt.
»Menschenskind, Jim, was ist passiert?«
Der mittlere Cowboy setzte sich schnaufend in Bewegung.
Auf der lichtüberfluteten Schwelle des Schlafhauses erschien ein vierter Mann – stämmig, untersetzt, mit einem buschigen Schnurrbart. Sein kariertes Hemd war nicht zugeknöpft und hing aus der Hose. Er hielt den patronenbespickten Revolvergurt lose in der Linken, der Colt steckte noch im Holster. Der scharfe Ruf des Mannes brachte die anderen zum Erstarren.
»Vorsicht, Jungs! Das ist nicht Jim – nur sein Pferd! Das ist…«
»Eine Falle, jawohl!«, sagte eine eiskalte Stimme aus der Dunkelheit zwischen dem Bunkhouse und dem Hauptgebäude.
»Und ihr seid darauf hereingefallen! Jetzt ist’s zu spät, Kuhtreiber! Keine Bewegung! Werft eure Eisen weg und bleibt friedlich!«
Die Weidereiter standen wie versteinert.
Über den Sattel des reiterlosen Pferdes war plötzlich ein Revolverlauf auf sie gerichtet. Überall in der Finsternis zwischen den Ranchgebäuden mahlten Stiefeltritte im Sand. Sporen klingelten silbern.
»Ihr Schufte!«, flüsterte der Schnurrbärtige erstickt. »Ihr elenden Lumpen! Wo habt ihr Jims Gaul her? Was habt ihr mit Jim und Tom gemacht?«
»Dumme Frage!«, sagte jemand und lachte kalt. »Heißt es nicht, dass sich kein Cowboy lebend von seinem Pferd trennt, he? Und jetzt seid ihr an der Reihe! Los, weg mit den Kugelspritzen, wir warten nicht gerne!«
»Freunde«, murmelte der Schnurrbärtige heiser, und ein wildes Funkeln erschien in seinen Augen, »ich glaube, jetzt bleibt uns nur eine Wahl! Denkt an Jim und Tom! Vorwärts, gebt es ihnen!«
Seine Hand schnappte zum Coltkolben.
Gleichzeitig griffen die anderen Weidereiter zu den Waffen.
Einen Augenblick später zerriss das rasende Peitschen der Schüsse die samtschwarze Nacht.
2. Kapitel
Marshal Mont Tucker begleitete seinen Besucher zur Tür. Bedauern malte sich auf seinem kantigen, wettergegerbten Gesicht.
»Es tut mir wirklich leid, Abe, dass ich dir nicht helfen kann! Aber als Town Marshal reichen meine Befugnisse nicht über die Stadtgrenze hinaus, leider! Was draußen im offenen Weideland vorgeht, das ist Sache des County Sheriffs, und der sitzt weit weg vom Schuss, verdammt weit! Ich wollte …«
»Schon gut, Mont, schon gut!«, murmelte Abe McGraw düster.
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich weiß, du meinst es ehrlich!«
McGraw legte eine Hand auf die Türklinke. Das Licht der Petroleumlampe schien die Falten in seinem Gesicht noch zu vertiefen. Der graue Bart, der das eckige Kinn bedeckte, schimmerte silbern.
»Abe«, murmelte der Marshal, »du weißt doch, dass du hier in Yellow Flat jederzeit meine Unterstützung findest.«
»Danke, Mont!«
»Ich meine«, redete Tucker zögernd, »wenn du irgendwelche Anhaltspunkte hättest, könnte ich vielleicht hier in der Stadt…«
McGraw zuckte die Schultern.
»Anhaltspunkte? Wenn ich die hätte, Mont, wäre ich mit meinen Leuten längst losgeritten und hätte mit den richtigen Burschen ein kleines Feuerwerk veranstaltet!«
Er schlug grimmig die Faust gegen den Türrahmen.
»Aber da ist nichts! Nicht der kleinste Fingerzeig! Ich weiß nur, dass einige hartgesottene Kerle darauf aus sind, mich und meine Ranch zu erledigen! Warum? Keine Ahnung! Die ganze Sache ist wie verhext! Mont, man kann nicht gegen Feinde kämpfen, die man nicht kennt!«
Der Town Marshal von Yellow Flat räusperte sich.
»Vielleicht solltest du deine Horseshoe-Ranch verkaufen, Abe.«
»Was?« Die Stimme des Ranchers wurde heftig.
»Verkaufen? Ich? Niemals, Mont!«
»Vielleicht könnte man auf diese Weise den Mann herausfinden, der hinter allem steckt«, gab Tucker zu bedenken.
»Wenn jemand daran interessiert ist, dich von deinem Besitz zu vertreiben und die Ranch selbst zu übernehmen, well, dann würde er sich doch melden, nicht wahr?«
»Das mag sein!«, brummte Abe MacGraw. »Nur – ich verstehe nicht, dass irgendwem an meiner Ranch gelegen sein könnte. Und noch was, Mont, niemand ist bisher mit einem Kaufangebot an mich herangetreten, und das wäre doch das Nächstliegende gewesen, oder? Mont, ich werde das Gefühl nicht los, dass diese verwünschten Banditen keine Ruhe geben, bis sie mich unter die Erde gebracht haben.«
»Rache also?«
»Ich wüsste nicht, Mont! Ich habe keine persönlichen Feinde!«
Er machte eine resignierte Handbewegung.
»Lassen wir es, Mont! Es ist sinnlos, wenn wir alle möglichen Vermutungen anstellen, die zum Schluss doch nicht stimmen.«
Er öffnete die Officetür.
»Well, Mont, gute Nacht!«
»Gute Nacht, Abe!«, rief Tucker ihm nach.
Steifbeinig stieg McGraw die Verandastufen hinab, überquerte schräg die Straße und näherte sich dem Haltegeländer vor dem Silberspur-Saloon, wo er sein Pferd angebunden hatte. Aus dem Saloon kam Stimmengewirr, Klaviergeklimper und das helle Lachen der Tanzmädchen.
Doch plötzlich hatte McGraw nur noch Ohren für das rasende Trommeln, das sich aus der Nacht dem Ortseingang von Yellow Flat näherte.
Das Hufgetrappel schwoll an, und Sekunden später sah der Rancher einen Reiter in die spärlichen Lichtbahnen brechen, die noch über der Main Street lagen. Tiefgeduckt saß der Mann im Sattel und spornte unbarmherzig das Pferd an.
Der Reiter zügelte den Gaul vor dem Silberspur-Saloon so heftig, dass das Tier in die Flanken knickte. Mit einem Satz war der Mann aus dem Sattel.
Er taumelte, einen Moment schien es, als würde er stürzen, dann hatte er sich bereits gefangen und hielt sich mit einer Hand am Steigbügel fest.
Sein breitflächiges schnurrbärtiges Gesicht war über und über mit Schweiß bedeckt. Das strähnige Haar hing ihm verklebt in die Stirn. Von einem Riss an der linken Schläfe tropfte ihm Blut auf die Wange.
»Boss!« ächzte er. »Boss …«
»Mike!« McGraw packte ihn an den Schultern.
»Ihr habt gekämpft, Mike?«
Mike Holmans Gesicht war aschfahl.
»Gekämpft?«, würgte er hervor.
»Boss, das war kein Kampf, das war ein Gemetzel! Wir hatten keine Chance, Boss! Es war eine Falle, eine hinterhältige, gemeine Falle! Und sie gaben keinen Pardon!«
Abe McGraws Fäuste fielen herab.
»Mike! Das… das heißt doch nicht…«
Mike Holman vermied es, dem brennenden Blick des Ranchers zu begegnen.
»Mike!«, flüsterte McGraw. Die schreckliche Ahnung ließ seine Stimme zittern.
»Was ist mit den anderen – mit Ken, Toby und Hai? Was ist mit ihnen? Mann, rede doch endlich!«
»Tot, Boss!«, murmelte Holman. »Alle tot! Und auch Tom und Jim, die auf der Weide waren, hat es erwischt! Boss, es ist schlimm – ich bin der letzte Mann der Crew!«
Eine ganze Weile fiel kein Wort mehr. Sie standen einander auf der Straße gegenüber und starrten sich an, Bestürzung, Bitterkeit und Verzweiflung auf den Gesichtern. Und drinnen im Saloon wurde noch immer gelacht, und eine heisere Männerstimme begann ein Lied zu grölen, als die Klänge des Klaviers wieder einsetzten.
McGraws Blick irrte die Straße entlang zur dunklen Prärie.
»Sie haben es also geschafft!«, sagte er brüchig. »Mit einem Schlag haben sie es geschafft! Diese Mörder! Ich bin am Ende, Mike!«
Er seufzte schwer.
Holman schreckte aus seiner Reglosigkeit. Er stieß sich vom Pferd ab.
»Boss«, sagte er hastig, »ich bin verfolgt worden! Ich fürchte, dieses Mordpack wagt sich sogar hierher in die Stadt! Es sieht so aus, als wollten sie in dieser Nacht reinen Tisch machen! Die geben erst Ruhe, wenn sie…«, er stockte.
McGraw nickte grimmig.
»Wenn sie mich unter die Erde gebracht haben! Das hab’ ich heute Abend schon einmal gesagt!« Seine Mundwinkel verkniffen sich.
»Mike, geh zum Marshal und sag ihm Bescheid!«
»Wäre es nicht besser, Boss, Sie würden von hier …«
Die Schultern des graubärtigen Ranchers strafften sich.
»Ich laufe nicht davon, Mike! Sollen sie nur kommen – ich werde bereit sein!«
Es sah aus, als wollte Holman noch etwas sagen. Aber dann entdeckte er die harte Entschlossenheit in McGraws Augen und schwieg. Achselzuckend fasste er sein abgehetztes Pferd an den Zügeln und führte es die Straße entlang zum Marshal’s Office.
Abe McGraw blieb allein mitten auf der Main Street vor dem Silberspur-Saloon zurück, breitbeinig, aufrecht, die Daumen in den breiten Revolvergurt gehakt. So spähte er die Straße entlang in die Richtung, aus der Mike Holman gekommen war. Seine Reglosigkeit zerfloss erst, als drinnen im Saloon schlagartig jeder Laut verstummte.
Sekunden später war das Zerklirren eines Glases über die halbhohen Pendeltüren zu hören – und dann krachte ein Revolverschuss.
3. Kapitel
Gelassen legte Lee Jackson seine Karten auf den mit grünem Samt überzogenen Tisch.
»Tut mir leid, Gents, die Runde geht wieder an mich!«
Er zog langsam die Einsätze zu dem Häufchen aus Münzen und Geldscheinen herüber, die sich bereits neben seinem Whiskyglas angesammelt hatten.
»Teufel, Mann!«, knurrte der Rancher neben ihm.
»Als Sie das Pokern lernten, hat man vergessen, Ihnen auch das Verlieren beizubringen!«
Er griff seufzend nach seinem Glas und leerte es mit einem schnellen Ruck.
Außer dem Rancher saßen noch ein junger Cowboy und ein Mexikaner mit Lee Jackson am Spieltisch. Die Blicke aus den schwarzen Augen des Mexikaners waren auf das Geld vor Lee gerichtet. In dem dunklen schmalen Gesicht des Mannes zuckte es nervös.
Lee war lange genug Spieler und kannte die Zeichen.
Der Mexikaner hatte an diesem Abend dauernd verloren – über die Hälfte von Lees Gewinn stammte von ihm. Der Mann brachte es kaum noch fertig, seine Wut zu verbergen. Noch eine Weile, und die Explosion würde erfolgen!
Lee räusperte sich.
»Es ist schon spät, Gentlemen. Ich schlage vor, wir machen Schluss für heute. Einverstanden?«
Der junge Cowboy erhob sich sofort.
»Einen besseren Vorschlag konnten Sie gar nicht machen, Jackson! Ich möchte nicht als armer Mann heimreiten!« Er grinste schwach, nickte den anderen zu und schlenderte zwischen den tabakqualmverhängten Tischreihen zur langen Theke hinüber.
Ringsum toste das dumpfe Stimmengewirr. Der hohlwangige Klavierspieler krempelte seine Hemdsärmel auf und hämmerte wieder auf die Tasten ein. Ein vollbärtiger angetrunkener Weidereiter begann lautstark zu grölen. Aus den mit Perlenschnüren verhängten Nischen, in denen rote Lampions brannten, kam das helle Lachen einiger Tanzmädchen.
»Und Sie, Gents?« Lee schaute den Rancher und den Mexikaner fragend an.
Der Mexikaner schüttelte sofort den Kopf.
»Nein, Mister!«, sagte er in hartem Akzent. »Wir hören nicht auf! Ich will Revanche! Sie haben kein Recht, jetzt einfach mit dem ganzen Geld abzuhauen, capito?«
Lee Jackson lehnte sich auf dem Stuhl zurück – ein schlanker dunkel gekleideter Mann mit scharfgeschnittenem Gesicht und undurchdringlichen grauen Augen – ein typischer Spieler dem Äußeren nach.
»Ich habe dabei nicht an meinen Gewinn, sondern an Ihr restliches Geld gedacht, Señor!« erklärte er sanft.
Der Mexikaner rückte seinen breitrandigen, mit Stickereien verzierten Sombrero ins Genick. Rabenschwarzes Haar ringelte sich in seine Stirn. Seine Augen blitzten.
»Ich verzichte auf Ihre angebliche Besorgnis!«, fauchte er. »Ich will spielen!«
Lee warf dem Rancher einen Blick zu. Der hob die Schultern.
»Eine Runde halte ich noch mit.«
»Also gut!«, nickte Lee.
Seine schlanken gepflegten Hände griffen nach den Karten, mischten mit routinierter Geschicklichkeit und teilten dann flink aus.
»Wie hoch der Einsatz?«
»Zehn Dollar!« brummte der Rindermann.
»Einverstanden! Wer kauft?«
»Drei!«, sagte der Rancher und tauschte die Karten aus.
»Zwei!«, erklärte der Mexikaner, betrachtete stirnrunzelnd sein neues Blatt und fügte hinzu: »Ich erhöhe auf zwanzig!«
»Ich gehe mit!« Der Rancher schob einen neuen Geldschein über den Tisch.
Schweigend folgte Lee seinem Beispiel. Der Mexikaner warf ihm über die gefächerten Karten einen stechenden Blick zu.
»Und das Doppelte!«, sagte er gepresst.
Der Rancher schob seine Karten zusammen und warf sie auf den Tisch. »Ich passe!«
»Und Sie, Spieler?« Ein herausfordernder Unterton lag in der Stimme des Mexikaners.
»Ich gehe mit!«
»Bueno!«, sagte der Mexikaner siegesgewiss. »Legen wir auf!«
Er breitete die Karten auf den grünen Samt: zwei Asse, zwei Könige, eine Dame – ein gutes Blatt. Ein überlegenes Lächeln auf den Lippen, streckte er eine Hand nach dem Einsatz aus.
»Moment, Señor!«, sagte Lee ruhig.
Die Hand des Mexikaners zuckte zurück, als habe sie glühendes Eisen berührt. Sein Oberkörper neigte sich nach vorne.
»Sie haben mein Blatt noch nicht gesehen«, erklärte Lee gelassen und legte auf.
Er besaß das Kreuz-As und König, Dame, Bube und Zehn der gleichen Farbe.
»Großer Rauch, auch das noch!«, stieß der Rancher verblüfft hervor. »Ein Flush!«
Das dunkle Gesicht des Mexikaners färbte sich grau.
Er sprang so heftig hoch, dass sein Stuhl polternd nach hinten kippte.
Der Rancher schnaufte erschrocken, stand schnell auf und glitt vom Tisch zurück.
Nur Lee blieb sitzen, ruhig, unbewegt, beide Hände lässig auf dem Tisch. Kühl schaute er zu dem Mexikaner hoch.
»Ich kann mich erinnern, Sie gewarnt zu haben, Caballero!«
»Aber nicht vor Ihrem Falschspiel!«, schrie der Mexikaner.
Mit einem Schlag verstummte ringsum an den Tischen alles Stimmengewirr. Die zuckenden Finger des Klavierspielers entlockten dem Instrument noch einen schrillen Misston, dann war es totenstill im Saloon. Alle Augenpaare waren auf den Tisch gerichtet, an dem Lee dem aufgebrachten Mexikaner ruhig gegenüber saß.
»Das ist ein schlimmes Wort«, sagte Lee sanft. »Ein Mann, der seinen Lebensunterhalt am Spieltisch verdient, kann das nicht auf sich sitzen lassen!«
»Caramba!«, brüllte der Mexikaner. »Was wollen Sie denn, he?«
»Dass Sie es schleunigst zurücknehmen!«, erklärte Lee fest und blieb unbeweglich sitzen.
»Zurücknehmen?«, wiederholte der Mexikaner. »Hast du den Verstand verloren, Gringo? Den ganzen Abend hast du keine zehn Dollar verspielt! Und das soll mit rechten Dingen zugehen? Ich wiederhole, du bist ein Falschspieler, Hombre! Und ich will mein Geld zurück – mein ganzes Geld!«
Lee blickte den Mexikaner eiskalt an.
»Dann hol es dir doch, Muchacho!«, sagte er leise. »Los, hol es dir doch!«
Einen Moment schien sein Gegenüber unsicher zu werden, schien ihm die Gefahr in den eisigen Augen des Spielers ganz deutlich.
Aber dann war er sich wieder der vielen Zuschauer und seines hohen Spielverlustes bewusst. Hass flammte in seinen Augen auf.
Seine Rechte zuckte zum Holster, schloss blitzschnell um den Revolverkolben und riss die Waffe heraus.
Lee packte die Tischkante mit beiden Händen und warf den Tisch schräg gegen seinen Gegner. Das Splittern von Glas war zu hören. Dann peitschte bereits der Schuss aus dem Revolver des Mexikaners.
Der Anprall des Tisches hatte den Mexikaner rückwärts geworfen. Die Kugel jaulte schräg in die Höhe und bohrte sich ins Holz der Decke. Der Mexikaner fing sich, sein Revolver ruckte und spie einen zweiten Feuerstrahl.
Doch Lee Jackson saß nicht mehr auf dem Stuhl.
Geschmeidig war er zur Seite geschnellt. Seine nervige Hand war unter dem Schoß seines langen dunklen Rockes verschwunden, und als sie wieder zum Vorschein kam, hielt sie einen kurzläufigen 36er Remington Colt umklammert.
Sein Schuss vermischte sich mit dem zweiten Krachen des Revolvers seines Gegners.
Die Kugel des Mexikaners pfiff an Lee vorbei, verfehlte um Haaresbreite den Kopf des kreidebleichen Barkeepers und zerschmetterte den Spiegel zwischen den hohen Flaschenregalen. Der Mexikaner schrie gellend auf. Seine Waffe wirbelte in hohem Bogen durch die Luft und verschwand scheppernd unter einem Tisch.
Der Mann wich keuchend zurück, bis er gegen eine Tischkante stieß. Er hatte die linke Hand gegen den rechten Unterarm gepresst. Zwischen seinen Fingern färbte sich der Stoff seines Hemdes dunkel von Blut.
Langsam richtete sich Lee auf. Ein hellgrauer Rauchfaden kräuselte vor der Mündung seines 36ers. Kalt schaute er dem Mexikaner in die Augen.
»Geh jetzt, Hombre, und überleg es dir beim nächsten Mal, ehe du einen Mann wieder des Falschspiels bezichtigst! Geh, die Sache dürfte damit erledigt sein!«
»Irrtum, Gringo!«, rief jemand hinter ihm.
»Wir denken gar nicht daran, dich so davonkommen zu lassen! Wir werden dir zeigen, wie groß du in Wirklichkeit bist, verfluchter Kartenhai! Weg mit deinem Schießeisen, sonst bekommst du unser heißes Blei mitten in deinen Schädel!«
4. Kapitel
Die Stille im Silberspur-Saloon war bleischwer. Die Umstehenden stauten den Atem, niemand rührte sich. Lee wusste ganz genau, dass kein Bewohner dieser Stadt und kein Rancher und Cowboy aus der Umgebung für ihn Partei ergreifen würde. Er war fremd in Yellow Flat – und er war ein Spieler. Das waren Dinge, die ihn zum Einsamen stempelten.
Er stand ganz starr. Über das Gesicht des verletzten Mexikaners vor ihm lief ein wildes Zucken.
»Pancho! Diego!«, schnaufte er, »Worauf wartet ihr noch? Gebt es diesem verwünschten Falschspieler! Seht ihr nicht, dass er mich getroffen hat?«
»Ruhig, Felipe, ganz ruhig!«, sagte eine raue Stimme hinter Lee. »Wir geben ihm schon, was ihm zusteht – aber auf unsere Art, capito?«
Die sägemehlbestreuten Dielen ächzten unter schweren Tritten.
Langsam wandte Lee den Kopf.
Durch die blaugrauen Rauchschwaden, die über den Tischen lagerten, sah er zwei hünenhafte Männer aus dem Hintergrund des Raumes auf sich zukommen. Ihre dunkelbraunen Gesichter und ihre Kleidung verrieten ihm, dass sie ebenfalls Mexikaner waren. Jeder hielt einen Revolver auf ihn gerichtet; Ihre Mienen zeigten finstere Entschlossenheit.
»Hast du nicht gehört, Gringo?«, knurrte der eine.
»Weg mit dem Eisen, sofort!«
Lee drehte sich ganz. Der Verwundete war jetzt keine Gefahr mehr für ihn. Jetzt zählten nur diese beiden dunkelgesichtigen Hünen. Er ahnte, was sie planten. Sie waren Männer, deren Gefährlichkeit in den Fäusten steckte. Wenn sein Colt erst einmal auf den Brettern lag, würden sie wie angeschossene Grislybären über ihn herfallen.
Aber es blieb ihm keine Wahl. Gegen zwei schussbereite Eisen kam der schnellste Colt nicht an!
Lees Gesicht wirkte wie aus Stein gemeißelt, als er den 36er zu Boden poltern ließ.
Über die Gesichter der beiden großen Mexikaner glitt ein Grinsen. Sie steckten ihre Revolver in die Holster.
»Bueno, Spieler, du bist ein kluger Mann! He, Felipe, sieh gut zu, wie wir mit diesem Hombre fertig werden! Und nimm das Geld an dich – alles, damit auch für uns etwas abfällt, Amigo!« Der Sprecher lachte.
Nebeneinander kamen sie auf Lee zu, die Arme angewinkelt, die Fäuste geballt. Die grellfarbenen Seidenhemden spannten sich über ihren muskulösen Schultern.
Lee trat vom Spieltisch weg an den freien Platz vor der Theke. Schweigend wartete er. Da waren nur die schabenden Tritte der beiden Mexikaner in der abgrundtiefen Stille.
»Angst, Kartenhai?«, fragte der linke Mexikaner grinsend.
»Wenn ihr kämpfen wollt, dann tut es!«, knurrte Lee. »Haltet euch nicht durch lange Vorreden auf!«
»Also doch Angst!«, sagte der Mexikaner. »Weißt du auch, dass Diego und ich noch niemals besiegt wurden, wenn wir zusammenarbeiteten?«
»Das kommt daher, weil ihr von Fairness nicht viel haltet!«, sagte da plötzlich eine fremde Stimme.
Die Köpfe von Lees Gegnern ruckten herum.
Ein Mann war durch den Kreis der stummen Zuschauer gebrochen und stand aufrecht und breitbeinig am Ende der messingbeschlagenen Theke. Er war groß, sehnig und besaß breite Schultern. Sein sonnengebräuntes Gesicht wirkte hart und verwegen. Das Auffälligste an ihm war der patronenbespickte Kreuzgurt, an dem zwei tiefgeschnallte Holster hingen.
Er war ein Buscadero – ein Zweihandschütze. Und die beiden langläufigen 45er Colts lagen wie hingeschmolzen in seinen Fäusten.
»Diablo!«, schnaufte Pancho. »Halt dich da raus! Das ist nicht deine Sache!«
»Ich kann sie zu meiner machen!«
»Warum solltest du, Hombre?«, knurrte Pancho. »Nur ein Narr würde das tun!«
»Oder ein Mann, dem es nicht gefällt, wenn zwei Bullen wie ihr über einen einzelnen herfallen!«
»Ich warne dich, Hombre!«
»Nur zu! Reden kannst du, so lange du willst!« Der Fremde lächelte. »Aber vergiss nicht, du mexikanischer Büffel: Wenn einer von euch eine Dummheit macht, werden meine Colts das letzte Wort behalten! Das ist ein Versprechen!«
Die beiden Mexikaner tauschten einen schnellen Blick. Dann murrte Pancho finster: »Ich sehe, du bist ein Pistolero! Auch für den besten Mann schlägt einmal die Stunde der Niederlage!«
»Vor allem, wenn eine Kugel oder ein Messer aus dem Hinterhalt kommen, ich weiß!« Der Fremde nickte grimmig. Seine blauen Augen funkelten.
»Mein Lieber, lass das nur meine Sorge sein! Gegen die Tatsache, dass momentan die Trümpfe bei mir liegen, kommst du nicht an, oder?«
»Mister«, sagte Lee Jackson schnell, »ich bin Ihnen sehr dankbar! Aber ich möchte nicht, dass Sie meinetwegen Kummer bekommen!«
»Kummer?«, fragte der Buscadero breit lächelnd. »Manche Menschen können ohne die richtige Art von Kummer einfach nicht leben! Nehmen Sie ruhig an, dass ich dazu gehöre!«
»Was verlangen Sie?«, knurrte Pancho.
»Nicht viel, nur einen fairen Kampf, wenn man von fair überhaupt sprechen kann bei eurer Kleiderschrankgröße! Well, ich will nur, dass dein Compadre schön ruhig und brav bleibt und du die Sache alleine austrägst! Das ist alles!« Und zu Lee sagte er: »Ich hoffe, Sie verübeln mir das nicht! Aber das Recht zu seinem Kampf will ich ihm nicht nehmen! Schließlich leben wir im Westen, nicht wahr?«
»Das habe ich keine Sekunde in meinem Leben vergessen!«, erwiderte Lee mit kaltem Lächeln. »Ich stehe auch dann noch in Ihrer Schuld!«
»Nach einer halben Stunde denkst du anders darüber, Gringo!«, knurrte Pancho wild, schwang die Arme hoch und sprang vorwärts.
Lee duckte sich blitzschnell und wich zur Seite aus. Aber der Mexikaner war schneller, als man es seiner schweren Figur zugetraut hätte. Er warf sich herum, und schon sauste seine geballte Rechte wieder nach vorne.
Lee riss den Kopf nach rechts. Aber ganz konnte er nicht mehr ausweichen. Schmerzhaft streifte die Faust seinen Kopf. Lee taumelte gegen einen Stuhl. Pancho schrie etwas, und im nächsten Moment knallte seine Linke dem Spieler mitten in den Leib.
Lee blieb die Luft weg. Seine Beine gaben plötzlich unter ihm nach. Den Stuhl umreißend, stürzte er zu Boden. Wie aus weiter Ferne hörte er die Stimme des Mannes, den er vorhin verwundet hatte.
»Weiter, Pancho! Gib es ihm!«
Der Hass und die Erbarmungslosigkeit dieser Stimme, jagten eine Welle eisigen Zorns in Lee Jackson hoch.
Mit zusammengebissenen Zähnen rollte er herum – und entging damit knapp einem Stiefeltritt seines bärenstarken Gegners. Ganz automatisch packten seine Fäuste zu, erwischten das vorstoßende Bein des Mexikaners und rissen es über sich weg. Der Mann brüllte auf, verlor das Gleichgewicht und kippte mit rudernden Armen hintenüber.
Ein Tisch stürzte um. Scherben klirrten. Der Ring der Zuschauer weitete sich hastig.
Keuchend kam Lee auf die Füße. Vor ihm richtete sich Pancho schwitzend auf die Beine. Hass loderte in seinen Augen, die wie gebannt auf Lee gerichtet waren.
»Bisher hast du Glück gehabt, Gringo!«, schrie er.
»Aber jetzt…«
Seine Haltung spannte sich zu einem neuen Angriff.
Ehe er sich erneut vorwärts werfen konnte, kam ein eindringlicher Ruf vom Salooneingang her.
»Genug, Pancho! Mach sofort Schluss, hörst du?«
Ein überraschtes Gemurmel durchlief die Reihen der Umstehenden. Lee war nicht weniger erstaunt. Trotz seiner Benommenheit, trotz des Hämmerns in seinen Schläfen, hatte er ganz genau erkannt, dass die Stimme einer Frau gehörte.
Pancho ließ sofort die Fäuste sinken.
Im Kreis der Saloongäste öffnete sich eine Gasse, die schnurgerade von der Theke zum Eingang führte. Am Rande dieses Korridors stand eine Frau vor den ausschwingenden Pendeltüren – eine junge Mexikanerin in knöchellangem Kleid, mit einer Spitzenmantille um den Schultern.
Ihr braunes Haar glänzte seidig. Sie war zwar keine Mexikanerin, schien aber doch mexikanischer Abstammung zu sein. In ihrem schönen Gesicht stand der Stolz. Für etliche Augenblicke vergaß Lee, was geschehen war. Er musste sich gestehen, dass er kaum zuvor eine Frau von solcher Schönheit gesehen hatte. Gerade hier in dieser einsamen kleinen Rinderstadt nahe der mexikanischen Grenze wirkte ihr Erscheinen völlig überraschend.
»Ich hoffe, Señores«, sagte die Frau erstaunlich selbstbewusst, »es ist nichts Schlimmes passiert! Pancho, mein Vater erwartet euch!«
»Si, Señorita!«, nickte Pancho sofort. Er drehte sich von Lee ab, als existierte der Spieler nicht mehr für ihn.
Diego räusperte sich und schob sich hastig an seine Seite.
Nur Felipe, den Lees Kugel am rechten Arm gestreift hatte, überwand seinen Hass nicht.
Mit der gesunden Linken deutete er auf Lee und rief schrill: »Señorita, dieser Mann ist ein Falschspieler! Er hat mich um mein ganzes Geld betrogen …«
»Das ist nicht wahr!«, unterbrach ihn Lee rau.
»Und wenn du jetzt noch in der Lage wärest, zum Eisen zu greifen, müsstest du es nochmals tun! – Entschuldigen Sie, Señorita, aber kein Mann lässt sich gerne als Verbrecher hinstellen!«
»Felipe ist ein Hitzkopf«, sagte die junge Frau.
»Wenn ich etwas gutmachen kann, dann…«
»Nein, Ma’am!«, erwiderte Lee steif. »Ich kann mir mein Recht selbst verschaffen, wenn es darauf ankommt!«
»So sehen Sie aus!«
Der Anflug eines Lächelns kräuselte ihre feingeschwungenen roten Lippen.
Lee schaute in ihre ausdrucksvollen Augen, und sekundenlang war ihm die Kehle wie zugeschnürt.
»Ich hoffe, ich habe mich nicht falsch ausgedrückt, Ma’am«, murmelte er rau.
»Ich danke für Ihr Angebot, aber es ist alles geregelt!«
»Gut!«, sagte die Frau dunkel.
»Mein Stiefvater ist sehr darauf bedacht, dass seine Leute sich nichts zuschulden kommen lassen! Wenn etwas ist, wenden Sie sich ruhig an ihn, Señor.«
»Jackson – Lee Jackson!«, stellte sich der Spieler mit einer angedeuteten Verbeugung vor.
»Mein Name ist Maria – oder wie die Amerikaner sagen Mary Alvaro!« Wieder war dieses flüchtige Lächeln auf ihren Lippen.
»Mein Stiefvater ist Don Vincento de Savilla. Sie finden ihn im Alamo-Hotel. Buenas noches, Señores!«
»Gute Nacht!«, antwortete Lee rasch.
Da hatte sie sich bereits abgewandt und war hinausgetreten. Pancho, Diego und als Letzter Felipe folgten ihr. Als ihre Schritte auf der Saloonveranda verklungen waren, setzte erregtes Stimmengewirr ein.
Lee starrte nachdenklich auf die pendelnden Schwingtüren.
»Eine bemerkenswerte Frau, wie?«, sagte eine bekannte Stimme neben ihm.
Lee schreckte auf.
»Ah, mein freundlicher Helfer von vorhin! Darf ich Sie zu einem Drink einladen?«
»Das ist eine Sache, die ich niemals ausschlage!«, erwiderte der sehnige Fremde lächelnd.
Sie schlenderten zur Theke, wo sich die anderen Gäste drängten. Bereitwillig wurde ihnen Platz gemacht. Lee bestellte zwei Whisky. Sie tranken einander zu.
»Ihren Namen habe ich vorhin gehört«, sagte der Buscadero, als er das leere Glas auf die Theke stellte. »Es wäre unfair, Ihnen meinen zu verschweigen! Schließlich müssen Sie doch wissen, an wen Sie ihre Drinks ausgeben! Well, ich bin Chad Kelley – und der nächste Whisky geht auf meine Rechnung!«
Er winkte dem Keeper, die Gläser zu füllen.
»Kennen Sie diese Lady – Mary Alvaro?«, fragte Lee wie beiläufig.
Kelley warf ihm einen schnellen Blick zu und zeigte wieder sein blitzendes Lächeln.
»Sie gefällt Ihnen, was?«
»Nennen Sie mir den Mann, auf den sie nicht Eindruck machen würde!«, antwortete Lee achselzuckend.
»Stimmt, Jackson! Ich weiß von ihr nur, dass sie vor zwei oder drei Tagen mit ihrem Stiefvater Don Vincento de Savilla nach Yellow Flat kam. Don Vincente scheint ein reicher Haziendero aus Mexiko zu sein, vielleicht auf der Flucht. Sie wissen ja, dass es südlich der Grenze dauernd gärt und brodelt. Politik ist da drüben eine höllisch heiße Sache. Außer den drei Kerlen, die Sie vorhin kennenlernten, arbeitet ein vierter Mann für den Don. Sie haben ein paar Frachtwagen auf dem Hotelhof abgestellt. Wohin sie wollen, weiß ich nicht.«
»Sind Ihre Informationen immer so gut, Kelley?«
Kelley zuckte die Achseln.
»Ein Mann wie ich muss seine Augen offenhalten.«
Er ging nicht näher auf die Bedeutung seiner Worte ein, griff schnell zum nachgefüllten Glas und prostete dem Spieler zu.
Ein neu hinzugekommener Mann schob sich näher. Er legte seine schwielige Rechte auf Lees Schulter.
»Ich habe vorhin alles mit angesehen. Sie sind ein guter Kämpfer, Jackson!«
Lee schaute in ein graubärtiges, wettergegerbtes Gesicht. Er hatte den Mann seit seiner Ankunft in Yellow Flat noch nie gesehen. Seine Miene wurde undurchdringlich – das übliche Pokergesicht.
»Wer weiß, wie es geendet hätte, wenn die Frau nicht gekommen wäre!«, antwortete er.
Der andere musterte ihn prüfend.
»Sie hätten ihn besiegt!«, sagte er entschieden. »Ich weiß es ganz genau, Jackson – Sie hätten ihn aufs Kreuz gelegt!«
»Belassen wir es also dabei!«, erwiderte Lee achselzuckend.
»Sie halten mich für aufdringlich, wie? Keine Sorge! Alles, was ich will ist eine Pokerpartie – keine langen Reden und keine Einladung zum Drink.«
»Pokern?«, wiederholte Lee befremdet.
»Es ist spät! Und nach der Sache von vorhin…«
Der Blick des Graubärtigen hing unverwandt an ihm. Irgendetwas Seltsames strahlte von diesem Mann aus, und da Lee keine Erklärung dafür fand, fühlte er sich leicht beunruhigt.
»Sie halten sich viel im offenen Land auf, Jackson, nicht wahr?«, fragte der Bärtige unvermittelt.
»Wie kommen Sie darauf?«
»Ihre Sonnenbräune lässt darauf schließen. Und an Ihren Reitstiefeln sieht man, dass Sie im Sattel ebenso daheim sind wie am Spieltisch.«
»Mister, worauf wollen Sie hinaus?«
»Ich habe den Eindruck, Sie sind auf freier Weide aufgewachsen, Jackson.«
»Zum Kuckuck, das stimmt! Ihre Beobachtungsgabe in Ehren, Gentleman, aber wollen Sie nicht endlich …«
Der Bärtige beugte sich vor. Seine Miene zeigte eine fast wilde Eindringlichkeit.
»Jackson, haben Sie niemals den Wunsch verspürt, Ihr Spielerleben mit dem Dasein auf offenem Weideland zu vertauschen? In die Welt zurückkehren, aus der Sie stammen? Jackson, geben Sie mir darauf eine ehrliche Antwort!« Beinahe betroffen schaute Lee dem anderen ins Gesicht.
Dieser Fremde, der wie ein Rancher aussah, dessen Fäuste von Lassonarben bedeckt waren – dieser Mann hatte ausgerechnet die Seite getroffen, die er – Lee Jackson – vor allen anderen Menschen erfolgreich geheim gehalten hatte. Für einige Sekunden vergaß Lee, wo er sich befand.
Zum ersten Mal packte ihn der alte Traum, den er manchmal in der Dunkelheit seiner kargen Hotelzimmer träumte, mitten im Gebraus der Stimmen, in den Schwaden des Tabakrauchs, die vom Licht der Petroleumlampen durchtränkt waren.
Da lag plötzlich das grüne Weideland vor ihm, da waren die niedrigen Gebäude einer kleinen Ranch vom Sonnenschein umflort, Rinder muhten hinter den Hügeln, in den Korrals weideten struppige Gäule, und der Wind trug den Duft von Salbei und Holzkohlerauch mit sich.
»Die Antwort, Jackson!«, brach die Stimme des Graubärtigen in seine Versunkenheit ein.
»Die Antwort!«
»Ich kann nur sagen, Sie scheinen Hellseher zu sein!«, erklärte Lee mit einem abweisenden Unterton.
Der andere schien das nicht zu hören.
Er seufzte fast erleichtert.
»Ich habe also recht! Gut, sehr gut! Jackson, kommen Sie jetzt! Kommen Sie zum Pokern!«
»Ich verstehe nicht …«
»Jackson«, sagte der andere schwer, »mein Name ist Abe McGraw, und ich biete Ihnen die einmalige Chance, beim Pokern die Hälfte einer Ranch zu gewinnen!«
Lee Jackson schaute McGraw an, als habe er nicht recht gehört. Der Rancher lächelte grimmig.
»Ich bin weder betrunken noch verrückt, Jackson! Und es ist auch kein Witz! Ich meine es ernst, todernst! Gehen wir also zu Ihrem Spieltisch?«
Neben McGraw erschien ein breitschultriger schnurrbärtiger Mann in Weidereitertracht. Er musterte Lee schief und knurrte leise: »Boss, das sollten Sie nicht tun! Was versprechen Sie sich davon, Boss?«
»Eine ganze Menge, Mike«, erwiderte Abe McGraw, ohne Lee aus den Augen zu lassen. »Dieser Mann ist ein Kämpfer, Mike! Ich könnte keinen besseren Partner für die Horseshoe-Ranch finden!«
Lee Jackson räusperte sich.
»Ich fange langsam an, ein bisschen zu verstehen, McGraw. Es sieht wohl so aus, dass Sie eher einen Revolvermann als einen Partner brauchen, wie?« McGraws bärtiges Gesicht wurde hart.
»Ein Mann, der eigenes Land und eigene Rinder besitzt, wird dafür besser kämpfen als einer, der dafür nur klingende Münze erhält. Das ist meine Rechnung.«
»Und sie scheint auch aufzugehen!«, sagte Lee, den Anflug eines Lächelns auf den Lippen.
»Nur – warum überhaupt das Spiel, McGraw?«
»Weil Sie meiner Meinung nach ein Mann sind, der nichts geschenkt haben will, Jackson! Wenn Sie gewinnen, sieht die Sache anders aus. Oder täusche ich mich?«
Eine Weile blickte Lee dem Rancher schweigend ins Gesicht. Dann sagte er langsam: »Sie werden mir allmählich unheimlich, McGraw. Well, gehen wir lieber zum Spieltisch. Vielleicht geben mir die Karten das Gefühl der Sicherheit zurück.«
»Boss«, sagte Mike Holman schnell zum Rancher, meinen Sie wirklich, das ist richtig? Dieser Mann ist ein Berufsspieler – kein Rindermann. Wenn er erst herausbekommt, was da draußen auf der Weide auf ihn wartet…«
»Ich denke«, unterbrach ihn McGraw ruhig, »er hat schon die richtige Ahnung davon. Lass das nur meine Sorge sein, Mike.«
Er fasste Lee am Ärmel.
Lee langte in die Tasche und warf ein paar Münzen auf die Messingplatte der Theke. Sein Blick streifte Chad Kelley. Der Buscadero grinste scharf.
»Ein Abend voller Überraschungen, wie, Jackson? Ich bin gespannt, was noch alles geschieht, ehe die letzte Lampe in diesem netten Saloon gelöscht wird!«
Er nickte Lee zu, als sich dieser mit McGraw entfernte.
»Viel Glück, Jackson! Und wenn Sie es in der nächsten halben Stunde tatsächlich schaffen sollten, Rancher zu werden, dann vergessen Sie den guten alten Kelley nicht! Der steckt nämlich mitten in einer tristen Flaute und würde sogar für einige Wochen Lasso und Brenneisen zur Hand nehmen, um seine Kasse aufzubessern.«
Er ließ sich vom Keeper einen neuen Drink einschenken und drehte sich lächelnd eine Zigarette.
Mike Holman folgte Lee und dem Rancher zum Tisch. Als sich die beiden setzten, blieb er stehen. Finstere Falten furchten seine Stirn.
McGraw blickte kurz zu ihm hoch.
»Mike, es ist besser, du beziehst auf der Veranda Stellung. Das Spiel soll nicht gestört werden, du verstehst schon!«
»Und ob ich verstehe!«, brummte Holman.
»Das ist schon eine Sache! Sie setzen sich hier seelenruhig zu einer Pokerpartie – und draußen schleichen vielleicht schon die Burschen herum, die…«
»Schon gut, Mike! Geh jetzt!«
Zum ersten Mal hörte Lee Unruhe aus der Stimme des Ranchers.
Holman zuckte die Schultern und stapfte zwischen den Tischreihen davon.
»Fangen Sie an, Jackson!«, forderte McGraw heiser.
Lee hatte seine schlanke Rechte auf das Kartenpäckchen gelegt, mischte aber noch nicht. Sein Blick bohrte sich in die Augen seines Gegenübers.
»Die Sache, in die Sie mich hineinziehen wollen, McGraw, ist vielleicht schlimmer als Sie zugeben wollen, wie?«
»Kann sein!«, brummte der Rancher. »Aber bedenken Sie, Jackson – eine bessere Chance erhalten Sie nie mehr! Durch ehrliches Spiel gewinnen Sie niemals so viel Geld, um sich eine Ranch kaufen zu können. Und Sie sind doch ein ehrlicher Spieler, Jackson, das weiß ich. Auch wenn es nicht viele von Ihrer Sorte gibt!«
Lee atmete tief ein. Langsam nahm er das Kartenpäckchen hoch. Plötzlich kam ihm das alles verrückt und unwirklich vor. Noch war es Zeit, aufzustehen und diese ganze Sache abzubrechen, ehe es vielleicht zu spät war. Aber Rätsel und Risiken, das waren Dinge, die ihn von jeher gereizt hatten, wahrscheinlich war das mit ein Grund, weshalb er gerade Spieler geworden war. Und dann war noch dieses andere, dieser Gedanke, der ihn mehr aufwühlte als das härteste Spiel. Der Gedanke daran, über eigenes Land zu reiten, endlich ein Stück Erde zu besitzen, das er Heimat nennen konnte!
McGraw beobachtete ihn aufmerksam beim Mischen der Karten. Schweigend teilte Lee die Karten aus, für jeden fünf. Als er die übrigen Karten ablegte, sagte er: »Ich schlage vor, McGraw, wir spielen nur diese eine Partie! Lassen wir somit das Schicksal entscheiden! Gewinne ich, well, dann haben Sie einen neuen Partner – verliere ich, dann werde ich bleiben, was ich bin: ein Spieler!«
»Einverstanden, Jackson!«
Auf McGraws breiter Stirn standen plötzlich Schweißperlen.
Lee fächerte seine Karten auseinander.
McGraw sagte rau: »Ich möchte gern zwei kaufen!«
»Bedienen Sie sich!«
McGraws Hände bebten ein wenig, als er zwei Karten ablegte und dafür zwei andere nahm. Über sein Blatt weg schaute er Lee aus brennenden Augen an.
»Wollen Sie wirklich nur dieses eine Spiel?«
»Es ist seltsam«, lächelte Lee kurz. »Haben Sie nun Angst zu gewinnen, oder fürchten Sie jetzt doch, die Hälfte Ihrer Ranch an mich zu verlieren? Well, McGraw, nur dieses eine Spiel!«
»Die Spielernatur in Ihnen ist also doch sehr stark«, murmelte McGraw nachdenklich. »Legen wir auf?«
»Yeah!«, nickte Lee.
McGraw warf seine Karten auf die grüne Samtplatte. Der Schweiß ließ sein Gesicht glänzen. Ein fiebriges Flackern war jetzt in seinen Augen.
Er besaß ein As, einen König, zwei Damen und eine Zehn, kein so sehr schlechtes Blatt.
Jetzt wurde Lee klar, dass McGraw keineswegs seinen Entschluss bereute. Der Rancher fürchtete, zu gewinnen, das war es! Langsam breitete er sein eigenes Blatt auf.
»Ihre Befürchtungen waren grundlos, McGraw!«, sagte er leise.
Da lagen die übrigen drei Asse, ein König und eine Dame.
»Meine Glückssträhne ist heute nicht zu übertreffen!«, sagte Lee und schob die Karten zusammen.
»Drei Asse!«, seufzte Abe McGraw. »Und ich fürchtete schon, mein As würde Ihr Blatt übertreffen!«
Er schob den Stuhl zurück und erhob sich. Sein Blick fiel nochmals auf seine aufgelegten Karten und blieb an dem einen As hängen. Es war das Pik-As, das As des Todes, wie es der Aberglauben des Weidelandes nannte.
Eine scharfe Falte erschien jäh zwischen McGraws buschigen grauen Brauen. Dann schüttelte er den Kopf, als wolle er irgendwelche trüben Gedanken verscheuchen und streckte Lee über den Tisch hinweg seine Hand entgegen.
Ehe er etwas sagen konnte, kam von der Veranda Mike Holmans wilder Schrei: »Sie sind da, Boss! Vorsicht, sie…«
Die Worte gingen im rasenden Peitschen von Revolverschüssen unter.
Lee schnellte vom Stuhl hoch, schlug den Rockschoß zurück und holte den 36er Remington Colt aus dem Holster. Auf der anderen Tischseite wirbelte McGraw herum und zog ebenfalls.
Ein Fenster zersplitterte unter dem Anprall einer Kugel. McGraw machte einen Schritt auf die Tür zu, dann ließ er plötzlich seine Waffe fallen, griff sich aufstöhnend mit beiden Händen an die Brust und knickte nach vorn.
Mit einem Satz war Lee neben ihm.
»McGraw!«
Der Rancher fiel auf die Knie. Lee beugte sich zu ihm hinab.
McGraw drehte ihm mühsam das schweißnasse, fahl gewordene Gesicht zu. Die Worte kamen brüchig über seine Lippen.
»Kämpfen Sie, Jackson! Kümmern … Sie sich nicht um mich! Nehmen Sie… Ihr Eisen und kämpfen Sie!«
Dann kippte er zur Seite und blieb neben dem Tisch liegen, auf dem noch seine fünf Pokerkarten verstreut waren.
Draußen dröhnten wieder Schüsse in rasender Reihenfolge.
Eine Stimme brüllte etwas. Pferde wieherten, Hufgetrappel setzte ein. Kugeln splitterten in das Holz der Saloonwand.
Überall im Raum waren die Männer von ihren Plätzen hochgesprungen. Ein Teil wich an die Wände zurück, andere bewegten sich zögernd, die Waffen in den derben Fäusten, zu den Schwingtüren.
Lee rannte los.
Das Hufgetrommel donnerte draußen die Main Street hinab. Noch ein paar Schüsse fielen, dann, als Lee die Pendeltüren erreichte, verstummte das Schießen.
Holman stürzte in den Saloon und wäre beinahe mit Lee zusammengestoßen. Draußen polterten hastige Tritte auf den Verandastufen.
Holman schaute sich wild um. Das Haar hing ihm schweißverklebt in die Stirn. Sein Hemd war an der rechten Schulter von einer Kugel zerfetzt.
»Boss, wo sind Sie? Um Himmels willen, was ist …«
Er schenkte weder Lee noch einem der anderen Anwesenden einen Blick und stürmte zwischen den Tischen zum Pokertisch, an dem er McGraw zurückgelassen hatte. Ein Ächzen rang sich über seine Lippen, als er den Rancher am Boden liegen sah. Er kniete rasch nieder.
»Boss, wo hat es Sie erwischt?«
Er nestelte mit zitternden Fingern an McGraws Hemdknöpfen. Der Stoff auf McGraws Brust färbte sich dunkel, immer größer wurde der Fleck. McGraws Lider flatterten.
»Lass nur, Mike, lass nur!«, murmelte er matt. »Es ist… Wo ist Jackson?«
»Was kümmert Sie jetzt dieser Spieler, Boss?«
»Mike, er… hat gewonnen! Er ist …«
»Sie haben also Ernst gemacht, Boss?«, keuchte Mike Holman.
»Yeah, Mike! Hol jetzt Jackson her! Ich … muss ihn sprechen, ehe es mit mir …«
»Da bin ich, McGraw!«, sagte Lee über Holmans Schulter.
»Gut, Jackson!«, ächzte der Getroffene.
»Hören Sie zu, ich …« Er rang nach Atem, ehe er weitersprach.
»Sie haben vorhin gewonnen und … mit mir geht es zu Ende!«
»Sagen Sie das nicht, Boss!«, schnaufte Holman. »Der Doc wird gleich hier sein! Und dann …«
»Nein, Mike! Ich … brauch’ keinen Doc mehr! … Jackson, meine Rechnung ging also doch nicht… ganz auf. Sie werden nicht mein Partner sein… Diese Halunken waren schneller! Aber Jackson… ich will, dass Sie meinen Kampf fortsetzen, hören Sie?«
»Yeah, ich höre!«, sagte Lee heiser. »Sie … haben gewonnen, Jackson!«, murmelte McGraw schwach. »Drei Asse… ein gutes Blatt! Drei Asse … Jackson, Sie haben Glück … Sie werden nicht die halbe Ranch, sondern alles bekommen! Die ganze Ranch, Jackson … aber Sie müssen kämpfen! Das ist alles, was ich noch will!«
Marshal Mont Tucker drängte sich durch den Ring der Umstehenden. Er hielt noch den rauchenden Revolver in der Faust, mit dem er draußen auf die Banditen gefeuert hatte.
»Abe!«, rief er erschrocken. »Abe!« Mühsam streckte McGraw eine Hand aus.
»Du bist Zeuge, Mont! … Du wirst dafür sorgen, dass niemand Jacksons Recht anzweifelt…«
»Zeuge wofür, Abe?«
»Ich … habe mit ihm um die Ranch gespielt. Er … hat gewonnen … mit drei Assen… Die Ranch … sie gehört ihm, Mont… verstehst du?«
Tucker wischte sich über die Stirn. Er schluckte.
»Abe, hast du dabei auch an Davy gedacht?«
McGraws bärtiges Gesicht nahm einen schmerzlichen Ausdruck an. Er ließ die Hand herabfallen.
»Davy? Ich glaube nicht, dass der… Junge jemals in dieses Land zurückkehrt! Nein, es ist… schon alles richtig so! Ich wollte nur…« Sein Kopf rollte plötzlich zur Seite. Mike Holman beugte sich tiefer über ihn.
»Boss, was …«
»Gib dir keine Mühe, Mike!«, sagte der Town Marshal dumpf. »Es ist vorbei! Er ist tot!«
Minutenlang war es totenstill im Silberspur-Saloon. Dann stand Mike Holman schweratmend auf. Lee starrte betroffen auf den Toten nieder. Die Gedanken in seinem Gehirn wirbelten durcheinander.
Holmans düstere Stimme riss ihn aus seiner Versunkenheit.
»Nun, Jackson, Sie haben gehört, was McGraw sagte! Wollen Sie wirklich die Ranch da draußen am Rio Grande übernehmen?«
Lee wandte den Blick von dem grauen Gesicht des Toten ab.
»Wer ist dieser Davy, von dem vorhin gesprochen wurde?«, fragte er leise.
»Abes einziger Sohn!«, antwortete Marshal Tucker an Holmans Stelle.
Als er sah, wie Lee überrascht die Stirn runzelte, erklärte er schnell: »Davy hat bereits vor einigen Jahren das Land verlassen. Niemand hat seitdem etwas von ihm gehört, niemand weiß, wo er sich aufhält. Er hat sich mit seinem Vater nicht mehr vertragen, das war der Grund. Er war schon immer ein rechter Hitzkopf, der Junge.«
»Steht nicht ihm die Ranch zu?«, Tucker zuckte die Achseln.
»Abe lebte lange genug, um alles zu klären, Jackson. Jetzt liegt es bei Ihnen.«
»Und damit Sie Bescheid wissen«, knurrte Holman, »die ganze Mannschaft der Horseshoe-Ranch besteht nur noch aus mir. Die fünf anderen Boys sind erschossen worden wie McGraw – in dieser einen Nacht, Jackson! Vielleicht gibt Ihnen das einen Begriff!«
»Allerdings!«, bestätigte Lee gepresst. »Erwarten Sie jetzt, dass ich alles rückgängig mache, Holman?«
»Wenn Sie vernünftig sind, Jackson, ja!«
Lees Lippen waren ganz schmal. Sein Blick ging an Holman und Tucker vorbei zu den Fenstern, vor denen samtschwarze Nacht hing. Leise sagte er: »Ich war ein Leben lang vernünftig, Gents! Ein Mann hat auch das Recht, seine Fehler zu machen, nicht wahr? Well, Holman, morgen früh reiten wir beide zur Ranch hinaus!«
»Das ist der Cottonwood Creek«, sagte Mike Holman in das Stampfen der Pferdehufe und das leise Knarren des Sattelleders hinein. »Er bildet nach Norden die Grenze der Horseshoe-Ranch. Im Süden schließt der Rio Grande das Ranchland ab, drüben liegt schon Mexiko. Die Ranch befindet sich direkt am Fluss, nur ein paar hundert Yard von der Grenze entfernt. Drei Meilen, dann sind wir da!«
»Jackson, ich muss immerzu daran denken, dass Sie sich zu viel vorgenommen haben! Wenn Sie auch auf eine Ranch versessen sind – der Preis wird schließlich doch mehr sein als nur drei Asse!«
»Der nächste Einsatz ist das Leben, nicht wahr?«, meinte Lee mit hartem Lächeln.
»Zum Teufel, damit sollten Sie nicht spaßen, Jackson!«, knurrte Holman. »Warten Sie nur, bis Ihnen erst mal die Kugeln um die Ohren pfeifen!«
»Sie halten nicht viel von mir, Holman?«
Der Kopf des schnurrbärtigen Weidereiters ruckte herum. Finster starrte er dem Spieler ins Gesicht. Sie ritten auf gleicher Höhe, Steigbügel an Steigbügel, durch den Wasserlauf, den Holman als Cottonwood Creek bezeichnet hatte.
Mike Holman hieb die geballte Rechte aufs Sattelhorn.
»Verdammt, Jackson, Sie haben recht! Ich hab’ noch nie etwas von einem Mann gehalten, der sein Geld an Spieltischen verdient.«
»Nicht gerade ein seltener Standpunkt«, sagte Lee gelassen.
»Na und?«, brummte Holman herausfordernd. »Wir Cowboys verdienen unser Brot durch verdammt harte Arbeit und …«
»Wenn ich Ihnen nicht passe, Holman, warum geben Sie dann nicht einfach Ihren Job auf?«
Der Cowboy starrte Lee verblüfft an. »Was? Sie wollen, dass ich …«
»Im Gegenteil, Mike!«, winkte Lee schnell ab. »Aber wenn ich Ihnen als neuer Boss nicht gefalle, und wenn Sie den Kampf für die Horseshoe-Ranch für aussichtslos halten, dann ist für Sie die einfachste Lösung …«
»Hören Sie auf, Jackson! Höllenfeuer, meinen Sie etwa, ich habe Angst? Weder vor Ihnen noch vor den Erzhalunken, die es auf diese Weide abgesehen haben, verflucht noch mal!«
»Das wollte ich nur wissen, Mike!«, sagte Lee sanft.
Holmans dunkle Augen blitzten ihn wütend an.
»Zur Hölle mit Ihrer glatten Art, Jackson! Das passt nicht zu einem Rindermann!«
»Langsam, langsam, Cowboy!«, lächelte Lee. »Vergessen Sie nicht, dass Sie mit Ihrem Boss sprechen!«
»Jackson, ich lasse mir nicht dauernd vorhalten, dass Sie …«
Lee beugte sich zur Seite, sein Blick bohrte sich hart in Holmans Augen.
»Was denn, Mike?« Seine Stimme war sanfter als je zuvor.
Holman schnappte hörbar nach Luft. Dann knurrte er etwas, was wie »Kartenhai« klang, schlug seinem grobknochigen Gaul die Sporen in die Weichen und galoppierte davon. Die Kälte verschwand aus Lees Augen. Er kannte diese Sorte von raubeinigen Weidereitern und wusste, dass er sich im Notfall doch jederzeit auf Mike Holman verlassen konnte.
Der Cowboy erreichte eine Gruppe breitästiger Hickory-Bäume und zügelte sein Pferd hart. In den Steigbügeln aufgestellt, spähte er zwischen den Bäumen hindurch. Als Lee herankam, drehte er sich ihm zu.
»Nun können Sie beweisen, Jackson, wie viel Sie für die Horseshoe-Ranch riskieren wollen!«
Er deutete zwischen den Stämmen nach vorn.
»Da, sehen Sie! Das ist die letzte Herde, die auf unserem Land weidet. Alle anderen Rinder wurden von den verflixten Halsabschneidern bereits fortgeholt! Wenn auch diese Tiere da vorne verschwinden …«
»Sie werden nicht verschwinden, Mike!«, unterbrach ihn Lee gepresst.
Er spähte in die Richtung, die Holman ihm gewiesen hatte. Dort vorn drängte sich Rind an Rind – ungefähr sechzig Tiere. Hufe wühlten die Erde auf, Hörner klapperten gegeneinander, heiseres Brüllen wehte zum Hickory-Hain herüber.
An den Flanken der Herde preschten Reiter hin und her, sehnige Gestalten in Weidekleidung, vom Staub umhüllt, der zwischen den Grasbüscheln hochstieg. Lassos kreisten, Peitschen wurden geschwungen, und raue anfeuernde Rufe vermischten sich mit dem übrigen Lärm.
Holman brummte: »Ich brauch’ Ihnen wohl nicht zu erklären, wer diese Burschen sind und was Sie wollen!«
Lee knöpfte seine dunkle langschoßige Jacke auf.
»Wofür Sie mich auch halten, Mike, ein so großer Trottel bin ich nun wieder nicht!«
Er zog seinen 36er aus dem Holster, überprüfte kurz die Ladung und nahm die Zügel straff. Holman betrachtete ihn abschätzend von der Seite.
»Das sind mindestens fünf Kerle da vorn!«
»Vielleicht sogar sechs oder sieben!«, nickte Lee ruhig und trieb seinen Braunen an.
»Kommen Sie, Mike?«
»Natürlich! Schon um zu sehen, wie Sie Ihre Abfuhr bekommen, Jackson!«
»Sie sind wirklich überwältigend in Ihrer Freundlichkeit, Mike!«, gab Lee grinsend zurück.
Sein Brauner trabte durch den Schatten unter den Hickory-Kronen.
Holman passte sich wortlos seiner Richtung an.
Schwingend fegten sie geradewegs auf die Herde und die Viehräuber zu. Das offene Gelände bot keine andere Möglichkeit als den offenen Angriff.
Während sie nebeneinander dahinjagten, fühlte Lee immer wieder Holmans forschenden Blick auf sich gerichtet. Gleich darauf wurden sie bei der Herde entdeckt. Ein Bandit stieß einen gellenden Schrei aus, deutete in ihre Richtung und riss ein Gewehr aus dem Sattelfutteral.
Der Feuerstrahl stach grell durch den dünnen Staubschleier. Der Knall drang jedoch nur schwach durch das Stakkato der Hufe. Lee presste die Lippen zusammen. Er sah, wie der Bandit repetierte und erneut feuerte.
Lee duckte sich tiefer auf den Pferdehals.
Andere Banditen verließen die Herdenflanke und preschten neben den Mann, der die ersten Schüsse abgefeuert hatte.
»Gewehre!«, schrie Holman kratzend durch das Hufewirbeln. »Sie haben alle Gewehre! Und wir sind noch nicht mal in Coltschussweite!«
Vorn blitzten jetzt gleichzeitig mehrere Mündungsfeuer. Über den beiden dahinjagenden Reitern lag ein bösartiges Sirren in der Luft.
Holman schimpfte wild. Noch immer waren sie nicht nahe genug, um mit ihren Revolvern das Feuer wirkungsvoll erwidern zu können.
»Jackson!«, brüllte Holman. »Höllenschlund und Pech und Schwefel! Diese Geier schießen uns ab wie die Hasen!«
»Dann kehren Sie doch um, Holman!«, schrie Lee schneidend zurück.
Er drosselte das Tempo seines Braunen nicht im Geringsten. Er fegte direkt auf die Banditen zu, die sich jetzt in breiter Reihe formiert hatten. »Wenn es überhaupt eine Chance gab, lag sie in der Schnelligkeit«, brüllte Holman wütend. »Den Teufel werde ich!«
Eine Kugel zischte haarscharf an seinem Kopf vorbei. Vor Lees Braunem fuhr ein Geschoss wuchtig in die Erde und schleuderte Dreck hoch. Der Gaul wollte zur Seite ausbrechen, aber mit eiserner Kraft hielt ihn Lee unter Kontrolle und trieb ihn weiter auf die Desperados zu.
Die Gewehre knallten wie rasend, aber die Banditen schossen zu hastig, ohne sorgfältig zielen zu können. Und dann waren Lee und der Cowboy nahe genug.
»Jetzt sind wir an der Reihe, Mike!«, schrie Lee.
Holman begriff sofort und lenkte seinen Gaul zur Seite. Sie ritten auseinander und begannen ihre Colts abzufeuern. Die Banditen schrien durcheinander. Lee und Holman versuchten, sie von den Flanken zu fassen. Minutenlang entstand ein Durcheinander unter den Viehräubern. Sie hatten diesen tollkühnen Angriff der beiden Gegner nicht erwartet.
Die Herde wurde noch unruhiger als sie schon gewesen war. Brüllende Rinder brachen mit hochgeworfenen Köpfen, aus, stampften die Erde und rissen mit ihren spitzen langen Hörnern Grasbüschel aus.
Lee merkte, wie der Braune langsamer zu werden drohte und gab ihm sachte nochmals die Sporen zu fühlen. In seiner Rechten spürte er den Rückstoß des Revolvers.
Ein Bandit stürzte mit hochgeworfenen Armen seitlich vom Pferd. Drei andere galoppierten schreiend auf ihn zu. Sie hatten ihre Gewehre jetzt ebenfalls mit Colts vertauscht. Lee hatte keine Zeit mehr, nach Holman auszuschauen. Er hörte nur rasendes Feuern aus der Richtung des schnurrbärtigen Reiters.
Mit einem harten Zügelruck brachte Lee seinen Braunen zum Halten. Eine Kugel zupfte an seinem schwarzen Rock. Er hob den 36er in Augenhöhe, und während ein weiteres Geschoss an seinem Gesicht vorbeipfiff, zog er den Stecher durch.
Ein kreischender Aufschrei drang durch den Lärm. Ein Bandit riss wild seinen Gaul zurück, wankte im Sattel, hielt sich krampfhaft am Sattelhorn fest und trieb sein Pferd schreiend nach hinten.
Lees Colt wanderte ein wenig zur Seite, die Mündung richtete sich auf den vordersten Angreifer. Wieder schoss er. Aber gleichzeitig wurde sein Brauner von einer Revolverkugel mitten in den Kopf getroffen.
Wie vom Blitz gefällt brach das Tier zusammen.
Lees Kugel sirrte wirkungslos schräg zum blauen Himmel hoch.
Lee bekam gerade noch die Füße aus den Steigbügeln, dann segelte er schon durch die Luft.
Der Aufprall war hart, er rollte herum, von der Wucht des Sturzes getrieben, und blieb benommen liegen. Verschwommen wurde er sich bewusst, dass er den 36er noch immer krampfhaft umklammert hielt. Dann hörte er das dröhnende Hufgetrappel herankommen.
Das Begreifen der tödlichen Gefahr durchzuckte ihn mit schmerzhafter Schärfe.
Keuchend stemmte er sich auf die Ellenbogen. In seinen Schläfen hämmerte es, in seinem Kopf stach es wie mit tausend Nadeln. Aber er vergaß Schmerzen und Benommenheit, als er die beiden Banditen entdeckte, die nur wenige Yard von ihm entfernt ihre staubbedeckten Gäule anhielten.
Gnadenlose Wildheit malte sich auf den hageren unrasierten Gesichtern.
Und das pausenlose Schüssepeitschen auf der anderen Herdenseite verriet Lee, dass Holman keine Möglichkeit hatte, ihm zu Hilfe zu eilen!
Die beiden Banditen hoben gleichzeitig ihre Colts …
5. Kapitel
Lee Jackson handelte rein instinktiv.
Blitzschnell schleuderte er sich zur Seite. Während dieser Bewegung fuhr seine rechte Faust in die Höhe, und der Zeigefinger krümmte sich am Abzugshebel. Das Krachen der Schüsse vermischte sich.
Pulverrauch wehte. Lee rollte sich herum.
Ein Pferd wieherte schrill. Aus den Augenwinkeln sah Lee Erdbrocken unter schmetternden Kugeleinschlägen hochwirbeln. Der linke Bandit saß plötzlich stocksteif und mit herabhängenden Armen auf seinem Gaul, dann kippte er lautlos aus dem Sattel.
Lee wartete auf den zweiten Schuss des anderen Rustlers, richtete sich hastig auf die Knie und schlug seinen 36er in die neue Richtung an.
Ehe er schoss, merkte er, dass das zweite Banditenpferd ebenfalls reiterlos geworden war. Ein dunkler Körper lag reglos und verkrümmt im zertrampelten Gras.
Lee sprang auf die Füße.
Die Schwäche war gleich vorbei, als er wieder Hufgetrommel vernahm. Von der Seite preschte ein Reiter auf ihn zu. Lee erwartete Mike Holmans schnurrbärtiges Gesicht über der flatternden Pferdemähne auftauchen zu sehen, es konnte seiner Meinung nach nur Holman sein, der den zweiten Desperado ausgeschaltet hatte.
»Hey, Jackson!«, schrie eine kräftige Stimme. »Da bin ich wieder! Können Sie sich überhaupt einen besseren Leibwächter wünschen, he?«
»Kelley!«, rief Lee erstaunt. »Chad Kelley!«
Der Zweihandschütze lenkte seinen hochbeinigen Falben mit den Schenkeln, wie ein Indianer. In jeder Faust lag ein langläufiger 45er, und vor jeder Coltmündung zerwehte eben weißer Pulverrauch.
Er lenkte den Falben halb vor Lee herum, und das Tier kam zum Stehen. Die Zähne blitzten in dem sonnengebräunten verwegenen Männergesicht.
»Was sagen Sie nun, Jackson? Wie bin ich zu Ihnen – und wie sind Sie zu mir? Jackson, das war nicht schön von Ihnen, dass Sie heute Morgen einfach aus Yellow Flat verschwanden, ohne sich an mich zu erinnern.«
Lee wurde sich bewusst, dass das Schießen auch auf der anderen Herdenseite verstummt war. Neben den Rindern brach Mike Holman durch die dünne Staubfahne und kam näher galoppiert. Von den übrigen Rustlern war nichts mehr zu sehen.
Lees Haltung entspannte sich. Lächelnd schaute er zu Kelley empor.
»Sie tun mir unrecht, Amigo! Ich wollte Sie sprechen! Aber im Alamo Hotel sagte man mir, Sie schliefen noch, und ich wollte schließlich Ihren Schlaf nicht stören. Ich bin ein höflicher Mensch, wenn’s darauf ankommt.«
»Das weiß ich zu schätzen!«, lachte Kelley. »Wahrscheinlich hätten Sie mich ohnehin in meinen süßen Träumen überrascht!«
»Süß?«, fragte Lee beißend.
Er streifte mit seinem Blick bedeutsam die beiden Schießeisen, die Kelley eben halfterte. »Ich weiß nicht, ob ein Mann wie Sie dieses Wort überhaupt in den Mund nehmen darf!«
Lachend schwang sich Kelley vom Pferd.
Inzwischen war Holman heran.
»Boss!«, schnaufte er. »Wir haben sie davongejagt! Wir haben es ihnen gezeigt, Boss! Teufel, das werd’ ich in meinem ganzen Leben nie vergessen!«
Zum ersten Mal sah Lee ihn lachen. Er schob seinen eigenen Revolver unter den Rock zurück und sagte ernst: »Mike, was ist los mit Ihnen?