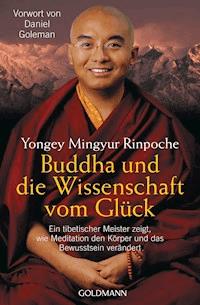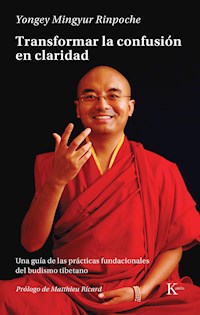9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die wahre Geschichte hinter dieser außergewöhnlichen Reise beginnt in jener Nacht, in der sich Yongey Mingyur Rinpoche dazu entschließt, sein bisheriges, wohlbehütetes und privilegiertes Leben als Abt eines wichtigen buddhistischen Klosters hinter sich zu lassen. Unbemerkt schlüpft er aus dem Tor und ist zum ersten Mal alleine mit sich selbst. Auf dem Weg in die ihm unbekannte Welt, die ganze vier Jahre andauern wird, muss er sich vollkommen neu zurechtfinden und entdeckt tief verborgene Wahrheiten über das Leben, sich selbst und die Welt um uns herum, die seine Lehre für immer prägen werden.
Dieses Buch erzählt die beeindruckende Geschichte zweier Arten von Sterblichkeit, der körperlichen und der seelischen. Und es zeigt uns, wie wir diese beiden unausweichlichen Tatsachen miteinander in Einklang bringen und die Angst vorm Sterben in die Freude am Leben umwandeln können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Die wahre Geschichte hinter dieser außergewöhnlichen Reise beginnt in jener Nacht, in der sich Yongey Mingyur Rinpoche dazu entschließt, sein bisheriges, wohlbehütetes und privilegiertes Leben als Abt eines wichtigen buddhistischen Klosters hinter sich zu lassen. Unbemerkt schlüpft er aus dem Tor und ist zum ersten Mal alleine mit sich selbst. Auf dem Weg in die ihm unbekannte Welt, die ganze vier Jahre andauern wird, muss er sich vollkommen neu zurechtfinden und entdeckt tief verborgene Wahrheiten über das Leben, sich selbst und die Welt um uns herum, die seine Lehre für immer prägen werden.
Dieses Buch erzählt die beeindruckende Geschichte zweier Arten von Sterblichkeit, der körperlichen und der seelischen. Und es zeigt uns, wie wir diese beiden unausweichlichen Tatsachen miteinander in Einklang bringen und die Angst vorm Sterben in die Freude am Leben umwandeln können.
Zum Autor
YONGEY MINGYUR RINPOCHE lebt als Exiltibeter in Indien. Bereits mit 17 Jahren wurde er zum bislang jüngsten tibetischen Meditationsmeister. Die frühe Begegnung mit dem Biologen und Bewusstseinsforscher Francisco Varela entfachte sein Interesse an Gehirnforschung und Neurowissenschaften. Eine eigene schwere Angststörung überwand er durch Meditationstechnik und erreichte bei neurologischen Messungen seiner Gehirnaktivität bislang nie gekannte Werte. Seine zugewandte, selbstironische Art zu unterrichten begeistert in Asien, Amerika und Europa Millionen von Menschen.
YONGEY MINGYUR RINPOCHE
MIT HELEN TWORKOW
AUF DEM WEG
Eine Reise zum wahren Sinn des Lebens
Aus dem Amerikanischen von Liselotte Prugger
Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »In Love with the World. A monk’s journey through the bardos of living and dying« im Verlag Spiegel & Grau, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe Dezember 2019
Copyright der Originalausgabe © 2019 by Yongey Mingyur Rinpoche
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotive: © Bridgeman Images/Rebecca CampbellA Skulk of Foxes; © Shutterstock/vasabii; © MyStocks
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23693-9V002www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
INHALT
PROLOG
TEIL EINS – Öl ins Feuer gießen
KAPITEL 1: Wer bist du?
KAPITEL 2: Erkenne die Welle an, aber verweile beim Ozean
KAPITEL 3: Mit einem goldenen Löffel im Mund geboren
KAPITEL 4: Vergänglichkeit und Tod
KAPITEL 5: Weisheit entstehen lassen
KAPITEL 6: Was wirst du im Bardo machen?
KAPITEL 7: Lektionen von Milarepa
KAPITEL 8: Der Bahnhof von Varanasi
KAPITEL 9: Leerheit, nicht »Nichts«
KAPITEL 10: Wenn du etwas siehst, sag etwas
KAPITEL 11: Ein Besuch von der Panik, meiner alten Freundin
KAPITEL 12: Ein Tag an den Ghats
KAPITEL 13: Vom Schlaf und von Träumen
KAPITEL 14: Schwimmen lernen
KAPITEL 15: Memento Mori
TEIL ZWEI – Nach Hause zurückkehren
KAPITEL 16: Wo der Buddha starb
KAPITEL 17: Was ist Ihr Wunschtraum?
KAPITEL 18: Durch die Dunkelheit kommen
KAPITEL 19: Eine zufällige Begegnung
KAPITEL 20: Nackt und bekleidet
KAPITEL 21: Nicht wählerisch sein
KAPITEL 22: Mit dem Schmerz arbeiten
KAPITEL 23: Die vier Flüsse des natürlichen Leidens
KAPITEL 24: Sich der Bardos entsinnen
KAPITEL 25: Alles abgeben
KAPITEL 26: Wenn der Tod eine gute Nachricht ist
KAPITEL 27: Das Gewahrsein stirbt niemals
KAPITEL 28: Wenn die Tasse zerbricht
KAPITEL 29: Im Bardo des Werdens
Epilog
Dank
Glossar
PROLOG
11. Juni 2011
Ich schrieb den Brief zu Ende. Es war nach zehn Uhr in einer heißen Nacht in Bodh Gaya im Norden Zentralindiens, und im Augenblick wusste es sonst niemand. Ich legte den Brief auf einen niedrigen Holztisch vor den Stuhl, auf dem ich oft saß. Sie würden ihn irgendwann am folgenden Nachmittag finden. Es gab nichts mehr zu tun. Ich schaltete das Licht aus und zog den Vorhang zurück. Draußen war es stockdunkel, nichts rührte sich, und genau so hatte ich es erwartet. Gegen halb elf begann ich im Dunkeln herumzulaufen und schaute ständig auf die Uhr.
Zwanzig Minuten später nahm ich meinen Rucksack, verließ mein Zimmer und schloss die Tür hinter mir ab. Im Dunkeln schlich ich auf Zehenspitzen die Treppe hinunter in die Eingangshalle. In der Nacht sichert ein schwerer Metallriegel zwei dicke Holztüren von innen. Jede Tür wird von schmalen, rechteckigen, fast gleich hohen, nach außen zu öffnenden Fenstern flankiert. Ich wartete, bis der Wachmann vorbeigekommen war. Als er nach meiner Berechnung am weitesten vom vorderen Tor entfernt sein musste, öffnete ich das Fenster und stieg auf die kleine Marmorveranda hinaus. Ich schloss das Fenster, flitzte die sechs Stufen zu dem mit Ziegelsteinen gepflasterten Fußweg hinunter und stellte mich schnell hinter die Büsche zur Linken.
Das Gelände ist von einem hohen Metallzaun umgeben. Die Seitenpforte am Weg bleibt tagsüber geöffnet, ist aber in der Nacht abgeschlossen, und in der Nähe passt ein Wachmann auf. Die vordere Pforte wird selten benutzt. Sie ist hoch und breit und führt zu einer Umgehungsstraße, die die beiden, parallel zueinander verlaufenden Hauptstraßen verbindet. Die beiden Eisenflügel der Pforte sind mit einer schweren Kette und einem großen Vorhangschloss gesichert. Um unbemerkt hinauszugelangen, durfte der Wachmann mich bei seiner nächsten Runde nicht sehen. Ich wartete hinter den Büschen, bis er vorbeikam, berechnete abermals, wann er in sicherer Entfernung sein musste, und rannte dann die dreißig Meter zur Hauptpforte hinüber.
Als ich meinen Rucksack über die Pforte warf, zielte ich auf den Rasenstreifen am Rand der geteerten Straße, damit er geräuschlos landete. Außerdem hatte mein Vater mich immer gemahnt: Wenn du auf Reisen bist und zu einer Mauer kommst, wirf immer zuerst dein Gepäck rüber, denn dann wirst du ganz bestimmt auch folgen. Ich schloss das Vorhangschloss auf, stieß den Torflügel auf und schlüpfte hinaus.
Vor Angst und Aufregung klopfte mir das Herz bis zum Hals. Die nächtliche Dunkelheit schien aufzuleuchten und all meine Gedanken zu absorbieren. Zurück blieb nur das schockierende Gefühl, mitten in der Nacht auf der anderen Seite des Zauns und zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben ganz allein draußen in der Welt zu sein. Ich musste mich zwingen, in Bewegung zu kommen. Ich griff zwischen den Gitterstangen hindurch und drückte das Vorhangschloss zu, dann hob ich mein Bündel auf und verbarg mich am Straßenrand. Zwei Minuten vor elf, und ich befand mich zwischen einem Leben und dem nächsten. Der Atem dröhnte in meinen Ohren, mein Magen verkrampfte sich. Ich konnte kaum glauben, dass mein Plan bislang perfekt aufgegangen war. Meine Sinne schärften sich und schienen sich über meinen konzeptuellen Geist hinweg auszudehnen. Die Welt begann plötzlich zu leuchten, und ich meinte, kilometerweit sehen zu können … nur das Taxi sah ich nicht.
Wo ist das Taxi?
Es war für elf Uhr nachts bestellt worden. Ich trat auf die Umgehungsstraße hinaus und hielt Ausschau nach Scheinwerfern. Auch wenn ich mit der Strategie eines Ausbrechers vorgegangen war, hatte ich niemandem von meinem Plan erzählt, und ein Fluchtauto wartete auch nicht auf mich. Auf der anderen Seite des Zauns, der nun hinter mir lag, war Tergar, ein tibetisches, buddhistisches Kloster … und ich war sein angesehener, sechsunddreißigjähriger Abt.
Ein Jahr zuvor hatte ich meine Absicht verkündet, ein ausgedehntes Retreat zu beginnen. Das hatte bei niemandem die Alarmglocken schrillen lassen. Dreijahresretreats sind in meiner Tradition üblich. Allerdings war vermutet worden, dass ich mich in ein Kloster oder in eine Eremitage in den Bergen zurückziehen würde. Abgesehen von Tergar in Bodh Gaya habe ich Klöster in Tibet und Nepal sowie Meditationszentren in allen Teilen der ganzen Welt besucht, aber nirgends hatte irgendjemand meine wahren Absichten erahnt. Trotz meiner angesehenen Position – oder präziser ausgedrückt, wegen ihr – würde ich nicht in einer institutionellen oder abgelegenen Unterkunft verschwinden. Ich hatte mir zum Ziel gesetzt, der althergebrachten Tradition der Sadhus, den herumziehenden, hinduistischen Asketen, zu folgen, die ihren ganzen Besitz aufgeben, um frei von weltlichen Belangen zu leben. Die frühesten Helden meiner tibetischen Kagyu-Übertragungslinie waren in die Fußstapfen ihrer hinduistischen Vorfahren getreten und hatten in Höhlen und Wäldern gelebt. Ich würde mein Leben als privilegierter Tulku – als anerkannte Inkarnation eines spirituellen Meisters – hinter mir lassen; es sozusagen »sterben« lassen. Ich würde mein Amt als jüngster Sohn des Tulku Urgyen Rinpoche, des hochverehrten Meditationsmeisters, niederlegen. Ich würde ohne Diener und Verwaltungspersonal leben und den Schutz, der mir durch meine Rolle als Abt und Linienhalter zusteht, gegen die Anonymität eintauschen, die ich noch nie gehabt, nach der ich mich aber seit langem gesehnt hatte.
Auf meiner Armbanduhr war es zehn Minuten nach elf. Mein Plan sah vor, den Mitternachtszug nach Varanasi zu nehmen. Der Zug fuhr vom nur dreizehn Kilometer entfernten Bahnhof Gaya ab. Das Taxi hatte ich am frühen Abend bestellt, als ich auf dem Rückweg vom Mahabodhi-Tempel war, der historischen Stätte, die an das große Erwachen Buddhas unter einem Bodhi-Baum erinnert. Ein Ableger des ursprünglichen Baumes markiert das Herz dieses weitläufigen Tempelkomplexes, und Pilger aus aller Welt kommen hierher, um unter seinem Blätterdach zu sitzen. Ich fuhr oft dorthin, aber an diesem speziellen Abend hatte ich nur vor, die rituelle Umrundung kora zu machen und Butterlampen zu opfern, um ein gutes Gelingen meines Retreats zu erbitten. Ich war von meinem langjährigen Diener, Lama Soto, begleitet worden. Plötzlich tauchten Scheinwerfer auf, und ich trat auf die Straße. Ein Jeep fuhr vorbei. Nach weiteren zehn Minuten sah ich abermals Scheinwerfer. Als ein großer Fernlaster auf mich zudonnerte, sprang ich zurück und rutschte in einer Schlammpfütze aus. Als ich meinen Fuß herauszog, blieb einer der Gummi-Flip-Flops darin stecken. Ich zog ihn heraus und versteckte mich wieder, diesmal mit glitschigen, schlammverschmierten Händen. Meine Hochstimmung verschwand, und Unruhe waberte wie Nebel herein. Jeder, der diese Straße frequentierte, würde mich erkennen. Niemand hatte mich je ohne Begleitung gesehen, weder zu dieser noch zu irgendeiner anderen Stunde. Ich hatte fest mit dem Taxi gerechnet. Ich hatte keine Vorstellung, was ich nach meiner Ankunft in Varanasi machen würde, aber in diesem Augenblick war es entscheidend für mich, den Zug nicht zu verpassen. Ich hatte keinen Plan B. Schwitzend vor Hitze und Aufregung machte ich mich schnell auf den Weg zur Hauptstraße.
Früher an diesem Abend waren Lama Soto und ich mit dem Jeep von Tergar zum fünf Kilometer entfernten Mahabodhi-Tempel gefahren. Wir hatten die kleinen Läden passiert, die die Hauptstraße säumen: Stände mit Textilwaren, ein paar Restaurants, Computercafés, Souvenir- und Ramschläden sowie Reisebüros. Neben Autos, Taxis, Fahrrädern und Rikschas verstopften auch Tuk-Tuks, die dreirädrigen, motorisierten Krachmacher, die Straßen. In der Nähe des Tempeleingangs säumten Bettler die Zufahrt mit ihren Almosenschalen. Auf dem Rückweg nach Tergar hatten wir an einem Reisebüro angehalten. Dort bestellte ich für elf Uhr nachts ein Taxi zur Hauptpforte des Klosters. Wir hatten uns auf Englisch unterhalten, damit Lama Soto, der nur Tibetisch sprach, nichts von dieser Verabredung mitbekam.
Ich war auf der Umgehungsstraße schon auf halben Weg zur Hauptstraße, als das Taxi endlich auftauchte. Nach einer halben Stunde allein in der Außenwelt spendete der begrenzte Raum im Auto unerwarteten Trost. Von klein auf hatte ich mehrmals täglich Gebete mit folgendem Inhalt gesprochen: Ich nehme Zuflucht zu Buddha, zum Dharma – den Belehrungen des Buddhas und zur Sangha – der erleuchteten Gemeinschaft. Nun stellte ich fest, dass ich Zuflucht in diesem Taxi nahm, und war dankbar für diesen Schutz.
Ich dachte an Naropa (etwa 980–1040 v. Chr.), den gelehrten Abt der buddhistischen Universität Nalanda. Ich wusste, dass er sein hohes Amt verlassen hatte, um eine höhere Weisheitsebene anzustreben, als er bislang erreicht hatte. Allerdings hatte ich noch nie über die Umstände seines Weggangs nachgedacht. Ich frage mich, ob er ganz allein losgezogen war. Vielleicht wartete ein Diener vor der Pforte mit einem Pferd. So war Prinz Siddharta aus dem Königreich seines Vaters geflohen: Er hatte sich seinem Wagenlenker anvertraut, und sie hatten eine heimliche Abmachung getroffen.
Als das Taxi auf Gaya zuraste, bewegte sich mein Körper vorwärts, während mein Geist rückwärts wanderte. In die so sorgfältig konstruierte Abreise schlichen sich plötzlich Misstöne ein. In den vergangenen Wochen hatte ich mir ausgemalt, wie das Geschehen an diesem Abend ablaufen würde. Nun betrachtete ich denselben Film in umgekehrter Reihenfolge, ausgehend von der Gegenwart und zurück in die Vergangenheit, und ich akzeptierte, dass es unterschiedliche Wege gibt, Abschied zu nehmen.
Lama Soto und ich waren gegen sieben Uhr abends vom Mahabodhi-Tempel zurückgekehrt, und ich hatte mich sofort in meine Privaträume im Obergeschoss meines Hauses zurückgezogen. Meine Wohnung besteht aus einem großen Empfangsraum für meine Gäste, von dem aus es in einen zweiten Raum geht, wo ich praktiziert und geschlafen habe. Das Haus liegt hinter dem Haupttempel, der etwa einem Gewog* entspricht. Jede Wand, jede Säule, und die gesamte Tempeldecke sind mit traditionellen Ornamenten geschmückt. Ein riesiger, goldener Buddha erhebt sich aus dem Schrein und ist direkt auf die Hauptpforte und den weiter hinten liegenden Mahabodhi-Tempel ausgerichtet. Am gleichen Tag war ich um die Marmor-Säulenhalle herumgewandert, die entlang den Außenmauern verläuft, auf die Galerie gestiegen, die über dem Hauptraum liegt, und hatte mich die ganze Zeit schweigend verabschiedet. Angrenzend an mein Haus gibt es ein Gästehaus und Verwaltungsbüros. Hinter diesen Gebäuden liegen die Schlafsäle und Klassenzimmer für etwa hundertfünfzig junge Mönche im Alter zwischen neun und zwanzig Jahren. Ich war an allen Räumen vorbeigegangen, alle Korridore entlanggelaufen und konnte noch immer nicht recht glauben, dass ich das vielleicht lange Zeit nicht mehr sehen würde. Ich plante, mindestens drei Jahre fortzubleiben. Ich hatte alles getan, was ich konnte, um das Wohlbefinden und das Training der Mönche auch weiterhin sicherzustellen. Ich hoffte, ich hatte nichts übersehen.
Lama Soto war gegen neun Uhr abends in mein Zimmer gekommen, um nachzufragen, ob ich noch etwas brauchte, bevor er sich zurückzog. Er stammt aus Kham, einer Gegend im Osten Tibets, die für ihre kräftigen, widerstandsfähigen Männer bekannt ist. Die letzten zehn Jahre, seit ich sechsundzwanzig war, war er mein Diener gewesen und hatte mich bei Menschenansammlungen wie ein Bodyguard abgeschirmt. Sein Zimmer lag im Erdgeschoss meines Hauses. Die Tür zu meinen Privaträumen hatte so laut gequietscht, weshalb ich im Zuge der Vorbereitungen zu meinem heimlichen Verschwinden sogar die Scharniere schmierte. Zwei Wochen zuvor hatte ich Lama Soto und die Klosterverwaltung in Kenntnis gesetzt, dass ich nicht vor Mittag eines jeden Tages gestört werden wollte. Diese ungewöhnliche Forderung ließ vermuten, dass ich Meditationen praktizieren und mich nicht unterbrechen lassen wollte. Aber in Wahrheit verschaffte ich mir so die Möglichkeit, schon über alle Berge zu sein, wenn meine Abwesenheit entdeckt wurde.
Was meiner Vorliebe für Lausbubenstreiche besonders schmeichelte, war der Trick, wie ich mir den Schlüssel zum Haupteingang besorgte. Ich war häufig zwischen meinen Klöstern in Indien und Kathmandu unterwegs, und bei einem vorangegangenen Besuch in Bodh Gaya hatte ich dem technischen Hausmeister erklärt, dass das Tor ein stabileres Vorhangschloss nötig hätte. Ich kündigte an, eines zu kaufen, wenn ich das nächste Mal in Delhi zu tun hatte. Zu diesem Zweck waren Lama Soto und ich an einem Nachmittag nach Old Delhi gefahren und hatten das Marktviertel abgeklappert, in dem es Schlosserwerkstätten gab. Als ich nach Bodh Gaya zurückkam, ging ich mit dem Hausmeister zur Pforte, um das alte Schloss auszuwechseln. Zum neuen Schloss gab es drei Schlüssel, von denen ich ihm zwei gab, aber den dritten behielt. Somit hatte ich auch die Möglichkeit, das Tor auf- und zuzuschwingen und zu testen, wie schwer es war und welche Geräusche es produzierte.
Der Mahabodhi-Tempel war inzwischen fast außer Sichtweite, doch ich wusste bereits von der Notwendigkeit, stets aufmerksam zu sein, ganz im Sinne des Buddha. Als ich in das Taxi gestiegen war, fühlte sich der Fahrer angesichts meiner erregten Stimme ermuntert, mit halsbrecherischer Geschwindigkeit loszupreschen. Tempel und Stupas, Bauwerke, die heilige Reliquien beherbergen, spiegeln das Herz und den Geist des Buddhas wider. Dadurch, dass wir die äußeren Formen des Buddhas respektieren, pflegen wir unsere eigene Weisheit. Doch der wahre Buddha, die erwachte Essenz des Geistes, existiert in jedem von uns.
Mein Herz schlug schnell. Wegen der Geschwindigkeit des Taxis und der Dunkelheit konnte ich vor dem Fenster nichts erkennen. Bilder rasten schneller durch meine Vorstellungswelt als das Taxi. Wissenschaftlern zufolge schwirren täglich fünfzig- bis achtzigtausend Gedanken durch den Geist. Ich hatte eher das Gefühl, dass es ebenso viele in einer Minute waren. Die Gesichter von Verwandten tauchten vor mir auf: meine Mutter Sonam Chödrön und Großvater Tashi Dorje in ihren Quartieren in Osel Ling, meinem Kloster in Kathmandu. Ich stellte mir Klosterverwalter, Nonnen und Mönche vor, die in formellen Schreinräumen meditierten; ich sah Freunde in europäischen Cafés sitzen oder in Hongkong in Nudelrestaurants an großen, runden Tischen speisen. Ich stellte mir ihre Verblüffung vor, wenn sie von meinem Verschwinden erfuhren: wie ihre Kinnladen nach unten klappten und ihre Gesichter ob dieser Nachricht nach vorn fielen: Hatte man sich etwa verhört? Ich schaute amüsiert zu, doch dieses Vergnügen erstreckte sich nicht auf meine Mutter. Als ich ihr Gesicht sah, wusste ich, welche Sorgen sie sich machen würde, und nun musste ich einfach dem Rat meines Vaters vertrauen.
1996 hatte ich meinen Vater in Nagi Gompa in seiner Klause an einem abgeschiedenen Berghang außerhalb von Kathmandu besucht. Er war an Diabetes erkrankt, aber keine Veränderung seiner körperlichen Verfassung deutete darauf hin, dass er bald sterben würde. Wie sich herausstellte, starb er zwei Monate später. Wir waren in seiner kleinen Kammer, einem Raum auf dem Dach seines Hauses, nicht größer als drei mal drei Meter; sein Gefolge bewohnte die unteren Stockwerke. Der Raum hatte ein großes Panoramafenster mit Blick über das Tal. Er war der Abt eines kleinen Nonnenklosters, und die Nonnen versammelten sich zu seinen Belehrungen in dieser kleinen Kammer.
Er saß auf einer erhöhten, rechteckigen Kiste. Hier schlief er und von hier aus unterrichtete er. Ein Laken bedeckte die untere Hälfte seines Körpers. Ich saß vor ihm auf dem Fußboden. Wie üblich begann er die Unterhaltung mit der Frage: Hast du irgendein Thema, das du mit mir diskutieren möchtest?
Ich sagte zu ihm, dass ich ein Wanderretreat beabsichtigte.
Er schaute zu mir herunter. Ami, sagte er und sprach mich mit einem tibetischen Kosenamen an: Hör zu, Ami, bist du sicher? Wirklich sicher?
Ich antwortete: Ja, ich bin sicher. Das wollte ich schon machen, seit ich ein kleiner Junge war.
Dann sagte mein Vater: Wunderbar. Aber wenn du das wirklich machen willst, habe ich einen Rat für dich: Geh einfach. Sag niemandem, auch nicht unseren Familienmitgliedern, wohin du gehst. Geh einfach, und es wird gut für dich sein.
Ich hatte seinen Rat nicht vergessen, obwohl fünfzehn Jahre vergehen sollten, bis ich ihn befolgte. Jahrzehntelang hatte ich im Rahmen der täglichen Liturgie immer wieder repetiert: Alles ist vergänglich; der Tod kommt ohne Vorwarnung; auch dieser Körper wird einmal eine Leiche sein. Je reifer ich meiner Ansicht nach wurde, desto mehr ahnte ich, dass ich die tiefste Bedeutung dieses Satzes nicht vollkommen absorbiert hatte, und doch hatte die Möglichkeit, dass dieser vergängliche Körper eine Leiche sein könnte, bevor ich meinen Vorsatz in die Tat umsetzte, immer für eine gewisse Unruhe gesorgt. Ich hatte lange Zeit gewartet, bis ich dieses Retreat in Angriff nahm, hatte gewartet, bis es zu einem Friss-oder-Stirb-Vorhaben geworden war – oder vielleicht treffender ausgedrückt, zu einem Friss-und-Stirb-Vorhaben. Ich würde alles hinter mir lassen, was ich kannte, und wüsste mit genauso wenig Gewissheit wie auf dem Sterbebett, was danach kommen würde.
Abgesehen von meiner Mutter, schmerzte es mich auch, Lama Soto zu verlassen, denn er war krank gewesen, und ich wusste, dass wir einander nicht wiedersehen würden. Er würde derjenige sein, der meine Abwesenheit entdeckte, und es war kein Vergnügen, mir seine Verzweiflung vorzustellen, wenn er die Implikationen des Briefes realisierte, den ich zurückgelassen hatte:
Wenn du diesen Brief liest, werde ich das ausgedehnte Retreat begonnen haben, das ich im letzten Jahr angekündigt hatte. Wie du vielleicht weißt, habe ich schon als kleiner Junge im Himalaya, wo ich aufgewachsen bin, eine sehr starke Beziehung zur Tradition des Retreats empfunden. Obwohl ich noch nicht recht wusste, wie man meditiert, lief ich oft von zu Hause weg zu einer Höhle in der Nähe, wo ich still dasaß und immer wieder das Mantra »Om Mani Peme Hung« in meinem Kopf rezitierte. Meine Liebe zu den Bergen und das einfache Leben eines Wandermönchs haben mich schon damals angesprochen.
* Verwaltungseinheit in Bhutan, die eine Gruppe von Dörfern umfasst.
KAPITEL 1Wer bist du?
Bist du Mingyur Rinpoche?
Mein Vater stellte mir diese Frage, kurz nachdem ich mit etwa neun Jahren begonnen hatte, mich von ihm unterrichten zu lassen. Es war so befriedigend, die richtige Antwort zu wissen, dass ich stolz verkündete: Ja, der bin ich.
Dann fragte er: Und kannst du mir sagen, was genau es ist, was aus dir Mingyur Rinpoche macht?
Ich schaute an meinem Körper hinunter bis zu den Füßen. Ich schaute auf meine Hände. Ich dachte über meinen Namen nach. Ich dachte darüber nach, wer ich im Verhältnis zu meinen Eltern und meinen älteren Brüdern war. Ich konnte mit keiner Antwort aufwarten. Dann machte mein Vater aus meiner Suche nach dem wahren Ich eine Art Schatzsuche, und ich suchte allen Ernstes unter Steinen und hinter Bäumen. Mit elf Jahren begann ich in Sherab Ling zu studieren, in einem Kloster in Nordindien, wo ich diese Suche durch Meditation verinnerlichte. Zwei Jahre später trat ich in das traditionelle Dreijahresretreat ein, in eine Periode intensiven Geistestrainings. In dieser Periode führten wir Novizen viele verschiedene Übungen aus, die nach und nach unser Verständnis für die subtileren Realitätsebenen vertieften. Das tibetische Wort für Meditation, gom, bedeutet, sich vertraut machen mit: vertraut damit, wie der Geist arbeitet, wie er unsere Wahrnehmungen von uns selbst und der Welt erzeugt und gestaltet, wie die äußeren Schichten des Geistes – die konstruierten Labels – wie Kleidung funktionieren, die unsere gesellschaftlichen Identitäten identifiziert und den nackten, unverfälschten Zustand des ursprünglichen Geistes verhüllt, egal, ob diese äußeren Kleider Businessklamotten, Jeans, Uniformen oder buddhistische Roben sind.
Als ich mich zu diesem Retreat aufmachte, verstand ich, dass der Wert der Kennzeichen sich je nach den Umständen und dem gesellschaftlichen Konsens verschiebt. Ich hatte bereits bejaht, dass ich nicht mein Name, mein Titel oder mein Status war, dass das essenzielle Ich nicht anhand von Rang oder Rolle definiert werden konnte. Gleichwohl hatten genau diese Bezeichnungen, von jeder essenziellen Bedeutung entleert, meine Tage umschrieben: Ich bin ein Mönch, ein Sohn, ein Bruder und ein Onkel, ein Buddhist, ein Meditationslehrer, ein Tulku, ein Abt und ein Autor, ein tibetischer Nepali, ein menschliches Wesen. Was davon beschreibt das essenzielle Ich?
Diese Liste aufzustellen ist eine einfache Übung. Es gibt nur ein Problem: Die unvermeidliche Schlussfolgerung widerspricht jeder liebgewonnenen Annahme, die uns am Herzen liegt, wie ich in diesem Moment gerade aufs Neue erfahren sollte. Ich wünschte mir, jenseits des relativen Selbst zu gelangen, des Selbst, das sich mit diesen Kennzeichen identifiziert. Ich wusste, dass diese gesellschaftlichen Kategorien, obwohl sie eine dominante Rolle in unseren persönlichen Geschichten spielen, mit einer größeren Realität jenseits von Kennzeichen koexistieren. Im Allgemeinen erkennen wir nicht, dass unsere gesellschaftlichen Identitäten von Kontext geformt und eingeschränkt werden und dass diese äußeren Schichten von uns innerhalb einer grenzenlosen Realität existieren. Gewohnte Muster überdecken diese grenzenlose Realität, sie verschleiern sie, aber sie ist immer da und wartet darauf, aufgedeckt zu werden. Wenn wir nicht von gewohnten Mustern eingeschränkt werden, die definieren, wie wir uns sehen und wie wir uns in der Welt verhalten, dann schaffen wir Zugang zu jenen Qualitäten des Geistes, die unermesslich sind, Qualitäten, die nicht von Umständen oder Begrifflichkeiten abhängig und die immer präsent sind. Aus diesen Gründen nennen wir das den ultimativen oder absoluten Geist oder den Geist absoluter Realität, was das Gleiche ist wie der Geist des reinen Gewahrseins und was genau diese Essenz unserer wahren Natur zum Ausdruck bringt. Anders als der intellektuelle und konzeptuelle Kopf und die grenzenlose Liebe eines weiten Herzens hat diese Essenz der Realität keine Verbindung zu jeglicher Art von Ort oder Materialität. Sie ist überall und nirgends. Sie ist gewissermaßen wie der Himmel, so vollkommen integriert in unserer Existenz, dass wir nie aufhören, seine Realität zu hinterfragen oder seine Qualitäten zu erkennen. Da das Gewahrsein in unserem Leben so präsent ist wie die Luft, die wir atmen, können wir überall und jederzeit darauf zugreifen.
Ich hatte eine gewisse Fähigkeit entwickelt, die relativen und absoluten Perspektiven gleichzeitig beizubehalten. Dennoch hatte ich keinen Tag ohne Menschen und Requisiten erlebt, die das zusammengeschusterte Flickwerk widerspiegelten, das ich und andere als Mingyur Rinpoche kennen gelernt haben: stets höflich, gern lächelnd, ein eher reserviertes Auftreten, ordentlich, glattrasiert, mit randloser Brille und Goldgestell. Nun fragte ich mich, wie sich diese Identitäten im Bahnhof von Gaya machen würden. Ich war viele Male vorher dort gewesen, aber immer mit mindestens einem Begleiter. Das hieß, dass ich nie ohne einen Bezug auf meinen Rang dort gewesen war und nie herausgefordert worden war, mich ausschließlich auf meine inneren Ressourcen zu verlassen.
Die Tibeter haben einen Begriff dafür, wenn sie bewusst die Herausforderungen an einen ruhigen Geist erhöhen. Sie nennen das Öl ins Feuer gießen. Im Allgemeinen nehmen wir Menschen in unserem Leben Ereignisse wahr, die uns immer wieder wütend, besorgt oder ängstlich machen und die wir dann mit etwa folgenden Aussagen vermeiden wollen: Ich kann mir keine gruseligen Filme ansehen. Ich kann nicht in großen Menschenansammlungen sein. Ich habe schreckliche Höhenangst oder Flugangst oder Angst vor Hunden oder vor der Dunkelheit. Aber die Ursachen, die diese Reaktionen auslösen, verschwinden nicht, und wenn wir uns in diesen Situationen wiederfinden, können unsere Reaktionen uns überwältigen. Wirklich schützen können wir uns einzig und allein dadurch, dass wir mit unseren inneren Ressourcen an diesen Themen arbeiten, denn äußere Umstände verändern sich ständig und sind daher nicht verlässlich.
Wenn wir Öl ins Feuer gießen, bringen wir schwierige Situationen absichtlich an die vorderste Front, damit wir direkt mit ihnen arbeiten können. Wir nehmen gerade diejenigen Verhaltensweisen oder Umstände, die wir für problematisch halten, und machen sie zu Verbündeten. Ein Beispiel: Als ich etwa drei oder vier Jahre alt war, unternahm ich mit meiner Mutter und den Großeltern eine Pilgerreise per Bus zu den wichtigsten buddhistischen Stätten in Indien. Auf der ersten Busfahrt wurde mir richtig übel. Und wenn wir später auch nur in die Nähe eines Busses kamen, bekam ich Angst, mir wurde schlecht, und es blieb nicht aus, dass sich mein Magen abermals umdrehte. Mit etwa zwölf Jahren fuhr ich nach einem einjährigen Aufenthalt im Sherab Ling Kloster in Nordindien nach Hause, um meine Eltern zu besuchen. Der Betreuer, der mich begleitete, buchte für uns eine Busfahrt nach Delhi, die die ganze Nacht dauern sollte, und von dort aus einen Flug nach Kathmandu. Ich hatte mich auf den Besuch gefreut, mich aber wochenlang vor der Busfahrt gefürchtet. Ich bestand darauf, dass der Betreuer zwei Plätze für mich buchte, denn ich glaubte, meinen Magen beruhigen zu können, wenn ich mich hinlegte. Aber kaum hatte die Reise begonnen und ich mich lang ausgestreckt, stellte ich fest, dass es mir im Liegen noch schlechter ging. Mein Betreuer bekniete mich, etwas zu essen oder einen Saft zu trinken, aber mein Magen war so aufgebläht, dass ich nichts schlucken konnte. Als der Bus unterwegs anhielt, wollte ich nicht aufstehen, um mir die Beine zu vertreten. Ich wollte mich nicht bewegen, und das hielt ich auch viele Stunden lang durch. Schließlich stieg ich dann doch aus, ging zur Toilette und trank ein wenig Saft.
Als ich zu meinen beiden Plätzen zurückkehrte, fühlte ich mich viel besser, und ich beschloss, es mit Meditieren zu versuchen. Ich begann mit einem Body Scan und brachte mein Gewahrsein auf die Empfindungen im Bereich des Magens, das Völlegefühl und die Übelkeit. Das war sehr unangenehm, ein wenig eklig und machte alles zunächst nur noch schlimmer. Aber als ich diese Empfindungen allmählich akzeptierte, erlebte ich meinen ganzen Körper als Gästehaus. Nun spielte ich den Gastgeber für diese Empfindungen und auch für die Gefühle von Abneigung, Widerstand und Reaktion. Je mehr Bereitschaft ich zeigte, diese Gäste in meinem Körper wohnen zu lassen, umso ruhiger wurde ich. Bald schlief ich tief und fest und wachte erst wieder in Delhi auf.
Dieses Erlebnis konnte nicht alle Ängste vor Busfahrten vertreiben, und sie kehrten bei weiteren Reisen zurück, wenngleich mit nachlassender Heftigkeit. Der große Unterschied war, dass ich nach dieser Fahrt nichts mehr gegen Busreisen hatte. Ich suchte sie nicht absichtlich aus, wie ich dieses Wander-Retreat ausgesucht hatte, aber ich war dankbar für die Herausforderung, mit meinem Geist zu arbeiten, um Widrigkeiten zu überwinden.
Wenn wir Öl ins Feuer gießen, statt die Flammen unserer Ängste zu ersticken, fachen wir das Feuer weiter an und gewinnen in der Folge Zutrauen zu unserer Fähigkeit, mit allen Situationen zu arbeiten, die sich für uns ergeben. Wir gehen keinen Situationen mehr aus dem Weg, die uns in der Vergangenheit beunruhigt haben, oder solchen, die destruktive Muster oder emotionale Ausbrüche erzeugen. Wir lernen, uns auf einen anderen Aspekt unseres Geistes zu verlassen, der unter unserer Reaktivität existiert. Wir nennen das »Nicht-Selbst«. Es ist das unbedingte Bewusstsein, das sich mit dem Auflösen des plappernden Geistes enthüllt, der den ganzen Tag lang Selbstgespräche führt. Man kann es auch so formulieren, dass wir vom normalen Gewahrsein zum meditativen Gewahrsein mentale Schalthebel benutzen.
Das normale Gewahrsein, das unsere täglichen Aktivitäten lenkt, ist eigentlich ziemlich überladen. Im Allgemeinen verbringen wir unsere Tage mit dem Kopf voller Ideen, was wir wollen und wie die Dinge laufen sollen und mit spontanen Reaktionen auf das, was wir mögen und was wir nicht mögen. Es ist, als trügen wir unwissentlich unterschiedliche Brillen, ohne eine Ahnung davon zu haben, dass diese Filter unsere Wahrnehmungen verschleiern und verzerren. Wenn wir beispielsweise reisekrank sind, steht diese zusätzliche Brille für Ekelgefühle vor dem Geruch und Schamgefühle, weil wir der Grund sind, dass andere sich vor uns ekeln. Die Tatsache, dass es jemand bemerken könnte, trägt weiter zu unserem physischen Unbehagen bei.
Angenommen, wir betrachten einen Berg mit normalem Gewahrsein. Unser Geist ist nach draußen gerichtet und folgt unseren Augen zum Berg. Vielleicht denken wir dabei an das letzte Mal, als wir diesen Berg oder irgendeinen Berg gesehen haben und mit wem wir damals zusammen waren oder ob das Wetter oder die Tageszeit, als wir den Berg gesehen haben, damals oder heute besser war oder ob wir hungrig oder glücklich sind. Oder wir denken an die Zeiten, wenn wir mit normalem Gewahrsein unsere Schlüssel und Handys einstecken, bevor wir aus dem Haus gehen. Wir könnten feststellen, dass dieser Vorgang oft mit der Angst verbunden ist, uns zu verspäten, mit der Unschlüssigkeit, welchen Weg wir zu unserer Verabredung nehmen sollen, oder wir könnten schon jetzt an das Nachhausekommen denken, bevor wir überhaupt losgegangen sind.
Mit dem meditativen Gewahrsein versuchen wir, diese Filter zu entfernen und die Projektionen zu verringern. Wir richten uns nach innen und erkennen das Gewahrsein als eine Qualität des Geistes. Wenn wir zum Berg schauen, gibt es weniger mentalen Verkehr zwischen uns und dem Berg, weniger Begriffe und Vorstellungen. Wir sehen Dinge im Zusammenhang mit dem Berg, die uns vorher nicht aufgefallen sind: wie die Silhouetten der Bäume die Bergkämme in Szene setzen, die Veränderungen der Vegetation oder den Himmel, der den Berg umgibt. Dieser klare Geist des Gewahrseins ist immer bei uns, ob wir ihn erkennen oder nicht. Er koexistiert mit der Verwirrung, mit den destruktiven Emotionen und mit der kulturellen Konditionierung, die die Art und Weise formen, wie wir die Dinge sehen. Aber wenn unsere Wahrnehmung sich hin zu meditativem oder ruhigem Gewahrsein verlagert, wird sie nicht mehr von Erinnerung und Erwartung eingeengt. Was wir auch sehen, berühren, schmecken, riechen oder hören, hat größere Klarheit und Schärfe und belebt unsere Interaktionen.
Kurz nachdem ich begonnen hatte, mich von meinem Vater unterrichten zu lassen, bekam ich Belehrungen über meditatives Gewahrsein. Einmal hing ich auf dem Dach meines Hauses herum und schaute gedankenverloren und ziellos durch die Gegend, als ich auf halber Höhe des Shivapuri – des Berges hinter Nagi Gompa – ein paar Straßenarbeiter bemerkte, die einen quer über die Flanke des Berges verlaufenden Wanderweg reparierten. Etwa sechs Leute begradigten den Weg mit Schaufeln, Spitzhacken und Schubkarren und räumten herabgefallene Erde und Steine zur Seite. Ich setzte mich hin und sah ihnen vom Dach aus bei der Arbeit zu. Dann dachte ich: Ich sollte meditieren. Nach den Anweisungen meines Vaters richtete ich meinen Geist auf sich selbst, ohne die Augen zu bewegen. Ich sah noch immer die Leute arbeiten, hörte den Klang der Spitzhacken, die Felsblöcke spalteten, und beobachtete die Schubkarre, die Erdreich über die Seite ablud. Aber plötzlich sah ich auch den schönen, blauen Himmel und die darüber hinwegziehenden Wolken, sah Blätter, die sich im Wind bewegten, spürte den Windhauch auf meiner Haut und hörte Vögel zwitschern. Vorher, mit normalem Gewahrsein, war mein Fokus verengt, und ich fühlte oder sah nichts als die Straßenarbeiter. Meditatives Gewahrsein – auch ruhiges Gewahrsein genannt – führt uns dazu, auf die Natur des Gewahrseins selbst zu schauen.
Wenn wir einmal mit dem ruhigen Gewahrsein vertraut sind, wechseln wir dennoch oft zwischen diesem Zustand und dem normalen Gewahrsein hin und her. Ungeachtet der Unterschiede zwischen ihnen, existieren beide Arten des Gewahrseins innerhalb eines dualistischen Konstrukts: Es gibt etwas, das beobachtet, und etwas, das beobachtet wird, die Erfahrung, dass das Gewahrsein sich selbst erkennt. Wenn diese Dualität wegfällt, fallen wir in das, was wir pures oder nichtduales Gewahrsein nennen. Nichtdualität ist die essenzielle Qualität des Gewahrseins, doch wenn wir von drei Arten des Gewahrseins sprechen, nämlich normal, meditativ und pur, sprechen wir von einem graduellen, empirischen Prozess, der von dualistischen zu nichtdualistischen Zuständen stattfindet, von einem sehr vollgestopften Geist zu einem Geist, der zunehmend befreit ist von gewohnter Reaktivität und vorgefassten Meinungen, wie etwas sein sollte. Diese Kategorien des Gewahrseins sind nicht scharf abgegrenzt, und unser Erkennen des puren Gewahrseins hat ebenfalls viele Abstufungen. Mit unterschiedlicher Tiefe oder Klarheit können wir sie aufblitzen sehen oder flüchtige Blicke darauf werfen. Ich wusste einiges über das pure Gewahrsein. Zum Teil fußte meine Absicht zu diesem Retreat auf dem Wunsch, mein Verhältnis zu diesem Aspekt der Realität zu intensivieren, und ich hatte gehofft, dies dadurch zu erreichen, dass ich aus meinem normalen Leben heraustrat.
Wer war es, der sich mitten in der Nacht anschickte, den Bahnhof von Gaya zu betreten? Meine rotbraune Robe, das gelbe Hemd und der rasierte Kopf – eine perfekte Verkleidung für die unbotmäßige Mischung aus Neugier, Beklemmung und Zuversicht, die jeden einzelnen Schlag meines Herzens begleitete – entlarvten mich als tibetischen, buddhistischen Mönch, Lama von Beruf, der auf so vielfältige Weise immer noch nach der Antwort auf die Frage meines Vaters suchte: Wer ist Mingyur Rinpoche?
Ich hatte mir Fähigkeiten angeeignet, das Gewahrsein zu erkennen – innerhalb klösterlicher Mauern und in Schreinräumen sowie auf meiner Meditationsmatte, immer in meiner Komfortzone und immer umgeben von Schülern und Dienstboten. Obwohl ich schon mein Leben lang meditiere und viele Jahre in buddhistischen Klöstern verbracht habe, machte ich mich nun auf den Weg zu einer anderen Art von Retreat. Meine Titel und meine Rollen würden auf dem Scheiterhaufen landen. Ich würde die groben, äußeren sozialen Schutzmechanismen und Strategien verbrennen, um frei zu sein, nicht frei vom Leben, sondern frei für das Leben, dafür, jeden Tag mit neu erwachtem Engagement für alles zu leben, was kommen mochte. Ich würde nicht einfach nur auf die fruchtbringenden Pfade zurückgreifen, die ich so gut kannte. Ich hatte eine leise Ahnung, dass diese Rollen mittlerweile tief eingebettet waren, und ich konnte so lange nicht mit ihnen arbeiten, bis ein einigermaßen großer Bruch sie an die Oberfläche gespült hatte.
Ich war alleine aufgebrochen, um diesen Bruch bewusst mit einer, wie ich sie mir vorstellte, Ego-Suizid-Mission zu provozieren. Ich wollte die tiefsten Tiefen dessen erforschen, wer ich, anonym und allein in der Welt da draußen, wirklich war. Ich wollte meine eigenen Fähigkeiten in neuen und herausfordernden Situationen austesten. Wenn ich meine eingefahrenen Abläufe wirklich durchbrechen, meine eigene Grenze finden und dann einfach weitergehen kann: Mal sehen, was mit meinem Erkennen des Gewahrseins passiert, mal sehen, was mit den Tugenden von Geduld und Disziplin passiert, wenn niemand zusieht, wenn niemand überhaupt weiß, wer ich bin, wenn vielleicht nicht einmal ich selbst weiß, wer ich bin.
Mit quietschenden Reifen kam das Taxi zum Stehen. Nun war die Zeit gekommen, das herauszufinden. Ich bezahlte den Fahrer und stieg aus. Wie um mir zu bestätigen, dass jede weltliche Zuflucht so flüchtig ist wie Rauch, blieb ich vor dem Bahnhof stehen, drehte mich um und schaute dem Taxi nach, bis es verschwunden war.
KAPITEL 2Erkenne die Welle an, aber verweile beim Ozean
Im Bahnhof von Gaya wimmelt es rund um die Uhr von Reisenden, Bettlern, Pilgern und plärrenden Kindern. Ganze Familien sitzen auf ihren Habseligkeiten oder legen sich auf den Bahnsteig und warten auf Züge oder sind hier, weil sie sonst nirgendwohin gehen können. Träger balancieren schwere Kisten auf ihren mit Turbanen behüteten Köpfen. Ziellos umherirrende Kühe, Tauben und Hunde bahnen sich ihren Weg zwischen den auf dem Boden sitzenden Menschen, vorbei an Vogelkäfigen und angeketteten Ziegen. Aus öffentlichen Lautsprechern plärren Gleis- und Fahrplandurchsagen. Händler bieten Tee und Snacks feil, schreien und drängen sich durch die Menschenmenge. Männer und Frauen kauen Betelnüsse und spucken den roten Saft aus, der Blutstropfen gleich auf den Boden spritzt. Es ist laut, chaotisch und schmutzig, Zustände, die mir bislang nur aus der Ferne bekannt waren. In früheren Zeiten wäre ich in einer reservierten Lounge geblieben, bis ein Begleitmönch die Fahrkarten gekauft und einen Träger organisiert hätte. Nun arbeitete ich mich durch das Gewimmel, das von trüben Deckenlampen in Schatten getaucht wurde.
Ich hatte noch nie ein Ticket für irgendetwas gelöst und trug in meinem Rucksack niemals mehr Gewicht als eine Flasche Wasser und vielleicht noch eine Sonnenbrille und einen Hut. Und nun lagen in meinem Rucksack zusätzlich zwei buddhistische Texte, die ich für diese Reise ausgewählt hatte. Die zehntausend Rupien, die ich bei mir hatte (etwa hundertfünfzig US-Dollar), stammten aus den vielen kleinen Kuverts, die Besucher als Spende auf den Tisch in mein Zimmer gelegt hatten. Lama Soto sammelte die Kuverts regelmäßig ein, bevor er sich allabendlich zurückzog, doch ich hatte einige Wochen lang jeden Tag ein wenig Geld abgezweigt. Ich studierte die Kreidetafeln, um mich in die richtige Schlange für den Zug nach Varanasi zu stellen. Dies würde meine erste Zugfahrt in der untersten Preisklasse sein. Ich bekam keine Platzkarte. Sobald ich mein Ticket hatte, stellte ich mich an die Wand des überfüllten Bahnsteigs und hoffte absurderweise, dass der Zug fahrplanmäßig käme. Ich hätte gern gewusst, ob Naropa überhaupt irgendwelches Geld dabeihatte, als er sein neues Leben begann. Dünne Rauchfäden von den kleinen Kochstellen machten die Luft stickig und verstärkten die filmische Vision einer Welt im Untergrund. Als die Atmosphäre immer klaustrophobischer wurde und mit einem fast physischen Gewicht auf mich drückte, wurde mein Vorsatz, Öl ins Feuer zu gießen, zur Realität – und das war erst der Anfang. Die wahre Natur meines Seins zu erforschen fachte die Flammen ein wenig früher an, als ich erwartet hatte.
Aus Gewohnheit nehmen wir uns und die Welt um uns herum als stabil, real und beständig wahr. Dennoch können wir ohne große Mühe leicht erkennen, dass es keinen einzigen Aspekt im ganzen Weltsystem gibt, der nicht einer Veränderung unterliegt. Ich war gerade an einem physischen Ort gewesen, und nun war ich an einem anderen. Ich hatte unterschiedliche Geistesverfassungen erlebt. Wir alle haben uns von Babys zu Erwachsenen entwickelt, haben geliebte Menschen verloren, Kinder heranwachsen sehen, haben Änderungen des Wetters und den Wechsel politischer Regierungen erlebt, Änderungen von Musikstilen, von Mode, von allem. Auch wenn es den Anschein hat, bleibt doch kein Aspekt des Lebens immer gleich. Der Abbau eines jeden Objekts, mag es noch so massiv erscheinen wie ein Ozeanriese, unser Körper, ein Wolkenkratzer oder eine Eiche, wird aufdecken, dass etwas, was den Anschein von Stabilität hat, genauso illusorisch ist wie Beständigkeit. Alles, was körperlich aussieht, zerfällt in Moleküle, Atome und Elektronen, Protonen und Neutronen. Und jedes Phänomen existiert in Wechselbeziehung mit Myriaden anderer Formen. Jede Identifikation einer Form hat nur eine Bedeutung im Verhältnis zu einer anderen. Groß hat nur eine Bedeutung im Verhältnis zu klein. Unsere gewohnten Fehlwahrnehmungen mit der Gesamtheit der Realität zu verwechseln bezeichnen wir als Unwissen, und diese Sinnestäuschungen bestimmen die Welt der Verwirrung oder Samsara.
Das Leben ist Veränderung und Vergänglichkeit. Dies war ein weiterer Kerngrundsatz meiner Ausbildung. Veränderung und Vergänglichkeit. Vergänglichkeit und Tod. Ich hatte dem Tod meiner Rollen und meiner Umwandlung zu einem allein in der großen, chaotischen Welt herumziehenden Wanderjogi freudig entgegengesehen. Doch nun auf einmal keinen Begleiter mehr ständig um mich zu haben traf mich wie ein Donnerschlag. Ich vermisste jetzt schon Lama Sotos breite Schultern und seine feste, Sicherheit ausstrahlende Präsenz. Auf mich allein gestellt zu sein gab mir kein Gefühl von Sicherheit. Erkenne die Welle an, aber verweile beim Ozean. Das geht vorüber … wenn ich es zulasse.
Wie es meine Art war, stand ich sehr aufrecht und ein wenig steif da und schaute auf die Obdachlosen hinunter, die sich für die Nacht hier niedergelassen hatten, einige von ihnen streckten wie Betrunkene alle viere von sich. Ich hätte erster Klasse reisen und in der Lounge mit den Deckenventilatoren warten können. Aber ich wollte es so haben … Umstände, so fremd, dass ich mir selbst fremd werde. Ich bin gerade einmal eine Stunde von meinem Kloster fort. Habe ich meine Grenzen schon erreicht? Natürlich nicht. Schüchternheit und Verletzlichkeit waren mir nicht neu, aber seit Jahrzehnten waren sie nicht mehr so unerwartet heftig über mich hereingebrochen. Ich wollte mich verbergen, aber ich konnte nirgendwo hin. Ich spürte die Spannung und den Widerstand in meinem Körper, und ich erkannte, wie sehr die Oberfläche meines Geistes von Unbehagen und Beurteilung aufgewühlt wurde. Gleichzeitig war auch ein durch lebenslange Praxis kultivierter Sinn von Stabilität präsent, obgleich sie sich zerbrechlich anfühlte, und das war ich nicht gewohnt.
Ich hatte mir nie vorgestellt, dass Betteln oder auf der Straße schlafen einfach sein würde. Ich hatte diese Art von Retreat gerade wegen seiner Schwierigkeiten gewählt. Ich hatte die Bettler beobachtet, die die Straße zum Mahabodhi-Tempel säumten, und mir mich in ihrer Mitte vorgestellt. Ich hatte mich darauf vorbereitet, wie ich auf Fremde reagieren würde, die einen Bogen um meine Almosenschüssel machten. In meiner Vorstellung reagierte ich auf ihre Indifferenz manchmal mit echter Besorgnis, weil sie so herzlos waren, dann wieder reagierte ich mit Wut. Ich hatte mich gefragt, wie weit ich wohl gehen würde, um an Essen zu kommen. Ich hatte mir vorgestellt, den Abfall wie ein Wildschwein zu durchwühlen. Ich war Vegetarier und aß kaum Süßes, aber in den letzten Wochen hatte ich versucht mir vorzustellen, dass ich Fleisch hinunterschlang und weggeworfene Kuchenkrümel aß. Ich hatte mich sogar gefragt, ob ich mich vor lauter Hunger überwinden könnte, rohe Fischeingeweide wie der indische Meister Tilopa zu essen.
Der indische Meister Tilopa (988–1069 n.Chr.) hatte in entlegenen Landesteilen weitab von Klöstern nach Anonymität gesucht. Doch seine gelegentlichen Begegnungen mit Suchenden hatten eine Spur wundersamer Geschichten hinterlassen, die sein Ansehen nur noch steigerten. Als die Botschaft von Tilopas außerordentlicher Weisheit Naropa erreichte, erkannte der große Pundit von Nalanda augenblicklich seine eigenen Grenzen und gab seine hohe Position auf, um einem Meister zu folgen, der mehr wusste als er. Schließlich holte er den exzentrischen Jogi am Ufer eines Flusses in Bengalen ein. Tilopa war vollkommen nackt und aß rohe Innereien, die ihm die Fischer zuwarfen, nachdem sie ihren Tagesfang ausgenommen hatten. Diese Begegnung war für Naropa der erste von vielen Tests, doch sein Glaube an diesen provokativen Mystiker stärkte seine Prüfungen und führte schließlich auch zu seiner Erleuchtung.
Ich hatte die Möglichkeit in Erwägung gezogen, Innereien von Fischen zu essen, und hatte meine Vorstellungskraft dazu benutzt, mich mit extremem Hunger, Kälte und Einsamkeit vertraut zu machen. Dabei hatte ich aber irgendwie versäumt, mir den Bahnhof und die Qual vorzustellen, allein in diesem düsteren, schauderhaften Dreckloch zu stehen und mich dabei so himmelweit entfernt von den Reisenden zu fühlen, die an meiner Robe vorüberstreiften, dass ich ebenso gut auf dem Mond hätte sein können. Es dauerte nicht lange, bis ich die Gleichgültigkeit gegenüber einem Mann ohne Rang am eigenen Leib erlebte. Obwohl ich meine Robe trug, hatte ich das Gefühl, genau taxiert, aber nicht respektiert zu werden. Mönche werden in Indien nicht respektiert. Selbst die hinduistischen Sadhus werden nur auf den Dörfern, nicht aber in den Städten geachtet. Das war im alten Tibet anders, wo Menschen verehrt wurden, die ihr Leben spirituellen Handlungen widmeten. Kinder lernten von klein auf, Mönche und Nonnen zu ehren. Buddha ist nicht nur eine historische Gestalt, sondern eine durch die Robe verkörperte, lebendige Präsenz. Aus diesem Grund haben mich öffentliche Bekundungen von Geringschätzung immer ein wenig betrübt.
Als der Zug einfuhr, packten die Mitreisenden ihre Kinder, Tiere, großen Koffer und die mit Stricken zusammengebundenen und mit Riemen um die Stirn geschnallten, gewaltigen Kleidersäcke und schoben und boxten sich zu den Türen, um einzusteigen. Ständig blieb mein Rucksack irgendwo hängen, und nur mit vollem Körpereinsatz konnte ich mich wieder befreien. Ich stieg als Letzter ein und begann die Zugfahrt plattgedrückt an der Tür. Es war nur schrecklich: Kopf, Rumpf und Beine waren zwischen Tür und menschlichen Körpern eingequetscht, ich konnte nichts sehen, bekam aber stattdessen einen entsetzlichen Gestank in die Nase. Ich musste den Mund öffnen, um die wenige Luft einzusaugen, die noch vorhanden war. Die nächsten paar Minuten konnte ich nicht verhindern, dass ich mich von den Eindrücken überwältigt fühlte.
In meiner Ausbildung wurde ich mit dem weiträumigen Gewahrsein meines natürlichen Geistes bekannt gemacht. Wir vergleichen dieses Gewahrsein mit dem weiten Himmel und den Meeren, Bezüge, die eine unermessliche Weite darstellen sollen, obgleich das Gewahrsein noch unermesslicher ist als Himmel und Meere zusammen. Wenn wir erst einmal lernen, die allgegenwärtige Qualität des Gewahrseins zu erkennen, den bedingten, abhängigen Geist loszulassen, und wenn wir erkennen, dass wir selbst dieses weite Gewahrsein sind, dann manifestieren sich unsere Gedanken und Emotionen als vom Gewahrsein untrennbare Wellen oder Wolken. Das Erkennen sorgt dafür, dass wir von den Geschichten nicht mehr mitgerissen werden, die unseren Geist in wiederkehrenden Zyklen herumwirbeln oder wie einen verrückten Affen herumspringen lassen. Wenn wir zulassen, dass unser Geist sich ständig in diesen Geschichten verfängt, dann ist es schwierig, das Gewahrsein zu erkennen. Wie wir alle wissen, werden die Wettersysteme innerhalb des Gewahrseins oft recht stürmisch. Doch je vertrauter wir mit dem Gewahrsein als eine dem Geist innewohnende Qualität sind, umso weniger kann uns das Wetter anhaben. Wellen entstehen und Wolken ziehen vorüber, und wenn wir nicht in ihnen festhängen, verlieren sie ihre Wirkung. Unsere Empfindsamkeit wird tiefer, und wir lernen, dem Wissen des gewahren Geistes zu vertrauen. In meinem Leben habe ich Wellen in Orkanstärke erlebt, aber sie hielten nicht lange an. Und nun war ich mir in dem gerammelt vollen Zug nicht ganz sicher, ob meine röchelnden Atemzüge vom Druck auf mein Gesicht herrührten oder von der Angst in meinem Herzen.
Nach ein paar Minuten ließ die starke Energie der Angst allmählich nach. Meine Atmung wurde ruhiger. Gleichzeitig machte sich das weite Gewahrsein bemerkbar, als wollte es der Welle begegnen. Manchmal geschieht das. Es ist, als würde allein die Kraft der Turbulenz es möglich machen, das Gewahrsein leichter zu erkennen als sonst, und eine große Emotion führt zu einem himmelähnlichen, großen Geist. Ich wurde von der Welle nicht mehr fortgespült und hatte nicht mehr das Gefühl zu ertrinken. Ich musste nur eines tun: sie gewähren lassen. Es machte keinen Sinn, das Weite suchen zu wollen. Die Welle war da. Obwohl ich es vorgezogen hätte, woanders zu sein, konnte ich das nun annehmen und in der Situation bleiben, im weiten Gewahrsein und in der unangenehmen Empfindung. Wenn wir in einer Realität bleiben, die weiter ist als der Himmel, lässt der destruktive Einfluss unserer wilden und gestörten Reaktionen automatisch nach. Aber Wolken wie Wellen verschwinden nicht. Sie lösen sich auf und bilden sich erneut.
Bei jedem Aufenthalt des Zuges drängten Menschen hinaus, und weitere Menschen stiegen ein. Ich arbeitete mich ein wenig weiter vor, bis ich einen Platz auf dem Boden ergatterte, wo ich mich mit gekreuzten Beinen hinsetzte und den Rucksack auf den Schoß legte. Das war eine weitere völlig neue Erfahrung. In der tibetischen Kultur nehmen reinkarnierte Meister wie ich eine höhere Sitzposition ein als andere Menschen, und für einen Tulku ist es tabu, auf dem Boden zu sitzen. Hätten Tibeter mich so gesehen, wären sie erschüttert gewesen. Aber hier kümmerte sich niemand um mich oder meinen Status, und abgesehen davon würde ich, wenn ich mein Vorhaben in die Tat umsetzen wollte, ohnehin eine Menge gesellschaftlicher Sitten abstreifen müssen.
Ich war zwar nicht gewohnt, erster Klasse zu fahren, aber ich war mir meines Unbehagens in dieser vollkommen neuen Umgebung deutlich bewusst. Die Farbe der Wände und Bänke war ein widerliches Grün, und in dem trüben Licht sah alles schimmelig aus. Ich hatte das genau so haben wollen, rief ich mir in Erinnerung, mit Menschen zu reisen, die in der Welt als unwichtig gelten und von der Gesellschaft nicht wertgeschätzt werden. Wer spürt also ein solches Unbehagen? Der hochverehrte Rinpoche? Der privilegierte Abt? Der starre Geist, der an diesen geehrten Titeln festhält?
Meine Augen befanden sich nicht im Leerlauf. Sie sahen nicht nur und ruhten auch nicht nur auf Objekten. Stattdessen wurden die Gestalten um mich herum zu fremden Wesen, zu anderen, zu denen da drüben. Ihre schmutzige Kleidung verdunkelte mein Herz. Ich störte mich an ihren rissigen, nackten Füßen, doch bald schon würden die meinen genauso vor Schmutz starren. Ihr Körpergeruch war abstoßend, obgleich mein Körpergeruch durch die Luftfeuchtigkeit, die Hitze und das Fehlen einer Klimatisierung vermutlich genauso penetrant war, denn das Hemd unter meiner Robe klebte schweißnass an meinem Körper.
Abermals war mein Körper an einem Ort und mein Geist an einem anderen. Einer davon war als Mönch verkleidet, aber meine Erlebnisse wurden von Wertungen der allergewöhnlichsten Art gestaltet. Es war wie ein Wachtraum. Dieser Traum war so seltsam wie eine vertraute und doch irgendwie andere Umgebung. Oder vielleicht war ich es, der anders war. Ich fühlte mich fehl am Platz. Ich war fehl am Platz in dieser neuen Welt. Es war fast so, als wäre ich in den Traum von jemand anderem geraten, und der Traum wollte mich ebenso wenig in sich haben, wie ich in dem Traum sein wollte. Aber nun war ich drin. Schließlich war es mein Traum, und es war der Traum, den ich mir ausgesucht hatte. Ich muss diesen Traum nicht mögen. Lass ihn einfach geschehen. Bleib nicht darin hängen. Soll er selbst mit sich klarkommen.
Ich spürte keinerlei Verbindung mit diesen Leuten. Trotz jahrelanger Praxis, die spontanes Mitgefühl mobilisiert, musste ich in meiner Erinnerung nach grundlegenden Mahnungen kramen: Jeder will glücklich sein; niemand will leiden. Auch diese Menschen haben wie ich Freude und Bedrängnis erlebt. Auch sie haben geliebte Menschen verloren. Auch sie haben Angst und Güte erlebt. Auch sie werden sterben, so wie ich sterben werde. Ein paar Minuten lang wiederholte ich diese Mahnungen mit echter Aufrichtigkeit, dann meldete sich die Abneigung wieder.
Bis zu dieser Nacht hatte ich mir die Orte meines Retreats als Höhlen, unberührte Bergseen und dörfliche Gassen vorgestellt. Ein Freund, der immer in der billigsten Zugklasse reiste, hatte die Fahrten als sehr angenehm beschrieben. Die Bänke sind hart, und manchmal sind die Waggons überfüllt, aber die Fenster sind immer offen, frische Luft strömt herein, und man kann bei jedem Aufenthalt Tee kaufen. Für mich hörte sich das gut an. So etwas wie das hier hatte ich mir nie vorgestellt.
Die folgenden paar Stunden wurde ich sowohl Lehrer als auch Schüler und dachte über Lektionen nach, als wäre ich wieder im Klosterkindergarten. Woher kam diese Aversion? Wie ist sie entstanden? Kam sie aus meinem Geist, aus meinem Körper oder von der Außenwelt? Meine Atmung war flacher als üblich. Ich verlangsamte und vertiefte absichtlich meine Atmung. Aber mein Geist fuhr fort, zu hinterfragen, zu kommentieren und jedes kleine Detail zu werten. Als ich das bemerkte, verstand ich, dass ich meine Aufmerksamkeit auf den wertenden Geist selbst richten musste. Waren meine Reaktionen richtig? Waren meine Annahmen korrekt? Woher kamen sie? Ich stellte mir Fragen, die mein Lehrer mir zu Beginn meines ersten Dreijahresretreats gestellt hatte.
Als ich dreizehn Jahre alt war, hatte mein Lehrer Saljay Rinpoche mich aufgefordert, angenehme und unangenehme Empfindungen in meinem Körper zu identifizieren. Ich versuchte andauernd, Begriffe zu verwenden, um Gefühle hervorzurufen: An Schokolade zu denken schafft angenehme Empfindungen. An Müll zu denken schafft unangenehme Empfindungen.
Aber diese speziellen Bilder waren alltäglich, sie hatten keinen Überraschungswert, und sie hatten keine Auswirkungen auf meinen Körper.
Saljay Rinpoche sagte: Du brauchst nicht zu denken. Fühle nur. Fühle, was in deinem Körper ist.
Das konnte ich nicht, und ich fragte, was ich machen sollte. Soll ich mir auf die Zunge beißen oder die Fingernägel in die Handflächen bohren?
Nein. Du brauchst keine Empfindungen zu erzeugen. Fühle nur so, wie du jetzt bist, was angenehm ist und was unangenehm.
Ich kapierte es nicht.
Eines Tages begann Saljay Rinpoche den Unterricht damit, dass er zu mir sagte: Ich habe eine gute Nachricht. Morgen fällt der Unterricht aus. Wir haben frei und können etwas unternehmen. Was wollen wir machen?
Freizeit! Ich war verrückt nach Picknicks und schlug Manali vor, eine besonders schöne Gegend nördlich von Sherab Ling am Fuß des Himalaya. Sie erinnerte mich an meine Heimatstadt in Nubri, einem Distrikt in Nordnepal, direkt an der südlichen Grenze zwischen Nepal und Tibet. Saljay Rinpoche hielt das für eine großartige Idee.
Bist du glücklich?, fragte Saljay Rinpoche.
Ja!, rief ich.
Wie fühlt sich das in deinem Körper an?
Wunderbar, sagte ich zu ihm. Mein Herz fühlt sich weit und glücklich an, und dieses Gefühl strahlt wie die Sonne und breitet sich bis in meine Gliedmaßen aus.
Das ist eine angenehme Empfindung, erklärte Saljay Rinpoche.
Wow! Endlich hatte ich es begriffen. Noch mehr Freude! Noch mehr angenehme Empfindung!
Picknick und Schokolade sind mentale Bilder, aber in meinem speziellen Fall hatte eines davon eine stärkere Auswirkung auf meinen Körper. Ich aß nur gelegentlich Schokolade, aber sie war keine Rarität, nicht wie ein freier Tag vom Unterricht und dazu noch ein Picknick. Im Körper gibt es tatsächlich immer eine Empfindung als Reaktion auf Anziehung und Abneigung. Das ist selbst dann der Fall, wenn sie auf einer Ebene stattfindet, die zu subtil ist, als dass wir sie wahrnehmen können. So schaffen beispielsweise Blumen im Allgemeinen positive Empfindungen. Sie sind schöne und willkommene Objekte, die bei Hochzeitsfeiern oder bei der Totenehrung eingesetzt werden. Geburtstage werden mit Blumen begangen, und wir bringen sie kranken Freunden mit, um sie aufzuheitern. Blumen verschönern und bereichern das Leben, und Blumengeschenke übermitteln Liebe, Fürsorge und Hingabe. Wenn wir dann erwachsen werden, dominieren diese Assoziationen unser Verhältnis zu Blumen, und wenn das geschieht, hören wir auf, das Vorhandensein sensorischer Reaktionen wahrzunehmen. Der Geist wird so in seiner eigenen, wiederkehrenden Blumengeschichte gefangen, dass er nicht auf den Körper achtet. Und doch stellen wir fest, wenn wir genau auf den Körper achten, dass eine Empfindung immer da ist, mag sie auch noch so subtil sein.
Als ich mit Empfindungen zu arbeiten begann, brauchte ich übertriebene Auslöser. So verkündete Saljay Rinpoche beispielsweise, nachdem er eine ausgesprochen angenehme Empfindung erzeugt hatte: Ach übrigens, wir können nicht fahren. Ich habe nur Spaß gemacht.
Meine Unterlippe schob sich zu einer Schnute vor, und auf einmal fühlte ich mich bedrückt und traurig.
Und jetzt sag mir, forderte Saljay Rinpoche mich auf, was für eine Empfindung hast du jetzt in deinem Körper?
Mein Herz fühlt sich verschlossen und beklommen an. Meine Zähne sind zusammengebissen, und dieses unangenehme Gefühl der Anspannung breitet sich über meinen ganzen Körper aus.
Ich begann zu lachen. Nun kannte ich Empfindung, ohne zu denken.
Als ich auf dem Boden des Waggons saß, wurde mir klar, dass ich mir diese Lektion noch einmal zu Gemüte führen musste, denn ich hatte mir diese Zugfahrt zwar vorgestellt, sie aber bis jetzt nicht gefühlt. Ich hatte mir die Außenwelt herbeigezaubert, aber die Empfindung nicht berücksichtigt. Doch die Paralleluniversen Körper, Geist und äußere Phänomene sind immer voneinander abhängig. Empfindung ist das Bindeglied zwischen Objekt und Geist, und zum Geistestraining gehört es, der subtileren Empfindungen gewahr zu werden, den Geist mit ihnen zu verbinden und festzustellen, wie sie uns beeinflussen. Dann können wir eine gewisse Distanz zu unserer Reaktivität legen, und das führt zu Befreiung. Ohne dieses Gewahrsein können wir in der Außenwelt vollkommen die Orientierung verlieren.
Lauf nicht vor diesen unangenehmen Gefühlen davon.Manipuliere sie nicht zu angenehmen Gefühlen. Verweile bei dem, was ist, bei dem, was immer sich ergibt. Ich versuchte es … aber all das Neue und das alles auf einmal und ganz besonders der Schock, allein zu sein, warfen mich immer wieder zurück. Tu so, als wärst du ein alter Mann, der Kindern beim Spielen zusieht, schlug ich mir vor. Schau einfach vergnügt zu, obwohl du die Hindernisse, den Kummer, die Sorgen, die Erschütterungen kennst. Du kennst das alles. Nun ist es an dir, am Ufer zu stehen und zuzusehen, wie das Wasser vorbeifließt. Nur zusehen, ohne dich von der Strömung mitreißen zu lassen.
KAPITEL 3Mit einem goldenen Löffel im Mund geboren
Um eine Redewendung zu bemühen, die ich im Westen gelernt hatte, wurde ich – jedenfalls für nepalesische Verhältnisse – mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. In jungen Jahren hatte ich mit persönlichen Problemen zu kämpfen, darunter mit schweren Panikattacken, aber die schwierigen Lebensumstände, mit denen die meisten Menschen konfrontiert sind, hatten mein Leben nie berührt. Dabei handelte es sich nicht nur um extreme Entbehrungen, mit denen meine Mitreisenden offenbar leben mussten. Ich wusste nicht einmal, wie man eine Fahrkarte kauft oder sich in einer Schlange anstellt. Das Taxi zu bestellen und den Fahrer zu bezahlen waren vollkommen neue Erfahrungen. Ich versuchte, andere zu beobachten, wie sie ihren Tee in den kleinen Wegwerfbechern kauften, falls ich mir auch einmal einen holen wollte.
Öl ins Feuer zu gießen würde mir den Löffel aus dem Mund schlagen, auch wenn ich in diesem Augenblick, in dem ich starr und aufrecht mitten in diesem bösen Traum saß, das Gefühl hatte, dass sich jede einzelne meiner Zellen gegen meine Umgebung auflehnte. Bei jedem Halt stiegen Fahrgäste aus und weitere ein. Nicht einer von ihnen erwies auch nur mit einem Nicken seinen Respekt für die Robe Buddhas.
Während der Zug hin und her schwankte, traten oder stolperten die Fahrgäste auf dem Weg zur Toilette unweigerlich über die, die auf dem Fußboden hockten. Jedes Mal, wenn es dazu kam, zuckte ich zurück.