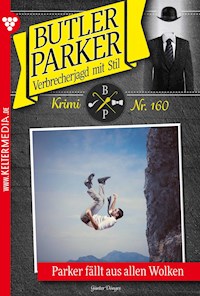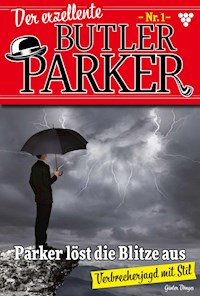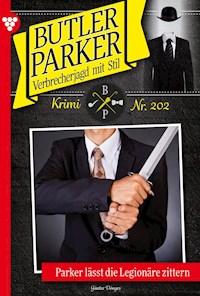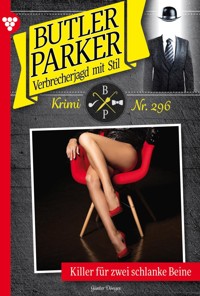Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Der exzellente Butler Parker
- Sprache: Deutsch
Exzellent – das ist er im wahrsten Sinne des Wortes: einzigartig, schlagfertig und natürlich auch unangenehm schlagfähig. Wer ihn unterschätzt, hat schon verloren. Sein Regenschirm ist nicht nur sein Markenzeichen, sondern auch die beste Waffe der Welt. Seinem Charisma, Witz und Charme kann keiner widerstehen. Der exzellente Butler Parker ist seinen Gegnern, den übelsten Ganoven, auch geistig meilenweit überlegen. In seiner auffallend unscheinbaren Tarnung löst er jeden Fall. Bravourös, brillant, effektiv – spannendere und zugleich humorvollere Krimis gibt es nicht! Von Philadelphia aus brauchte er nur runde fünfundsechzig Meilen, um nach Atlantic City zu kommen. Es war eine schnelle Fahrt ohne jede Überraschungen, wenn man von der Massenkarambolage absah, die den Highway Nr. 30 für mehr als eine halbe Stunde blockierte. Doch damit hing seine schlechte Laune nicht zusammen. Sie hatte ganz andere Gründe, die sehr viel tiefer lagen. Seit seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft fühlte Ralf Porter sich stets schlecht gelaunt. Um ein Haar wäre er beinahe in einen Mordprozeß verwickelt worden. Gut, man hatte ihn wieder auf freien Fuß gesetzt. Doch er wußte sehr genau, daß er in das Blickfeld der Polizei geraten war. Man interessierte sich wieder für ihn, schaute ihm auf die Finger. Für Ralph Porters Geschäfte war das lebensgefährlich. Er schätzte die Unauffälligkeit. Als Berufsmörder und Boß einer Gang legte er auf Publicity keinen Wert. Wem er dieses Interesse zu verdanken hatte, war Porter bekannt. Ein gewisser Josuah Parker aus Chikago hatte ihm diese Suppe eingebrockt. An ihr hätte er sich beinahe den Magen verdorben. Porter kannte diesen Butler Parker. Gut, dieser skurrile Mann mit der schwarzen steifen Melone und seinem unvermeidlichen Regenschirm hatte eine Runde verloren und nicht beweisen können, daß er, Porter, Mitwisser einer Mordserie gewesen war. Parker war aber nicht der Mann, der die Dinge nun auf sich beruhen lassen würde. Er suchte ganz sicher nach einer Möglichkeit, um diese Scharte wieder auszuwetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der exzellente Butler Parker – 87 –Auf der Jagd
Unveröffentlichter Roman
Günter Dönges
Von Philadelphia aus brauchte er nur runde fünfundsechzig Meilen, um nach Atlantic City zu kommen. Es war eine schnelle Fahrt ohne jede Überraschungen, wenn man von der Massenkarambolage absah, die den Highway Nr. 30 für mehr als eine halbe Stunde blockierte. Doch damit hing seine schlechte Laune nicht zusammen. Sie hatte ganz andere Gründe, die sehr viel tiefer lagen.
Seit seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft fühlte Ralf Porter sich stets schlecht gelaunt. Um ein Haar wäre er beinahe in einen Mordprozeß verwickelt worden. Gut, man hatte ihn wieder auf freien Fuß gesetzt. Doch er wußte sehr genau, daß er in das Blickfeld der Polizei geraten war. Man interessierte sich wieder für ihn, schaute ihm auf die Finger. Für Ralph Porters Geschäfte war das lebensgefährlich. Er schätzte die Unauffälligkeit. Als Berufsmörder und Boß einer Gang legte er auf Publicity keinen Wert.
Wem er dieses Interesse zu verdanken hatte, war Porter bekannt. Ein gewisser Josuah Parker aus Chikago hatte ihm diese Suppe eingebrockt. An ihr hätte er sich beinahe den Magen verdorben. Porter kannte diesen Butler Parker. Gut, dieser skurrile Mann mit der schwarzen steifen Melone und seinem unvermeidlichen Regenschirm hatte eine Runde verloren und nicht beweisen können, daß er, Porter, Mitwisser einer Mordserie gewesen war.
Parker war aber nicht der Mann, der die Dinge nun auf sich beruhen lassen würde. Er suchte ganz sicher nach einer Möglichkeit, um diese Scharte wieder auszuwetzen. Porter hatte großen Respekt vor dem Butler. Er kannte dessen Gerissenheit und Schläue. In Fachkreisen der Unterwelt hatte der Butler sich längst einen Namen gemacht. Viele hielten ihn zwar nur für verrückt, doch die Kenner wußten es besser. Parker war ein Gangsterjäger, den man wie die Pest fürchtete.
Ralph Porter hatte Atlantic City bisher noch nicht mit seinem Besuch beehrt. Vor der Fahrt hierher hatte er sich aber eingehend informiert. Er wußte genau, was ihn erwartete, nämlich ein riesiges Meerbad mit Hotelkästen aller Preisklassen, in dem sich pro Jahr fast 15 Millionen Gäste und Touristen einfanden. Porter wußte von der enorm großen Convention Hall, einer Kongreßhalle, die die Menschen einer mittelgroßen Stadt fassen kann und schließlich von der im September stattfindenden Beauty Contest. In diesem Schönheitswettbewerb kürte die Jury alljährlich die Miss America.
Das alles war Porter bekannt.
Doch Porter kam nicht als Besucher. Er reiste in Sachen Mord. Er hatte den Auftrag übernommen, einen ganz bestimmten Besucher von Atlantic City umzubringen. Name und Aussehen dieses Opfers waren ihm bekannt. Persönlich hatte er sein Opfer noch nie gesehen. Er wußte nur, daß es sich um einen Nachtclubbesitzer aus Miami handelte, der dem Gangstersyndikat von Florida unangenehm aufgefallen war.
Porter war Spezialist für solche heiklen Aufträge. Bisher hatte er sie stets diskret, schnell und erfolgreich getätigt. Kein Grund also, warum es diesmal anders sein sollte. Und doch fühlte Porter sich zum ersten Male unsicher. Er glaubte sich seit einigen Tagen beobachtet. Er hatte seinen Auftraggebern zu verstehen gegeben, daß es für ihn besser wäre, ein paar Monate lang zu pausieren. Doch die Männer des Syndikats hatten sich darauf nicht eingelassen. Sie wollten, daß Ralph Porter so schnell wie möglich handelte. Sie fürchteten nämlich, von Herb Rosedale verpfiffen zu werden …
*
Diese Sorge hatte auch Rosedale.
Nach seinem Ärger mit dem Syndikat ahnte er, daß er umgebracht werden sollte. Nachträglich nannte er sich einen kompletten Idioten, daß er sich mit dem Syndikat eingelassen hatte. Doch dieser Fehler ließ sich nicht mehr ausbügeln. Auch nicht mit Geld. Die Männer des Syndikats stellten sich schwerhörig. Von einer Unterwerfung wollten sie nichts mehr wissen. Die letzte, endgültige Entscheidung stand allerdings noch aus. Rosedale hoffte, daß sie für ihn gut ausfiel.
Der mittelgroße, schlanke Mann mit dem sportlichen Aussehen und dem braungebrannten Gesicht hatte sich Atlantic City als Versteck ausgesucht. Inmitten der vielen Menschen fühlte er sich bedeutend sicherer als in Florida oder in einer Großstadt. Die Spitzel des Syndikats saßen zwar überall, doch in einer Ferienstadt mit diesem Riesenrummel konnte man am besten untertauchen.
Rosedale wohnte in einem mittleren Hotel, das sich Ventnor House nannte. Es lag in einer Querstraße der Atlantic Avenue und wurde von Gästen mit mittelschwerer Brieftasche bewohnt. Rosedale hatte sich als Kaufmann eingetragen. In der Menge der Gäste ging er völlig unter. Er legte es allerdings auch darauf an, nicht aufzufallen. Trotz aller Sorgen hatte sich die Angst etwas gelegt.
An diesem Nachmittag rief er von der Halle des Hotels aus eine bestimmte Nummer in Miami an. Er hatte sich eine Zigarette angezündet und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand der engen und überhitzten Telefonzelle.
»Hallo, May«, sagte er, als auf der Gegenseite abgehoben wurde. »Hier spricht Bob. Sei vorsichtig, wenn du antwortest.«
»Du kannst offen sprechen«, sagte sie. »Hier ist alles in Ordnung.«
»Übertreib bloß nicht, Süßes. Du weißt genau, in welchen Schwierigkeiten ich stecke.«
»Ich glaube, du solltest dir keine Gedanken mehr machen, Herb.«
»Ist für mich angerufen worden?« Er bemühte sich, gleichgültig zu sprechen.
»In der Nacht«, gab May zurück. Sie hatte eine verhangene, rauhe Stimme. »Man will sich mit dir einigen, Herb. Aber es wird nicht gerade billig werden.«
»Es ist wirklich angerufen worden?« Herb Rosedale atmete tief durch. Auf seiner Stirn bildeten sich Schweißperlen. Sie rührten nicht nur von der Hitze in der Zelle her.
»Sie wollen deinen Laden übernehmen, aber du kannst als Manager darin weitermachen.«
»Die sind wohl wahnsinnig geworden«, stieß Rosedale hervor. Mit solchen Bedingungen hatte er nicht gerechnet.
»Wenn du mich fragst, Herb, so würde ich annehmen«, riet May ihm. »Sie sitzen am längeren Hebel. Aber du hast Zeit, dir die Sache genau zu überlegen. Sie gaben dir drei Tage.«
»Ob sie mit sich reden lassen werden?«
»Wahrscheinlich nicht, Herb. Sie wollen wohl der ganzen Branche klarmachen, daß man ihnen nicht auf der Nase herumtanzen kann.«
»Na gut, ich werde mir den Fall überlegen«, sagte Rosedale gespielt kühl und lässig. »Was ich tun werde, weiß ich noch nicht.«
»Von wo aus rufst du an?« wollte May wissen.
»Es ist besser, du weißt es nicht«, meinte Rosedale und lachte leise auf. »Ich traue den Brüdern nicht über den Weg.«
»Das ist auch gut so«, antwortete May. »Hör’ zu, Herb, steck’ auf und gehe auf die Bedingungen ein. Ich möchte dich gern noch mal Wiedersehen.«
»Wirklich, May …?«
»Was dachtest denn du?« Fast empört klang die Stimme »Weshalb halte ich hier aus und lasse mich von diesen Rüpeln herumstoßen? Doch nur, weil ich dich Wiedersehen will!«
»Schade, daß du nicht hier sein kannst«, sagte Rosedale aufseufzend, »wir könnten uns ein paar nette Tage machen. Aber das läßt sich ja nachholen. Morgen melde ich mich wieder.«
»Sie werden morgen wieder anrufen. Soll ich ihnen sagen, daß ich dich inzwischen gesprochen habe?«
»Sag’ ihnen, daß ich mir den Fall überlegen werde, aber laß durchblicken, daß ich zu Kreuze kriechen werde.«
»Gott sei Dank!« Mays Stimme klang erleichtert. »Ich höre schon, daß du vernünftig geworden bist, Herb. Es ist auch besser so.«
Herb Rosedale legte auf, drückte die Zigarette im Wandaschenbecher aus und verließ die Telefonzelle. Als er durch die Halle hinüber zu den Liftschächten ging, fiel sein Blick auf einen gut gekleideten Mann, der vor der Rezeption stand und sich eintrug.
Rosedale achtete nicht weiter auf diesen Gast, der seriös und zurückhaltend aussah. Er konnte ja nicht wissen, daß sein Mörder bereits im Hotel war …!
*
Ralph Porter ließ sich nicht anmerken, daß er sein Opfer erkannt hatte. Er nahm den Schlüssel entgegen, sah nach dem Hausdiener, der das Gepäck zum Lift brachte, und schlenderte hinüber in die Bar. Nach der langen Fahrt benötigte er dringend einen harten Drink. Vielleicht gelang es dabei auch, die miesen Gedanken herunterzuspülen. Der Berufsmörder stemmte sich auf einen Hocker hoch und bestellte sich beim Barkeeper einen doppelten Gin und ein Glas Lagerbier. Er zündete sich eine Zigarette an und warf einen Blick durch das seitliche Fenster.
Unterhalb der Straße sah er ein Stück der Pacific Avenue und das Boardwalk, einer Promenade, die auf dicken Holzstempeln stand und bei Flut teilweise vom Meer überspült wurde. Vom eigentlichen Strand war vom Hotel aus nichts zu sehen. Der Boardwalk versperrte die Sicht.
Eigentlich klappt’s ja wie bestellt, sagte sich der Killer. Ich habe Rosedale bereits gesehen. Gut, daß ich mir sein Gesicht von den Fotos her eingeprägt habe. Der Mann lebt im gleichen Hotel wie ich. Nun brauche ich nur noch auf die richtige Gelegenheit zu warten, um die Tat auszuführen …
Ralph Porter hatte sich inzwischen einen Plan zurechtgelegt. Er war dafür, sein Opfer ertrinken zu lassen. – Das nahe Meer bot sich dazu förmlich an. Falls Rosedale als ein Ertrunkener angespült wurde, gab es keine lange Fragerei.
Dann wußten die Behörden ohnehin, daß ein bedauerlicher Unglücksfall passiert war.
Porter hatte natürlich auch andere Dinge in Erwägung gezogen. So verfügte er zum Beispiel über einen automatischen Revolver, dessen registrierter Besitzer schon seit Jahren nicht mehr lebte. Diese Waffe hatte Porter bisher noch nie benutzt. Mußte aus ihr geschossen werden, wollte er sie fein säuberlich auseinandernehmen und die Einzelteile sicher vergraben. Und zwar für jedes Einzelteil dann einen anderen Platz.
Diese Waffe führte der Berufskiller nicht im Gepäck mit sich. Solch einen Leichtsinn hätte er sich niemals erlaubt. Als ein der Polizei bekannter Gangster mußte er schließlich immer mit Überraschungen rechnen. Falls man ihn zu einem Gespräch bat, falls man sein Gepäck durchwühlte, immer mußte alles in bester Ordnung sein.
Als dritte Tötungsart gab es dann noch das Messer. Ralph Porter hatte sich in einem Kaufhaus in Philadelphia eingedeckt. Messer dieser Sorte gab es in Unmengen. Sie wiesen kein besonderes Detail auf und konnten bis zum Käufer nicht rückverfolgt werden.
Dieses Messer befand sich natürlich auch nicht in Porters Gepäck. Es lag wie die Schußwaffe wohlverwahrt in einem gesonderten Päckchen und wurde von der Post nur gegen Nennung des Stichwortes ausgeliefert. Ich brauche nur noch herauszufinden, ob Rosedale allein ist, sagte der Mann. Steht das fest, was übrigens sehr wahrscheinlich ist, töte ich Rosedale und fahre nach ein paar Tagen zurück nach Chikago.
Es gab nur einen Menschen, den Porter fürchtete. Doch dieser Mann war in Chikago, wie er genau wußte, Ein Josuah Parker hatte für Schönheitswahlen nichts übrig. Nein, es konnte kaum noch Komplikationen geben. Parker war fern und das Opfer mehr als nahe.
Porter setzte das Bierglas an die Lippen und nahm einen kräftigen Schluck. Als er das Glas wieder absetzte, verkrampften sich plötzlich seine Finger. Er schob ruckartig den Kopf vor und sah durch die Scheibe. Er wollte seinen Augen nicht trauen. Es mußte ein Irrtum oder eine fatale Ähnlichkeit sein.
Langsam entspannten sich die Finger, die das Glas hielten. Er sah der Figur nochmals nach, die langsam über die etwas geneigte Straße lustwandelte und auf die Pacific Avenue zuhielt.
Und ich dachte schon, es könnte Parker sein, beruhigte er sich. Verblüffende Ähnlichkeit mit diesem verdammten Hund! Schließlich weiß ich ja, wie Parker aussieht!
Behutsam stellte er das Glas ab und bekam einen Hustenanfall. Der Mann, der Parker in Kleidung und Haltung so durchaus ähnlich war, blieb stehen und drehte sich zum Hotel um.
Das ist Parker! Porter schluckte und sprang dann blitzschnell vom Hocker herunter. Ihn kümmerten nicht die erstaunten Gesichter der Bargäste, die ihm verblüfft nachschauten. Porter lief zur Tür, stürzte in die Halle und lief hinaus auf die Straße.
Ich will es genau wissen, fuhr es durch seinen Schädel, ich will wissen, ob Parker hier in Atlantic City ist.
Er stieß einige Passanten an, als er im schnellen Lauf die Straße hinunterlief. Groß konnte der Vorsprung Parkers gar nicht sein. Porter war bekannt, daß der Butler es verabscheute, sich schnell oder überhastet zu bewegen. Um nichts in der Welt aber wäre Parker gelaufen. Das hätte seiner inneren Haltung und Würde nicht entsprochen.
Porter ging langsamer. So sehr er auch Ausschau hielt, der Butler war nicht mehr zu sehen. Falls es ihn tatsächlich gegeben hätte, schien er vom Erdboden verschluckt worden zu sein.
Blöde Täuschung, fluchte Porter in sich hinein, ich bin nervös wie ein altes Mädchen, das ’ne Heirat wittert. Parker kann’s doch gar nicht gewesen sein! – Nicht zu glauben, wie der Kerl an meinen Nerven zerrt. Es wird höchste Zeit, daß ich ihm das Genick breche …!
Kaum aber beruhigt, regte der Berufskiller sich schon wieder auf. Wenn es Parker nicht gewesen war, mußte doch sein Doppelgänger noch in der Nähe sein. Dieser Mann konnte sich doch wohl ebenfalls kaum in Luft aufgelöst haben.
Der Gangster gab das weitere Suchen auf, zündete sich eine Zigarette an und ging langsam zurück zum Hotel. Seine Laune sank weit unter den Nullpunkt.
Er hatte das Hotel noch nicht ganz erreicht, als er plötzlich erschreckt zusammenfuhr. Ein stechender Schmerz breitete sich vom Hinterkopf aus. Unwillkürlich faßte er nach der schmerzenden Stelle. Die Fingerkuppen ertasteten eine kleine Schwellung.
Muß ’ne Biene oder Wespe gewesen sein, beruhigte sich der Gangster.
Die Zähne zusammenbeißend, ging er weiter.
Plötzlich, ohne jede Ankündigung, wurde sein Hinterkopf noch mal von der vermeintlichen Biene gestochen. Doch jetzt wußte Porter bereits, daß er beschossen worden war. Die Schußwaffe war ihm unbekannt, auch das Geschoß. Nur der böse Schmerz war eine Tatsache, die er nicht wegzuleugnen vermochte.
Ohne es auf weiteren Ärger ankommen zu lassen, nahm er die Beine in die Hand und rettete sich zurück in die Hotelhalle. Von hier aus beobachtete er die Straße, sich dabei die deutlichen Schwellungen reibend.
Auffälliges war nicht zu sehen. Normal und durchschnittlich aussehende Passanten waren auf der Straße. Weit und breit aber kein Mensch, der mit Josuah Parker hätte verwechselt werden können.
Abwarten, sagte er sich, auch ich bin mal an der Reihe, aber dann staubt’s nicht nur, sondern dann gibt es unverdauliche Brocken! Irgend etwas stimmte aber nicht. Aus Zufall bin ich nicht beschossen worden. Wenn ich nur wüßte, womit man meinen Hinterkopf getroffen hat. Kugeln können’s nicht gewesen sein. Tut verdammt weh, zum Teufel …!
Ralph Porter stakste zurück in die Bar, doch sein Appetit war verschwunden. Er fuhr hinauf in sein Zimmer und richtete sich ein. Der Koffer und die große Reisetasche waren schnell ausgepackt.
Ich sollte schleunigst wieder einpacken und verschwinden, sagte er sich. Falls Josuah Parker wirklich hier in der Nähe ist, wird es Ärger geben. Und ich habe keine Lust, wegen zehntausend Dollar auf den elektrischen Stuhl zu kommen.
Ralph Porter langte nach dem Telefon und ließ sich von der Hotelvermittlung eine Verbindung mit einer Chikagoer Nummer herstellen. Es dauerte knapp eine Minute, bis er eine ihm bekannte Stimme hörte. Sie gehörte Larry Medfort, seiner rechten Hand, die in seiner Abwesenheit die Gang leitete.
»Was ist los, Chef?« fragte Medfort erstaunt. Es paßte einfach nicht zu seinem Boß, daß er sich während einer seiner Dienstreisen meldete.
»Stell fest, Larry, ob sich dieser verdammte Parker in der Stadt aufhält«, befahl Porter knapp. »Sobald du Bescheid weißt, will ich angerufen werden. Präg dir meinen Namen hier im Atlantic City ein. Ich bin unter meinem richtigen Namen abgestiegen. Laß mich aber nicht zu lange warten.«
»Riecht nach Ärger, was?«
»Schluß der Sendung«, erwiderte Porter, der stets mißtrauisch war und durchaus damit rechnete, daß seine Leitung eventuell abgehört wurde. »Ich will wissen, wo Parker sich aufhält.«
Porter legte auf und wollte nach seiner brennenden Zigarette greifen, als das Telefon auf dem kleinen Tischchen klingelte. Er beugte sich vor und hob den Hörer ab.
»Hier Porter«, meldete er sich, »Wer ruft an?«
Auf der Gegenseite blieb alles still.
»Hallo, wer spricht?« fragte der Gangster noch mal.
Stille auf der Gegenseite.
»Zum Teufel, warum melden Sie sich nicht?« brüllte Porter wütend in die Sprechmuschel.
Ein feines Klicken in der Leitung aber zeigte ihm an, daß auf der Gegenseite aufgelegt worden war. Porter knallte den Hörer in die Gabel. Es schüttelte ihn. Gegen seinen Willen spürte er ein kaltes Gefühl, das über seinen Rücken rieselte. Jede Drohung oder Anspielung hätte er ertragen, doch dieses Schweigen auf der Gegenseite machte ihn unsicher und nervös.
Parker, dachte er, das kann nur Parker gewesen sein! Dieser verdammte Bursche liebt doch solche Tricks. Er will mich nervös machen. Aber da beißt er bei mir auf Granit. Mit mir kann man so was doch nicht machen …!
Ralph Porter trat ans Fenster. Unwillkürlich beobachtete er die enge Straße unter sich, unwillkürlich hielt er plötzlich Ausschau nach dem Butler, den er wie die Pest haßte. Es beruhigte ihn keineswegs, daß er Parker nicht entdecken konnte. Ja, wenn er ehrlich gegen sich selbst sein wollte, mußte er zugeben, daß es ihm lieber gewesen wäre, wenn er den Butler gesehen hätte …!
*
Als es dunkel geworden war, schlenderte Herb Rosedale hinunter zum lichtüberfluteten Boardwalk. Er war kein Kind von Traurigkeit, er brauchte Betrieb um sich herum, mußte Menschen um sich haben. Da er nun schon mal in Atlantic City war, wollte er seine Freiheit auch in vollen Zügen genießen. Möglichkeiten dazu boten sich von selbst an.