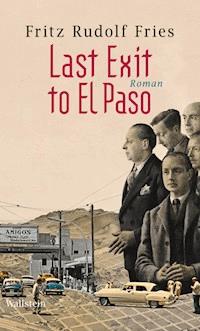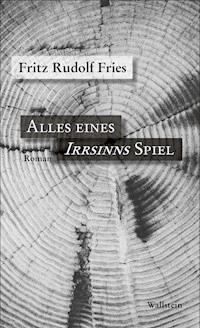20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fritz Rudolf Fries' Essays zur Literatur sind Ausdruck seines großen literarischen Interesses, das sich weder auf Epochen noch auf Stile eingrenzen lässt. Insbesondere der spanischsprachigen Literatur widmete er dabei zeit seines Lebens seine Aufmerksamkeit. Die knapp fünfzig Texte zur Literatur, die dieser Band versammelt, reichen zeitlich von den späten 50er Jahren bis in Fries' Todesjahr 2014, und zeigen einen Autor, der sich mit unterschiedlichsten Autoren und Werken befasste und dabei mit außergewöhnlichem literarischen Gespür nie die Freude daran verlor, literarische Neuentdeckungen zu machen. Neben Autoren wie Daniel Kehlmann, dessen Debüt Fries mit großer Zustimmung rezensierte, oder Thomas Pynchon beschäftigte sich der in Bilbao geborene Fries besonders auch mit der spanischsprachigen Literatur. Der vorliegende Band zeigt nun, dass sich diese Auseinandersetzung nicht auf bestimmte Stile oder Epochen beschränkte. Vielmehr reichen die Texte von spanischen Schelmenromanen des 16. Jahrhunderts über Miguel de Cervantes bis in die Moderne. Hier begegnen dem Leser bekannte Namen spanischer und lateinamerikanischer Autoren wie Federico García Lorca, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Pablo Neruda oder die Nobelpreisträger Octavio Paz und Mario Vargas Llosa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Fritz Rudolf Fries
Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies
Texte zur Literatur
Fritz Rudolf Fries
Auf der Suche nach demverlorenen Paradies
Texte zur Literatur
Herausgegeben und mit einem Nachwortvon Helmut Böttiger
Wallstein Verlag
Standortbestimmungen
Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies
Über den ariadnischen Roman von José Lezama Lima
Der wahre Leser muß der erweiterte Autor sein.
Novalis
Stets sah er in seiner nächsten Familie, seiner
Frau und seinen Kindern den einzigen Weg, um
zur anderen, fernen Familie, der verzauberten,
übernatürlichen zu gelangen.
José Lezama Lima, Paradiso
Man darf nicht bei dem Satz Heideggers, daß der
Mensch ein Sein-zum-Tode ist, stehenbleiben.
Denn wer ist eigentlich der Dichter? Ein Sein,
das eine neue Kausalität der Auferstehung
schafft.
José Lezama Lima, Rede auf dem Kulturkongreß,
Havanna 1968
José Lezama Limas Kosmos ließe sich aus Zitaten wirken. Wie die Spinne, die in lateinischen Ländern ihren Namen der Ariadne verdankt, ist er nichts ohne das eigene Netz. Der Ariadnefaden des Autors will den Leser einspinnen; das wachsende Werk der Kritiker um diesen einzigen, 1966 in Havanna erschienenen Roman des Autors prüft die Machart dieses ariadnischen Romans, auf die Gefahr hin, selber ins Netz zu gehen. Fürchten wir durchaus, unsere Freiheit des bequemen Lesens dabei zu verlieren. »Lezama zu lesen«, hat Julio Cortázar geschrieben, »ist eine der mühsamsten und oft auch ärgerlichsten Tätigkeiten, die es geben kann.« Cortázar weiß, wovon er spricht; er hat das Manuskript für den Druck redigiert und gegen die Gleichgültigkeit des Autors mit Satzzeichen versehen, die wie Atempausen waren im Duktus des Asthmatikers Lezama. Cortázar hat neben Vargas Llosa eine der ersten Exegesen des Romans geschrieben und sie in seinem wunderlichen Buch Reise um den Tag in achtzig Welten veröffentlicht. Jules Verne, als gemeinsamer Ahnherr, bot sich an, wenn Lezama auf seiner kubanischen Insel die Wunder eines gerade entdeckten Kontinents findet. 1966 ist die Zeit einer Blockade um Kuba. Lezamas Roman, in einer geringen Auflage von 4000 Exemplaren erschienen und sogleich vergriffen, bleibt beinah unbemerkt. Nicht einmal die kubanischen Leser ahnten, was sie sich da auf den häuslichen Tisch gelegt hatten. Wer war denn dieser José Lezama Lima?
Um das Jahr 1963 leitet Lezama die Abteilung für Literatur und Publikation des neuen Kuba. Er wird Vizepräsident des Schriftstellerverbandes und Berater des Kubanischen Zentrums für literarische Studien. Doch seltsam genug, Lezama bleibt unsichtbar für jene Reisenden des Jahres 1963, einen Professor und seinen Assistenten, die in Sachen Literatur nach Kuba kommen. Nichts bringen sie in Erfahrung über diesen Mann, der seit 1944 an seinem Roman Paradiso arbeitet und im November 1963 vermutlich über Oppiano Licario nachdenkt, diese Inkarnation literarischer Aufklärung. Der Koloß, der Panzer aus Blei, wie er spöttisch genannt wurde, der gewaltige Esser, der asthmatische Zigarrenraucher, der in Dantes Paradies so gut zu Hause war wie in den Kochrezepten seiner kubanischen Großmutter, man zeigte ihn uns nicht, wir trafen ihn nicht auf dem Paseo del Prado. Immerzu besichtigten wir die Großen der kubanischen Literatur und Wissenschaft; den Namen des größten Poeten aber verschwieg uns eine wie heilige Scheu, vielleicht eine Art Respekt, den Magier bei seinen Kreisen zu lassen, noli me tangere; denn es hätte die Geburt dieses Gebildes Paradiso gefährden können. So saß Lezama im Spinnennetz der eigenen Wohnung in der Altstadt von Havanna, umgeben von Trödelkram und den bebilderten Enzyklopädien seiner Kindheit, versorgt von seiner Mutter, die 1964 sterben würde – (»Alles, was ich tat, ist meiner Mutter gewidmet«). Zeigte er Besuchern wie Vargas Llosa seine Bücher und Bilder, so verwandelte seine begleitende Rede den Schatz in eine andere Dimension. Lezamas romaneske Welt war total, sie begann und endete in der eigenen Wohnung. Zehn Jahre nach Erscheinen von Paradiso gilt seine Leistung als eine der größten des lateinamerikanischen Romans. Das ist um so erstaunlicher, da Lezama seine Insel nicht verlassen hat außer für zwei flüchtige Reisen nach Mexiko (1940) und Jamaika (1950). In kultureller Hinsicht aber war die »Perle der Antillen« privilegiert gewesen, was auch damit zusammenhing, daß sich Kuba als letzte Kolonie aus der Bindung zu Spanien gelöst hatte: 1898, für Spanien ein Jahr der Erniedrigung und Selbstbesinnung seiner Intellektuellen. Was aus Europa nach Kuba kam, war oft nicht mehr als Treibgut, die verblaßten Moden von gestern, mit denen sich eine bürgerliche Klasse kostümierte, deren Frivolität an Historien aus der Antike erinnerte. Lezamas Atemnot rührte wohl auch daher, daß er, ein zweiter Herkules, die Last zweier Kulturen tragen wollte, der kubanischen und der europäischen, genauer, der griechischen, die auch für Lezama ein Paradies der Menschheit bedeutete. Im Übergang der Zeiten war der Lezama Lima der sechziger Jahre eines jener aussterbenden Fossilien von universaler Bildung. Von Jahr zu Jahr bedaure ich mehr, mit ihm nicht auf einer Bank unter den Lorbeerbäumen des Prado gesessen und die hohnvolle Anmaßung seines Geistes wie den aufgerissenen Schlund eines Ogers bewundert zu haben. Wir, die Reisenden, wußten ja, was wir wußten, aber hier hätte unser geordnetes europäisches Wissen fürchten müssen, von einem jener Taifune, wie sie seit Shakespeares Sturm über die Karibik toben, mitgerissen zu werden. »Das Auge eines Taifuns«, hat Lezama geschrieben, »gleicht der phantastischen Vegetation der Barockkunst.« Auf ihrem langen Weg von Ägypten nach Griechenland, in ihrer spanischen und französischen Prägung, wurde die europäische Kultur für den kubanischen Autor das, was Amerika für Europa lange Zeit gewesen war: eine exotische Landschaft. Paradiso leistet in der spielerischen Emanzipation von dieser Kultur den gleichen Beitrag wie die namhaften lateinamerikanischen Romane der Gegenwart.
Bei einem Dichter wie Lezama Lima, der für seine Gedichte, Essays, für seinen Roman mit der Gabe eines Antiquars findet, was er gerade braucht, möchte man glauben, der Bazillus der sterblichen Zeit habe ihn unberührt gelassen. Doch es findet sich in der Summe des Riesenromans auch eine Chronik der Inselgeschichte, die über die Handlung mit ihrer Spanne von den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts bis in die vierziger Jahre des 20. hinausgeht. Die Familiengeschichte des Autors ist Teil der aus Zucker und Diktatur gemachten Geschichte Kubas.
Havanna, als Hauptstadt der kubanischen Bourgeoisie, so sieht es die Amerikanerin Jean Franco, eine der besten Interpretinnen Lezamas, war verkommener als Miami. Es wurde ein »Gringo-Bordell«, nachdem die USA das spanische Erbe in Kuba angetreten hatten. In diesem Bild erschien García Márquez die Stadt, wenn er aus der Erinnerung schreibt: »Die Lateinamerikaner meiner Generation stellten sich Havanna als schändliches Gringo-Bordell vor, in dem die Pornographie zum öffentlichen Schauspiel erster Ordnung geworden war, lange bevor sie auch im Rest der christlichen Welt eingebürgert wurde; für den Gegenwert eines Dollars konnte man einer Frau und einem Mann von Fleisch und Bein zusehen, wie sie sich nach allen Regeln in einem Theaterbett liebten. Diesem Paradies des Lasters entströmte eine diabolische Musik, eine geheime Sprache des süßen Lebens, eine bestimmte Art, zu gehen und sich zu kleiden, eine ganze Kultur der Sittenverderbnis, die im Raum der Karibik das tägliche Leben glanzvoll beeinflußte. Allerdings wußten die besser Informierten, daß Kuba die kulturell am höchsten entwickelte Kolonie Spaniens gewesen war … und daß die Tradition der literarischen Kaffeehausrunden und der Dichterwettkämpfe unzerstörbar fortlebte, während die Gringos von den Expeditionskorps die Heldendenkmäler bepißten und die Banditen der Präsidenten der Republik bewaffnet über die Gerichtshöfe herfielen, um die Anklageschriften zu rauben …«
Wie begegnet ein angehender Dichter wie José Cemí diesem Gringo-Bordell? Doch wohl auch mit Sarkasmus, mit dem schwarzen Humor der Kubaner, der zur Kunst des Überlebens gehört. Farraluques Abenteuer im berühmten achten Kapitel des Romans haben etwas von diesem Sarkasmus. Die Übertreibung ist hier ein poetisches Element, das zugleich Lezamas Verfahrensweise anschaulich macht. Eine metaphernreiche Sprache (Juan Goytisolo hat ihr eine Untersuchung gewidmet) hebt hier die funktionalen Werkzeuge der Natur gleichsam ins Orgiastische eines Gedichts – und somit ins Bild einer zweiten Natur. »Ich glaube, das Wunder eines Gedichts ist, daß es einen Körper schafft, eine resistente Substanz zwischen einer fortschreitenden Metapher, die unendliche Verbindung herstellt, und einem letzten Bild, welches das Überleben dieser Substanz, dieser Poesie gewährleistet.« (Lezama)
Unbemerkt geht man in die assoziativen Fallen dieses Autors, wenn man über Paradiso schreibt. Eine Metapher, die jeder Leser gern detektivisch löst, beginnt mit der Frage: Ist der Held der Autor? Im Tristram Shandydes Lawrence Sterne – einer der Paten des Schriftstellers Lezama – kommt bekanntlich der Held erst am Ende des Romans auf die Welt.
José Cemís Fahrt in die Welt beginnt gleich auf den ersten Seiten des Buches, als eine Erfahrung von Schmerz und Krankheit; doch scheint es, als ob der Autor seine Neugier für diesen Helden nur so lange wachhalten kann, wie er ihm die Erinnerung an die verlorene Kindheit zurückbringt.
José Lezama Lima wurde am 19. Dezember 1910 in einem Militärlager nahe Havanna geboren. Sein Vater gehörte als Artillerieoberst zur Militärhierarchie der kubanischen Republik unter ihrem liberalen Präsidenten Miguel Gómez. Lezamas Mutter kam aus einer Familie, die in Kuba José Martís Kampf um die Unabhängigkeit unterstützt hatte – bis zum eigenen Ruin. Als Folge dieser politischen Betätigung hatte die Familie Jahre im nordamerikanischen Exil verbringen müssen. Im Roman gewinnt die Heirat der Eltern Cemís eine überhöhte Bedeutung in der Verbindung des »verbalen Stoizismus der Basken« (Jean Franco) mit der kreolischen Fröhlichkeit der Familie Rialtas. Die quasi alchimistische Heirat disparater Elemente war ja seit dem Mittelalter ein Rezept zur Erzeugung einer poetischen Welt.
Lezama litt schon als Kind unter Asthmaanfällen, die ihn oft zu wochenlanger Bettruhe zwangen. Die Krankheit isolierte ihn von anderen Kindern, brachte die lebenslange Bindung an die Mutter, den frühen Umgang mit Büchern. In die frühen Jahre der Kindheit fällt der Tod des Vaters, der das Opfer einer Grippeepidemie wird. Für Lezama beginnt nun ein Leben im Haus der Großmutter, eine Erziehung durch Frauen. Bis zu seinem Tod am 9. August 1976 in Havanna verläßt Lezama das Ambiente der kleinbürgerlichen Wohnung nicht. Sie ist die Mitte seiner Kreis um Kreis wachsenden phantastischen Welten, darin er von sich das sagen konnte, was er in einem frühen, berühmten Gedicht, Der Tod des Narziß, notiert: »Danae webt die vom Nil vergoldete Zeit.« Er studiert Philosophie und Jura. Als Student beteiligt er sich 1930 am Aufstand gegen die Diktatur Machados – eine Episode, die später in der symbolischen Überhöhung des Romans zu einem Kampf von Licht und Finsternis wird, im klassischen Antagonismus einer Fehde zwischen Feder und Schwert. Damals erkennt er, nach seinen Worten, »die grenzenlose Zukunft des Kubanischen« als einen Ansatz revolutionärer Mythologie. Das gewaltsame Machadato, das bis 1933 an der Macht blieb, war eine reaktionäre, proimperialistische Diktatur, die den Widerstand der Arbeiter und der Intelligenz hervorrief. Da der Landesherr die Universitäten schloß, blieb für Lezama nur das häusliche enzyklopädische Studium auf eigene Faust. Eine spätere Biographie Lezamas wird einen Akzent auf diese Jahre des Dichters legen müssen, auf diese Zeit der Assimilation der heterogenen kubanischen Elemente, wie wir sie im Roman wiederfinden, von der Geographie bis zur Kochkunst der Insel, von der Geschichte bis zur Sprache, ein von Liebe und Wissen genährtes Amalgam, mit dessen Hilfe Lezama die »Montego Bay« der Literatur erreichen konnte. 1936 besucht der spanische Lyriker und spätere Nobelpreisträger Juan Ramón Jiménez Kuba. Lezama gewinnt seine Freundschaft, und der Meister bestärkt ihn in seinen dichterischen Versuchen. Dennoch bleibt die Brotarbeit, die Anwaltskanzlei. Lezama beginnt Proust und W. C. Williams zu übersetzen. Und er beginnt die Herausgebertätigkeit heute legendärer literarischer Zeitschriften wie Orígenes, die »beste Zeitschrift spanischer Sprache«, wie Octavio Paz sie genannt hat. Orígenes wird für Lezama etwas wie ein kapriziös von ihm dirigiertes Orchester, in dem mitzuspielen der Ehrgeiz der jungen kubanischen Intelligenz war. Mit der Geburt von Orígenes beginnt 1944 die Arbeit am Roman Paradiso.
Lezamas Paradies ist die Poesie. Die Vertreibung aus dem Paradies der Kindheit diktiert der Tod. »Der Tod gab mir ein neues Lebensverständnis, das Unsichtbare begann auf mich zu wirken.« Der Tod des Vaters hatte für Lezama wie für José Cemí die Abwesenheit des Vaters bedeutet, oder in den Kategorien des Autors gesagt: die Abwesenheit des Bildes. Mit der Arbeit am Roman beginnt die Auferstehung des Bildes. Zwei andere Sterbefälle notiert Lezama für seine Arbeit: den gewaltsamen Tod des Studenten Rafael Trejo (1930) und den Tod der Mutter im September 1964 – »eine neue Zwangsvorstellung für mich«.
Lezamas über Jahrzehnte konzipierte hermetische Welt wird noch vor Erscheinen des Buches mit der siegreichen kubanischen Revolution von 1959 konfrontiert. Für einen langsam schreibenden Autor wie Lezama eine Provokation, der er nur mit einer ihm eigenen Dimension begegnen kann: der grenzenlosen Dimension des Kubanischen, der Utopie.
»Wenn die Revolution stark genug ist«, erklärt er nach Erscheinen von Paradiso, »wird sie alles verdauen, selbst Paradiso.« Lezama blieb in den frühen revolutionären Jahren ein Außenseiter – das Wort so verstanden, daß es die Rolle des Beobachters an der Peripherie des Kreises einschließt. Das konnte zu Mißverständnissen führen, zu Verkennungen auf beiden Seiten der kubanischen Blockade, die 1963 mit der Invasion an der Schweinebucht kläglich scheiterte. Das Thema Literatur und Revolution hat Lezama auch in den Jahren nach Erscheinen seines Romans beschäftigt. So äußerte er sich in einer Umfrage der »Casa de las Américas« Ende 1968: »Die Revolution hat für mich eine wesentlich größere Bedeutung als nur die einer Veränderung. Sie war eine Integration, eine Vertiefung des Kubanischen. Sie hat uns die Transzendenz der Person gelehrt und die dem Menschen von der Schöpfung zubestimmte universale Dimension eröffnet …« Es überrascht nicht, daß Lezama aus der Welt seines Romans einen Übergang in die Postulate einer anderen, aus der Notwendigkeit des Alltags formulierten Sprache suchte. Man braucht in diesen Sätzen nur das Wort »Revolution« und das Wort »Paradiso« auszutauschen, um Lezamas Absichten zu begreifen.
Paradiso – Paradies, so hieß Dantes gewaltige Schöpfung aus der italienischen Renaissance. Mit Dante ist dem Leser des Romans ein weiteres Stichwort an die Hand gegeben, sich im Labyrinth der Sätze Lezamas zurechtzufinden. Letztlich ist jede Lektüre des Buches ein Ariadnefaden, den der Leser selber legen muß. Lezama wechselt ständig von der Mitteilung zur Bedeutung, von der Erzählung zur Auslegung, in einer Spannweite, die zuweilen schon die bloße Reportage zur antiken Fabel macht. Ärgerlich, wenn da Rätsel nicht aufgehen, die keinen Einlaß in unser Gedächtnis finden, so als kämen sie aus einer voradamitischen Zeit, in der die Fortpflanzung der Menschen, wie Lezama es sieht, noch der Sprossung der Bäume glich. Hier erinnert Lezama nicht ohne Ironie an einen Weltenschöpfer, der am siebenten Tag noch ein paar Dinge in der Tasche behielt, um sie später in die Seiten eines Romans zu streuen.
Dante hatte im Gastmahl (II, 1) vier mögliche Anleitungen gegeben, Literatur zu untersuchen. Erstens: der wörtliche Schriftsinn, die »schöne Lüge«, die auf der Oberfläche des Werks schwimmt wie eine Wasserrose. Zweitens: die nach der »versteckten Wahrheit«, was steckt zwischen den Zeilen – für Dante wie für den Katholiken Lezama die Allegorie, die Offenbarung des Heiligen Geistes in der Taube. Drittens: die Moral von der Geschichte, die Aussage, die die Kritiker am liebsten schwarz auf weiß nach Hause tragen. Viertens: die Enthüllung der »sublimen Dinge«, letztlich eine Phantasmagorie, die eine Phantasmagorie gebiert, der unerklärliche Rest von Kunst, der einem entweder beim Lesen oder im Träumen aufgeht. »Wie die große Trilogie seines Meisters«, schreibt Rodriguez-Monegal in diesem Zusammenhang, »erfordert auch Lezamas Werk sukzessive Lektüre.«
Die erste Schicht des Romans schält sich aus einer bekannten Tradition, wie sie Goethe und Jean Paul ausgebildet haben und wie sie im spanischen Schelmenroman einen profanen Vorläufer hat: den Bildungs- und Familienroman. Die Irrfahrt des jugendlichen Helden José Cemí in die Welt, bis zu dem Augenblick, da er, wie sein viele Jahrzehnte älteres zweites Ego, selber ein Dichter wird, der abermals eine erfahrene Welt in die Fiktion holen wird. Das Ergebnis von Cemís Dichtkunst wäre womöglich die ungeschriebene Fortsetzung zu Paradiso geworden, ein Roman, dem Lezama den Titel »Inferno« geben wollte. Auf dem sicheren Boden dieser Tradition stehend, kann Lezama sich wie ein Schöpfer gebärden; da anderenorts der allwissende Erzähler längst ausgelacht wurde, scheut Lezama sich nicht, seine Figuren nach Belieben hin und her zu schieben mit Bemerkungen wie: »Was tat der junge Ricardo Fronesis, während über seine Herkunft berichtet wurde?« oder: »Señora Rialtas Bruder, der in diesem Roman gemäß seiner Eigenart aufzutreten verlangt.« Diese Willkür entäußert sich auch in kritischen Kommentaren und Meinungen des Autors – im Roman eines Romans trifft sich die Poetik des Mittelalters mit der Neuzeit; angesichts der Blindheit mancher Kritiker mag dies auch eine ironische Absicht des Essayisten Lezama sein, seinen beschränkten Kollegen von der Kritik die Stichworte zu soufflieren. Dagegen verstößt er gegen die einfachsten Regeln der Höflichkeit dem Leser gegenüber, wenn er seine Figuren ohne jede realistische Motivation zusammenbringt, weil die höhere Vernunft des Romans es so will. Damit Cemí im 13. Kapitel (und die Zahl mag kein Zufall sein) eine schicksalhafte Begegnung erleidet, setzt der Autor Martincillo Vivo, Adalberto Kuller, José Cemí und Oppiano Licario in einen Omnibus, der mit seiner Stierkopflenkung so alltäglich dann auch wieder nicht ist. Ähnlich verwirrend ein anderes Verfahren Lezamas, das an Jean Paul erinnert: Er macht das Kleine groß und umgekehrt, als verwechsle er ständig die Linsen eines Opernglases. Der Tod Onkel Albertos bekommt drei Zeilen; das Fieber des Gitarristen wenige Seiten davor darf sich über mehrere Seiten ausbreiten. Auf die Frage nach seinen Verfahrensweisen gab Lezama die einzig mögliche Antwort: »Mein leidenschaftliches Barock assimiliert alle Elemente der äußeren Welt.«
Ein Wagnis unsererseits wäre es, diese ungesicherten Termini wie Barock oder Romantik zur Deutung des Romans heranzuziehen. Es gibt ein kubanisches Barock bei Alejo Carpentier und ein anderes bei Lezama Lima. Beide gehen zurück auf eine Assimilation europäischer und afrikanischer Elemente auf Kuba. Die Behutsamkeit, mit der Cemís Großmutter mit Zimt umgeht in einem der vielleicht schönsten Abschnitte des Romans, korrespondiert mit der ballistischen Fantasie des Obersts und der Ehrenrührigkeit des Kochs Juan Izquierdo. Bei dem Cartesianer Carpentier gilt die Erkennbarkeit der Linien als oberstes Gebot; sein magischer Realismus ist wie eine Begleitmusik unserer alltäglichen Erfahrungen. Bei Lezama ist es die Rekonstruktion des Labyrinths von Kreta, indem er eine Postkarte der Gärten von Aranjuez unterlegt. Der so verwirrte Leser müßte sein eigenes Labyrinth planen, um nicht der Gefangene dieses Autors zu bleiben.
Über Lezamas Sprache ist viel geschrieben worden. Ähnlich wie die französischen Surrealisten verwandelt er die bekannten Dinge in Über-Dinge, um paradoxerweise das Ding an sich zu destillieren. Das klingt abstrakter, als es ist, und beginnt bei der Namensgebung seiner Figuren. Zu Jose Cemí gibt es verschiedene Übersetzungen. Die einfachste lautet: C’est mi – eine französisch-spanische Hybride: »Das bin ich«, der Autor José Lezama Lima. Der kubanische Folklorespezialist José Juan Arram dagegen interpretiert: »Cemí ist ein Wort aus einer verschollenen Ursprache der Karibik und meint die Götter und ihre bildliche Darstellung.« Für Jean Franco leitet sich der Name von sema (Zeichen) ab. Vermutlich hat Lezamas kreative Ironie das alles auch schon gewußt und intendiert. Am Anfang war das Wort, aber dann kamen die Etymologen. Cemís Begleiter durch die Unter- und Oberwelt der Stadt sind Fronesis, das heißt der Besonnene, zugleich der Titel eines Dialogs bei Platon, und Foción, das heißt der Triebhafte. Oppiano Licario, magischer Lehrer der Spätzeit Cemís, der einem nachgelassenen Romanfragment Lezamas den Titel gibt, trägt den Vornamen eines römischen Dichters (der zugleich poetisches Streben bedeutet); aus dem Nachnamen lassen sich Anklänge an Ikarus heraushören. Lezamas Metaphern sind oft enträtselt worden – zuweilen führten die Auslegungen zu neuen Rätseln. Die Sprachgewalt des Autors ist oft so willkürlich auktorial wie die Kompositionskunst seines Romans. Es ist, als ob Lezamas Erinnerungsvermögen die kruden Substanzen seiner eigenen Lebensgeschichte rasch verlieren würde, wenn er sie nicht assoziativ an Vergleiche bindet, an Fernerliegendes, in anderen Zeiten und Räumen unter anderem Namen Geschehenes, das im Rhythmus seiner Struktur eine Wiederkehr ankündigt. Und Wiederkehr ist Auferstehung. Man lese die ersten Seiten des Romans, in der rührenden Szene vom kranken Cemí und der Wärterin schlägt der Naturalismus der Beschreibung ständig um ins Vergleichsmuster anderer Zeiten und Welten.
Die Ungleichzeitigkeit herangeholter Dinge ergibt für Lezama eine neue, überraschende Qualität. Erst das dichterische Bild bringt die flüchtige Zeit zum Stehen. Die Kühnheit der Metaphern, aus denen sich das Bild zusammensetzt, erinnert an die Sprache García Lorcas. Es ist nicht verbürgt, ob Lezama den spanischen Dichter bei seinem Besuch in Havanna (1930) kennengelernt hat.
In der Theorie des Bildes, dieser Momentaufnahme eines Paradieses, geht Lezama über seine Vorläufer hinaus. Marcel Prousts berühmte »Madeleine«, jenes Stück Gebäck, das der Erzähler in den Tee taucht, um sein Erinnerungsvermögen anzuregen, die glücklichen Tage der Kindheit zu reproduzieren, diese »Madeleine« gehörte zum Ritual einer Zauberformel, mit deren Hilfe sich Proust über die Miseren der erlebnisschwachen Gegenwart hinwegsetzen konnte. Lezamas Verfahren ist willkürlich in der Zusammensetzung der Elemente.
Der kubanische Autor erinnert manchmal an einen Zauberkünstler, der seine Requisiten durcheinandergebracht hat – das Ergebnis verblüfft ihn selber, und er kann es weder sich noch uns erklären. Die Welt bleibt ein Rätsel bis zum Jüngsten Tag. Das absolute Bild bezaubert, weil es nicht zu erklären ist, und der Roman wird zu einem zweiten Kosmos, darin jeder Leser ein anderes Jahrhundert der Auslegung bedeutet. Nach Erscheinen des Buches in Frankreich sprach die Kritik enthusiastisch von einem »zweiten Proust«. Die »schöne Lüge« der Oberfläche verführte die Kritiker. Beide Autoren waren Asthmatiker, beide hatten eine starke Mutterbindung und eine versteckte oder offene Neigung zur Homosexualität, in beiden Werken ist die Suche nach der verlorenen Zeit die Motivation des Erzählens etc. Schließlich hatte Lezama nach der siegreichen kubanischen Revolution den Plan einer Veröffentlichung des großen Romanwerks von Marcel Proust zu den wichtigsten editorischen Aufgaben erklärt. Wie Proust sah auch der um eine Generation jüngere Lezama den Roman als eine totale Gattung, lebendiger als die Kritiker, die ihn totsagten, ein Medium wie ein Schwamm, fähig, das Leben des Autors im doppelten Sinne aufzusaugen, seine Erfahrung wie seine Energie mitzunehmen, die Reise durch einen scheinbar leeren Tag mit achtzig Welten zu bereichern. Die Unterschiede zu Proust aber sind unübersehbar. Denn dort, wo Proust Erhellung sucht, Psychoanalyse betreibt, Aufklärung für seine Charaktere und deren Tun, Traumdeutung, von der Nacht in den Tag schreibt, geht Lezama den umgekehrten Weg. Für ihn gilt der paradoxe Satz Heraklits: »O Dunkel, du mein Licht.« Prousts Sprache dient der klinischen Studie seiner Figuren, sie ist gebunden an die jeweilige Gesellschaftsschicht der Pariser Aristokratie und Bourgeoisie der Jahrhundertwende. Bei Lezama spricht der Koch Juan Izquierdo nicht anders als Oppiano Licario – der auktoriale Erzähler treibt in seinem leidenschaftlichen Gestus seine Figuren bis ins Äußerste, bis sie alle nur Figurationen des Autors sind. Das hat zuweilen komische Wirkungen, die auch in der kubanischen Tradition des schwarzen Professors liegen, in einer Art linguistischem Karneval, wo der Sklave dem Herrn das angelesene Wissen nachäfft. Die komische Wirkung der Diskrepanz zieht sich bis in die erotischen Szenen, für die spanisch schreibende Welt eine Provokation, die erst in jüngster Zeit etwa von Julio Cortázar in seinem Roman Album für Manuel übertroffen wird. Vor dem Hintergrund jenes »Gringo-Bordells« der vierziger und fünfziger Jahre sind die erotischen Szenen bei Lezama von einer erstaunlichen Freiheit – als Gegenteil käuflicher Liebe. Illusion, Leidenschaft, die Verwandlung ins Bild eines adamitischen Urzustands, in welchem Liebe nicht Zeugung von Schuld war, dies sind die Leitgedanken der endlosen Diskussionen über die Homosexualität. Durch Evas Leichtsinn erfolgte die Vertreibung aus dem Paradies, und so sind es im Roman nur die Frauen, zu denen der Held keine sexuellen Beziehungen hat, wie seine Mutter und seine Großmutter, die durch die Sympathie des Autors den Männern nahekommen. Das Thema der Homosexualität im Gesamtplan des Romans zu deuten bleibt eine von der Kritik noch ungenügend gelöste Aufgabe. Ungeklärt auch die Frage, ob Lezama, indem er eine im Niedergang befindliche kleinbürgerliche Familie mit dem heroischen Pathos der Antike beschreibt, Ironie oder Verklärung im Sinne hatte. Ironie ja, aber ist er ein Gesellschaftskritiker im hergebrachten Sinn? Verklärung ja, aber ist es dann nicht eine rückwärtsgewandte Utopie? Das wiedergewonnene Paradies ist das Bild der Kindheit. Doch: Kann die Unschuld der Kindheit (im poetischen Sinn) nicht die Weisheit einer befreiten Menschheit sein? Erzähler wie Leser machen eine gemeinsame Erfahrung: Sie erleben den Tod der Figuren des Romans. Doch der einsame Tod des Obersts wie der Albertos entbehren, wie Jean Franco anmerkt, der tragischen Bedeutung. Im Tod finden beide keinen Einklang mit ihrem Leben, weder stirbt Alberto als Bohemien noch der Oberst als Soldat. Ihr Tod geht in kein Kollektivgedächtnis ein, das den Tod José Martís oder der Helden der Moncada bewahrt. Gerade für einen kubanischen Leser beginnen hier Korrespondenzen, die den Roman als Teil einer Gesamtgeschichte der Insel erscheinen lassen.
Lezama Lima als raunender Magier: Die Leser des spanischen Originals werden oft die eine oder andere dunkle Stelle mit jenem Unterbewußtsein aufnehmen, das man beim Lesen von Gedichten wie einen Tagtraum erlebt. Für die Übersetzer des Romans, Curt Meyer-Clason und Anneliese Botond, mußte jedes Wort auf die Feinwaage der Bedeutung gelegt werden. Ihre Arbeit im Bergwerk dieses Romans verdient eine besondere Würdigung.
Über Paradiso zu schreiben gleicht dem Abenteuer, in einen Malstrom hinabzusteigen. Nur eine wiederholte Lektüre des Romans kann neben dem Vergnügen am schon Vertrauten die Summe seiner Themen erkennen lassen. Es mag dem Leser dann so gehen wie José Cemí, der am Ende seiner Wanderungen durch die Stadt das Rätsel der eigenen Existenz zu lösen beginnt.
Bemerkungen anhand eines Fundes oder Das Mädchen aus der Flasche
Julio Cortázar und die schöne blasse Prosopopeya
Als der Chronist dieser Begebenheit neulich am Ufer der Seine spazierte und den Anglern zusah, stieß er in Höhe der Insel Saint-Louis mit dem Fuß an eine Flasche. Nun weiß jeder, daß Anglerglück in Paris heute vom großen Warenhaus zu beziehen ist und kaum aus den trüben Wassern der Seine. Auch sind die Angler nicht mehr die netten, beschaulichen Spaßvögel wie bei Maupassant, sondern in sich gekehrte Typen, die die Zeit ihrer Arbeitslosigkeit damit verbringen, ein Paar aufgeweichte Schuhe, manchmal eine ungeöffnete Konserve, Flaschen aus den Fluten zutage zu fördern und die Beute auf dem Flohmarkt zu verhökern. Sehr alte Stücke finden ihre Liebhaber in Antiquitätenläden. Als besagter Schreiber sie also auflesen wollte, aus Neugier, die aller Aufklärung Anfang ist, wurde ihm die Flasche aus der Hand gezogen – der Angler hatte sie noch nicht vom Haken gelöst. Man wurde sich handelseinig, und der Schreiber sah wieder einmal den Satz von Picasso bestätigt: »Ich suche nicht, ich finde.« Lag doch eingerollt in der grünen Flasche ein Papier, das kein Manuskript war, vielmehr etwas wie eine bedruckte Umhüllung, und aus dieser stieg nackten Fußes Prosopopeya, gewann rasch an Größe und Umfang und ward ein schönes, wenn auch blasses Mädchen. Wie es nicht ohne Groll verriet, war es von Julio Cortázar in diese Flasche gesperrt worden, indes der Meister Paris wieder einmal verlassen hatte und durch den blauen Äther hin zu einer Weltkonferenz flog, auf der er mit einer Rede die praktische Seite seiner poetischen Existenz unter Beweis stellen würde. Werde ich dir auch glauben können? fragte der also betroffene Schreiber die Schöne. Denn rührt dein Meister nicht immerzu an die Lüge, wenn er schreibend erzählt? Darf ich, sagte er, dich an einen Satz aus der Erzählung Teufelsspucke erinnern: »Michel hat sich der Literatur schuldig gemacht, unwahrer Verfertigungen.« Oder was geschieht in Liliana weint: Der Todkranke hilft sich mit Schreiben, und das heißt, er stilisiert sich sein Leben, er braucht die Lüge. Oder nimm Die Gesundheit der Kranken. Der Tod des Sohnes wird der Mutter verschwiegen, indem man ihr eine fiktive Geschichte erzählt, eine Paraphrase zu den wirklichen Geschehnissen. Und wird nicht die schriftstellerische Tätigkeit überhaupt in Frage gestellt, wenn wir in Schritte in der Spur erfahren müssen, der Verfasser der gefeierten Dichterbiographie hat schon in der Auswahl der Fakten, im Arrangieren des Materials einen Lügenschleier gewoben? Beschädigen die Lügen der Kunst am Ende nicht auch diejenigen, die von ihr leben? Nähren die Illusionen der Liebe wie in Beleuchtungswechsel?
Jetzt trägst du etwas zu dick auf, erwiderte Prosopopeya. Aber stellen diese Lügen nicht die Intelligenz des Lesers ständig auf die Probe?
Prosopopeya war noch blasser geworden, da man sie, indirekt, als Lügnerin bezeichnet hatte. Mag sein, sagte sie, es liegt am Gegenstand der Erzählungen, die wir besser cuentos nennen sollten – ein Sammelbegriff, der Novelle und Kurzgeschichte meint; ist doch beinahe jeder cuento Julios (und sie las die Titel vor, indem sie mit einiger Mühe ihren Kopf auf den Rücken drehte) eine Liebesgeschichte. Und Liebe, fügte Prosopopeya hinzu und sah dabei aus wie die Verkünderin der Freiheit auf einem Gemälde von Delacroix, die Liebe ist der feine Riß im abgenutzten Mantel der Alltäglichkeiten. Sie ist der Beginn einer Erschütterung, sie wird eine fantastische Dimension.
Julios cuentos halten den Bruch und den Übergang fest.
Durchaus bedenkenswert, was du sagst, gab der Schreiber zu. Als wäre das fantastische Element in vielen cuentos deines Meisters zugleich eine Erfahrung Verliebter. Liebe kann sich alles vorstellen, sie krempelt die empirische Welt um, sie produziert immerzu Hoffnung, also Zukunft, doch sobald sie aufhört, die Welt durchlässig zu finden, weil die Luft Stein wird, stellt sie, um überhaupt etwas zu retten, sich selber dar.
Der Autor, sagte Prosopopeya, überläßt es seinen Figuren, am Ausgang einer Erfahrung sich selber darzustellen. Die Literatur schenkt die Wiederholung, also die Chance, vom Apfel der Erkenntnis zu essen. Mehr als einmal fragt man sich, sagte der Schreiber, wer erzählt uns das? In welcher Ecke des Zimmers steht der Erzähler? Am Anfang vernimmt man ein paar Stimmen, die nach und nach ihren Raum finden. Diese Art zu erzählen hat viel Musikalität, ein Fragen und Antworten von Stimmen. In Fräulein Cora zum Beispiel hat jede Figur (als befänden wir uns in einem Hörspiel) Gelegenheit, sich darzustellen. In Zwei Seiten der Medaille wird gesagt, nur einer der beiden Liebenden schriebe das, aber es ist eine gescheiterte Liebe, und nur deshalb hat die Klage eine Stimme.
Nicht ganz, sagte Prosopopeya, und es klang wie ein Vorwurf: Sie weint, und er setzt sich hin und schreibt es sich von der Seele.
»Das Feuer aller Feuer …«, sagte der Schreiber und wußte nicht wie seine Frage formulieren. Ist die Liebe das alles verzehrende Feuer, heute wie vor zweitausend Jahren? Ein Feuer, das frißt, das in sich zusammensinkt und vergeht?
Prosopopeya lachte über diese – sagte sie Neurose des Lesers, ja alles genau auseinanderzunehmen, was der Autor aus einem ihm selbst oft fremd bleibenden Antrieb zusammengebaut hat. Sie verwies stolz auf Julios souveräne Art, Zeit und Raum zu überbrücken, und zwar nicht durch Darstellung von Ewigkeitswerten, sondern indem er den Riß aufzeigt, Liebe als eine Geschichte von Gewalttätigkeit. Und im übrigen, ohne einen unerklärbaren Rest wäre Kunst keine Kunst, sagte sie.
Aber du willst doch nicht behaupten, widersprach der Schreiber, ausgerechnet er, der ein so politisch bewußter Autor ist, sei ohne Botschaft an seine Leser?
Es kann nicht die Botschaft eines Leitartikels sein, betonte Prosopopeya. Die Liebe ist die Botschaft, sagte sie dunkel. Blüht sie nicht sogar aus dem Chaos auf der Südlichen Autobahn? Ist sie nicht wie der Beginn einer Bruderschaft? Als nach Sommer und Winter endlich der Stau behoben wird, hastet alles zurück in die Normalität des routinierten Lebens, und vergessen ist …
Eine überzeugende Kritik am Spätkapitalismus, sagte der Schreiber schnell, eine Kritik auch an den Hoffnungen eines Lieblingsautors von Julio, Jules Verne, die sich vervollkommnende Technik würde den Menschen zum Herrn der Schöpfung machen. Was tatsächlich entstanden ist, sind absurde Situationen der Entfremdung.
Ein Stichwort übrigens, ergänzte Prosopopeya, das Absurde, auf das wir noch zurückkommen. Aber sind diese cuentos nicht unentwegt Botschaften, rätselhaft zuweilen, aber dechiffrierbar? Manuskripte aus Flaschen oder Täschchen, auf den Finder kommt es an. Der junge Mann, der das Pariser Streckennetz der Metro auf und ab fährt, Mädchen beobachtet, vergleicht, sie anspricht, wegschickt …
… obschon sie weint, unterbrach der Schreiber, der sein Herz zeigen wollte.
Sie weint, wiederholte Prosopopeya ungerührt. Nun gut, aber war sie die Richtige? Ist die Großstadt nicht wie ein Meer, auf dem der Zufall regiert? Der junge Mann ist der Abenteurer unsrer Tage, sein Reisebericht unterscheidet sich nur in einem Punkt von den Berichten früherer Abenteurer: Er bringt uns nicht die unbekannte Ferne ins Haus, er verfremdet uns das Bekannte, damit wir es besser erkennen. Denn wir sind hier nicht, sagte die Schöne mit Entschiedenheit, bei E. T. A. Hoffmann, wo die Mädchen aus Flaschen vorgeführt werden, die Flöhe und die Katzen reden können. Das Fantastische im modernen cuento aus Lateinamerika hat nichts mit dem Märchen zu tun. Im Märchen ist das Märchenhafte nur eine Qualität, die zu der uns bekannten Welt hinzutritt. Die fantastischen Momente dagegen sind Alarmsignale aus der Welt des Lesers.
Gut, gut, sagte der Schreiber, der gern selber auf diese Unterschiede gekommen wäre. Bist du nicht, fragte er, am Ende jene Maga aus Julios bedeutendem Roman Rayuela – die Geliebte, die Horacio Oliveira eines Tages in Paris verliert und zu suchen beginnt? Und mit der Suche setzt der Roman ein. Mir scheint, in Manuskript aus dem Täschchen haben wir den Keim des großen Romans vor uns.
Bring das nicht durcheinander, protestierte Prosopopeya. Roman, Kurzgeschichte. Der Roman ist wie ein Film. Die Kurzgeschichte wie eine Fotografie.
Hat dein Meister während einer Rede in Kuba gesagt. Und in derselben Rede verteidigt er sich gegen stille Vorwürfe, sein Erzählen habe nichts zu sagen zu den revolutionären Umwälzungen in Lateinamerika. Es genüge nicht, unterstreicht Cortázar, wenn ein sympathischer Herr aufs Land führe, beispielsweise zu den Gauchos der argentinischen Pampa, und sich aufnotiere, worüber die am Lagerfeuer plaudern. Der cuento ist da am besten, wo er sich am weitesten vom Naturalismus entfernt, Träume und Ängste und Wünsche der Unterdrückten sagen mehr über den Charakter der Unterdrückung aus als deren direkte Denunzierung. In Das zweite Mal sind die kaffeetrinkenden Beamten (und sind nicht sie es, die zu erzählen anfangen?) in einer Kanzlei, die man sich in Santiago de Chile, in Brasilien, Argentinien und an anderen Orten vorstellen kann, die freundlichen Helfershelfer eines menschenvernichtenden Molochs. Und nun beachte man, wie sich in diesem cuento die Stimmen der Vorgeladenen zu einer moralischen Gegenkraft fügen, wie ihr Miteinander-Reden ein Gefühl von Hilfe erzeugt, von Solidarität. Der Leser wird in dieses Reden einbezogen, Lesen wird zum Mit-Reden.
Die Literatur kann mehr als ein Fernsehbild, als eine Nachricht, sagte Prosopopeya nicht ohne Stolz, und der Schreiber stimmte ihr zu.
Der cuento, sagte er, wie er seit den dreißiger Jahren zu einer auffälligen Gattung in Lateinamerika geworden ist, fixiert den Augenblick. Er stiftet nicht nur einem Land ohne ausgeprägte Vorgeschichte eigene Mythen, er ist zugleich literarisches Spiegelbild einer in Eruptionen verlaufenden Geschichte dieses Kontinents.
Eine überaus literarwissenschaftliche Kombination, sagte Prosopopeya zweifelnd. Nun gut, der cuento ist ein Labor des Erzählens. Aber urteilen wir doch ganz praktisch: Eine Begebenheit wird auf kaum zwanzig Seiten mitgeteilt, eine Zeitung druckt das in ihrer Wochenendbeilage ab, man kann es auf einmal lesen und weitergeben und zusehen, mit was für einem Ausdruck der Nachbar das liest. Über einen cuento kommt man schneller ins Gespräch als über einen Roman.
Eine Sammlung von cuentos, sagte der Schreiber, scheint mir ein Widerspruch zu sein.
Weil er nicht verhindern kann, daß seine cuentos in Sammlungen erscheinen, sagte die Schöne und achtete wohl nicht sehr auf ihre Worte, schreibt Julio Romane. Am Ende bleibt alles in der Familie, fügte sie hinzu und las, ins Mieder blickend, die Innenseiten der Blätter, die ihr als Gewand dienten. Das sind, erklärte sie und zog eines von ihnen ein wenig nach oben, wie eine Dame ihr spitzenbesetztes Unterkleid, Manuskriptblätter einer Übersetzung, die Julio von Edgar Allan Poes gesammelten Werken gemacht hat. Ich will nur einen Satz vorlesen aus einer Geschichte von Poe, deren Titel dir bekannt vorkommen muß, aus Manuskriptfund aus einer Flasche …
Ausgezeichnet, sagte der Schreiber, eine romantische Stilgesinnung als Tradition.
Unsinn, widersprach Prosopopeya. Du begreifst wirklich langsam. Julios Irrfahrten enden nicht im Malstrom unerforschter Geographie wie bei Poe. Seine Fahrten ereignen sich vor unsrer Tür, und er findet achtzig Welten an einem Tag. Also höre: »Eine Empfindung, für die ich keinen Namen weiß, hat von meiner Seele Besitz ergriffen – ein Gefühl, das keine Analyse zulassen will; für das die Erfahrungen vergangener Zeiten sich als unzureichend erweisen; und für das, wie ich fürchte, die Zukunft selbst mir keinen Schlüssel liefern wird. Für einen Geist, gefügt wie der meinige, ist diese letzte Erwägung ein Übel. Ich werde nie – ich weiß genau, ich werde niemals – befriedigt werden, hinsichtlich der Natur meiner Konzeptionen. Immerhin ist es nicht zum Verwundern, daß diese Konzeptionen so unbestimmt sind, da sie schließlich ihren Ursprung in so gänzlich neuartigen Quellen haben. Ein neuer Sinn – eine neue Entität wird soeben meiner Seele angegliedert.«
Die stupende Übersetzung stammt von Arno Schmidt, sagte der Schreiber.
Auf die Übersetzer seiner Werke hat Don Julio einen Rochus, sagte die Schöne.
Kann ich mir denken, sagte der Schreiber und verschwieg seinen Teil.
Es ist der selbstpersiflierende Tonfall des Spanischen, der nie gelingt, erläuterte Prosopopeya.
Ein weites Feld, entgegnete der Schreiber. Laß uns noch etwas zum Absurden sagen. Die für mich beste Erzählung Julios ist Anweisungen für John Howell. Der universale Charakter der cuentos deines Meisters erweist sich ja nicht durch ihre wechselnden Schauplätze, sondern durch die Beherrschung literarischer Milieus: In Schritte in der Spur die Anspielung auf Henry James, auch wenn mir das nicht so recht einleuchtet. Aber dieser cuento aus der Welt des Theaters ist Geist von Shakespeare und Marlowe, Howell ein Bruder Hamlets.
Es ist viel einfacher, sagte das blasse Mädchen. Julio ist ein Moralist bester Tradition. Kunst soll betroffen machen; Howell, der zufällige Zuschauer bei einer mäßigen Theateraufführung, findet, auf die Bühne geholt, nicht die Spielregeln der Kunst, sondern die des Lebens: Seine Entscheidung könnte einen Mord verhindern.
Die Kunst ist ja das Leben, sagte der Schreiber, der seine Zurechtweisung nicht verwunden hatte.
Der Leser als Zuschauer oder Mitspieler muß dennoch die Trennungslinie erkennen, die Bühne vom Parkett unterscheiden. Hier berühren sich die cuentos auch mit den Detektivgeschichten Poes. Gäbe es keine Grenzziehung zwischen Gut und Böse, wozu dann der detektivische Aufwand?
Aber man hat ja auch seinen Spaß am Entschlüsseln, sagte der Schreiber.
Der cuento, sagte die Schöne aus der Seine, ist wie die Kunst der Fotografie: Sieht man eine Weile aufs Bild, ist man selber drin und wandelt auf den Fluchtpunkt zu.
Wie in der Erzählung Teufelsspucke, nach der Antonioni seinen Film Blow Up gedreht hat – übrigens nicht eben zur Zufriedenheit der Freunde des Autors, die er in Solentiname besucht. Im Film enthüllt die Vergrößerung der Fotografien ein Verbrechen.
Die Geduld des Lesers …, sagte Prosopopeya, ohne den Satz zu beenden.
Solentiname, sagte der Schreiber, war ein Ort, den der Dichter Ernesto Cardenal gegründet hatte, eine pädagogische Provinz für die ärmsten Indios. Was Cortázar von dieser Reise nach Solentiname mitbringt, scheint zunächst nicht mehr zu sein als ein Reisebericht, die Freunde, die Landschaft, die schönen Kinderzeichnungen, Cardenals Urkommunismus, die Bibel, die für die Indios voller Gleichnisse aus ihrem Leben steckt, einem von Angst und Tod umgebenen Leben. Spätestens beim Fotografieren …
… und bei der Vorstellung, Napoleon zu Pferde könnte auf dem Polaroidfoto erscheinen, unterbrach Prosopopeya ungeduldig.
Spätestens da, fuhr der Schreiber fort, kommt ja eine historische Dimension ins Bild der gegenwärtigen Zustände. Die Pointe des cuento wird eine doppelte: Als der Reisende in Paris die Fotos betrachtet, kündigen sie an, was wenig später in Solentiname geschieht, die barbarische Verwüstung der Schule, die Kinder erschlagen, die Zeichnungen zerrissen. Soweit folgt der cuento den tatsächIichen Ereignissen. Am Schluß aber, als die Frau des Erzählers die Fotos betrachtet, sind die naive Schönheit, der pädagogische Ernst, die der Reisende gesehen hat, wiederhergestellt.
Auch das eine Vision, ergänzte Prosopopeya. Cardenal ist heute Kulturminister in Nicaragua. Solentiname kann der Name eines jeden Ortes sein, wo für die Zukunft gelernt und gemalt wird.
Was aber, fragte der Schreiber, sagst du mir zu dem cuento mit dem harmlosen Titel Sommer?
Ach, antwortete sie, das kommt jeden Tag und überall auf der Welt vor. Die Banalität der Wiederholung, ein Wochenendhaus, das Abendbrot, Beethoven als Nachtisch auf dem Plattenteller. Ohne das weiße Pferd an der Glastür, diesen Schatten in der Nacht, der etwas Unbegreifliches ankündigt, könnte das alles wie bisher weiterlaufen und sich weiter abnutzen.
Du vergißt das Kind, sagte der Schreiber. Das Kind hätte das Pferd ins Haus gelassen, es hätte keine Angst vor dem Unbekannten gehabt.
Das Absurde, sagte Prosopopeya, kann manchmal eine Chiffre sein für eine noch nicht beschreibbare Zukunft. Das Poetische an diesen cuentos, betonte die Schöne und sah auf die Schlepper, die in Richtung Pont des Arts zogen, ist, daß sie schwebende Zustände einfangen, ohne unsre Welt zu verlassen.
Nun sag uns noch, bat der Schreiber, wer dieser Julio Cortázar ist, und verzeih die Frage, die Welt ist groß, vor allem da, wo sie klein ist.
Er trägt einen Bart, sagte das Mädchen, und wäre manchmal, scheint mir, gern Jack London und an anderen Tagen Jules Verne. Was ihn am tiefsten im Leben getroffen hat, ist der Tod seines Freundes Che Guevara. Prosopopeya hob ein wenig den Saum ihres Gewandes, als fände sie dort die lexikalischen Daten, die sie nun vortrug: Er wurde 1914 in Brüssel als Sohn argentinischer Eltern geboren. Vierjährig kam er nach Buenos Aires, das war wie eine zweite Geburt. Er wurde Argentinier mit einer großen Sehnsucht nach Europa. Man spürt das oft in seinen Geschichten und Romanen.
Du meinst die Schauplätze? fragte der Schreiber naiv.
Prosopopeya achtete nicht darauf und fuhr also fort: Als junger Mann arbeitete er als Lehrer, studierte bis 1945, geriet wie so viele Studenten in Lateinamerika in Konflikt mit der herrschenden Klasse, rebellierte gegen die Vaterfigur des Diktators Perón und emigrierte 1951 nach Paris. Ein Exil, das fortwährt. Bei der UNESCO in Paris wurde er Übersetzer für die Konferenzsprachen Spanisch, Englisch, Französisch, machte bald besseren Gebrauch von seinen Kenntnissen und übertrug englische und amerikanische Autoren ins Spanische (vornehmlich beim Anhören von Jazzplatten).
Darf ich ein Zitat einfügen, bat der Schreiber. »Aus meinem Land ging ein Schriftsteller weg, der die Realität, ähnlich wie Mallarmé es sich vorstellte, in einem Buch gipfeln lassen wollte; in Paris wurde ein Mensch daraus, dessen Bücher in der Wirklichkeit gipfeln sollen.«
Ein sehr schönes Zitat, sagte Prosopopeya mit einem leichten Vorwurf in der Stimme, als sei es schon zu oft verwendet worden.
Der Schreiber schlug Prosopopeya ein nahes Café vor, ein Glas Wein … Aber sie war schon gegangen und hatte sich im Gehen ein paar überflüssiger Blätter entledigt, die der Schreiber sorgfältig auflas, paginierte und in seine Tasche steckte.
Ein Roman der Labyrinthe
Nachwort des Übersetzers zuJulio Cortázars Roman »Rayuela«
Als ich noch einmal den großen Raum durchquerte, sah ich auf einem Schreibtisch einen Karteikasten und öffnete ihn: alle Karteikarten waren unbeschrieben. Ich hatte einen blauen Filzstift, und bevor ich hinausging, zeichnete ich auf fünf oder sechs Karteikarten Labyrinthe und steckte sie zwischen die anderen Karteikarten …
Julio Cortázar, Nächte in den Ministerien Europas, aus: Reise um den Tag in achtzig Welten
Leser fragen einen Autor: Woran arbeiten Sie jetzt? Sie sollten sich besser nach der Vorgeschichte des fertigen Buches erkundigen. Womöglich ist sie unauffindbar. In den fünfziger Jahren lebte in Paris ein argentinischer Emigrant, ein Schriftsteller, den die europäische Kritik in die Nähe von E. T. A. Hoffmann rückte, in Verbindung mit Novalis und den französischen Surrealisten brachte – das Magisch-Realistische des späteren lateinamerikanischen Romans war noch unbekannt. Dieser Mann, Julio Cortázar, führte eine Doppelexistenz; tagsüber bei der UNESCO in Paris als Übersetzer beschäftigt, beschrieb er nachts seine Entdeckungen, diese Reisen um den Tag in achtzig Welten. Die Nächte von Paris waren auf der anderen Seite der Hemisphäre die Tage von Montevideo oder Buenos Aires. Cortázar, in beiden Welten zu Hause, hat sich vielleicht nie an die Gleichzeitigkeit von Ereignissen gewöhnen wollen, die für uns andere durch einen Ozean getrennt sind. Nehmen wir an, er lernt ein Mädchen aus Montevideo in Paris kennen, die Maga, die ein Kind hat und Lieder von Hugo Wolff singt. Die Maga kann mit der Wirklichkeit lügen, sie ist aber auch eine große Erfinderin von Geschichten, an denen die klugen Mitglieder des Schlangen-Clubs verzweifeln. Cortázar-Oliveira verliert sie und macht sich auf die Suche: Der Roman kann beginnen. Aber die Romane des 19. und 20. Jahrhunderts, vor allem die spanisch geschriebenen, sind voll solcher Geschichten. Was tun? Eine Gegenfigur wird gebraucht; ein älterer Schriftsteller verkörpert diese Rolle, Morelli, ein Alter ego Cortázars, wenn auch aus der Zukunft der späten Jahre herbeigeholt – der eindimensionale Roman für Leser-Weibchen wird durch ihn in Frage gestellt, zerstört umgesetzt. Der Leser wird zum Komplizen, er kann das Buch noch einmal komponieren, mittels einer Zahlentabelle, die ihm der Autor an die Hand gibt. Nach dem Verlust der Maga aber büßt der Roman seine Schönheit ein. Die Komik des fait divers, der Anzeigen und vermischten Nachrichten aus der Zeitung, setzt sich durch, in denen auch Morellis Traktate sich in ihrem ästhetischen Überzeugungsgestus nicht einmal sehr hervorheben. Paris Ende der fünfziger Jahre, das glich einem Debattierclub nach Art des Schlangen-Clubs. Hier könnte der Roman sich zurückziehen und neu entstehen, die Stadt ist eine Magierin an sich; auch wenn sich die Sterne in ihren Pfützen spiegeln, muß man sie entziffern. In Paris kann man sich nicht der Harmonie der geschlossenen Augen hingeben; die Mitglieder des Schlangen-Clubs analysieren, als hätten sie zuviel Sartre gelesen. Sie können sich nur mit Descartes entschuldigen, der gesagt hat, Gott allein sei schöpferisch, der Mensch denke nur, aber er vermag alles zu denken, was Gott geschaffen hat. Gut, daß es auch in der Pariser Nacht, die der amerikanische Tag ist, die Musik von Louis Armstrong, Charlie Parker, Clifford Brown gibt und der Jazz das wird, was er auch für uns sein kann, eine Aufhebung von Zwängen für die Dauer einer Improvisation.
Rayuela wurde 1963 in Buenos Aires veröffentlicht. Das Buch gilt als der Beginn der großen lateinamerikanischen Literatur, die sich bis in unsere Tage in immer neuen Verwandlungen offenbart. Mir scheint dennoch, Rayuela behaupte einen einsamen Platz. Der 1914 in Brüssel geborene, seit 1951 in Paris lebende argentinische Autor schreibt nicht aus der wunderträchtigen Mitte eines Ortes wie Macondo; jene prähistorischen Eier und Schmetterlinge, die bei García Márquez das Wunderbare und die Gleichzeitigkeit aller Erscheinungen darstellen, sind an den Ufern der Seine nicht zu finden. In seiner skeptischen Poetologie ist Cortázar vielleicht dem Kubaner José Lezama Lima verwandt. Cortázar war der erste, der einen Ariadnefaden durch das romanhafte Labyrinth Lezama Limas Paradiso legte, als das Buch 1966 das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Lezama Lima seinerseits nennt seine Arbeit über Rayuela – Julio Cortázar und der Beginn des anderen Romans. Der »andere Roman« bleibt nach Vollendung solcher Werke wie Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust, wie Ulysses von James Joyce ein Postulat, das in der Unwiederholbarkeit der Leistung eingefroren ist. Ähnliches ließe sich von Rayuela sagen, im Gesamtwerk des Autors eine einmalige Kombination von Sehnsucht, Komik und Aufarbeitung aller Philosophien, die den Menschen als Einzelwesen retten wollen.
Die Vorgeschichte eines Romans baut sich aus lauter Zufällen auf. Cortázar hat sich selber bezeichnet als einen, dessen Stigma das Suchen ist. Dennoch ist Rayuela die vermutlich beste topographische Beschreibung der Stadt Paris. Aus der Verzweigung der Großstadt, ihren Straßen und Metrolinien, ergibt sich das Grundmuster des Romans, das Labyrinth. In diesem mag Oliveira sich vorkommen wie der Minotaurus, der sein Opfer gehabt hat. Lezama Lima postuliert die Aufgabe des Romanciers, wenn er schreibt, man müsse ständig auswählen zwischen dem Tod, dem Zirkus und dem Irrenhaus. Nach dem Tod des Kindes, dem Verschwinden der Maga gerät die Episode mit den Clochards zur Zirkusnummer; die Rückkehr nach Argentinien, zu Traveler und Talita (es wäre eine Rückkehr in die Diktatur Peróns gewesen), kann nur in ein Leben im Irrenhaus einmünden. Dieser Absurdität vermag man einzig mit einem absurd geführten Leben zu begegnen, wie Cortázar einmal gesagt hat, um so möglicherweise die unendliche Absurdität zu durchbrechen. Oliveira erträgt das Absurde, aber Talita ist nicht die Maga, die Imitation ersetzt nicht die Liebe.
Das Labyrinth des Lebens, am Anfang war es eine simple Kreidezeichnung auf dem Straßenpflaster, ein Hüpfespiel. Spiele bewahren für Cortázar die Magie einer frühen, kindlichen Menschheit, die glaubte, mit wenigen Schritten in die Vergebung zu gelangen, in ein Mandala ewigen Lebens, in den anderen Himmel. Rayuela ist der Versuch des etwa fünfundvierzigjährigen Autors, die Welt, die er kannte, erfahren hatte, liebte, der Probe des kindlichen Himmel-und-Hölle-Spiels zu unterziehen. Was sich an quasi-philosophischen Äußerungen im Roman findet, würde Cortázar heute kaum wiederholen. Sein Erlebnis der lateinamerikanischen Revolution, seine Reisen nach Kuba, Nicaragua, zu den Bauern, Fischern und Kindern in Solentiname, haben die Sätze seiner späteren Erzählungen und Romane geprägt.
Die Kritiker werden immer neue Labyrinthe um dieses Buch legen. Der Leser wird dem Buch, das ihn herausfordern soll, lesend ein Kapitel hinzufügen, eine neue Zahl einbringen, die das Puzzlespiel bereichert. Die Labyrinthe des Autors können nur beim Lesen überwunden werden und uns ins Freie führen.
Durch einen Spiegel in einem dunklen Wort
Zur Werkausgabe von Jorge Luis Borges
Die Literatur ist unerschöpflich, aus dem hinreichenden Grund, daß jedes Buch unerschöpflich ist. Das Buch ist keine geschlossene Einheit: Es ist eine Beziehung, ein Zentrum unzählbarer Beziehungen.
Jorge Luis Borges
Wissen Sie, alles, was man über mich geschrieben hat, ist apokryph.
Jorge Luis Borges
Im Gehäuse seines unerschöpflichen Werkes ist der Dichter so alt wie die Welt; an Jahren ist Jorge Luis Borges so alt wie unser zwanzigsten Jahrhundert. Eine Frage, die dem blinden Seher aus Argentinien in jedem Gespräch gestellt wird, ist die nach seiner Identität. Wer sind Sie? Borges verweigert sich keiner Frage, seine Antworten aber enthalten oft ein gut Teil Spott über den Frager; die Komödie des bürgerlichen Literaturbetriebs wird von Borges durchschaut und zugleich ausgenutzt. Rezensionen zu nichtexistierenden Büchern gehören ebenso zu seinem Werk wie das falsche Zitieren aus überlieferten Quellen. Die Fantasie des Autors ist dabei nur die erweiterte Seite einer empirischen Realität.
Im Sommer 1984 war Borges Gast literarischer Kolloquien auf Kreta und in Sevilla. Auch hier konnte die Frage nach Herkunft und Selbstverständnis nicht ausbleiben. Borges resümierte: »Ich bin ein Konglomerat. Europäer von der Bildung her, Südamerikaner von der Familie her, aber meine Mutter war Engländerin. Spanisch- und englischsprachig aufgewachsen, aber seit dem ersten Europa-Aufenthalt 1914 in Genf auch französisch sprechend, gelegentlich schreibend. Meine geistigen Wurzeln reichen bis zum Buddhismus, zugleich gibt es starke Einflüsse des Judaismus wie des katholischen Christentums. Dazu kommt ein ›Übergepäck‹ an Literatur – Stevenson und Novalis, Jefferson und Spengler, Shaw und Victor Hugo, dessen Wort vom Albtraum als ›schwarzes Pferd der Nacht‹ mir unvergleichlich ist. Vielleicht bin ich ein mythengläubiger Rationalist? Ein von Schopenhauer genährter Skeptiker mit einer Privatmoral?«
1981 schrieb die rechtsgerichtete argentinische Zeitschrift Cabildo, Borges sei eine Erfindung dreier Autoren, eine Ausgeburt von Leopoldo Marechal, Adolfo Bioy Casares, Manuel Mújica Laínez. Seine Erscheinung, sein Erdendasein werde von dem italienischen Schmierenschauspieler Aquiles Scatamacchia »verkörpert« – eine Unterstellung, die Borges belustigt haben wird und die zugleich seinem Maskenbedürfnis entspricht, aber auch seiner Vorstellung, daß Literatur letzten Endes eine kollektive Angelegenheit sei. Im neunzehnten Jahrhundert hatte Arthur Rimbaud seine eigene Person mit dem bekannten Wort »Ich ist ein anderer« aufgehoben. Borges führt diese Linie fort, wenn er von sich sagt: »Ich weiß nicht einmal, wer von uns beiden diese Seite schreibt.«
Die Verdächtigung des argentinischen Revolverblattes war eine Erwiderung auf die Bemühungen Borges’, sich um den Verbleib jener vielen zu kümmern, die unter der Diktatur des Generals Videla in den siebziger Jahren in Argentinien verschwanden. »In meinem Land habe ich gegen den Terrorismus geschrieben …«, erklärte Borges einem der vielen Interviewer aus aller Welt. Seine politische Haltung bleibt dennoch suspekt. Die moralische Kraft lateinamerikanischer Literatur, jene Einheit von Autor und Werk, ist bei Borges vieldeutig, versteckt und diffizil. Der »andere« Borges, der Ehrendoktor vieler Universitäten, der Preisträger, der weltbekannte Autor überraschte seine Leser, als er 1976 aus der Hand des schlimmsten Diktators auf dem lateinamerikanischen Kontinent im Nachbarland Chile den Ehrendoktor und den Orden »Bernardo O’Higgins« annahm. Der »Rektor« der Universität von Santiago de Chile, ein General Toro, feierte Borges als einen Streiter gegen die Gewalt, gegen den schlechten Geschmack und den Egoismus in einer materialistischen Welt, und er lobte den Dichter als einen Kämpfer für die menschlichen Werte abendländischer Zivilisation. Borges bedankte sich mit einer Rede über den argentinischen Schriftsteller und die Tradition. Unsere Tradition, so erklärte er und meinte die lateinamerikanische Literatur im ganzen, verdanke sich der abendländischen Erbschaft. Freilich verwendeten die Argentinier alle europäischen Themen ohne jede Ehrfurcht, was »glückliche Konsequenzen« zeitigen könne. – Eine absurde Komödie jenseits der politischen Realität? Oder die List des Autors, eine Weltöffentlichkeit, die sich mit den Zuständen in Chile weitgehend abgefunden zu haben scheint, durch einen Skandal aufzurütteln? Borges als Hamlet in einem aktualisierten Drama seines verehrten Shakespeare? Oder doch nur der Kniefall des blinden Dichters vor der Macht der Schwerter und Symbole? Womöglich sind es Eskapaden dieser Art, mit denen sich der greise Borges von Jahr zu Jahr die Gunst der Nobelpreis-Richter verscherzt. Borges, das »geistesgeschichtliche Konglomerat«, ist dennoch kaum weniger ein Autor des lateinamerikanischen Kontinents wie Cortázar, Carpentier oder Vargas Llosa. Die jeweils extrem unterschiedlichen Entwicklungen der lateinamerikanischen Länder und der in ihnen aufgehobenen Kulturen führen bei den genannten Autoren zu verschiedenen Ausdrucksformen. Gemeinsam aber ist ihnen die Abwehrhaltung zum Über-Ich der europäischen Vergangenheit. Für Autoren der jüngeren Generation ist es leichter, sich von den politischen Fehlern des argentinischen Meisters zu distanzieren. Die Generation nach Borges, die die lateinamerikanische Literatur in der Welt vertritt, steht zu Borges in einem Schüler-Meister-Verhältnis. So schreibt Vargas Llosa über seine ersten literarischen Versuche: »Ich wollte meine Erzählung Der qualitative Sprung nennen, und mein Ziel war es, kalt, intellektuell, konzentriert und ironisch zu schreiben, gleich einer Erzählung von Borges, den ich in diesen Tagen gerade entdeckt hatte.«
Die lateinamerikanische Revolution beginnt nicht erst mit den Proklamationen und Kriegen Bolívars, Sarmientos oder José Martís gegen die Spanier. Mit den ersten Niederlassungen des Kolumbus in der Neuen Welt. Aus dieser Dialektik entstehen die Romane von Asturias oder Carpentier, die wiederum eine neue Tradition einleiten, wie Carlos Rincón untersucht hat, als er 1975 über Erzählungen von Borges schrieb: »Die Geschichte Argentiniens, das Bild Lateinamerikas und das Schicksal des Lateinamerikaners kondensiert Borges in einem archetypischen Symbol: dem Duell. Das Messer ist das blinde Gesetz, das das Leben des Gaucho beherrschte … Die Art und Weise, wie Borges lateinamerikanische Grundsituationen, die bei ihm zu Grenzsituationen mit archetypischem oder modellhaftem und enthistorisierendem Charakter werden, einfängt, gibt uns einen Einblick in eine Welt der Gewalt, deren Protagonisten dazu verurteilt sind, zu töten oder getötet zu werden. Das ironische Spiel mit Denkmodellen und Vorstellungen aus der Geschichte von Philosophie, Religion oder Literatur zum anderen, die, auf ein Paradox gebracht, auf ihren Gehalt und ihre Gültigkeit nach allen Seiten hin überprüft und in ihren Variationsmöglichkeiten durchgespielt werden – Vorstellungen vom Unendlichen,