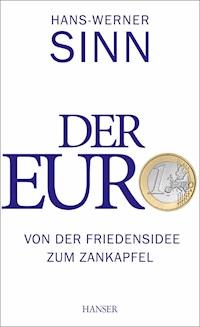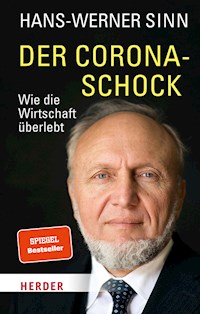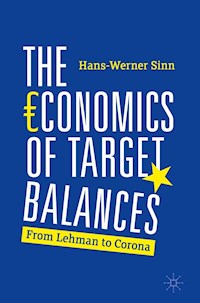Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Hans-Werner Sinn hat wie kein anderer in den letzten Jahrzehnten die wirtschafts- und sozialpolitischen Debatten in Deutschland und Europa geprägt. Er gilt als einer der wichtigsten Köpfe der Bundesrepublik und als einflussreichster Ökonom im deutschsprachigen Raum, seine Leistungen auf der wissenschaftlichen Weltbühne sind unbestritten. In seiner Autobiografie, die anlässlich seines 70. Geburtstags erscheint, zieht er die Bilanz eines außergewöhnlichen Lebens - von seinem Weg aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, in denen er auch mit dem Schicksal von Flucht und Vertreibung konfrontiert war, an die Spitze der Forschung. Zu seinem Weg gehört die Mitgliedschaft zur Jugendorganisation der SPD, den Falken, ebenso wie der Einfluss durch die 68er oder die Bewunderung für Willy Brandt. Das Studium der Volkswirtschaft in Münster, Mannheim und später in Kanada veränderte seine geistigen Prägungen einschneidend und für immer. Sinn nahm Abschied von allem Ideologischen, das ihm bis heute ein Gräuel ist. Stattdessen folgt er den Regeln der Wissenschaft, bei denen es ihm vor allem auf die fortwährende Suche nach der Wahrheit ankommt – das Credo seines Lebens. Hans-Werner Sinns Stimme hat in den wirtschafts- und sozialpolitischen Debatten des letzten Vierteljahrhunderts großes Gewicht: Als Professor für Volkwirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und als Präsident des renommierten ifo Instituts, das er in der Krise übernahm und zu einem weltbekannten Forschungszentrum machte. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, Ehrendoktorwürden und Preise aus dem In- und Ausland. Seine Leistungen auf der wissenschaftlichen Weltbühne sind herausragend, doch Sinn blieb nicht im Elfenbeinturm der Wissenschaft. Er hat mit seinen wirtschaftspolitischen Überlegungen die Republik verändert. Ob Kritik an den ökonomischen Regeln der Wiedervereinigung, ob Standortdebatte, Reform des Sozialstaates, Bewältigung der Eurokrise, Migration oder Brexit ... Hans-Werner Sinn mischt sich ein, durchaus kontrovers. Auch nach seiner Emeritierung gilt er als einer der einflussreichsten Ökonomen und Intellektuellen hierzulande, arbeitet wissenschaftlich, hält Vorträge und ist Gesprächspartner für Politik und Medien. Sinns Biografie spiegelt 30 Jahre deutscher und europäischer Wirtschaftspolitik und ist ein Stück Zeitgeschichte. "Meine geistige Prägung ist die Wissenschaft, der mit ihr verbundenen Suche nach der Wahrheit habe ich mein Leben gewidmet. Andererseits will ich die dabei gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um die Ökonomie und die Gesellschaft besser zu machen. Das ist meine Aufgabe als verantwortungsethischer Volkswirt. Deshalb beteilige ich mich seit langem an den wichtigen Debatten. Deshalb habe ich mich für viele Verbesserungen in der Ökonomie eingesetzt. Dass ich dabei anecke, ist unvermeidlich. Wer die Wahrheit sagt, hat nicht nur Freunde." (Hans-Werner Sinn)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1048
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Werner Sinn
Auf der Suche nach der Wahrheit
Autobiografie
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2018
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Die verwendeten Fotos stammen, sofern nicht anders gekennzeichnet, aus dem Privatarchiv des Autors. Die Rechte liegen in diesen Fällen bei ihm. Die weiteren Rechte: S. 657 Mitte links: Herr Kossiek, Brake; S. 660 oben: Karl Otto, Bielefeld; S. 668 unten: Eleana Hegerich, München; S. 670 oben: Bayerische Staatskanzlei / Rolf Poss; S. 670 Mitte: Bayerische Akademie der Wissenschaften / F. Schmidt; S. 672 oben: Deutscher Hochschulverband, Kornelia Danetzki; S. 672 mitte: CESifo. Bei der Suche nach sonstigen Rechteinhabern sind wir sorgfältig vorgegangen, dennoch ließen sich nicht alle Rechte abschließend klären. Falls Sie Ihre Rechte berührt sehen, setzen Sie sich bitte mit dem Verlag Herder in Verbindung.
Abdruck des Tagesspiegel-Interviews vom 27. Oktober 2008 auf S. 206–208 mit freundlicher Genehmigung Verlag Der Tagesspiegel GmbH/Carsten Brönstrup, Stefan Kaiser
Umschlaggestaltung: Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © Dominik Butzmann/laif
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster, Belgern
ISBN (E-Book) 978-3-451-80777-0
ISBN (Buch) 978-3-451-34783-2
Für Gerlinde,
für unsere Kinder und Schwiegerkinder
sowie unsere Enkel
Inhalt
Anstatt eines Vorworts – Auf der Suche nach der Wahrheit
Was mich antreibt
Den eigenen Weg gehen
Vom Kampf gegen die Alternativlosigkeit, meinen Wurzeln und dem Wert eines guten Biers
Reisen des Lebens: Aufstieg, Ökonomenwelten, große Liebe
1 Der Abstieg vom Elfenbeinturm
Glasperlenspiele
Mein Schlüsselerlebnis: Die deutsche Wiedervereinigung
Eine Frage des Geldes: Währungsumstellung und Kaltstart
Persönlich betroffen und Zeuge des Mauerbaus
Perspektivenwechsel: Los Altos Hills und Palo Alto
»Für Krieg, Revolution und Frieden«: Die Hoover-Enttäuschung
Paul Samuelson und wie die westdeutschen Arbeitgeber und Gewerkschaften den Menschen in den neuen Ländern ihre Chancen nahmen
Ein Meer von Deutschlandfahnen
Beim IWF: Politische Spiele
Drohungen muss man trotzen
Albert O. Hirschman und die Junker
Operettenstoff aus Bolivien: Gonzalo Sánchez de Lozada
Wieder ein Fehler: Wohnen im Osten
2 Wie ich zum Volkswirt wurde
Am liebsten Biologie. Ökonomie als zweite Wahl
Reise in eine unbekannte, freie, offene Welt
Liebe meines Lebens
Der Zauber ägyptischer Musik, Mohammed und die Versteckaktion
Meine ersten Lehrmeister: Herbert Timm und John Maynard Keynes
Keynesianismus, Neoklassik und die Schizophrenie der Volkswirtschaftslehre
Die Musgrave-Schule
Sinn, der Marxist?
Ein Gläschen Piccolo
Inspiration ohne Ende: Nach Mannheim in den Ökonomen-Olymp
Forscher-Take-off: Erste Erfolge
Mehr als er hat, kann man ihm nicht nehmen: Warum die Banken Glücksspiele spielen
Sturm und Drang: Die Habilitation
Buffalo, Gießen oder München? Es hätte auch anders ausgehen können
3 Frühe Prägungen: Kleine Verhältnisse und darüber hinaus
Ein armer Junge mit Wurzeln im Westen und in Pommern
Heimat, Brake, westfälisches Land
Von der Dorfschulklasse als Einziger aufs Gymnasium in der Stadt
Neue Horizonte: Lehrmeister und Lernlust
Vatererbe: Arbeit, Unternehmerfleiß, Durchsetzungskraft
Starke Autos, echte Freundschaften: England und Frankreich
Spachteln für das Nordkap. Und das Ende meiner Jugend
4 Missionar oder Revolutionär?
Die Schule des Mittelstreckenlaufs, Albert Schweitzer und die Löwen
Bei den Falken: Freie Gedanken und Willy Brandt
Atemlos in der Mitte des Sees und auf dem Gipfel: Lektionen im Zeltlager
Ein Bewusstsein für historische Schuld: Oradour-sur-Glane und Lidice
In Israel: Kibbuzerfahrung und ein denkwürdiger Auftritt
»Mit jedem Schritt, mit jedem Tritt«: Gegen Nazis, Wiederbewaffnung, Atomkraft und Kommunisten
Polarisierende Zeiten: Sozialdemokratischer Hochschulbund, Studentenbewegung und linkes Leben
Prager Frühling als Lokaltermin
Ausflug nach Sarajevo
Die Prüderie der Achtundsechziger
Rechte Gefahr: In den Fängen von Thaddens
5 Die Schatten der Vergangenheit
Mein Albtraum
September 11
Vertreibung, Aussöhnung mit Tschechien und imposante Politiker
Der Großvater in Kolberg: Sozialdemokrat, Nazi-Gegner, KZ-Häftling
»Sin«: Was für ein passender Name für einen Deutschen
Ein Bild von Deutschland. Und ein Brief an Helmut Kohl
Komplexe Schuld-Verhältnisse: Heinrich von Stackelberg und seine Schule
Weltfinanzkrise, die »Neunmalklugen« und ein Besuch bei Charlotte Knobloch
Juden und Manager: Sturm der Entrüstung über einen missglückten Vergleich
6 Die Grenze zwischen Markt und Plan
Von links zur Erkenntnis: Der Sieg der »unsichtbaren Hand«
Effiziente Märkte, Kochtöpfe und warum Hayek recht hat
Idealbild Markt und der Volkswirt als Arzt: Beispiel Umwelt und warum es keinen Gegensatz von Ökonomie und Ökologie gibt
Der Homo Oeconomicus
Der methodologische Individualismus und die Nöte eines deutschen Wissenschaftlers
Anarchie, Ordoliberalismus und Neoliberalismus
Von Ronald Coase bis Max Weber: Wilder Westen, Migration und Eigentumsrechte
Öffentliche Güter, Steuern und Staatsschulden: Die Finanzwissenschaft und ihr großartiger Vater
Warum Politiker ihre eigene Agenda verfolgen und warum der Volkswirt das Volk beraten sollte
»Zwei gegensätzliche Visionen des Staates«: Die Buchanan-Musgrave-Debatte
7 Die wichtigste Frage: Wie wird der Wohlstand verteilt, und wie sollte er verteilt werden?
Neymar, Topmanager & Co: Wer was bekommt und was das mit Migration und Gerechtigkeit zu tun hat
Von reich zu arm: Der Schleier des Unwissens und warum die staatliche Umverteilungspolitik grundsätzlich nützlich ist
Die EU, die Sozialmigration und das Wohlfahrts-Trilemma
Gut gemeint, aber nicht gut getan: Der falsch konstruierte Sozialstaat ...
... und warum die Agenda 2010 und der aktivierende Sozialstaat der Ausweg gewesen sind
Wolfgang Wiegards Dienst, Gerhard Schröders Preis und ein Theaterstück
Große Enttäuschung Angela Merkel: Das Leipziger CDU-Programm und seither sehr viele Schritte zurück
8 Eine Frage der Verantwortung: Klima, Umwelt und Energie
Weckruf des Club of Rome
Früh dabei: Das deutsche Zentrum der Umweltforschung
Größte Herausforderungen: Treibhauseffekt und Klimawandel
Falsche Politik: Der Emissionshandel und das Erneuerbare-Energien-Gesetz beißen sich
Das Grüne Paradoxon
Warum man kein Kohlenstoffbudget braucht, wohl aber die Extraktion verlangsamen sollte
Es geht nur global
Der grüne Flatterstrom und warum wir die Wende der Wende brauchen
9 Die Entdeckung der Welt
Unterwegs sein
Verspätete Hochzeitsreise: Aufbruch ins Franco-Spanien ...
... und tief versunken im Maghreb
Japanischer Zauber und drei Affen: »Sage nicht kekko, bevor du Nikko gesehen hast«
Mongolische Wunder: Schlechte Deals und weise Kamele
Englische Lektionen: Die Höhen der London School of Economics und die Kehrseite von Maggie Thatcher
Western Ontario: Das wichtigste Jahr meiner akademischen Laufbahn
Wir Kanadier
Auf hoher See nach Hause: Wehmut, Luxus und die Entdeckung der Langsamkeit
10 Frischluft dringend benötigt: Eine bessere Ökonomie für eine bessere Gesellschaft
Der Knoten platzt: Höchste Zeit für Veränderung
Die Vereinigung der Europäischen Ökonomen
In München: Als »Küken« gestartet und dann schnell die Fenster auf
Bewertete Professoren, »Ehemalige« und Medaillen
Eine neue Zeitschrift für die Wirtschaftspolitik
Der Verein für Socialpolitik, die Kathedersozialisten und was heutige Ökonomen von ihnen lernen können
Schon früher: Zarte Versuche der Öffnung
Mehr Jugend und Internationalisierung
Schwärmt aus!
Auf zum Tanz: Im Weltverband der Finanzwissenschaftler
11 Auch in München: Modernisierung durch Internationalisierung
Herr Zimmermann und die Schweiz. Die Geburt des Center for Economic Studies (CES)
Vollkontakt für junge Wissenschaftler: Direkt an der Forschungsfront
Auf nach Amerika!
Das CES bei der Arbeit: Im Hintergrund und an der Spitze
Ein Leuchtturm: Die Munich Lectures in Economics
Viele Versuchungen und ein Schubladenplan: Die Gründung des CESifo-Forschernetzwerks
Dynamische Entwicklung: CESifo hebt ab und wirkt in die Welt
Viele Begegnungsräume: Fachtagungen und ein Irrenhaus in der Nähe von Venedig
Kein Zuckerschlecken: Heftiger Widerstand aus London
Näher ran an die Politik: Eine Top-Konferenz in München und endlich ein »Europäischer Wirtschaftsbericht«
12 Das ifo Institut: Vom Sanierungsfall zum Champion
Das Institut am Boden: Finanzprobleme, Teilabwicklung und ermüdende Verhandlungen
Ein Ruck in der Belegschaft und große Baumaßnahmen
Mehr Wirkung durch eine Medienoffensive: Zeitschriften, Buchreihen, Internet
DICE: Eine neue Datenbank für Europa als zweites Standbein
Eine neue Philosophie für bessere Forschung: »Ordentliche Professoren« müssen her
Ehre, Öre und die wissenschaftliche Freiheit an den Instituten
Ein Auftrag für mehr Qualität: Lunchtime und Arbeit in den Ferien
Konferenzen und Veröffentlichungen: Durchbruch an die Spitze auf breiter Front
Evaluierungen ohne Ende: Das große Zittern und Erleichterung
Präsidiales Multitasking: Institutsleitung, Forschung und öffentlicher Diskurs
Der Erfolg hat viele Väter
»Beim Barte des Propheten«
13 Wo bleibt mein Europa?
Währung, Brexit, Flüchtlinge, Ukraine: Aus der Traum?
Hauptproblem Euro: Wie er die Schuldenlawine in Gang setzte, Industrien zerstörte und die Parteienlandschaft umpflügte
Das Eurosystem als WG-Kasse: Teure Krisen-Scheinlösung mit der Druckerpresse und wie es besser gegangen wäre
Die Target-Salden (1): Detektivische Entdeckung, große Aufregung und Kampf um die Deutungshoheit
Die Target-Salden (2): Wertlose Forderungen statt wachsender Goldschatz, der Flügelschlag des Schmetterlings und Mario Draghi beim Papst
Der OMT-Beschluss der EZB: Wie Kanzlerin und Gerichte es zuließen, dass die Staatspapiere Südeuropas am Bundestag vorbei in Eurobonds verwandelt wurden
Eine Diskreditierung und ein Husarenstück namens QE zulasten Deutschlands
Die große Entwertung: Wehe, wenn die Baby-Boomer ihr Geld zurückhaben wollen
Unser Euro? Mein Europa!
Epilog – Die Rolle des Ökonomen in einer mündigen Gesellschaft
Schemen im Nebel
Von der Beratungsresistenz der Politik
Wider Ideologie und Denkverbot
Auf der Suche bleiben
Danksagung
Werkverzeichnis (Auswahl)
Personenverzeichnis
Stimmen zum Autor
Über den Autor
Eine Chronologie – auch in Bildern
Anstatt eines Vorworts – Auf der Suche nach der Wahrheit
Was treibt mich an, wohin führt mein Weg? Welchen Beitrag leiste ich für die Gesellschaft – welchen für Familie, Freunde, mir anvertraute Menschen, Kollegen? Halte ich mich an die Prinzipien und Gebote, die mir Eltern, Großeltern und andere Lehrmeister mitgaben? Wer und was ist mir wirklich wichtig, für wen und für welche Ideale lohnt es sich zu kämpfen?
Für jeden bewusst, vernünftig und verantwortungsvoll agierenden Menschen ist es unverzichtbar, sich diese vielleicht philosophisch anmutenden Fragen immer wieder zu stellen, um so sein Leben auf Kurs zu halten.
Aber keine Sorge: Ich bin Volkswirt und damit Sozialwissenschaftler, und kein Philosoph. Ich frage, denke und schreibe anders. Und doch habe ich in jenen rund sieben Jahrzehnten, die mein Leben nun umfasst, diese Fragen mit mir geführt. Ich stellte sie mir schon früh und immer wieder, und ich versuchte, sie auch dann im Auge zu behalten, als mich die ungeheure Dynamik meiner beruflichen Verpflichtungen, insbesondere das Amt als Präsident des ifo Instituts, bis an die Grenzen meiner Kräfte forderte. Im Rückblick will es mir manchmal sogar scheinen, dass sie mich geleitet haben. Aber weiß ich das? Ich will da nichts hineinkonstruieren.
Was mich antreibt
Was ich aber weiß, ist, dass ich mit diesem Buch, meiner Autobiografie, auch diese Fragen zu beantworten versuche.
Seit meiner Jugend treibt mich die Neugier, und deshalb stand für mich fest, dass ich Wissenschaftler werden wollte. Rerum cognoscere causas – »Den Grund der Dinge erkennen« – ist ein auf den römischen Dichter Vergil zurückgehender Leitspruch der Wissenschaften, den ich schon früh verinnerlicht habe, lange bevor ich im Lateinunterricht davon erfuhr.
Er leitet mich bis heute. Und bis heute interessiert mich stets das Neue, das mir Unbekannte. Ich will wissen, wie die Dinge zusammenhängen, ich will verstehen. Und wenn ich verstanden habe, mache ich mich alsbald auf zu einer neuen Suche nach dem Neuen, um auch das zu verstehen.
Als ich das Gymnasium in Bielefeld verließ, hätte ich am liebsten gleich mehrere Fächer parallel studiert, so hatte mich der Schulunterricht fasziniert und motiviert. Und als ich mich dann schließlich für die Volkswirtschaftslehre entschieden hatte, wollte ich am liebsten in allen wichtigen Teilgebieten des Faches tätig werden. Nichts beschreibt vielleicht besser, wie sehr mich die »Suche nach der Wahrheit« schon immer beseelte. Nicht von ungefähr also ist dies nun auch der Titel dieser Autobiografie.
Ich gebe zu: Bis zum Schreiben der vielen Seiten, die sie nun umfasst, war mir dieses Leitmotiv meines Lebens nicht voll und ganz bewusst. Aber, wie ich im Epilog am Ende dieses Buches noch ausführen werde, bin ich ein Mensch, der beim Schreiben lernt. Vor allem beim Schreiben eines Buches – auch dieses Buches, das so ganz anders ist als alles, was ich bislang geschrieben habe.
Die Vergangenheit ist nie abgeschlossen. Auch die eigene nicht. Das gilt für jeden – auch für mich. Die Sicht auf sie – und die Geschichte, die wir über sie erzählen – wird bestimmt durch das Hier und Jetzt. Und so wandeln sich mit dem Fluss der Ereignisse auch die Antworten auf die Lebensfragen.
Allerdings wandeln sie sich wohl immer weniger, je älter man wird und je bewusster man lebt. Ich bin nun, mehr als fünfzig Jahre seit dem Beginn meines Studiums der Volkswirtschaftslehre – das war im Herbst des Jahres 1967 –, um einige Erkenntnisse reicher, die aus vielen beruflichen und persönlichen Erfahrungen und dem Nachdenken darüber resultieren. Ich betrachte sie als Geschenk des Älterwerdens. Zugleich hat mein langes Wirken als Forscher und Hochschullehrer im In- und Ausland, als Buchautor, Vortragsredner, Präsident nationaler oder internationaler Fachverbände und öffentlicher Streiter für ökonomische Vernunft mein Bewusstsein auch tief und nachhaltig geprägt und geschärft. Ich glaube daher sagen zu können: »Auf der Suche nach der Wahrheit« wird mir wohl auch in zehn Jahren oder später als Leitmotiv meines Lebens gelten können, wenn es mich dann noch gibt.
Den eigenen Weg gehen
Die Neugier und die kompromisslose Suche nach der Wahrheit hat meine Karriere als Hochschullehrer, als Wissenschaftler und als Anwalt für eine bessere Wirtschaftspolitik geprägt, der – ich gebe es zu – keiner Kontroverse aus dem Weg ging. Nachdem ich zunächst an den Universitäten Münster und Mannheim sowie in Kanada studiert, geforscht und unterrichtet hatte, schlossen sich über dreißig Jahre als aktiver Hochschullehrer an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) an. Insgesamt komme ich so über mein gesamtes Leben hinweg gerechnet auf 82 Semester universitärer Lehre – wobei die vielen Wochenenden, die ich für Verwaltungsakademien tätig war, eigentlich noch hinzuzuzählen wären. Ich kann es selbst kaum glauben. Viele Generationen von Studenten besuchten meine Vorlesungen, viele Doktoranden promovierten bei mir, weitere Forscher habe ich auf die eine oder andere Art und Weise unterstützen können, indem ich ihre Habilitationen begleitete, also jene wissenschaftlichen Arbeiten, die die Voraussetzung dafür sind, dass man ein ordentlicher Professor an einer Universität werden kann.
Meine Studenten, Doktoranden und Habilitanden bekleiden nun wichtige Posten in dieser Gesellschaft, und einige meiner akademischen Schüler lehren heute an angesehenen Universitäten. Ich verhehle nicht, dass mich das ein wenig mit Stolz erfüllt, einem Stolz, den man mir verzeihen möge. Eine »Sinn-Schule« der Ökonomie, vor der sich manche »Sinn-Opponenten« in Politik und einigen Medien nun womöglich fürchten mögen, gibt es aber nicht. Jeder Student, jeder akademische Schüler, ob jünger oder älter, hat seinen eigenen, von ihm selbst gewählten Weg der Erkenntnis und der Einflussnahme auf die Wissenschaft und die reale Welt der Wirtschaft zu gehen. So wie ich ihn auch selbst suchte und fand. Wenn ich aber »meinen« Schülern – neben der sauberen Anwendung der ökonomischen Methode als Wissenschaft auf welchen Forschungszweig und auf welche Forschungsfrage auch immer – eines zu vermitteln trachtete, dann war es dieses: Die Suche nach der Wahrheit, die das Ziel der volkswirtschaftlichen Forschung ist, mag zwar nicht selten mühsam sein und nur in kleinen Schritten vorangehen. Aber sie darf innere und äußere Widerstände nicht scheuen und muss mutig sein. Anders ist jene Wahrheit, der sich – wie ich denke – ökonomische Forscher verpflichtet fühlen sollten, nicht zu haben.
Für manchen mag das lebensfern klingen. Kann sein. Natürlich weiß ich, dass ein jeder im Leben Kompromisse machen muss, in der Politik, als Mitarbeiter im Unternehmen, im Sportklub, in der Familie. Doch unberührt davon bin ich entschieden der Ansicht: Die Wahrheit bleibt doch die Wahrheit und sie muss ausgesprochen werden, damit die Dinge sich zum Besseren ändern können.
Allerdings sollte ein Leben, das der Suche nach ihr gewidmet ist, auch Spaß machen. Was wäre das sonst auch für ein Leben? Nur Kopfarbeit allein macht nicht glücklich. Um den Kopf freizubekommen, muss man nicht nur Texte oder Bücher schreiben und denken, sondern auch einmal – zum Beispiel – Tore köpfen. Das zumindest habe ich, solange meine Gelenke und Sehnen es zuließen, mit Begeisterung getan. Mit meinen wissenschaftlichen Assistenten, mit Gastforschern oder anderen Kollegen haben wir über viele Jahre hinweg regelmäßig im Münchner Englischen Garten gekickt. Wir hätten eigentlich einmal untersuchen sollen, wie das die Qualität unserer Arbeit beeinflusst hat. Besser gefühlt haben wir uns auf jeden Fall. War ich ein Leistungsträger beim Fußball? Nun ja ... Wie viel Tore ich geschossen habe? Nun ja ... Man verlange nicht zu viel von einem Verteidiger. Letztlich war ich wohl doch besser am Schreibtisch aufgehoben. Aber trotzdem ...
Vom Kampf gegen die Alternativlosigkeit, meinen Wurzeln und dem Wert eines guten Biers
Ich komme aus den einfachen dörflichen Verhältnissen einer jungen Familie in Westfalen mit mütterlichen Wurzeln im Osten. Ich weiß, was es heißt, arm zu sein, und ich kenne die Nöte des Alltags, ja die Armut. Ich bin auch deswegen Ökonom geworden, weil ich die Gesellschaft besser machen wollte – zugunsten gerade der einfachen Menschen, auch jener, die weniger gute Start- und Entwicklungschancen haben als andere. Für manche mag das romantisch klingen, für manche idealistisch, für manche gar gefährlich utopisch. Das ficht mich nicht an. Genauso wenig wie es mich anficht, wenn man mich – der ich in wirtschafts- und sozialpolitischen Debatten immer wieder eindringlich Stellung bezogen habe – hin und wieder als »Marktradikalen« oder »Neoliberalen« zu verunglimpfen sucht. Beides ist grober Unfug, jedenfalls so, wie es gemeint ist.
Hat es mich trotzdem genervt? Manchmal schon. Auf jeden Fall hat es mich angespornt. Und mit meinem idealistischen Antrieb habe ich selbst ja auch andere genervt. Hin und wieder sogar mich selbst ... Ein gutes Bier und eine deftige Brotzeit, die ich als Neu-Bayer schätze, haben dann bisweilen geholfen. Wirklich!
In diesem Zusammenhang frage ich mich im Übrigen nicht selten: Bin ich mittlerweile eigentlich fast schon »richtiger« Bayer oder bin ich noch »echter« Westfale? Das weiß ich oft selbst nicht. Als ich in diesem Buch über meine westfälische Heimat schrieb, war ich ganz und gar eingetaucht in die damalige Zeit auf dem Lande, zwischen den Fachwerkbauten und den schweren Ackergäulen, während die immerwährende warme Brise, die vom weiten Meer kam, mein Gesicht umwehte. So jedenfalls erinnere ich mich auch an meine Wurzeln in meinen Kinder- und Jugendtagen.
Doch wenn ich mich heute umschaue, dann bin ich eben im Freistaat – und das ja sehr gerne und bereits seit mehreren Jahrzehnten. Dann sehe ich meine ganz und gar bayerischen Enkel vor Bergen und Seen im Schnee und in der gleißenden Sonne. Ich tauche beim Oktoberfest auf der Münchner Theresienwiese ein in die Massen der schunkelnden Menschen, deren Vitalität und Fröhlichkeit ich mich spätestens nach der ersten Maß weder entziehen kann noch will.
Und bin ich nach zwei langen Aufenthalten in Kanada nicht auch ein wenig Kanadier? Wenn ich mich mit dem Rucksack auf Skiern durch die verschneite Winterlandschaft stapfen sehe, wenn ich im Herbst die roten Ahornwälder durchwandere oder im Sommer die Gischt des Eriesees inhaliere, wenn ich Thanksgiving feiere und mir die in Butter gebackenen Pfannkuchen mit Ahornsirup in den Mund schiebe: Ja, dann bin ich tatsächlich ein Kanadier durch und durch. Und will es immer sein.
Kein Zweifel, meine Wurzeln haben sich im Laufe meiner Lebensjahre verbreitert und verästelt. Und das ist auch gut so, denn so nähren sie mich und geben mir Halt.
Doch zurück zu meinem Antrieb, der mich einst zum Volkswirt machte mit dem Ziel, einen Beitrag für eine bessere Gesellschaft zu leisten: Er ist im Laufe der Zeit immer weiter gewachsen, und heute ist er größer denn je. Denn auch die Herausforderungen sind größer geworden. Ich habe Kinder und Enkel, denen gegenüber ich mich verantwortlich fühle. Auch meine Nachbarn und Freunde hierzulande, ja meine Landsleute, meine Freunde und Bekannten in Europa und die Menschen überall auf der Welt haben Kinder und Enkel. Alle Nachkommen haben ein Recht darauf, sich in Frieden nach eigenen Fähigkeiten entfalten zu können. Es ist die Aufgabe der ökonomischen Forschung, dazu beizutragen, dass auch ihre Lebenschancen gewahrt werden, statt einfach zuzuschauen, wenn aktuelle Politikergenerationen sie ihnen nehmen.
Deswegen ging ich als Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, dessen Rettung aus einer existenzbedrohenden Krise und dessen Wiederaufbau ich 17 Jahre harter Kärrnerarbeit widmete, in die Medien und suchte den Kontakt zu den Menschen. In Radio- und Fernsehsendungen, in Talkshows, Nachrichtensendungen oder auch anderen Formaten mischte ich mich ebenfalls ein. Auch deswegen schrieb ich allgemein verständliche Artikel in deutschen und internationalen Zeitungen und initiierte ein europäisches Forschernetzwerk – das heute im Übrigen in der Volkswirtschaftslehre eines der größten der Welt ist. Und ich schrieb zudem Bücher zu zentralen wirtschaftlichen Problemen und Krisen, die einerseits den harten internationalen Forschungsstandards entsprachen, andererseits aber doch so verfasst waren, dass sie auch gebildete, ökonomischen Wahrheiten gegenüber aufgeschlossene Leser verstehen.
Probleme und Krisen, zu denen man als Volkswirt gefragt war, gab es in den letzten knapp dreißig Jahren ja genug: die Wiedervereinigung und die damit verbundenen wirtschaftspolitischen Fehler zulasten der Menschen in Ostdeutschland; die Standortthematik und die »Heilung« des »kranken Manns« in Europa, der die Bundesrepublik bis weit in die 2000er-Jahre hinein war; der trügerische Jubel über die Exportweltmeisterschaft Deutschlands; die massiven Fehler in der Umwelt- und Energiepolitik; die Weltfinanzkrise und das wachsende Unbehagen am Kapitalismus; die Deutschland bis in die ferne Zukunft billionenschwer belastende Eurokrise; die Zuwanderung in den Sozialstaat durch die ebenfalls politisch fahrlässig gelenkte Migration; das Versagen der EU beim Brexit und anderes mehr.
Die Bücher zu diesen Themen wurden allesamt zu Bestsellern. Dass mir das als Autor schmeichelt: geschenkt. Viel wichtiger ist, dass sie zu dem wurden, was mir wichtig war und bis heute ist: zu einer Grundlage für eine andere Argumentation als jene bequeme »alternativlose«, die sich die vor allem an der Wiederwahl in Ämter interessierte Politik immer häufiger zu eigen macht.
Schon in meiner Jugend und dann noch mehr im Zuge zunehmender Begeisterung für mein Studium entschied ich: Ich will nicht in den Tag hineinleben, sondern mit Blick auf die Gesellschaft verantwortlich handeln. Beides will ich noch immer. Meine Bücher waren und sind, wie ich finde, so, wie ich sie geschrieben habe, ein Ausdruck dieser Lebensphilosophie.
Reisen des Lebens: Aufstieg, Ökonomenwelten, große Liebe
»Auf der Suche nach der Wahrheit« – diese Autobiografie also – ist schließlich auch eine Reise. Und sie ist es auf mehreren Ebenen.
Sie beschreibt zum einen die Reise eines kleinen Jungen aus anfänglich armer Familie, dem es gelang – früh unterstützt durch fürsorgliche Eltern und Großeltern sowie durch exzellente Lehrer und Professoren im In- und Ausland –, seinen Weg in die vorderen Ränge der ökonomischen Wissenschaft und öffentliche Wirtschaftsdebatten zu finden. Sie ist damit zugleich eine Geschichte des geistigen und sozialen Aufstiegs zunächst in Zeiten des Wirtschaftswunders und später der Nachwendezeit.
Sie beschreibt damit zum anderen eine Reise des Aufbruchs in eine neue Welt, die von Ideologien nichts wissen will. Und diese Reise war weit. In meiner Jugend im westfälischen Brake wurde ich eher »links« geprägt, auch durch meine Familie. So war ich unter anderem sehr aktives Mitglied der Falken, der Jugendorganisation der SPD, denen ich vieles zu verdanken habe. Etwa die kritische Thematisierung der Nazi-Vergangenheit, die in der Schule nicht stattfand. Oder Auslandsreisen nach Frankreich, die meine Eltern sich nie hätten leisten können und die den Grund legten für meinen bis heute andauernden Einsatz für das Friedensprojekt Europa.
Andererseits aber lernte ich in meinem Studium der Ökonomie auch, dass mich »linke«, durchaus gut gemeinte Gesinnung, die mit Blick auf praktische Wirtschaftspolitik allzu oft auf eine bloße Umverteilungspolitik zugunsten der nicht Arbeitenden abstellt, nicht weiterführt. Das Ziel, alle arbeitsfähigen Menschen in den Arbeitsprozess und damit in das stabilisierende Gefüge einer Kollegenschaft einzugliedern, ließ sich – so verstand ich – auf diese Weise nicht realisieren. Ich nahm daher nach und nach Abschied von allem Ideologischen – mit den »Rechten« hatte ich mich ohnehin noch während meines Studiums geprügelt –, ohne mich dabei im Mindesten einer Partei verbunden oder gar verpflichtet zu fühlen. »Meine« Partei wurde vielmehr die der Wissenschaft und der wissenschaftlich basierten Aufklärung der Öffentlichkeit über das, was ökonomisch vernünftig ist und was infolgedessen wirtschafts- und sozialpolitisch getan werden muss.
Dieses Buch beschreibt ferner eine Reise in das, was wissenschaftlich ambitioniert betriebene Volkswirtschaftslehre früher war und heute ist und sein muss, damit sie erfolgreich bleibt – an Universitäten, in Forschernetzwerken oder an Wirtschaftsforschungsinstituten wie dem ifo Institut. Es lotet dabei auch ihre Möglichkeiten und Grenzen aus und gibt zugleich – quasi en passant – einen Überblick zu wichtigen ökonomischen Herausforderungen, Denkströmungen, Institutionen und Personen: Wie viel Markt, wie viel Staat, wie viel Plan? Was ist gerecht, und wie viel Umverteilung ist richtig? Wie sieht ein richtig konstruierter Sozialstaat aus – und was ist dabei mit Blick auf die Migration zu beachten? Welche Gestalt hat eine ökonomisch sauber fundierte, passgenaue Klima-, Umwelt- und Energiepolitik? Was läuft in Europa und mit dem Euro falsch, und wie ginge es besser? Wie ist den Auswüchsen des Kasino-Kapitalismus Einhalt zu gebieten?
»Die Suche nach der Wahrheit« ist ebenfalls eine Reise an internationale Institutionen wie den Internationalen Währungsfonds oder die Europäische Zentralbank und Top-Universitäten in den USA, Großbritannien oder eben Kanada, dieses Land, das meine Frau Gerlinde und ich durch zwei längere Lehr- und Forschungsaufenthalte über alle Maßen schätzen gelernt haben.
Und so ist denn dieses Buch – last but not least – auch eine Reise des Lebens, das ich so nur zusammen mit meiner Frau erfahren, bestehen und gestalten konnte. Gewiss, ich lege hier vor allem Zeugnis ab von dem, was ich beruflich und wissenschaftlich voranbringen konnte, und dies vor dem Hintergrund vielschichtiger ökonomischer, politischer und gesellschaftlicher Veränderungen in Deutschland, Europa und der Welt. Vieles davon ist geglückt, manches nicht.
Vollständig geglückt aber ist mein Leben mit meiner Frau Gerlinde; sie habe ich im ersten Semester unseres gemeinsamen Ökonomiestudiums in Münster kennen- und lieben gelernt; mit ihr zusammen habe ich arbeiten und publizieren können; mit ihr habe ich eine wunderbare Familie gegründet; sie war und ist meine erste Ansprechpartnerin in allen wichtigen Fragen; mit ihr habe ich atemberaubend schöne und prägende Reisen nach Nordafrika, Japan, China, Nordamerika, Bolivien, die Mongolei und in viele andere Länder der Welt unternommen, von denen ich hier auch erzählen werde.
Sie ist die Liebe meines Lebens. Noch vor der Ökonomie. Ob sie mir das glaubt? Ich höre sie schon lachen.
Hans-Werner SinnMünchen, Januar 2018
1 Der Abstieg vom Elfenbeinturm
Glasperlenspiele • Mein Schlüsselerlebnis: Die deutsche Wiedervereinigung • Eine Frage des Geldes: Währungsumstellung und Kaltstart • Persönlich betroffen und Zeuge des Mauerbaus • Perspektivenwechsel: Los Altos Hills und Palo Alto • »Für Krieg, Revolution und Frieden«: Die Hoover-Enttäuschung • Paul Samuelson und wie die westdeutschen Arbeitgeber und Gewerkschaften den Menschen in den neuen Ländern ihre Chancen nahmen • Ein Meer von Deutschlandfahnen • Beim IWF: Politische Spiele • Drohungen muss man trotzen • Albert O. Hirschman und die Junker • Operettenstoff aus Bolivien: Gonzalo Sánchez de Lozada • Wieder ein Fehler: Wohnen im Osten
Glasperlenspiele
»Betreiben Sie keine Glasperlenspiele!« Mit diesen Worten, die auf Hermann Hesses Roman Das Glasperlenspiel Bezug nahmen, entließ mich mein sehr geschätzter Münsteraner Professor Herbert Timm im Jahr 1974 an die volkswirtschaftliche Fakultät der Universität Mannheim. Meine Frau, Gerlinde Sinn, und ich hatten von seinem akademischen Schüler Hans Heinrich Nachtkamp Angebote erhalten, an dessen neuem Institut wissenschaftliche Assistenten zu werden, und diese Angebote auch angenommen. Für uns stellten sie eine großartige Chance dar, die nächsten Schritte unserer Zukunft auch ein Stück weit beruflich gemeinsam zu gehen und räumlich nicht mehr getrennt zu sein, denn ich arbeitete in Münster und meine Frau in Dortmund.
Nachtkamp hatte sich gerade habilitiert, also die hierzulande höchstrangige wissenschaftliche Lehrberechtigung erworben, und übernahm nun eine Professur in Mannheim, wohin wir ihm gemeinsam folgen konnten. Zwar wäre ich überaus gerne und wohl auch viel lieber in Münster geblieben – zu inspirierend war dort die wissenschaftliche Arbeit und auch das menschliche Miteinander. Aber da Timm kurz vor der Pensionierung stand und die Möglichkeit, bei einem anderen Kollegen als Assistent zu bleiben, immer noch keine Familienzusammenführung bedeutet hätte, hatte ich eigentlich keine echte Wahl. So nahm ich einerseits mit Vorfreude, andererseits schweren Herzens von meinem Lehrmeister Abschied.
Herbert Timm selbst sah diesen Abschied ebenfalls mit gemischten Gefühlen, wenn auch aus anderen Gründen. Die Universität Mannheim galt damals in der Volkswirtschaftslehre als ein Zentrum der theoretisch-mathematischen Forschung. Timm verhehlte nie, dass er diese für gleichsam esoterisch und weltabgewandt hielt. Er hatte es zwar durchaus verstanden, Theorie und Praxis in einer für uns Studenten faszinierenden Weise zu verbinden, und er präsentierte uns des Häufigeren sparsam gestrickte und gerade deshalb nützliche mathematische Modelle zu Teilaspekten des Wirtschaftsablaufs. Mit zunehmendem Alter und zunehmender Erfahrung neigte er allerdings mehr und mehr einer politikorientierten, an praktischen ökonomischen Problemen orientierten Forschung zu und lehnte eine selbstreferenziell betriebene Wirtschaftswissenschaft ab, die nach seiner Meinung dazu neigte, entrückte ökonomische Probleme zu erfinden, um sie dann theoretisch-mathematisch zu lösen.
Timms an mich gerichtete Warnung vor der Glasperlenspielerei war in gewisser Weise berechtigt. Er war in Sorge, dass mich die Mannheimer Fakultät für Volkswirtschaftslehre mit ihrer mathematischen Orientierung auf den falschen Pfad bringen würde. Seine Warnung habe ich nie vergessen, auch wenn ich ihre Bedeutung aufgrund meiner damaligen Unerfahrenheit wohl nicht ganz erfassen konnte. Heute aber, nach vielen Jahren auch theoretischer Forschung, weiß ich seine Haltung besser einzuordnen als zu jener Zeit – und auch noch besser wertzuschätzen. Zwar bin ich nach wie vor der Meinung, dass die mathematisch-theoretische Forschung für einen jungen Volkswirt das unabdingbare Rüstzeug ist, auf dem er später im Leben seine Politikempfehlungen aufbauen kann. Und ich möchte auf keinen Fall die großartigen Jahre in Mannheim missen, die mir quasi ein zweites Ökonomiestudium mit großer theoretischer Tiefe ermöglichten, obwohl ich mein Diplom als Volkswirt längst in der Tasche hatte. Doch sehe ich auch die Gefahr einer Verselbstständigung der theoretischen und ökonometrischen Forschung, die sich mehr auf mathematische Methoden statt auf institutionelles Wissen, praktische ökonomische Relevanz und wirtschaftspolitisch nützliche Ergebnisse bezieht. So mancher Professor agiert heute tatsächlich als Magister Ludi, wie ihn Hermann Hesse beschreibt, also als ein Schulmeister des esoterischen Spiels einer von der Welt abgekoppelten geistigen Elite. Die gleichsam auf sich selbst bezogene Forschung, der gelehrte Diskurs über Themen, die für die Praxis irrelevant sind, eine bloß rituelle Befolgung der Regeln der Wissenschaft: Die Entwicklung der ökonomischen Wissenschaft zeigt diese Tendenzen, und hat damit Ähnlichkeit mit dem, was Hesses Protagonist Josef Knecht in der rituellen Kunstwelt der »Padägogischen Provinz« Kastalien erlebt. Auch ich war ein Magister Ludi.
Dabei möchte ich nicht missverstanden werden: Es gibt viele inhaltlich sehr gehaltvolle Arbeiten, die sich auf hohem theoretischen Niveau bewegen und ökonometrische Methoden auf wichtige Fragestellungen anwenden. Die Theorie versucht komplexe ökonomische Zusammenhänge mithilfe der analytischen, nicht-numerischen Mathematik zu durchdringen. Dank wachsender Computerleistungen avancierte die Ökonometrie in den letzten Jahren zu einem immer bedeutsamer werdenden Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, bei dem es darum geht, numerische Daten mittels statistischer Methoden im Hinblick auf kausale Zusammenhänge zu durchforsten. Immer wieder kommen mir theoretische und ökonometrische Arbeiten zu Gesicht und begeistern mich. Ich bin dezidiert der Auffassung, dass eine an aktuellen Problemen orientierte Ökonomie eine starke theoretische Basis braucht, um im Nebel des Geschehens Strukturen zu erkennen. Ebenso haben die Methoden der Ökonometrie ihren unschätzbaren Wert bei dem Versuch, aus bereits vorhandenen Datensätzen empirische Zusammenhänge zu suchen, die man sonst nicht erkennen würde.
Einerseits. Denn andererseits habe ich das Gefühl, dass die Zahl der Studien, die sich unter Verwendung komplexer Methoden im Prinzip trivialen Inhalten zuwendet, noch immer erstaunlich hoch ist und sogar stark zugenommen hat. Das ist keine gute Entwicklung, und wir Ökonomen tun gut daran, zu überdenken, wie wir sie korrigieren können.
Verwundert bin ich überdies, wenn ich sehe, wie Ökonomen – ob etabliert oder erst am Anfang ihrer Karriere stehend – bei ihrer Suche nach zeit- und raumlosen Wahrheiten nicht einmal aufblicken, wenn um sie herum die Wogen großer Krisen hochschlagen und die Welt der Wirtschaft aus den Fugen gerät. Auch dies ist keine gute Entwicklung.
Mein Schlüsselerlebnis: Die deutsche Wiedervereinigung
Das Schlüsselereignis, das mich selbst gezwungen hat, auf den festen Boden der Analyse echter Probleme zurückzukehren, die die Welt bewegten, war ohne Zweifel die deutsche Wiedervereinigung. So gesehen freue ich mich nicht nur immer noch, dass ich sie miterleben durfte. Ich bin auch dankbar, dass sie zudem mein wissenschaftliches Denken und Handeln, meine eigene Suche nach der Wahrheit maßgeblich verändert hat. Und diese Veränderung begann, als ich im Herbst 1989 – ich war damals schon fünf Jahre auf meinem Lehrstuhl in München –, nur kurz nach dem Fall der Berliner Mauer auf Empfehlung meines Amtsvorgängers Hans Möller vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft kooptiert wurde.
Die Wurzeln dieses altehrwürdigen Wissenschaftlichen Beirats gehen zurück bis ins Jahr 1943. In seiner heutigen Form indes war er ein Jahr vor der Gründung der Bundesrepublik im Jahr 1948 geschaffen worden, um die Wirtschaftspolitik der Westzonen und später der Bundesrepublik zu gestalten. Hans Möller trat ihm 1950 bei, war lange Vorsitzender und nahm über den Beirat maßgeblich auf die Wirtschaftsgesetze der Bundesrepublik Einfluss. Auch deshalb hatte seine Empfehlung einiges Gewicht.
Noch heute gilt dieser Beirat als der wissenschaftliche Beirat schlechthin, weil er der erste war und weil in ihm die ordnungspolitischen Grundregeln der Bundesrepublik Deutschland definiert wurden, die Ludwig Erhard dann im Rahmen seines Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft umsetzte. Bekanntermaßen formten diese Grundregeln die Basis des deutschen Wirtschaftswunders nach dem Krieg.
Als die Mauer fiel, war fast automatisch auch die Agenda des Beirats für die kommende Zeit vorherbestimmt. Als Erstes schrieben wir einen wohlwollenden Kommentar zu Helmut Kohls legendärem »Zehn-Punkte-Programm«. Dann folgten verschiedene Gutachten zum sich anbahnenden Vereinigungsprozess, die von der Währungsumstellung über die Privatisierung bis zur Lohnpolitik reichten. Unsere Aufgabe bestand letztlich darin, uns mit den konkreten wirtschaftspolitischen Optionen für die Gestaltung eines solchen Prozesses auseinanderzusetzen und Handlungsempfehlungen abzugeben. Mit einem Schlag lag die ausschließlich theoretische Welt der ökonomischen Wissenschaft hinter mir. Nun galt es ausgehend vom theoretischen Denken praktische und zeitaktuelle ökonomische Probleme zu verstehen und an ihrer Lösung mitzuwirken.
Wir im Beirat standen im Prinzip auf Kohls Seite. Helmut Kohl hatte die Zeichen der Zeit erkannt und sich zum Motor des Vereinigungsprozesses gemacht. Er war zwar anfangs auf dem falschen Fuß erwischt worden. So erinnere ich mich noch gut an den 9. November 1989, als die Mauer gefallen war und meine Frau und ich, vor Freude weinend, vor dem Radio saßen, um die Dinge zu verfolgen. Das Interview, das Kohl damals gab, schien indes nicht davon zu zeugen, dass er der Situation gewachsen war. Er wiegelte ab und stammelte Dinge, die bei mir eher den Eindruck entstehen ließen, als kämen ihm die Ereignisse ungelegen. Ich war wütend, weil er nicht zu begreifen schien, was hier passiert war. Sollte er wirklich nicht verstehen, dass das Wunder einer Wiedervereinigung, das viele von uns nicht mehr zu erhoffen gewagt hatten, nun dabei war, Realität zu werden?
Aber Helmut Kohl hat damals vermutlich doch erheblich mehr begriffen, als er im Radio zum Ausdruck bringen wollte. Ich nehme an, dass er bereits die Probleme vor sich sah, die der Widerstand anderer Nationen bringen würde, und deshalb zu diesem frühen Zeitpunkt keinen der Nachbarn und Großmächte mit womöglich missverständlichen Aussagen irritieren wollte. Auch kann man es ihm im Rückblick betrachtet kaum verdenken, dass er und seine Berater die eigentlich für alle vollkommen überraschende Situation zunächst einmal gründlich analysieren mussten, bevor er sich festlegte. Als er nur wenig später sein Zehn-Punkte-Programm zur Wiedervereinigung vorlegte, hatte er die Dinge definitiv im Griff. Dieses Programm war gründlich konzipiert, und es enthielt konkrete Schritte zu einer Annäherung beider deutscher Staaten unter einem gemeinsamen europäischen Dach.
Das Programm hatte Kohl weder mit François Mitterand noch mit Margaret Thatcher abgestimmt. Er wusste, dass sie dagegen sein würden. Und er wusste, dass die Opposition noch härter gewesen wäre, wenn er sie vorher konsultiert und dann seine Vorschläge dennoch unterbreitet hätte. In der Tat wollten Thatcher und Mitterand die Wiedervereinigung verhindern. Letztlich aber sahen sie kaum noch eine Möglichkeit, diese Haltung gegen die deutlich anderen Positionen der Großmächte USA und Sowjetunion durchzusetzen, die sich einer Wiedervereinigung nicht in den Weg stellen wollten. Sie mussten nachgeben. Mitterand rang Kohl immerhin noch den endgültigen Verzicht auf die alten deutschen Ostgebiete sowie die Zusage einer Änderung der Europäischen Verträge ab, die dann ja auch auf dem Gipfel von Maastricht im Jahr 1991 beschlossen wurde.
Eine Frage des Geldes: Währungsumstellung und Kaltstart
Dass der Kern dieser Änderung der Europäischen Verträge die Aufgabe der D-Mark sein würde, wussten wir damals noch nicht, denn zunächst einmal ging es darum, die Mark der DDR durch die D-Mark abzulösen. Wir vom Wissenschaftlichen Beirat erstellten dazu zu Beginn des Jahres 1990 ein Gutachten, in dem die Modalitäten der Währungsumstellung, insbesondere der Umrechnungskurs, diskutiert wurden. Das Gutachten teilte die Skepsis der Bundesbank gegenüber einer Währungsumstellung aller Vermögenswerte zum Kurs 1:1, weil das einen inflationären Geldüberhang erzeugt hätte. Es wäre also mehr Geld in Umlauf gebracht worden, als für die laufenden Transaktionen der Volkswirtschaft erforderlich gewesen wäre, was eine Inflationsgefahr heraufbeschworen hätte. Doch während die Bundesbank vorschlug, alle Vermögenstitel zum Satz 2:1 umzustellen, empfahlen wir im Beiratsgutachten, zwar alles zum Satz 1:1 umzurechnen, aber nur einen Teil als Bargeld auszuzahlen und einen anderen Teil als bloße Vermögenstitel auf Sperrkonten festzulegen, die man dann zu einem späteren Zeitpunkt freigeben würde. Ähnlich war schon 1948 bei der Einführung der D-Mark im Westen verfahren worden. Für diesen Vorschlag sprach, dass es auch in der DDR Vermögenstitel wie Sparguthaben und Lebensversicherungen gab, die nicht in Geldform vorlagen, sondern nur in Geldwerten ausgedrückt waren.
Tatsächlich entschied sich die Bundesregierung letztlich für einen Mittelweg zwischen den Vorschlägen der Bundesbank und des Beirats. Etwa ein Drittel der Vermögenswerte wurde zum Kurs 1:1 umgetauscht, und zwei Drittel zum Kurs 2:1, freilich ohne unserem Vorschlag der Einrichtung von Sperrkonten zu folgen.
Sämtliche Lohnkontrakte wurden zudem, wie wir vom Beirat es empfohlen hatten, 1:1 umgestellt. Damit setzte sich unsere Position gegenüber jener der Bundesbank durch. Die Bundesbank hatte zugunsten ihres Vorschlags, alle Vermögenstitel im Verhältnis 2:1 umzustellen – also auch die Löhne – im Prinzip zu Recht angeführt, dass für die umfangreichen Exporte der DDR nach Westdeutschland ein wesentlich niedrigerer Umtauschkurs als 1:1 angesetzt worden war, um die Ostprodukte hierzulande auch wettbewerbsfähig zu halten. In der Tat betrug dieser Kurs über alle Warengruppen gerechnet im Schnitt etwa 4,3 Mark Ost je D-Mark West, und zu diesem Kurs waren die von der DDR nach Westdeutschland exportierten Produkte im Westen auch wettbewerbsfähig. Die aus dem Osten stammenden Möbel von Ikea oder auch die Orwo-Filme, die das Versandhaus Quelle vertrieb, hatten zwar keine hohe Qualität, aber sie waren immerhin billig genug, um sich so auf dem Westmarkt halten zu können. Würde man die Löhne nun mit einem Schlag 1:1 umstellen, so befürchtete die Bundesbank, dann würde die ostdeutsche Wirtschaft mit einem Schlag ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren.
Das stellte zwar eine im Prinzip plausible Position dar, die man nicht einfach so und a priori verwerfen konnte. Dennoch waren wir im Beirat davon überzeugt, dass man die damit verbundene Strategie der ostdeutschen Bevölkerung nicht zumuten durfte, denn die sogenannte Kaufkraftparität bezüglich der Güter des täglichen Lebens, also nicht bezüglich der Exportprodukte lag nahe bei dem Wert 1:1. Mit anderen Worten: Die Grundnahrungsmittel im Osten waren in Mark Ost etwa so teuer wie im Westen in Einheiten von D-Mark. Die Aufrechterhaltung des Lebensstandards der Bevölkerung verlangte unserer Ansicht nach eine gleichwertige Umstellung aller Vermögenstitel – mit der oben genannten Einschränkung, einige Vermögenswerte temporär zu sperren – sowie auch die gleichwertige Umstellung der Lohnkontrakte. Dass die Löhne dann für die Wettbewerbsfähigkeit der Treuhandbetriebe zu hoch sein würden, war uns bewusst. Andererseits schöpften wir aus dem Umstand, dass sie dennoch bei nur einem Drittel der Löhne des Westens liegen würden, die Hoffnung, dass die Produktivität der ostdeutschen Betriebe nach einer Übernahme westlichen Know-hows hinreichend schnell steigen würde, um eine solche Lohnumstellung auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten zu rechtfertigen.
Ich fand diese und andere Fragestellungen rund um die sich anbahnende Wiedervereinigung faszinierend und die Diskussion im Beirat, dem ein Großteil der Elite der deutschen Wirtschaftswissenschaft angehörte, in hohem Maße spannend. Auf einmal ging es nicht mehr um abstrakte mathematische Modelle, deren Variablen aus abstrakten Buchstaben bestanden, sondern um die Menschen selbst und um konkrete Politikempfehlungen. Das war ein anderes Verantwortungsniveau, als man es für die akademisch-theoretische Forschung benötigte. Entsprechend hart und ernsthaft verliefen unsere Debatten im Beirat.
Kein Zweifel, in der Rückschau haben mein ökonomisches Wissen und mein Problembewusstsein durch die schließlich viele Jahre währende Arbeit im Beirat immer wieder einen Schub bekommen, von dem ich lange zehren konnte. Eigentlich zehre ich sogar bis heute davon. Und mehr noch: Die Arbeit für den Beirat veränderte nicht nur mein Denken, sondern auch mein Schreiben. Sie legte damit auch den Grund für meine allmählich wachsende Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit, in den Debatten um wirklich wichtige wirtschaftliche Fragestellungen Deutschlands und Europas.
Das gilt bereits für das Buch zu den ökonomischen Herausforderungen rund um die deutsche Vereinigung mit dem Titel Kaltstart, das meine Frau und ich über den folgenden Winter und zum Beginn des Jahres 1991 fertigstellten. Das Buch hat maßgeblich von den Diskussionen im Beirat profitiert, weil sie mir das Problembewusstsein und die innere Unruhe schufen, ohne die man ein so komplexes Werk nicht angehen kann. Aber erst durch die täglichen Diskussionen mit meiner Frau Gerlinde entwickelte sich das Wissen und die Vorstellung von der Struktur des Buches, die uns in die Lage versetzten, gemeinsam zur Feder zu greifen.
Das Buch erschien anfangs in einer akademischen Aufmachung, doch weil es sich gut verkaufte, wurde die dritte Auflage als Taschenbuch mit einem Foto auf dem Titelblatt herausgebracht. Auf dem Foto sind meine Frau und ich mit einem Mercedes und einem Trabi zu sehen. Um die Schwierigkeiten eines Kaltstarts zu verdeutlichen – wie ihn unseres Erachtens die ostdeutsche Wirtschaft vor sich hatte – verbanden wir für das Coverfoto beide Autos mit einem Starterkabel. Es entstand im März in unserem Garten. Wir hatten eigentlich schon lange die Idee zu dem Foto gehabt, doch plötzlich war der Schnee weg und die Not groß. Dann schneite es überraschend doch noch einmal, und das Foto musste nun schnell gemacht werden. Die Frage war indes: Wo bekommen wir jetzt einen Trabi her? Nach langem Telefonieren fanden wir einen Autoverleiher in München, der einen im Angebot hatte. Sofort machte ich mich auf den Weg, holte ihn ab und fuhr ihn in unseren Garten. Ein Nachbar stand schon bereit und schoss das Foto. Man konnte ja nicht wissen, wie lange der Schnee noch liegen würde.
Doch die Geschichte geht noch weiter. Als ich nämlich den Trabi zurückbrachte, fragte ich den Verleiher, was er für das Auto bezahlt hatte. Statt zu antworten wollte er wissen, ob ich es denn nicht kaufen wolle. Ich zögerte – allerdings nicht lange. Ich habe schon, dachte ich kurz, dümmere Sachen in meinem Leben gekauft. Und so willigte ich kurz entschlossen ein und erwarb für 1.000 D-Mark einen Trabi. Tatsächlich fuhren wir ihn auch einige Jahre lang und hatten viel Spaß mit ihm – bis unser älterer Sohn Philipp 18 wurde und ihn übernahm, freilich nur in der Absicht, ihn alsbald zu verkaufen, um einen alten VW-Golf dafür zu erwerben. Bis auf den Umstand, dass mein Sohn etwas ungehalten war, weil ich den Verkaufspreis auf 500 D-Mark gedrückt hatte, ist die Zeit, als wir den Trabi besaßen, eine sehr schöne Episode meines Lebens, auf die ich mit etwas Wehmut zurückblicke. Ich fand, dass 500 D-Mark ausreichend waren, nachdem wir den Wagen so lange genutzt hatten, und hatte auch etwas Mitleid mit den armen Schluckern, die sich da gemeldet hatten, um das Auto vom Sohn eines nicht unvermögenden Professors zu kaufen. Mein Sohn war mit dem Geschenk der 500 D-Mark immer noch gut bedient.
Kaltstart war primär für volkswirtschaftliche Fachkollegen geschrieben, doch fand es auch viel Aufmerksamkeit in der Politik und in der allgemeinen Öffentlichkeit. Es legte den Grundstein für eine ganze Serie von Monografien, die ich später nach ähnlichem Muster schrieb und deren Wirkung immer stärker über die Grenzen der Fachdisziplin hinausstrahlte. Stets war es mein Bemühen, über neue zeit- und raumgebundene Politikprobleme zu schreiben und sie faktenreich und auf dem soliden Boden der volkswirtschaftlichen Theorie zu untersuchen, ohne dabei im Fachjargon zu versinken. Immer habe ich mich bemüht, eine Sprache zu verwenden, die jeder verstehen würde, denn ich will nicht einsehen, dass nur das Wissenschaft und Erkenntnis ist, was so kompliziert geschrieben ist, dass es nur von anderen Fachleuten verstanden wird.
Die Regierung Kohl mochte zwar von alternativen Analysen und Handlungsoptionen zum wirtschaftlichen Vereinigungskurs, um die es uns in unserem Buch ja vor allem ging, nichts mehr wissen und beschleunigte den Schritt auf dem einmal eingeschlagenen Weg eher noch. Doch wurde – wie erwähnt – Kaltstart durchaus breiter diskutiert. Auch Bundespräsident Richard von Weizsäcker interessierte sich sehr und lud mich in die Villa Hammerschmidt ein. Er hörte sehr aufmerksam zu, stellte tiefgehende Fragen und beglückwünschte mich und auch meine Frau, die nicht dabei sein konnte, zum Inhalt.
Das Buch erschien übrigens nicht nur in Deutschland. Es erschien auch auf Englisch bei MIT-Press, dem Verlag des renommierten Massachusetts Institute of Technology, sowie in französischer, russischer und koreanischer Sprache. Jahrzehnte später kam es zudem auf Chinesisch heraus.
Die Südkoreaner zeigten sich erwartungsgemäß besonders interessiert. Meine Frau und ich wurden zu einer Vortragsreise eingeladen, um über die deutschen Erfahrungen zu berichten. Die deutsche Wiedervereinigung stellte für unsere Gastgeber ein Experiment dar, von dem sie hofften, aus ihm womöglich unmittelbare Schlüsse für die Möglichkeiten einer Wiedervereinigung von Süd- und Nordkorea herleiten zu können – auch wenn die Verhältnisse auf der koreanischen Halbinsel viel schwieriger sind, u. a. auch deswegen, weil der Norden im Verhältnis zum Süden viel größer ist als Ostdeutschland im Verhältnis zu Westdeutschland.
Persönlich betroffen und Zeuge des Mauerbaus
Die Überwindung der deutschen Teilung im Jahr 1990 stellt das wichtigste historische Ereignis meines Lebens dar. Allerdings nicht nur deswegen, weil ich mich fortan immer mehr von der ökonomisch-theoretischen Kunstwelt verabschiedete und mich verstärkt den praktischen ökonomischen Fragestellungen zuwandte, sondern auch deswegen, weil mich die Teilung genauso wie ihre Überwindung sehr persönlich betraf. Vermutlich hätte ich – hätten meine Frau und ich – unser Buch ohne diese persönliche Prägung kaum schreiben können.
Die Teilung hat mich nicht nur berührt, weil ich viele Verwandte in Ostdeutschland und Berlin hatte, sondern auch, weil ich tatsächlich unmittelbarer Zeitzeuge beim Bau der Mauer war. Am Samstag, dem 12. August 1961 – ich war damals 13 Jahre alt – fuhren wir nämlich mit dem Lloyd Alexander TS meines Vaters vom Westteil Berlins, wo wir bei einer Schwester meiner Mutter wohnten, in den Osten, um dort Tante Lieschen zu besuchen, eine Schwester meiner Großmutter. Tante Lieschen war dort nach einer geschiedenen Ehe mit einem russischen Geschäftsmann hängen geblieben und schrieb uns stets liebe Briefe. Der Weg führte am späten Vormittag mitten durch das Brandenburger Tor zur Senefelder Straße, wo sie uns schon zum Essen erwartete.
Bei der Rückkehr am frühen Nachmittag erlebten wir dann aber eine unerwartete Überraschung, die wir zunächst nicht recht deuten konnten. Soldaten hatten das Brandenburger Tor verstellt und rollten Stacheldraht aus. Schnell war klar: Auf diesem Weg kamen wir nicht mehr in den Westteil, und so wurden wir stattdessen durch einen anderen Ausgang herausgeleitet. Zurück auf der anderen Seite der Grenze klebten unsere Verwandten bereits am Radiosender – anders konnte man es nicht nennen – und versuchten zu verstehen, was sich da ereignete. Am nächsten Tag, dem historischen 13. August, zeigte es sich dann für jedermann: Die Grenze war in der Nacht geschlossen worden.
Was bedeutete das? Niemand wusste es. Die ganze Stadt geriet in Aufruhr, und in Windeseile verbreitete sich Angst, Angst vor dem, was nun noch geschehen würde, Angst auch davor, dass nun die Sowjets kommen und die US-Amerikaner ihren Schutz für den Westteil beenden könnten.
Ich machte mich in dieser aufwühlenden Situation mit Straßenbahn und S-Bahn auf den Weg zum Brandenburger Tor, um selbst nachzuschauen, freilich ohne zu sagen, wohin ich gehen würde. Dass meine Familie beunruhigt sein würde, weil ich lange nicht zurückkam, verdrängte ich angesichts der Dramatik der Ereignisse. Ich war einfach zu neugierig.
Und was ich sah, war in der Tat aufregend. Auf der Westseite des Tors hatten sich Menschenmassen versammelt, ein hölzernes Podest war aufgebaut, und ein Redner sprach zur Menge. Ich hörte zu, verstand aber vieles nicht, machte einige Fotos mit meiner Agfa Clack und fuhr später wieder nach Hause, wo ich schon ungeduldig und in großer Sorge erwartet wurde.
Seit diesem Ereignis hat mich Ostberlin fasziniert. Jedes Mal, wenn wir seither die Stadt besuchten, versuchte ich wieder, in den Osten zu gelangen, um nachzusehen, was dort geschah. Wir Westdeutschen durften ja nach Ostberlin, während den Westberlinern der Zutritt verwehrt blieb. Diesen Spielraum nutzte ich: So ging ich also, als ich bereits älter war, regelmäßig ins Brecht-Theater am Schiffbauerdamm und in die Distel, jenes derbe legendäre politische Kabaretttheater, das im Osten Kultstatus genoss und auch im Westen bekannt war. Diese Vergnügungen waren damals billig zu haben.
Später, nachdem Willy Brandt im Rahmen seiner Ostpolitik für die Westdeutschen das Recht ausgehandelt hatte, auch die Verwandten in der DDR zu besuchen, fuhr ich mit meiner Frau und anderen gelegentlich nach Oberschlema, einem Ort in der Nähe der Grenze zur Tschechoslowakei. Die langen Warteschlangen und die detaillierten, erniedrigenden Grenzkontrollen, die ich so nie wieder irgendwo auf der Welt erlebt habe, prägten sich in meinem Gedächtnis ein und ließen den Groll auf das ostdeutsche System wachsen. Auch das erklärt die tiefe Emotion, die mich erfasste, als die Mauer fiel.
Tante Lieschen war da schon lange tot. Wenige Wochen nach dem Fall der Mauer starb auch meine Tante Ilse, die Schwester meiner Mutter, bei der ich zu wohnen pflegte, wenn ich in Berlin war. Zum Begräbnis, in den ersten Tagen des Januar 1990, fuhr ich mit meiner Frau, und wir trauerten um meine liebe Tante. Danach aber wollten wir nachschauen, was nun mit der Mauer geschah. Beim Fußweg durch den Tiergarten hörten wir ein dumpfes, monotones Brummen, das immer lauter wurde, auf das wir uns aber keinen Reim machen konnten. Schließlich sahen wir die Ursache: Das Brummen stammte von Tausenden von Hämmern, mit denen die Menschen die Mauer zertrümmerten, um sie zu zerstören, aber auch, um sich Souvenirstücke abzuschlagen.
Ein Foto, das in der Sammlung dieses Buches enthalten ist, zeigt meine Frau. Ich nahm es von innen, also von Osten her, auf, nachdem ich zuvor durch das Loch in der Mauer dorthin geklettert war. Sofort nach dem Schnappschuss ermahnte mich einer jener dort postierten »Vopos«, ein Volkspolizist der DDR, wieder in den Westen zurückzukehren – was ich auch brav tat.
Wichtiger aber ist: Das Erlebnis schließt für mich einen Erinnerungskreis von fast 29 Jahren meines Lebens, während derer sich mein politischer Geist geformt und die Kenntnis der inneren Abläufe und Beharrungskräfte politischer Systeme gewachsen war. Nicht zuletzt deswegen steht das Foto heute in meinem Arbeitszimmer, und ich schaue nicht selten darauf.
Das Interesse an den Geschehnissen im Osten und die Zuneigung zu den Landsleuten, die nach dem Krieg die schlechteren Karten gezogen hatten, ließen mich seither nie wieder los. Auch meine Kinder wollte ich mit diesem Teil der deutschen Geschichte vertraut machen. So unternahmen wir im Sommer 1992 zusammen mit ihnen eine lange Radtour durch die neuen Bundesländer. Da man auch zu jener Zeit noch im Vorhinein kaum etwas organisieren konnte, fuhren wir mit vollen Satteltaschen von Celle bei Hannover gen Osten und machten dabei einen großen Halbbogen am Arendsee vorbei über Perleberg zur Müritz, und von dort nach Rheinsberg, nicht ohne dort die gleichnamige Novelle von Kurt Tucholsky zu lesen. Dann ging es weiter am Stechlinsee vorbei bis in das Zentrum von Berlin. In Jugendherbergen und Gasthöfen kamen wir stets ohne Probleme unter und genossen dieses Land, das uns so fremd gewesen war und uns nun mit der Schönheit seiner Natur gleichsam umarmte.
Perspektivenwechsel: Los Altos Hills und Palo Alto
Zurück zur Entstehung von Kaltstart. Nicht nur die Diskussionen im Wissenschaftlichen Beirat oder meine persönliche Geschichte, von der ich berichtet habe, lieferten Anstöße zu diesem Buch. Unschätzbar wichtig waren vielmehr auch viele Gespräche und Begegnungen in den USA. Dorthin nämlich reiste ich unmittelbar nach Abschluss des Währungsgutachtens des Beirats für ein Forschungsfreisemester. Ich ging zunächst an die Universität Stanford, die mich zu einem längeren Gastforscheraufenthalt eingeladen hatte. Anerkannte Größen der Ökonomie wie Kenneth J. Arrow, damals bereits Nobelpreisträger, Joseph E. Stiglitz, der gut zehn Jahre später ebenfalls den Nobelpreis erhielt, und John Shoven hatten sich für die Einladung stark gemacht.
Die Reise warf mich zwar zunächst in eine andere Umgebung, für die die Ereignisse in Deutschland fern zu sein schienen, doch währte die Distanz nicht lange. Im Frühsommer 1990 lud mich nämlich der Verwaltungsrat der Universität Stanford ein, vor einem ausgewählten Publikum einen Vortrag zu den ökonomischen Aspekten der deutschen Vereinigung zu halten. Das war eine Herausforderung, der ich mich nicht entziehen konnte und wollte. Ich kam nicht wenig ins Schwitzen, denn mein Bewusstsein mit Blick auf die praktischen wirtschaftlichen Herausforderungen der Wiedervereinigung war damals noch ziemlich unterentwickelt. In den deutschen Zeitungen, die ich zur Vorbereitung nun eifrig konsultierte, fand ich auch nicht viel zur ökonomischen Seite des Geschehens. Da ging es eher um die Frage, ob die Ostkindergärten erhalten blieben, als um das, was mit den Firmen der DDR passieren würde. Zum Glück hatte ich durch die Debatten im Beirat zur Währungsumstellung bereits einiges an relevanten Informationen gesammelt, um die Diskussion mit dem Verwaltungsrat in Stanford leidlich zu überstehen.
Die dominante Figur bei dem Treffen war George P. Shultz, der zu Beginn des Vorjahres im Kabinett Ronald Reagans noch als Außenminister der USA amtiert hatte. Er stellte die meisten Fragen und trug auch selbst stark zur Diskussion bei. Er hob die besondere Leistung von Helmut Kohl im Prozess der sich anbahnenden Wiedervereinigung hervor und betonte, dass dieser Prozess ohne dessen Entschlossenheit nicht so weit gediehen wäre. Mir bot die Zusammenkunft Anlass und Ansporn, in den folgenden Wochen und Monaten immer tiefer in die ökonomische und politische Problematik der deutschen Vereinigung einzusteigen und den Fortgang des Einigungsprozesses über die deutschen und US-amerikanischen Medien intensiv zu verfolgen.
Ich sah George Shultz übrigens zum Jahresbeginn 2015 in Stanford wieder, als ich beim Jahresfest des Alumni-Klubs der Universität den Festvortrag zur europäischen Eurokrise hielt. Er war nun ein betagter Herr in den Neunzigern, doch immer noch erstaunlich frisch und im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Wir haben uns freundlich die Hände geschüttelt und Erinnerungen ausgetauscht. Die Alumni-Klubs der Universitäten sind Vereinigungen ehemaliger Studenten, die in den USA eine große Bedeutung haben und die beim Studium geknüpften Beziehungen ein Leben lang erhalten. Sie generieren für die Universitäten im Vergleich zu dem, was in Europa üblich ist, ein hohes Spendenaufkommen, das eine wichtige Rolle im Budget der Universität spielt.
Die Zeit, die wir – meine Familie und ich – 1990 in Kalifornien verbrachten, war wunderschön. Ich reiste schon im März dorthin, direkt nach dem Ende des deutschen Wintersemesters. Erst lebte ich allein in einem kleinen, etwas heruntergekommenen Kutscherhäuschen, das sich im Park einer prächtigen Villa in Los Altos Hills befand, einem mondänen Ort im Küstengebirge des Pazifik, der das Silicon Valley überblickt. Ich kaufte mir für 3.000 Dollar einen riesigen weißen Kombi der Marke Chrysler mit einem Acht-Zylinder-Motor, einen typischen amerikanischen Straßenkreuzer also, der mich – anders als deutsche Autos es täten – nicht auf straffem Kurs durch die Kurven und über die Bodenwellen führte, sondern behäbig, schwer und ruhig über der Straße zu schweben schien. Der Wagen hatte bereits 160.000 Meilen auf dem Buckel, war aber ausgezeichnet erhalten. Am liebsten hätte ich ihn später nach Deutschland importiert, so sehr war ich von seiner Qualität angetan, doch das lohnte sich angesichts der damit verbundenen Transport- und Umbaukosten nicht.
Mit dem Wagen fuhr ich täglich zu der in einem romanischen Stil gebauten und von Palmen umrankten Universität. Die Gründerfamilie Stanford hatte sich unverkennbar ein großes Schweizer Skihotel als Modell für die zentralen Universitätsbauten ausgesucht. Und ihrer Universität hatte sie den auf den deutschen Humanisten Ulrich von Hutten zurückgehenden, hier ins Deutsche übersetzten Leitspruch »Die Luft der Freiheit weht« gegeben, der noch heute im Wappen so geführt wird. Angesichts derart großer kultureller Schnittstellen konnte ich mich fast wie in der Heimat fühlen.
Und das war auch in anderer Hinsicht so. Wenn ich etwa am Abend in mein Stanforder Zuhause kam, erwartete mich der Hund meiner Wirtin, ein braun-schwarz-weiß gefleckter Beagle, schon freudig mit seinem Schwanz wedelnd. Ich musste mit ihm erst einmal eine Weile spielen – was ich gerne tat –, bis er mich losließ und ich mein Essen kochen konnte, während ich zugleich auf dem Weltempfänger, den ich mir vor Ort gekauft hatte, auf Kurzwelle die Nachrichten aus Deutschland hörte. In dieser spannenden Zeit der sich 1990 vollziehenden Wiedervereinigung war ich geradezu süchtig danach, täglich die neuesten Entwicklungen zu erfahren. Auch die Telefongespräche mit meiner Frau drehten sich nicht selten um diese Entwicklungen.
Im Frühsommer, zwei Monate vor dem Beginn der Sommerferien, kam dann meine Frau mit unseren Kindern nach. Sie hatten so früh freibekommen, weil wir versprochen hatten, dass sie in Stanford die Summer School besuchen würden, was sie dann auch mit großer Begeisterung taten. Nun reichte der Platz im kleinen Kutscherhäuschen nicht mehr, und ich mietete für ziemlich viel Geld auf dem erweiterten Campus das Haus eines indischen Professors, der in Stanford arbeitete und nun ein Sabbatical, also ein Freisemester für die Forschung, in seiner Heimat wahrnahm. Dort, in Palo Alto, lebten wir, wie man nur in Amerika leben kann. Der Kühlschrank mit der Eiswürfel-Automatik, die großzügigen, weiß gehaltenen Räumlichkeiten, der prächtige Garten: All dies schuf die perfekte amerikanische Idylle, vervollkommnet durch ein Schwimmbecken unter Palmen und einen Jacuzzi, etwas, das wir in Deutschland zu jener Zeit kaum kannten. Im Jacuzzi haben wir so manchen Abend mit einem Glas kalifornischem Wein in der Hand gesessen, in die Sterne geschaut, von den USA geschwärmt und überlegt, was nun wohl in der Heimat los war. Und angesichts der sich abzeichnenden Wiedervereinigung war ja eine Menge los.
»Für Krieg, Revolution und Frieden«: Die Hoover-Enttäuschung
Bei meiner Arbeit saß ich in einem Zimmer der Hoover Institution, welches sich auf der anderen Straßenseite gegenüber der Encina Hall, dem Hauptgebäude der volkswirtschaftlichen Fakultät, befand. Der Platz dort war beengt, und so wies man mir einen Raum an der Hoover Institution zu, jenem legendären, fast 100 Jahre alten Think Tank, der zwar zur Stanford Universität gehört, aber von einem eigenen Gremium beaufsichtigt wird.
Meine Nachbarin im Nebenzimmer am Institut erzählte mir allerlei interessante Dinge. Zum Beispiel, dass sich der Straßenasphalt vor dem Gebäude wie Meereswellen bewegte, als Kalifornien im Winter ein schweres Erdbeben hatte, das zum Einsturz vieler Häuser und sogar einer Highway-Brücke geführt hatte. Noch interessanter war freilich, was sie über die Stimmung im Think Tank nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zu berichten hatte, und die war alles andere als gut.
Die Hoover Institution trägt den Beinamen for War, Revolution, and Peace, also »für Krieg, Revolution und Frieden«. Sie gilt als ein erzkonservatives Institut, das sich mit den wichtigen strategischen Fragen der Weltpolitik beschäftigt. Hier werden Armeen in Planspielen bewegt, Länder unter Kontrolle gebracht, Ölquellen gesichert und Handelsbeziehungen geplant, um das amerikanische Weltreich zu entwickeln und zu stabilisieren. Auch mir gegenüber wurde dort über die Bestrebungen nach amerikanischer Hegemonie mit einer Selbstverständlichkeit geplaudert, die mir als Europäer – zumal als Deutschem, der Hegemonialüberlegungen mit einer anderen, einer schrecklichen Ära der Geschichte in Verbindung zu bringen pflegt – den Schauder über den Rücken trieb.
Man könnte nun denken, dass in dieser Institution der Jubel der Mitarbeiter über den Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs groß war. Doch davon konnte nicht die Rede sein. Vielmehr überwog die Tristesse, denn über kurz oder lang drohte nun all das Wissen, das man sich in Jahren mühsamer Recherche über das sowjetische Wirtschaftssystem und die sowjetische Einflusssphäre erarbeitet hatte, zu Makulatur zu werden. Aufsatz-Manuskripte, die geschrieben, aber noch nicht veröffentlicht waren, verloren ihren Wert, und die halb fertigen Bücher über den Kommunismus, die in der Pipeline steckten, konnte man nun in den Papierkorb werfen. Keine angenehme Aussicht. Und offenbar konnten der Gewinn und die Freiheit für Millionen von Menschen in Ostdeutschland und Osteuropa die Trauer über die eigenen Bedeutungsverluste nicht aufwiegen. Mich hat das seltsam berührt, gerade dort, in den USA, dem selbst ernannten Hort der Freiheit, eine solche Einstellung zu erleben. Mehr noch: Ein derart krudes Verständnis von Verantwortung hat mich verblüfft.
Die in jeder Hinsicht spannende Zeit in Stanford ging bald zu Ende, und wir brachen auf in Richtung Princeton, der Universitätsstadt an der Ostküste, wo ich den Herbst verbringen wollte, bevor das Wintersemester in Deutschland begann. Wir packten all unser Hab und Gut in und auf unseren riesigen weißen Chrysler-Kombi und durchkreuzten Nordamerika – mittlerweile übrigens zum fünften Mal, nachdem wir bei früheren Aufenthalten in Kanada schon zweimal hin- und hergefahren waren. Die reine Fahrtzeit für eine solche Durchquerung muss man mit einer Woche bis zu zehn Tagen veranschlagen, was für deutsche Standards nach viel klingen mag. Das liegt daran, dass man in den USA auch auf den Autobahnen nur 55 Meilen pro Stunde, also etwa 90 Stundenkilometer fahren darf und dass die Entfernungen einfach riesig sind. Allein die Luftlinie von Palo Alto bis Princeton bemisst sich auf über 4.000 Kilometer. Zum Vergleich: Vom nördlichen Hamburg bis ins südliche München sind es, Luftlinie, gut 600 Kilometer.
Auf unserer Route lernten wir auch endlich den Süden der USA kennen, den wir bislang nicht gesehen hatten, und gewannen einen guten Eindruck vom Leben in einer Hochzivilisation in semiariden, also halbtrockenen Gebieten, das auf der Basis fossiler Wasservorräte und nur aufgrund eines enorm hohen Energieeinsatzes für die Klimageräte möglich ist.