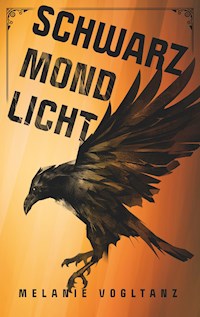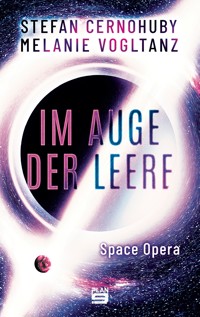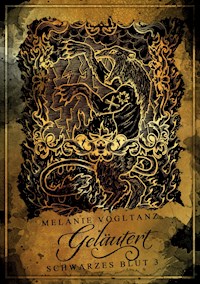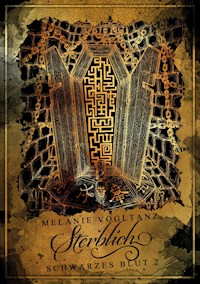1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Zyniker gerät in eine märchenhafte Feenwelt. Ein Serienmörder, der seinen Opfern die Augen raubt, zeigt sein wahres Gesicht. Ein Fastfoodimbiss richtet mit der geheimen Zutat in seinen Burgern verheerenden Schaden an.
In neun phantastischen Geschichten aus den Genres Dark Fantasy, Horror und Science Fiction bekommen Sie es mit entarteten Fabelwesen, miesen Typen, Zombies und Pharmakonzernen zu tun. So unterschiedlich die Geschichten auch sein mögen, haben sie alle einen gemeinsamen Nenner: Sie sind ebenso finster wie das Federkleid eines Raben. Kommen Sie mit, wenn Sie sich trauen – und wagen Sie eine Reise auf dunklen Schwingen.
Enthält:
• Finster war´s im Märchenland
• Hans und Margarethe
• Geliebte des Waldes
• Seelenwandler
• Rabensohn
• Bestienblut
• Du bist, was du isst
• Humane Methoden
• Rattenplage
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Auf dunklen Schwingen
Rabenschwarze Geschichten
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenImpressum
Copyright © 2015 by Melanie Vogltanz
A-1130 Wien, www.melanie-vogltanz.net
1. Auflage 10/2015
Der Inhalt dieses Buches ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung der Autorin wiedergegeben werden.
Lektorat: Jacqueline Mayerhofer
Satz: Melanie Vogltanz
Coverdesign: Juliane Schneeweiss, www.juliane-schneeweiss.de
»Hans und Margarethe«: Erstveröffentlichung in Grimms Märchen. Update 1.1, Machandel Verlag 2012.
»Geliebte des Waldes«: Erstveröffentlichung in Die Einhörner, Verlag Torsten Low 2012.
»Seelenwandler«: Erstveröffentlichung in Liebe zwischen Welten, Verlag Ohneohren 2014.
Gedruckt mit freundlicher Genehmigung der o.g. Verlage.
Illustrationen: rvrspb | Shutterstock (www.shutterstock.com)
Eine Warnung
Hier ist er also nun, nach über zehn Jahren Schreibarbeit und einem halben Dutzend Romanveröffentlichungen: mein erster Kurzgeschichtenband. Ich könnte Ihnen nun eine lange, schmalzige Anekdote über meinen Werdegang als Autorin aufs Auge drücken, Ihnen von durchwachten Nächten, wundgetippten Fingern und freud- und freundlosen Jugendtagen berichten. Aber mal ehrlich: Sowas wollen Sie nicht lesen.
Was Sie wollen, ist Spannung. Vielleicht suchen Sie nach Tragik und Romantik, vielleicht wollen Sie sich gruseln oder gar ekeln. Sie möchten sich wundern, möchten mit lebensechten Figuren mitfiebern und miträtseln, wollen mit ihnen schwitzen und weinen und sogar bluten. All das kann Ihnen dieses Buch bieten. Bevor Sie sich nun aber in die vorliegenden Geschichten stürzen, muss ich Sie fairerweise warnen. Was auch immer Sie erwarten, erwarten Sie eines nicht: ein Happy End. Dieses Buch wird Sie vielleicht wütend machen, deprimiert oder gar verzweifelt. In meinen Geschichten bekommt der Held selten das Mädchen, und eine blütenweiße Weste färbt sich rasch schwarz.
Sie wollen es dennoch wagen? Gut. Dann begleiten Sie mich auf eine Reise, deren Ausgang ebenso ungewiss ist wie der des Lebens selbst: eine Reise auf dunklen Schwingen.
Aber sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt.
(K)ein Märchen
Finster war´s im Märchenland
Theodor Finster, von Verwandten und Schleimern kurz Theos genannt, starrte auf die verschwimmenden Zeilen auf dem Monitor und versuchte zum wiederholten Mal zu begreifen, was er hier tat. Sein Blick glitt zum Fenster, an dem unbewegliche Aluminiumjalousien angebracht waren. Wenn Licht in seine Zelle fiel, warfen sie ein gitterartiges Muster auf den Schreibtisch. Ja, manchmal fühlte er sich wie ein Gefangener. Nicht in dieser Firma – nicht ausschließlich. Selbst jenseits seiner Legebatterie erwartete ihn keine Freiheit. Er war eingeschlossen in einer Welt grauen Asphalts, angefüllt mit Gefangenen wie ihm, die in einer Sträflingskleidung aus Schlips und Anzug von einer Zelle zur nächsten hetzten, angetrieben von unsichtbaren Wärtern, die sich in Uhren, Computern und Handys verbargen.
Theos schnaubte, griff nach dem leeren Pappbecher vor sich und zerdrückte ihn in der Faust. Er hatte mehr verdient als das. Weder Reichtum noch Erfolg waren ihm vergönnt, womit er ja noch leben könnte. Aber wenigstens glücklich wollte er sein.
»Du bist ja so bleich und abwesend heute. Wirst du etwa krank?«
Ohne sich zu dem Kollegen umzudrehen, der für Theos ebenso unbedeutend war wie der Rest des Inventars, gab er zurück: »Brüte wahrscheinlich eine Grippe aus.« Das entsprach unglücklicherweise der Wahrheit. Seit Tagen fühlte er sich matt und kränklich, was seine Stimmung noch weiter drückte.
»Dann bleib lieber zuhause, bevor du uns noch alle ansteckst.«
Als der andere begriff, dass Theos keinen Wert auf Konversation legte, drehte er seinen Stuhl quietschend in die entgegengesetzte Richtung.
Auch am nächsten Morgen hatte sich Theos‘ Stimmung nicht gebessert. Er hatte kaum geschlafen, und der aschfarbene Himmel schien seine Laune widerzuspiegeln. Als er seine Wohnung verließ, zogen die Abgase des morgendlichen Stoßverkehrs in seine Lungen. Übelkeit kratzte in seiner Kehle. Züge von Menschen, stinkend, lärmend, donnerten an ihm vorbei, in hirnloser Hast einem Ziel zustrebend, das sie niemals erreichen würden. Theos‘ Abneigung gegen den Rest der Welt verdichtete sich zu einem brennenden Knoten in seiner Magengegend. Ihm wurde klar, dass er so nicht weitermachen konnte. Aber er sah keine Möglichkeit, auszubrechen.
Theos ließ sich von der Menschenmenge bis zum Bahnhof weiterschleppen. Er wollte sich bereits der Herde von Bürohengsten anschließen, die in den aufgebohrten Leib der Erde hinab galoppierte, als er plötzlich innehielt und den Kopf wandte. Unvermittelt entgleiste seine Miene.
Vor dem Abgang zur Bahn gab eine junge Frau auf ihrer Violine eine flotte Cantate zum Besten. Ihr dunkles Haar flog, während sie sich im Rhythmus der Musik bewegte, und ihre Augen blickten versunken in den Aschehimmel über ihr. Niemand außer Theos schien Notiz von der Geigerin zu nehmen, was ihm unbegreiflich war. Die fröhliche Melodie lockerte den Knoten in seinem Magen ein wenig, und er hatte den Eindruck, als könnte er mit einem Mal wieder freier atmen.
Da wurde er angerempelt, und ein übergewichtiger Mann zog ihm beinahe seine Aktentasche über den Kopf, als er sich keuchend an Theos vorbeischob. Automatisch fiel Theos‘ Blick auf seine Armbanduhr. Zu spät, zu spät!, ätzte der Wächter darin. Geh weiter, weiter. Und er wollte auch gehen. Er wusste, dass er gehen musste.
Dennoch tat er es nicht. Er begriff, dass er keinerlei Grund hatte, sich im Büro einschließen zu lassen, dass dort nichts Bedeutendes oder Nützliches auf ihn wartete. Also blieb er.
Die Geigerin spielte mehrere Stunden lang. Sie entlockte ihrer Violine herrliche Klänge, die Theos‘ graue Welt erleuchteten und ihn zum ersten Mal seit langer Zeit wieder so etwas wie Lebensfreude empfinden ließen. Kein anderer Passant hielt an, um zuzuhören, und so bildeten er und die Musikerin eine Insel in einem aufgewühlten Ozean, der sie tosend umbrauste.
Es war um die Mittagszeit, als die Frau ihr Instrument sinken ließ. Mit der Hand, in der sie noch immer den Bogen hielt, strich sie ihr Haar zurück, und da konnte Theos nicht mehr an sich halten. Ausgelassen applaudierte er, woraufhin die Musikerin überrascht den Blick hob und ihm ein verunsichertes Lächeln zuwarf.
Ihr Äußeres war nicht minder ungewöhnlich als ihr Spiel: Sie war sehr hoch gewachsen, größer als er selbst, und von einer unnatürlichen Blässe, die ihr Ähnlichkeit mit einer Porzellanpuppe verlieh. Ohne Schminke und anderem überflüssigen Tand war sie wohl das, was man als Naturschönheit bezeichnete.
»Das war fantastisch«, sagte er aufrichtig.
»Danke?« Sie schien unsicher, ob sie das Lob annehmen sollte.
»Wo haben Sie so Geige spielen gelernt?« Theos wunderte sich selbst über sein Mitteilungsbedürfnis. Für gewöhnlich verachtete er Menschen, die Fremde in ein Gespräch verwickelten, das erschien ihm erbärmlich und aufdringlich. Aber in diesem Fall konnte er nicht anders.
»Auf der Straße«, gab die Frau zurück.
»Wie, auf der Straße?«, fragte Theos. »Dann hatten Sie keinen Lehrer? Sie haben sich das alles selbst beigebracht?«
»Was für seltsame Fragen«, stellte die Frau fest. »Du bist überhaupt ein seltsamer Mensch. Noch nie zuvor hat jemand angehalten, um zuzuhören. Du bist der Erste.«
Traurigerweise verwunderte dies Theos nicht im Geringsten. »Die meisten Menschen denken, sie hätten Wichtigeres zu tun, als schöner Musik zuzuhören.«
»Es ist nicht nur die Musik. Vielmehr scheint ihr überhaupt nichts wahrzunehmen, was euch nicht auf euren Wegen voranbringt. Lediglich die Kinder sehen sich nach mir um, aber ihre Eltern zerren sie sofort weiter, als würden sie weder ihre Kinder noch die Musik in ihre Herzen lassen.«
Theos zuckte mit den Schultern. »Sie haben’s eben eilig.«
»Wie wollen sie dann ihr Leben genießen? Glück oder Zufriedenheit empfinden?« Sie lächelte wieder, diesmal deutlich offener.
»Gar nicht«, gab er zurück. »Für sowas ist in dieser Welt eben kein Platz.«
»In dieser Welt vielleicht nicht«, lenkte die Musikerin ein. »Aber was, wenn ich dir nun sage, dass es mehr als nur diese eine gibt? Dass ich von einem Ort stamme, an dem Harmonie und Glückseligkeit herrschen und es kein Übel gibt?«
»Ich würde mich vermutlich verabschieden und ein Pfefferspray bereithalten, für den Fall, dass Sie mir folgen.«
»Du glaubst mir also nicht.«
»Kein bisschen.«
»Das ist äußerst schade. Ich dachte, ein Mann, der meiner Musik mit so viel Hingabe lauscht, wäre auch für … mehr empfänglich. Ich scheine mich getäuscht zu haben.«
Theos seufzte. »Sie sind wirklich eine liebenswerte Verrückte, aber ich muss weiter. Wenn ich jetzt losgehe, komme ich vielleicht noch vor Büroschluss in der Firma an und man reißt mir den Arsch nur halbtags auf.«
»Ich könnte es dir zeigen. Dich mitnehmen.«
Theos hob die Augenbrauen.
Sie nickte bekräftigend. »Was hast du schon zu verlieren?«
»Meinen Job?«, schlug er vor.
Sie blinzelte und zeigte eine Reihe blendend weißer Zähne. »Ich habe den Eindruck, das wäre kein Verlust, den du sonderlich bedauern würdest.«
»Ist es … weit?«
Sie schüttelte den Kopf.
Er biss sich auf die Unterlippe. In seinem Leib spürte er ein Ziehen und Zerren, als wollte etwas sein Innerstes nach außen kehren. »Was soll das werden? Eine Art Märchen?«
Die Fremde fasste ihn am Handgelenk und strahlte ihn an. »Ganz recht. Ein Märchen.«
Und zum wiederholten Mal an diesem Tag überraschte Theos sich selbst, indem er sich protestlos von ihr fortführen ließ.
Sie waren kaum eine halbe Stunde gegangen, als sie eine menschenleere Seitengasse erreichten. Hier war das Tosen und Brausen der Großstadt zu einem fernen Gluckern herabgesunken. Am Ende der Gasse, die von verfallenen Häuserfronten eingeschlossen war, stand ein mannshoher Biedermeierspiegel, dessen Goldrahmen fahl und glanzlos geworden war. Das Glas des Spiegels jedoch war überraschend klar, als würde es täglich gewissenhaft und sorgsam poliert.
»Hier müssen wir durch«, erklärte die Geigern und deutete mit dem Bogen auf den Spiegel.
Theos konnte sich nicht entscheiden, ob er lachen oder weinen sollte. »Sehr witzig.«
»Ich scherze nicht. Warum fällt es dir so schwer, einfach in das Märchen einzutauchen?«
»Vielleicht, weil Märchen debiler Schwachsinn sind.«
»Das ist einfach nur falsch.«
»Und das ist nur ein alter, hässlicher Spiegel.«
Die Augen der Geigerin funkelten. »Dass du das denkst, beweist, dass du noch nie zuvor hinter dein Spiegelbild geblickt hast.« Liebevoll strich sie über den Rahmen. »Glaub mir, er enthält mehr, als du auf den ersten Blick wahrnehmen kannst. In seinem Glas ist magischer Sand eingeschmolzen, der hundert Jahre lang von hundert Herrschern aus hundert Königreichen gesammelt wurde. So erzählt man es sich zumindest auf unserer Seite«, ergänzte sie.
»Klingt, als hätte sich das eine Dreijährige ausgedacht.«
»Das spielt keine Rolle. Der Spiegel und seine Magie sind sehr real.« Damit fasste sie in das Glas und griff dabei ebenso widerstandslos hindurch, als handelte es sich um Wasser. Theos gab ein ersticktes Würgen von sich.
Sehr behutsam legte sie Geige und Bogen vor dem Spiegel ab, dann griff sie nach ihm. Er wollte zurückweichen, aber die Frau zog ihn unbeirrbar zu sich – und direkt durch den Spiegel hindurch. Ein wohlig-warmes Gefühl legte sich wie Seide um Theos‘ Körper, dann war es auch schon vorbei und er hinter dem Spiegel angelangt.
Vor ihm breitete sich eine fruchtbare Landschaft aus. Sie waren umgeben von niedrigen Holzhütten, vor denen sich Menschen tummelten, ähnlich groß und blass wie die Geigerin an seiner Seite. Kinder wie Erwachsene tollten über weite Felder, lachten, tanzten und sangen sogar!
»Wie kommen wir hierher?«, fragte er, als er seine Sprache wiedergefunden hatte.
»Durch den Spiegel.«
»Aber das ergibt doch überhaupt keinen Sinn!«
Sie sah ihn an, als hätte er etwas furchtbar Dummes gesagt. »Natürlich nicht. Es ist ein Märchen.«
Er wollte antworten, brachte jedoch keinen Ton heraus. Stattdessen ließ er sich von der lachenden Musikerin voranziehen, die von den Menschen ringsum überschwänglich begrüßt wurde. Auch Theos wurde herzlich empfangen, und niemand fragte nach dem Grund seines Hierseins.
»Hier sind ja alle so freundlich«, stellte er irritiert fest.
»Natürlich.«
»Was ist das hier?«
»Unser Zuhause«, antwortete sie, als würde dies alles erklären.
»Wie kommt es, dass noch nie jemand bemerkt hat, dass es euch gibt?«, hakte Theos weiter nach.
»Ich sagte doch bereits, dass deinesgleichen uns nicht beachtet«, gab sie zurück.
Theos nickte zerstreut. Eine Horde Kinder kam auf ihn zugelaufen und bombardierte ihn mit Fragen. Um sie abzuwimmeln, warf er ihnen seine Armbanduhr zu, woraufhin sie aufgeregt plappernd davonstürmten.
»Und ihr kommt durch diesen Spiegel in unsere Welt?«, versicherte er sich.
»Manchmal«, bestätigte sie und ließ sich am Rande eines Blumenfelds nieder. »Es ist faszinierend, euch zuzusehen. Aber wir versuchen nie, uns euch aufzudrängen oder euch zu stören, schließlich habt ihr bis heute kein besonderes Interesse an uns gezeigt.« Sie grinste Theos schelmisch an. »Ich gebe zu, dass ihr mich neugierig gemacht habt. Als ich eines Tages am Bahnhof einen Geigenkoffer fand, den jemand wohl in Eile zurückgelassen hatte, beschloss ich, das Instrument aufzubewahren.«
»Warum?«, wollte Theos wissen.
»Ich passe darauf auf, bis der Besitzer zurückkommt. Deshalb spiele ich auch jeden Tag an derselben Stelle, in der Hoffnung, dass die Violine ihren Herrn wiederfindet. Sie vermisst ihn sehr, weißt du.«
»Wie rücksichtsvoll von dir.«
Wenn sie seinen Sarkasmus bemerkte, ging sie nicht darauf ein. »Bislang ist er nicht aufgetaucht, aber immerhin habe ich dich getroffen.« Sie strahlte ihn an. »Wie heißt du überhaupt?«
»Theodor.«
»Ich bin Noémi.« Sie umschloss seine Rechte mit beiden Händen, ihr leuchtendes Gesicht war dem seinen dabei unangenehm nahe. »Es ist so schön, neue Freunde kennenzulernen.«
Theos wich ein Stück zurück, um den Sicherheitsabstand wiederherzustellen. »Ja, sicher. Und was seid ihr? So etwas wie Elfen oder Feen?«
Sie runzelte die Stirn. »Ist das wichtig? Wir sind glücklich, das ist alles, was zählt.«
Er ließ es dabei bewenden, beugte sich nach vorn und entwurzelte eine besonders schöne, in voller Blüte stehende Rose. Wenn es sich um einen Traum handelte, dann war der Schmerz der Dornen an seinen Fingern überraschend real.
»Glücklich«, wiederholte er. Über seinem Kopf spannte sich ein azurblauer Himmel, an dem Schwärme von Vögeln ihre Kreise zogen. Irgendwo erklang fremde, heitere Musik. »Eigentlich ist all das zu schön, um wahr zu sein.«
»Du grübelst immer so viel«, stellte Noémi fest. »Zerdenkst alles. Genieß doch einfach, dass du hier bist.«
»Seid ihr niemals traurig? Oder zornig?«
»Niemals.«
»Was ist mit Streit?«
Sie ließ ein leises Lachen hören, das ihre Verwirrung nur zum Teil überspielte. »Aber warum sollten wir denn streiten?«
Theos schüttelte verständnislos den Kopf. »Nicht jeder hier kann ständig glücklich sein. Das wäre ja vollkommen widernatürlich!«
Sie strich sich das Haar zurück, das ihr ins Gesicht gefallen war, und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. »So ist es aber. Wenn du mich dich führen lässt, wirst du es mit eigenen Augen sehen.«
Theos wollte es in der Tat mit eigenen Augen sehen, also begleitete er Noémi durch ihre Welt. Er lernte einige der Dorfbewohner kennen und prüfte ihr Glück auf Herz und Nieren. Die blasshäutigen Menschen ließen seine Fragerei anstandslos über sich ergehen, machten jedoch deutlich, wie wenig sie von dem begriffen, was er ihnen zu sagen versuchte. Nach und nach begann Theos tatsächlich zu glauben, dass Noémi recht hatte. Hier war jeder glücklich. Immer.
»Du kannst hierbleiben, wenn du willst«, sagte Noémi, nachdem sie ihren Rundgang beendet hatten. »Dann könntest du ebenso sorgenfrei leben wie wir.«
»Ich denke darüber nach«, gab Theos stockend zurück. »Aber vorerst möchte ich nachhause, einen klaren Kopf bekommen.«
»Du kannst mir deine Entscheidung mitteilen, wann immer du willst«, sagte Noémi. »Ich stehe jeden Tag am Bahnhof und spiele meine Lieder.«
Er ließ sich zurück zum Spiegel führen und trat hindurch. Als er sich kurz darauf allein in der schäbigen Seitengasse wiederfand, hinter ihm ein Tor in eine andere Wirklichkeit, erschien ihm sein Besuch in Noémis Dorf wie ein drogengetränkter Traum. Gleichzeitig wusste er sehr genau, dass diese Begegnung tatsächlich stattgefunden hatte – er brauchte nur in seine Jackentasche zu fassen und die Dornen der Rose zu spüren.
Zuhause erwarteten ihn mehrere zornige Nachrichten auf seinem Anrufbeantworter, alle dienstlich. Er löschte sie, stellte die Rose in ein Glas mit Wasser und legte sich vollständig bekleidet aufs Bett. In seinem Kopf jagten sich die Gedanken.
Er hatte sich einen Notausgang aus dieser grauen Hölle gewünscht, und nun hatte er ihn gefunden. Noémi hatte recht gehabt – es war ein Märchen, und er spürte, dass es ihn bereits vollständig in sich aufgesogen hatte. Er musste diese absurde Welt wiedersehen. Er musste dieses absurde Mädchen wiedersehen.
Als er am nächsten Morgen erwachte, krachten die Erinnerungen an den gestrigen Tag wie Pistolenkugeln in seine Hirnschale. Sein erster Blick galt der Rose. Fast erwartete er, dass sie sich über Nacht in Wohlgefallen aufgelöst hätte, aber sie war noch immer dort, wo er sie zurückgelassen hatte, auch wenn sie den Ausflug weit schlechter verkraftet zu haben schien als er. Ein Großteil ihrer Blüten war über Nacht abgefallen und ihr Kopf neigte sich trostlos gen Boden.
Nachdem er die abgefallenen Blüten entsorgt hatte, machte er sich auf den Weg zu Noémi, die wie versprochen am Bahnhof spielte. Schon von weitem hörte er, wie verändert ihre Melodien klangen. Waren es gestern noch beschwingte Stücke gewesen, so jammerte ihre Geige nun in schweren, melancholischen Klängen.
Noémi bemerkte Theos, spielte das Lied mit einigen nachlässigen Bogenstrichen zu Ende und ließ die Violine sinken. Ihr Gesicht schien noch bleicher als gestern. An den feucht glänzenden Spuren auf ihren Wangen erkannte er, dass sie geweint hatte.
Hatte sie nicht noch gestern behauptet, alle Menschen ihrer Welt seien immer glücklich?
»Ist etwas geschehen?«, fragte Theos, während er krampfhaft versuchte, nicht hämisch oder triumphierend zu klingen.
»Es ist furchtbar«, wisperte Noémi. »Du musst mit mir kommen und es mit eigenen Augen sehen, andernfalls würdest du es nicht glauben.«
Erneut führte sie ihn zu dem geheimen Portal in der einsamen Seitengasse. Das Glas des Spiegels wirkte fahl und trübe, an manchen Stellen war es vollständig erblindet. Theos runzelte die Stirn. Er hätte schwören können, dass die Spiegeloberfläche am Vortag kristallklar gewesen war.
Ein klammer Wind schlug ihm entgegen, als er auf der anderen Seite hervortrat. Wolkenberge jagten über den Himmel und eisiger Regen stürzte auf sie herab. Theos hatte den Eindruck, als hätte er nicht nur alle Wärme, sondern auch alle Menschen weggewaschen, die gestern noch unter der Sonne frohlockt hatten.
»Über Nacht wurden viele von uns von einem schweren Fieber befallen«, flüsterte Noémi. »Bei manchen scheint sich die Krankheit sogar auf den Verstand niederzuschlagen. Noch nie zuvor habe ich etwas so Schreckliches erlebt. Wir alle sind mit der Situation vollkommen überfordert. Um ehrlich zu sein, ich hatte gehofft, du könntest uns helfen. Im Gegensatz zu uns weißt du, wie man Katastrophen meistert, schließlich treten sie in deiner Welt täglich auf.«
»Ich bin kein Arzt«, setzte Theos abwehrend an. »Aber ich kann mir die Sache ja mal ansehen«, fügte er widerwillig hinzu, als er Noémis verzweifeltem Blick nicht länger standhalten konnte.
Also ließ er sich von ihr erneut durch das Dorf führen, und diesmal war das Bild, das sich ihm bot, ein gänzlich anderes. Die meisten Menschen lagen in Decken vergraben, schwitzend und hustend, viele von ihnen mit sichtlich hohem Fieber. Theos glaubte nicht, dass sie mehr beutelte als eine einfache Grippe, doch eine Grippe konnte in einer Gesellschaft ohne Medikamente bereits ein Todesurteil darstellen. Andere Dörfler wirkten körperlich gesund, waren aber, wie Noémi bereits angedeutet hatte, geistig verwirrt. Zusammengekauert hockten sie in dunklen Ecken. Manche umklammerten dabei ein Bündel oder murmelten unverständliche Worte. Ein Mann hielt Theos‘ Armbanduhr in den Händen, auf die er unablässig starrte. Keuchend zählte er die Sekunden mit.
Als sie ihren Rundgang beendet hatten, schüttelte Theos ratlos den Kopf. »Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll.«
»Du musst es wenigstens versuchen!«, flehte Noémi.
»Ich kann sie nicht gesund machen. Ich kann nur versuchen, deine Trauer zu mildern.«
»Dann tu es«, hauchte sie.
Er schloss sie in seine Arme. Sie ließ es willenlos geschehen, und als er ihr das Haar zurückstrich, hinderte sie ihn nicht daran. Wieder wurde ihm überdeutlich bewusst, dass sie eine Frau von geradezu unheimlicher Schönheit war, und er konnte nicht anders, als sich zu ihr hingezogen zu fühlen. Sorgfältig trocknete er ihr blasses Gesicht und drückte seine Lippen auf ihre.
»Was tust du?«, fragte sie erstickt.
»Ich zeige dir, wie man in meiner Welt mit ausweglosen Situationen umgeht.«
Als er sie zu Boden drückte und den Saum ihres Kleides über ihre Knie schob, wehrte sie sich nicht, ebenso wenig bei allem, was folgte.
Als es vorbei war, musterte er die verstörte Frau neben sich unbehaglich, die nichts zu wissen schien, was Frauen in seiner Welt wussten. Er spürte, dass er einen unangenehmen Fehler begangen hatte.
»Fühlst du dich nun besser?«, fragte er wider besseres Wissen.
Noémi sagte nichts. Nach einigen Minuten in drückendem Schweigen erhob Theos sich.
»Wo gehst du hin?«
»Nachhause. Diese Welt hält nichts, was sie verspricht.«
»Wirst du wiederkommen?«
»Ich weiß nicht«, log er.
In Wahrheit hatte er seinen Entschluss längst gefasst. Das Paradies existierte nicht, wie er nun bitter erkannte. Niemals wieder würde er an diesen unsäglichen Ort zurückkehren, der ihm das klargemacht hatte.
In seiner Wohnung angekommen, konnte er den Blick auf die Rose im Glas nicht unterdrücken. Sie war mittlerweile vollends verdorrt, all ihre Blüten abgefallen. Theos warf sie achtlos in den Müll und redete sich selbst ein, dass nun alles wieder sein würde wie zuvor. Er machte einen Telefonanruf, in dem er sich für sein Fernbleiben entschuldigte, kam mit einer Abmahnung davon und stellte sich auf eine Rückkehr in sein fades, trostloses Leben ein.
Am dritten Morgen seines außernatürlichen Erlebnisses befand er sich erneut auf dem Weg zur Arbeit, resigniert, aber gefasst. Er rechnete damit, am Bahnhof wieder auf die Musikerin zu treffen, hatte sich aber vorgenommen, es den anderen gleichzutun und sie keines Blickes zu würdigen. Irgendwann, so hoffte er, würde er dann vielleicht tatsächlich aufhören, sie wahrzunehmen.
Als er jedoch an die Stelle kam, an der Noémi zu spielen pflegte, packte ihn Grauen. Er erstarrte mitten im Schritt, die Augen ungläubig geweitet. Sein Vorsatz, sie links liegenzulassen, zerbröckelte wie feuchter Sand. Die einst beschwingte Musikerin war nicht wiederzuerkennen. Ihr Haar hing ihr in fettigen Strähnen ins Gesicht, sie war abgemagert bis auf die Knochen. Ihr Geigenspiel war kaum mehr als solches zu erkennen – quietschend und kratzend schrammte der Bogen über die Saiten, konnte ihnen keinen einzigen geraden Ton entlocken. Am meisten schockierte Theos jedoch der Anblick ihrer Finger. Die Saiten des Instruments schnitten tief ins Fleisch, und helles Blut lief an ihren Händen herab und besudelte den Hals der Violine – als hätte jemand dem Instrument die Kehle durchtrennt.
Als er auf sie zustolperte, bemerkte sie ihn nicht. Ihre Augen starrten blind ins Nichts, kein Funken Leben war mehr darin. Hätten ihre Hände sich nicht noch immer unermüdlich mit dem Instrument abgequält, Theos hätte sie glatt für eine Tote gehalten.
Zu grob packte er sie an den Armen und schüttelte sie, brüllte ihren Namen. Noémi öffnete den Mund zu einem lautlosen Schrei, ihre Augen rollten in den Höhlen wie Glasmurmeln. Die Violine entglitt ihr und fiel zu Boden. Mit dem Krachen von splitternden Knochen zerbarst sie auf dem Asphalt. Wie in Trance starrte Theos auf die Trümmer, die mit Noémis Blut befleckt waren. Ein Schrei drängte seine Kehle empor, als er ein kleines, zusammengekrümmtes Wesen zu erkennen glaubte, das zwischen Splittern und Saiten zum Vorschein kam; ein Wesen, das Theos an einen sich windenden Embryo erinnerte.
Bereits im nächsten Moment erkannte er, dass er sich getäuscht hatte, dass es nichts gewesen war als Blut und Holz. In ihm tobten Schwindel und Übelkeit, er spürte überdeutlich, wie sein Verstand an den Kanten des Wahnsinns entlang schrammte.
»Noémi, was ist passiert?«, brachte er hervor.
Nur sehr langsam nahm sie Notiz von ihm, und noch langsamer schien der Sinn seiner Frage in ihren Verstand zu sickern. »Zerstört«, hauchte sie. »Alles zerstört.«
»Wovon sprichst du? Noémi!« Er schüttelte sie heftiger, aber kein weiterer Ton war ihr abzuringen. Kurzentschlossen packte Theos sie und zog sie hinter sich her, suchte selbst den Weg in die Seitengasse, den sie die Tage zuvor gemeinsam gegangen waren.
Als er schließlich vor dem Spiegel stand, begann er zu begreifen. Ein Spinnennetz aus Rissen hatte sich über die Oberfläche ausgebreitet, große Stücke Glas waren herausgebrochen und lagen in Scherben auf dem Asphalt. Theos streckte die Hand aus und berührte den Spiegel. Anstatt hindurchzugleiten, schnitt er sich an einer scharfen Kante. Wie in Trance presste er die blutende Hand an die Brust.
»Heute Morgen konnte ich hinaus, aber nicht mehr hinein«, erklang plötzlich Noémis tonlose Stimme neben ihm. »Ich spüre, dass jenseits dieses Tores nichts mehr lebt.« Verständnislos starrte sie auf den Bogen, den sie noch immer in der Hand hielt und der nun keinen Sinn mehr zu machen schien. »Ich hätte mich nicht in die Geschicke der Menschen einmischen dürfen. Es war so ein wunderschönes Märchen, und ich habe es zerstört.«
»Nein, Noémi, das hast du nicht«, widersprach er hilflos.
Ihr Blick hob sich, fixierte Theodor Finster zum ersten Mal an diesem Tag wirklich. »Du hast recht. Das warst du.«
Damit brach sie zusammen und zerbarst zu seinen Füßen wie die Violine, die ihr Verhängnis geworden war.
Hans und Margarethe
»Gib schon zu, Hans – wir haben uns verirrt.«
Der Angesprochene warf seiner Beifahrerin einen scheelen Blick zu und umklammerte das Lenkrad fester. Der Bildschirm des Navigationsgerätes blinkte ihnen nun schon seit geraumer Weile in hämischem Weiß entgegen. Wenn eine Maschine Schadenfreude empfinden konnte, dann, daran hatte Margarethe keinen Zweifel, musste es so aussehen.
»Wir haben uns nicht verirrt. Ich weiß genau, wo wir sind«, grummelte Hans und deutete mit dem Finger auf die Landkarte. »Siehst du, da sind wir: der große Pfeil im weißen Niemandsland.«
Margarethe seufzte. Ihr war der Sinn nach Scherzen schon vor dreißig Kilometern vergangen. Dass der Satellit die abgelegene Landstraße, auf der sie nun schon seit knapp einer Stunde dahintuckerten, nicht orten konnte, war eine Sache – was sie aber wirklich mächtig wurmte, war die Tatsache, dass Hans nicht einfach seinen Fehler einsehen und umkehren konnte.
Männer …
Dann geschah das, worauf sie insgeheim schon die ganze Zeit gewartet hatte: Der Motor begann zu stottern, spuckte und hustete ein paar Mal gequält und verstummte dann. Überraschend sanft verlor der Wagen an Tempo und kam schließlich zu einem Halt.
»Sag jetzt nichts«, mahnte Hans durch zusammengepresste Zähne.
»Fällt mir doch im Traum nicht ein«, murmelte Margarethe.
Sie blieb im Wagen sitzen, während Hans ausstieg und nach dem Grund für ihren unfreiwilligen Zwischenstopp suchte. Nachdem er sich ins Innere der Motorhaube gewühlt hatte, kam er achselzuckend und ölverschmiert an ihr Beifahrerfenster. Mit hochgezogenen Augenbrauen ließ sie die Scheibe hinunter.
»Das muss ein grober Fehler sein«, meinte er.
Margarethe verdrehte die Augen. Sollte sie ihm den Schleier gleich von den Augen reißen oder ihn lieber noch ein wenig im Dreck herumwühlen lassen? Sie entschied sich für die schnellere Methode und tippte auf die Tankanzeige.
»Ja, ein grober Fehler, Herr Mechaniker. Das Benzin ist alle. Hättest du noch rechtzeitig getankt, bevor wir losgefahren sind, wie ich es dir gesagt habe …«
»Diese Wucherer bekommen keinen Cent von mir«, unterbrach Hans sie mit schneidender Stimme.
»Und wo gedenkst du nun in dieser Einöde billigen Treibstoff aufzutreiben, du Genie?«
Für einen Moment schien Hans angestrengt nachzudenken. Margarethe konnte geradezu sehen, wie es hinter seiner Stirn arbeitete. Dann deutete er schließlich in den finsteren Wald, der die Landstraße auf beiden Seiten säumte.
»Hier gibt es bestimmt irgendwo einen Förster. Der wird uns weiterhelfen.«
Margarethe verschränkte die Arme vor der Brust. »Das kannst du vergessen. Ich werde keinen Fuß in diesen Wald setzen. Nur über meine Leiche!«
»Ich fasse es nicht, dass ich mich von dir habe breitschlagen lassen! Wenn ich in dieser Einöde verrecke, dann bist du schuld, hörst du?«
Hans beachtete sie gar nicht. Mit grimmigem Gesichtsausdruck stapfte er durch das Unterholz, so rasch, dass Margarethe laufen musste, um mit ihm Schritt zu halten. Dabei stolperte sie mehr als einmal über eine Wurzel. Das Gestrüpp um sie herum riss ihre Kleidung und ihre Haut auf, und der schwere Geruch von nassen Tannennadeln und Erde raubte ihr den Atem. Wäre sie nicht so aus der Puste gewesen, hätte sie laut geschrien.
Ihr Zorn verrauchte beinahe augenblicklich, als sie einen Blick über die Schulter zurückwarf. Das dichte Unterholz hatte sich hinter ihnen gleich einem eisernen Vorhang geschlossen, und von der Straße war keine Spur mehr zu sehen. Angst wallte in Margarethe hoch, und sie holte rasch zu Hans auf, um ihn an der Schulter zu fassen.
»Warte, Hans, bitte. Wenn wir so tief in den Wald gehen, finden wir doch niemals wieder heraus! Hans!«
Plötzlich blieb Hans so ruckartig stehen, dass Margarethe unsanft gegen ihn prallte. »Sieh mal, da vorn ist Rauch. Hier lebt also doch jemand!« Triumphierend grinste er Margarethe an. »Und du hattest Zweifel …«
Margarethe enthielt sich jeden Kommentars. Misstrauisch betrachtete sie den Rauchfaden, der sich in einigen hundert Metern Entfernung in die Höhe kräuselte. Hans lief los. Margarethe folgte ihm langsamer und in einigem Abstand.
Bald schon blinzelte ihnen eine kleine, heimelig wirkende Holzhütte aus dem Dickicht entgegen. Das Grundstück ringsum war nicht eingezäunt, was bewies, wie einsam diese Gegend tatsächlich sein musste. Sie hatten ungeheures Glück gehabt, dass Hans zufällig den Rauch entdeckt hatte, andernfalls hätten sie wohl tagelang durch den Forst irren können, ohne auch nur auf eine Menschenseele zu treffen. Bei diesem Gedanken schauderte Margarethe.
Die Hütte machte einen gemütlichen Eindruck, wirkte jedoch nichts so, als wäre sie von einem Wildhüter bewohnt. Hinter den sorgsam geputzten Fensterscheiben entdeckte Margarethe rosa Vorhänge mit verspieltem Blümchenmuster. Der Garten, der von den wild wuchernden Fichten und Tannen des Waldes gesäubert worden war, wirkte gepflegt und war gespickt mit bunten Wildblumenrabatten. Die hell lackierte Eingangstür stand einen Spalt breit offen – durch den in diesem Moment eine feuerrote Katze den Kopf ins Freie streckte.