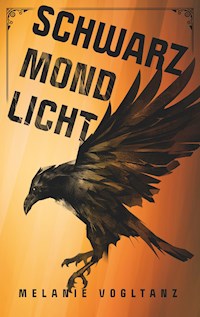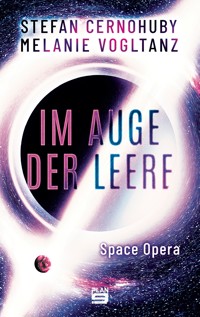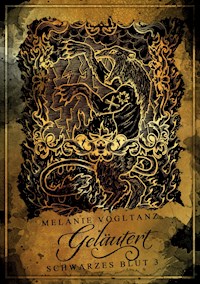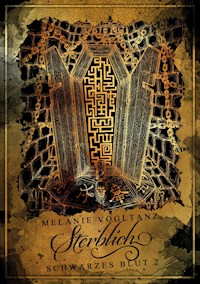2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Schwarzes Blut
- Sprache: Deutsch
Wien im Jahr 1365: Der Schwertkampf ist Elyssas geheime Leidenschaft. Als bluttrinkende Kreaturen, sogenannte Strigois, die Stadt infiltrieren und eine Spur von Gewalt, Blut und Tod hinter sich herziehen, werden Elyssas Fähigkeiten mit einem Mal überlebensnotwendig. Sie kämpft - und verliert. Doch in einer Stadt, in der Leichen ihre Gräber verlassen, bleibt nicht alles tot, was stirbt. Elyssa kehrt zurück. Stärker. Entschlossener. Und so viel hungriger. Vollständig überarbeitete Neuauflage von "Schwarzes Blut: Maleficus"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über die Autorin
Melanie Vogltanz hat Deutsche Philologie, Anglistik und LehrerInnenbildung an der Universität Wien studiert. Sie wurde 1992 in Wien geboren und hat den berühmt-berüchtigten Wiener Galgenhumor praktisch mit der Muttermilch aufgesogen. Dem klassischen Happy End sagt sie im Großteil ihrer Geschichten den Kampf an, denn auch das Leben endet selten gut.
2007 veröffentlichte sie ihr Romandebüt; weitere Veröffentlichungen im Bereich der Dunklen Phantastik folgten. 2020 wurde ihr Roman »Schwarzmondlicht« für den Phantastik-Preis »Seraph« in der Kategorie »Bester Independent-Titel« nominiert.
Wenn sie nicht gerade eigene Geschichten zusammenspinnt, arbeitet sie als Lehrerin, korrigiert, lektoriert und übersetzt für Verlage und Kollegen oder hält ihre Frettchenmusen bei Laune.
Mehr Informationen auf: www.melanie-vogltanz.net
Inhaltsverzeichnis
Wann sterben Geschichten?
Erstes Buch: Todeskampf
I.Kapitel
II.Kapitel
III.Kapitel
IV.Kapitel
V.Kapitel
VI.Kapitel
VII.Kapitel
VIII.Kapitel
IX.Kapitel
Zweites Buch: Wiedergeboren
I.Kapitel
II.Kapitel
III.Kapitel
IV.Kapitel
V.Kapitel
VI.Kapitel
VII.Kapitel
VIII.Kapitel
IX.Kapitel
X.Kapitel
XI.Kapitel
XII.Kapitel
XIII.Kapitel
XIV.Kapitel
XV.Kapitel
XVI.Kapitel
XVII.Kapitel
XVIII.Kapitel
XIX.Kapitel
Drittes Buch: Abgesang
I.Kapitel
II.Kapitel
III.Kapitel
IV.Kapitel
Wann sterben Geschichten?
Ein Vorwort
Die »Schwarzes Blut«-Reihe ist ein Mammut-Projekt, das mich schon seit Beginn meiner Schreibkarriere begleitet. Der erste Band, damals noch unter dem Titel »Maleficus«, entstand bereits im Jahr 2007. 2014 wurde es erstveröffentlicht, und seither ist die Welt erheblich gewachsen. Obwohl Elyssas Geschichte mittlerweile zu Ende erzählt ist, lassen manche Charaktere und Welten einen nie wirklich los, und gerade das Universum von »Schwarzes Blut«, das bevölkert von niemalssterbenden Wesenheiten ist, die voller Hunger nach mehr ihrem Ende trotzen, bietet nach all den Jahren immer noch neue Anreize, neue Winkel, die es zu erforschen gilt. Für mich persönlich liegt der besondere Reiz dabei im Balanceakt zwischen historischer Realität und Fiktion, und über die Jahre hat sich eine Art westliche Alternativgeschichte herausgebildet, die im Spätmittelalter ihren Anfang nimmt und sich bis in die Moderne zieht.
Wann sterben Geschichten? Wenn sie nicht mehr erzählt werden wollen, wenn sie sich leergelaufen haben, aus der Welt gealtert sind. »Schwarzes Blut« ist keine solche Geschichte. Wie die Strigoi und Hemykinen, die sie bevölkern, ist sie immer noch hungrig nach mehr.
Mit diesem Buch, das für die vorliegende Ausgabe vollständig überarbeitet wurde (gewissermaßen »auferstanden« ist), hat alles seinen Anfang genommen: eine junge Frau und ihr Schwert im spätmittelalterlichen Wien.
Erstes Buch:
Todeskampf
I.
Wien im Jahre 1365
Stoß – Parade. Für andere Gedanken war in ihrem Kopf kein Platz. Nur der Tanz der Klingen, und ihr Schwert, das als Verlängerung ihres Körpers fungierte. Stoß – Ausfallschritt – Parade.
Der Hieb ihres Gegners kam ihrem Gesicht so nahe, dass sie den Luftzug des Stahls an ihrer Wange spürte. Sie parierte den Schlag mit einem wuchtigen Gegenhieb, der dem anderen beinahe die Waffe aus der Hand prellte, und setzte nach. Die Klinge züngelte nach seiner Brust. Es gelang ihm gerade noch, sich mit einem hastigen Rückwärtsstolpern in Sicherheit zu bringen.
Dabei war er gezwungen, seine Deckung aufzugeben. Sofort registrierte sie die Chance. Sie fuhr vor und schlug zu. Funken sprühten, als ihr Gegner verzweifelt seine Klinge nach oben riss, doch er war zu erschöpft von dem langen, erbitterten Kampf, um die Parade aufrechtzuerhalten. Mit einem schmerzerfüllten Aufschrei ließ er die Waffe fallen und sprang zurück.
Er war ihr schutzlos ausgeliefert.
Entschlossen hob sie das Schwert zum allerletzten, entscheidenden Schlag …
»Elyssa! Elyssa, um Himmels willen, hör auf!«
Das Entsetzen in der vertrauten Stimme riss sie aus ihrer Konzentration. Ihre fließenden Bewegungen stockten, sie strauchelte. Im buchstäblich letzten Moment gelang es ihr, das Schwert herumzureißen, sodass der Hieb, der ihren Gegner glatt enthauptet hätte, seine Schulter verfehlte und sich tief in den Stamm einer Esche bohrte, die das Pech gehabt hatte, an der falschen Stelle zu wachsen.
Elyssa ließ den zitternden Griff des Schwertes los. Irritiert fasste sie sich an die schweißnasse Stirn und zwang ihren nach Bewegung lechzenden Körper zum Verharren.
»Elyssa, hast du den Verstand verloren? Es hätte nicht mehr viel gefehlt und du hättest mich um einen Kopf kürzer gemacht! Was um alles in der Welt sollte das?!« Das Gesicht ihres Cousins war kalkweiß. Auch er war in Schweiß gebadet, sein Atem ging stoßweise.
Es war nicht das erste Mal, dass Elyssa gemeinsam mit Philipp einige Übungen absolviert hatte, so verausgabt wie in diesem Duell hatten sie sich allerdings noch nie. Für einen Augenblick hatte sie alles um sich herum vergessen, ihr Verstand hatte sich in einen Winkel tief in ihrem Bewusstsein zurückgezogen und der reinen, ungezähmten Kraft ihres Körpers Platz gemacht. Wie ein Berserker hatte sie auf den um einen Kopf größeren Mann eingedroschen und ihn immer weiter in die Defensive gedrängt. Ohne dass Elyssa es bemerkt hatte, war aus dem Spiel bitterer Ernst geworden.
»Ver… verzeih«, stammelte sie. »Ich weiß auch nicht, was plötzlich in mich gefahren ist.«
»Offenbar der Teufel, wie so oft«, scherzte Philipp schal, doch durch seine unbekümmerte Maske schimmerte noch immer ein Hauch von Schrecken. Er bückte sich nach seiner Waffe, die zwischen ihnen im hohen Gras lag. Es handelte sich um eine Bauernwehr: eine armlange, schwertähnliche Fechtwaffe, die man auch als Bürgerlicher führen durfte; kürzer, leichter und erheblich schmuckloser als Elyssas Schwert.
»Habe ich dich verletzt?«
»Nur meinen Stolz«, gab Philipp zurück und schlug seine Waffe mit einem resignierten Schulterzucken in den stabilen Hanfsack ein, in dem er sie transportierte. »Obwohl es keine Schande ist, gegen dich zu verlieren. Du bist gut, Cousine.«
»Es gehört nicht viel Können dazu, einen Kaufmann im Duell zu schlagen. Es sei denn, bei der Waffe handelt es sich um einen Abakus.«
»Sehr witzig.« Philipp und zog an ihrer speckigen Schürze, die bereits ihre Mutter getragen hatte, wenn sie tagein, tagaus in der alten Kaschemme Bier und Wein ausgeschenkt hatte. »Dass die Zunft der Gastleute seit vielen Jahrhunderten begnadete Fechtkünstler hervorbringt, muss mir bisher wohl entgangen sein. Nicht zu vergessen das kriegerische Geschlecht der Frauen, das schon seit Menschengedenken uns arme, schwache Männer durch seine Unbarmherzigkeit und Stärke unterdrückt.« Feixend fasste er nach dem Saum ihres Kleides.
Elyssa schlug seine Hand beiseite. »Lass das!«, zischte sie.
»Was meinst du?« Er hielt sein Grinsen wacker aufrecht.
»Das weißt du genau. Es ist schon schlimm genug, dass wir uns heimlich hier treffen. Du weißt, dass sich das für eine Frau nicht ziemt.«
»Ich bin keine Frau«, protestierte Philipp.
Elyssa ignorierte den halbherzigen Versuch, die Stimmung zu retten. »Wenn man dich dann auch noch hier so sieht, wie du an meinen Kleidern spielst, kommen schnell Gerüchte auf, und im Handumdrehen kennt mich ganz Wien als deine Mätresse.«
Philipp schnaubte verächtlich. Das Witzereißen war ihm sichtlich vergangen. »Na und? Sollen sie doch reden!« Sein Tonfall wurde etwas sanfter. »Du bist wie eine Schwester für mich, Elyssa. Wer auch immer in unserer Beziehung etwas Verwerfliches oder Lasterhaftes sieht, ist ein Narr.« Er wollte ihr eine wirre Haarsträhne aus dem Gesicht streichen.
Elyssa fing seine Hand ab und reichte sie ihm zurück wie ein abgelehntes Geschenk. Um seine Mundwinkel zuckte es verletzt, aber er versuchte nicht noch einmal, sie zu berühren.
»Denk nicht an die anderen«, erwiderte sie. »Denk an mich. Denk an Großvater. Willst du seinen Ruf zerstören? Das wäre ein schlechter Dank, nach allem, was er für uns getan hat, findest du nicht?«
Philipp wirkte nun eindeutig verstimmt. »Mach dich nicht lächerlich. Wir kommen seit fast zehn Jahren hierher, und bislang hat uns nie jemand entdeckt. Warum sollte sich das jetzt ändern?«
»Weil Dinge sich nun mal ändern«, erwiderte Elyssa, und sie konnte nicht verhindern, dass sich ein bitterer Unterton in ihre Stimme mischte. »Ebenso wie wir. Wir sind keine Kinder mehr, Philipp. Als wir jung waren, waren die geheimen Duelle ein Jux, aber mittlerweile sind wir da rausgewachsen. Heute steht weit mehr auf dem Spiel.«
»Was soll das werden, Elyssa?« Philipps Finger tanzten um den Griff seiner Bauernwehr. »Willst du mich wegwerfen wie ein Spielzeug, dessen du überdrüssig geworden bist? Bin ich dir langweilig geworden? Oder zu schwach? Ich bin keine Herausforderung mehr für dich, nicht wahr? Dass du mich überflügelt hast, das hat sich schon vor langer Zeit abgezeichnet, aber das spielt doch keine Rolle. Ich schätze unsere gemeinsame Zeit hier, selbst wenn du mich dabei nur quer über die Lichtung prügelst.« Er senkte die Stimme: »Du etwa nicht?«
»Du kannst das nicht verstehen!« Gegen ihren Willen erhob sie ihre Stimme. »Du hast mit fünfzehn diese Kaufmannstochter geheiratet, nachdem du bei ihrem Vater deine Bilderbuch-Lehre abgeschlossen hattest! Wenn du nach Hause kommst, dann wartet dein braves Frauchen mit Eintopf auf dich, und deine Kinder himmeln dich an, als wärst du Siegfried persönlich. Zu Recht, schließlich kannst du ihre kleinen Bäuche füllen. Dein Leben ist einfach perfekt!«
Er lachte erstaunt auf. »Das glaubst du? Du denkst, mein Leben sei perfekt?«
»Aber natürlich! Und während du dich hier mit deiner kleinen Cousine amüsierst, riskiere ich das letzte bisschen Respekt, das man mir noch entgegenbringt. Denkst du etwa, ich tue das hier zu meiner Zerstreuung?« Sie deutete vielsagend auf das Schwert, das sie mit voller Wucht in den Baumstamm gerammt hatte. »Im Gegensatz zu dir nehme ich das Fechten ernst. Ich möchte lernen, ich möchte gut werden, begreifst du das? Die Zeit mit dem Schwert in der Hand ist die einzige Zeit in meinem Leben, in der ich mich nicht falsch und … und deplatziert und ungenügend fühle! Aber das kannst du natürlich nicht verstehen.«
Philipp hob die Hände, als wollte er einen Fausthieb abwehren. Seine Mimik war von Zornesfalten zerfurcht. »Was ich heraushöre«, sagte er, »ist blanker Neid. Es ist nicht meine Schuld, dass du noch immer unverheiratet bist. Du sagst, ich soll an Großvater denken. Aber wenn jemand Großvater Schande bereitet hat, dann ja wohl du. Und ich glaube, das weißt du auch sehr gut.«
Mehrere Herzschläge war Elyssa sprachlos. »Wie … wie kannst du es wagen, Philipp.«
»Aber es stimmt. Für dich war doch nie einer gut genug! Ich habe Großvater schon oft gesagt, dass man dich Sturkopf zu deinem Glück zwingen muss, aber er hat immer nur gelächelt und das Thema gewechselt.«
Elyssas Augen wurden schmal. »Zu meinem Glück zwingen?«
»Hättest du es einmal versucht, dann wüsstest du, dass die Ehe nichts ist, das man scheuen muss. Sie ist angenehm, Cousine.«
»Das kannst du leicht sagen, als Mann«, erwiderte sie schneidend. »Du hast dir dein Weib ausgesucht wie eine Kuh auf dem Viehmarkt. Stämmige Hüften, von Rasse und von Wert, erstanden zu einem angemessenen Preis. Was sie von dir hält, kann dir eigentlich egal sein, denn unterordnen muss sie sich dir ohnehin.«
»Magda liebt mich!«
»Sie ist an dich gewöhnt. Das ist etwas anderes.«
Philipp schnitt ihr mit einer abgehackten Geste das Wort ab. »Ich muss mir das nicht anhören! Du bist verbittert und neidisch. Mit dir kann man nicht vernünftig diskutieren.« Er riss seinen Sack vom Boden hoch.
»Wohin gehst du?«
Philipp wurde nicht langsamer, als er über die Schulter zurückrief: »Fort von dir. Ich brauche mir deine Beleidigungen nicht länger anzuhören.«
»Schön, aber wenn du jetzt gehst, brauchst du nicht mehr zurückzukommen!«, schrie sie ihm nach.
Mit brodelndem Zorn im Magen und zusammengekniffenen Lippen starrte Elyssa ihrem Cousin nach, der bald zwischen den Bäumen des umliegenden Waldes verschwunden war. Als sie ihn nicht mehr sehen konnte, wirbelte sie mit einem Aufschrei herum und riss ihr Schwert aus dem Baumstamm. Sie ließ sich auf den von Moos bewachsenen Boden der Lichtung fallen und stieß die Spitze ihrer Klinge in die weiche Erde.
Möglicherweise hatte Philipp recht, und sie war tatsächlich neidisch. Es fiel ihr einfach schwer, zu verstehen, wie zwei Menschen, die eine so ähnliche Ausgangssituation gehabt hatten, zwei so unterschiedliche Wege einschlagen konnten.
Elyssa und Philipp waren beide ohne Eltern aufgewachsen. Als zuerst ihr Vater und dann ihre Mutter der großen Pestwelle zum Opfer fielen, war Elyssa kaum drei Jahre alt. Die Erinnerung an die beiden war verwischt, beinahe vollständig aus ihrem Gedächtnis geschabt vom Radiermesser der Zeit. Sie glaubte, dass da auch Geschwister gewesen waren, vielleicht ein großer Bruder und ein Säugling, der oft des Nachts schrie, aber in ihrem Kopf fand sie keine Namen. Auch sie musste die Seuche geholt haben.
Sie wusste nicht einmal, wo man ihre Familie verscharrt hatte, denn Gräber waren während der großen Epidemie ein Luxus gewesen, den sich nur wohlhabende Familien hatten leisten können. Das einzige klare Bild, das aus Elyssas Unterbewusstsein aufstieg, wann immer sie versuchte, sich an ihre Eltern zu erinnern, war ein von dunkel verfärbten Pestbeulen entstelltes, androgynes Gesicht mit halb geschlossenen Lidern und schlaffem Mund, das ihr als Mädchen oft Albträume bereitet hatte. Ob es zu ihrem Vater, ihrer Mutter oder einem Fremden gehörte, konnte sie nicht sagen.
Mehr als das war ihr von ihrer Kindheit nicht geblieben: das Gesicht des Schwarzen Todes.
Auch Philipps Vergangenheit war von Schicksalsschlägen zerrüttet. Sein Vater, Elyssas Onkel, wurde bei der Suche nach Pilzen von einem Eber angefallen und schwer verletzt. Er überlebte das Wundfieber nicht. Nach dem Tod ihres Ehemanns weigerte Philipps Mutter sich, ein weiteres Mal zu heiraten, trotz des Spotts, den das Volk einer Witwe entgegenbringt, die keinen neuen Mann akzeptiert. Nur wenige Monate darauf wurde sie von einem Betrunkenen auf offener Straße belästigt, der lallend um ihre Aufmerksamkeit und ihre weiblichen Attribute buhlte. Als die Witwe versuchte, sich ihm zu entziehen, wurde er gewalttätig.
Niemand kam Philipps Mutter zu Hilfe. Sie wurde erst erlöst, als der Zecher sie in seiner Wut versehentlich erwürgte.
Ihr Großvater Theodor hatte beide Kinder bei sich aufgenommen, ihnen Obdach gewährt und sie vor dem Leben auf der Straße bewahrt. Philipp lohnte dem alten Mann seine Fürsorge und Liebe, indem er jegliche Erwartungen erfüllte, die man an einen Sohn haben konnte. Im Gegensatz zu Elyssa hatte er keinerlei Schwierigkeiten, sich in die sinnlose Etikette der Gesellschaft zu fügen. Er katzbuckelte gerne vor denen, die mehr wert waren als das schmuddelige Waisenkind, und seine besonnene, respektvolle Art öffnete ihm viele Türen, die seine Abstammung verschlossen gehalten hätte. Ein alter Kaufmann, den der Herr noch mit keinem Sohn gesegnet hatte, nahm Philipp sogar in die Lehre und setzte ihn als seinen Nachfolger ein. Dies war weit mehr, als ein Kind von Philipps Stand sich erträumen konnte.
Elyssa war da ganz anders. Bereits als Mädchen zeigte sie wenig Interesse daran, eine der zahlreichen Handwerkskünste zu erlernen, die Töchter für gewöhnlich von ihren Müttern mitgegeben bekamen. Stattdessen stahl sie mit sechs einem Ritter, der bei ihnen in der Taverne eingekehrt war, das Schwert, das er achtlos neben sich gelegt hatte, während er auf einem der Tische seinen Branntweinrausch ausschlief. Ihr war gewesen, als hätte es sie zu sich gerufen. Als sein Besitzer am nächsten Morgen erwachte, ging er davon aus, er hätte seine Waffe während seines Gelages verloren. Damals hatte sie noch nicht gewusst, dass der Besitz eines Schwertes ihren Tod bedeuten konnte, wenn man es bei ihr fand, und als sie es erfuhr, bedeutete die Klinge ihr bereits zu viel, als dass sie sich noch um die Konsequenzen geschert hätte.
Zuerst war das Schwert ihr fast zu schwer gewesen, um es anzuheben. Elyssa hütete es sorgsam, kämpfte mit Stöcken gegen Dornenbüsche und Apfelbäume und harrte dem Tag, an dem sie stark genug dafür sein würde. Nachdem Philipp hinter ihr Geheimnis gekommen war, übten sie zu zweit. Ein Garnisonssoldat, der oft bei seinem Lehrmeister einkehrte, verriet dem wissenshungrigen Jüngling nach dem zweiten Bierkrug bereitwillig den einen oder anderen Kniff für den Kampf, nachdem dieser behauptet hatte, sich für einen Eintritt ins Heer zu interessieren. Philipp leitete seine Instruktionen eifrig an Elyssa weiter. Es war ein aufregendes, verbotenes Spiel – zu Anfang.
Ihr Großvater Theodor wusste von diesen Beschäftigungen seiner Enkelin selbstverständlich nichts, und das war auch besser so. Elyssa hätte den alten Mann gerne stolz gemacht, und sie tat ihr Bestes, um ihm im Familiengeschäft zur Hand zu gehen. Doch sich einem der widerwärtigen, stinkenden Stelzböcke hinzugeben, die einen Großteil des männlichen Geschlechts bildeten, brachte sie schlicht nicht über sich.
Das konnte Philipp natürlich nicht begreifen. Für ihn war es selbstverständlich, immer die Erwartungen zu erfüllen, die man von außen an ihn herantrug. Elyssa dagegen war eine Kämpferin. Wenn sie eines Tages das lohnende Ufer erreichen würde, dann nicht deshalb, weil sie sich mit dem Strom hatte treiben lassen, sondern weil sie gegen die Strömung angeschwommen war.
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf hob sie den mit frisch gewaschenen Laken gefüllten Weidenkorb auf, den sie als Tarnung für ihre Waffe benutzte. Nach einem letzten Blick auf die tiefe Kerbe, die sie in den Stamm der Esche geschlagen hatte, verließ sie die Lichtung und tauchte in das grün schillernde Meer ein, in das die durch die Baumkronen fallenden Sonnenstrahlen den Wald verwandelten.
In der Taverne erwartete Theodor sie bereits. Sein schütteres, schneeweißes Greisenhaar war ungewöhnlich zerzaust, was ihm Ähnlichkeit mit einer übergroßen Schleiereule verlieh.
»Kind«, begann er, »wo warst du nur so lange? Du wirst dringend gebraucht. Wir haben einen neuen Gast, und das einzige Zimmer, das noch frei ist, hat gestern ein grässlicher Trunkenbold belegt. So etwas kann ich dem guten Mann nicht zumuten. Lass mich die Laken aufhängen.«
Er machte Anstalten, Elyssa den Korb abzunehmen. Rasch zog sie ihn weg. »Ich erledige das schon.«
Theodor lächelte. »Danke, Liebes. Du musst meine Hast entschuldigen, aber du warst heute wirklich ungewöhnlich lange fort.« Erst jetzt betrachtete er Elyssa eingehender. »Ist etwas vorgefallen? Du wirkst bedrückt.«
»Es ist alles in bester Ordnung«, log Elyssa. »Wer ist denn nun der edle Gast?«
»Wie kommst du darauf, dass er edel ist?«
»Weil du dir wegen eines einfachen Landstreichers nicht solche Umstände machen würdest.«
»War das so offensichtlich?«, fragte Theodor sichtlich belustigt. »Ja, du hast recht, wir haben in der Tat einen außerordentlichen Gast: einen Dominikaner auf Pilgerreise, der uns mit seiner Anwesenheit beehrt.«
»Was will denn ein Pfaffe bei uns?«
»Elyssa …«, setzte Theodor mahnend an.
»Ja, ja, ich werde mich benehmen. Aber nur, solange er sich auch benimmt.«
»Elyssa!«
Sie stieß verächtlich die Luft durch die Zähne aus. »Pfaffen … Bigotte Heuchler, allesamt. Ich werde ihn bewirten, aber ich werde ihm nicht schmeicheln. Das kannst du schön selbst übernehmen.«
Theodor warf die Arme in die Luft, als würde er göttlichen Beistand erbeten. »Elyssa, was soll ich nur mit dir machen?«
»Für den Anfang könntest du mich vorbeilassen, damit ich das Zimmer für den edlen Kirchenmann vorbereiten kann.«
Theodor seufzte resigniert und trat einen Schritt zur Seite. »Gut, gut. Tu das. Ich stelle dich unserem Gast später vor.« Später, wenn du dir der Gefahr bewusst geworden bist, die von ihm ausgeht.
Obwohl er es nicht aussprach, konnte Elyssa es trotzdem hören. Schweigend ging sie an ihm vorbei und stieg, den Korb unter dem Arm, die Treppe hinauf.
Bevor sie das Gästezimmer aufsuchte, bog sie in die Schlafkammer ab, die sie sich mit Theodor teilte. Als sie ihr Schwert aus dem Korb holen und in ihrem Versteck verwahren wollte, stellte sie verärgert fest, dass die Waffe nicht da war. Der Streit mit Philipp musste sie so aufgewühlt haben, dass sie sie einfach auf der Lichtung hatte liegen lassen. Nicht einmal das fehlende Gewicht war ihr aufgefallen. Ein solch leichtsinniger Fehler war ihr noch nie unterlaufen. Auch wenn es ihr widerstrebte, sie würde wohl oder übel bis nach Sonnenuntergang warten müssen, um die Waffe zu holen, davor sah sie keine Möglichkeit, die Taverne unbemerkt zu verlassen.
Mit nachlässigen, zornigen Bewegungen warf sie die feuchten Laken über die Wäscheleine, die unter der Zimmerdecke gespannt war. Dann, noch immer mit brodelnder Wut im Bauch, widmete sie sich dem Zimmer des Pfaffen – nein, Predigers. Nicht minder energisch, als sie vorhin mit dem Schwert umgegangen war, säuberte sie den Raum, in dem, wie bereits von Theodor prophezeit, ein unappetitlicher Geruch hing, dem Elyssa auch mit Wasser und Kernseife nicht das Geringste entgegenzusetzen hatte. Ihr Ehrengast musste sich wohl oder übel an den Gestank gewöhnen, wenn er nicht unter freiem Himmel nächtigen wollte.
Sie konnte nicht leugnen, dass ihr die Vorstellung gefiel.
Ein Laut in ihrem Rücken ließ sie aufhorchen. Sie wandte sich um und blickte geradewegs in das Gesicht eines Mannes, der an der halb offenen Tür lehnte und sie eindringlich musterte. Seine Haltung war geradezu provozierend entspannt, als wäre es vollkommen natürlich, dass er dort stand und Elyssa bei der Arbeit zusah.
Elyssa erwiderte seinen Blick ausdruckslos, dann wandte sie sich wieder ihrer Arbeit zu.
»Wie lange steht Ihr schon da?«
»Eine Weile.« Die Stimme des anderen war ein wohltuender, sonorer Bariton. Seine Worte waren von einem dezenten Akzent untermalt, den Elyssa nicht einzuordnen wusste.
»Verzeiht, dass ich mich von hinten an Euch herangeschlichen habe wie ein gemeiner Dieb. Ihr seid mir bereits unten in der Schenke aufgefallen, und ich konnte nicht anders, als Euch zu folgen.«
»Ihr tut gerade so, als müsste ich das als Kompliment auffassen«, erwiderte Elyssa, während sie die Strohsäcke ausschüttelte. »Dabei sagt es mehr über Euch als über mich.«
»Eure Schlagfertigkeit ist bewundernswert. Ich war schon an vielen Orten dieser Welt und bin eigentlich der Ansicht, ich hätte bereits alles gesehen, was es zu sehen gibt. Und doch, Ihr seid wahrlich anders als alle Frauen, die mir bisher begegnet sind.«
»Und Ihr«, sagte sie, »seid genau wie alle schmierigen Trunkenbolde, die glauben, sie könnten mich mit Schmeicheleien beeindrucken, die ich noch nie zuvor gehört habe.«
»Ihr irrt Euch.«
Elyssa hielt in der Bewegung inne. Aus den Augenwinkeln beobachtete sie den Gast aufmerksam. Seine Stimme war umgeschlagen, kälter und härter geworden.
Seine Miene wurde weicher, als ihr Blick ihn traf. »Ich fürchte, ich muss Euch ein Geständnis machen. Ich habe Euch beobachtet, auf der Lichtung. Und ich bin tief beeindruckt.«
Nun wandte Elyssa sich doch vollends zu ihm um. »Ihr habt … Ihr habt was?«
Dinge ändern sich, flüsterte ein Echo ihrer eigenen Stimme in ihrem Kopf.
»Ich weiß, es war ungebührlich, aber es war ein Versehen. Die Kampfgeräusche haben mich angelockt, und als ich erst dieses außerordentlichen Schauspiels gewahr wurde, gelang es mir einfach nicht, mich wieder davon loszureißen. Ihr habt Talent.«
»Ihr werdet mich doch nicht verraten?«, fragte Elyssa scharf.
Der Mann lachte. »Aber wo denkt Ihr hin? Ich würde niemals etwas tun, das Euch schaden könnte. Ich bewundere Euch. Obwohl ich zugeben muss, dass ich es bedauere, die Kunde über Eure Fertigkeiten nicht verbreiten zu dürfen. Mit der richtigen Anleitung könntet Ihr es in dieser Kunst weit bringen.«
Elyssas Miene verfinsterte sich. »Es ziemt sich nicht.«
»Es gibt allerlei Dinge, die sich nicht ziemen«, meinte der Fremde, wobei er das Wort auf eine Weise betonte, als wäre es etwas unbeschreiblich Widerwärtiges. »Schlimmere Dinge. Man tut sie trotzdem und nicht selten.«
»Ich bin nicht man«, widersprach Elyssa betont.
»Dafür eine wahrlich außergewöhnliche Frau.«
Sie unterdrückte ein Augenrollen. »Ich habe zu arbeiten.«
Der Fremde nickte. »Ich verstehe. Verzeiht, dass ich Eure kostbare Zeit in Anspruch genommen habe.«
»Euch ist vergeben.« Elyssa wandte sich demonstrativ ab.
Als sie sich das nächste Mal nach ihm umdrehte, war der Fremde verschwunden. Sie hatte nicht gehört, wie er gegangen war.
Im Schankraum klebten lüsterne, vom vergossenen Alkohol trüb gewordene Augen an ihrem Rücken und ein paar Handbreiten tiefer, während sie mit zügigen Schritten den Weg zwischen Treppe und Theke zurücklegte. Dahinter fand sie Theodor, der gerade mit einem Lappen den Schmutz in einem Becher verteilte.
Als er seine Enkelin bemerkte, ließ er augenblicklich von seiner sinnlosen Tätigkeit ab. »Da bist du ja, Kind! Unser Gast kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen. Ich hatte bereits befürchtet, du würdest mich im Stich lassen.« Sein Tonfall schlug um, er senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Du wirst dich doch zu benehmen wissen, nicht wahr?«
Elyssa seufzte. »Selbstverständlich, Großvater. Ich werde ein braves Mädchen sein. Ich werde ganz still bleiben und artig nicken, wenn nach meiner Meinung gefragt wird. Wenn es angebracht ist, werde ich lächeln, ansonsten schweigen und mich damit begnügen, hübsch auszusehen.«
»Gut so«, erwiderte Theodor, doch in seiner Stimme lag keinerlei Strenge, vielmehr eine leise Belustigung.
»Wo ist denn nun der hohe Besuch?«
Der Greis bedeutete Elyssa, ihm zu folgen. Vor einem der Tische blieb er stehen und verneigte sich flüchtig in Richtung des Gastes.
»Darf ich vorstellen: Vater Stephanus vom Orden der Dominikaner. Er hat den weiten Weg vom ungarischen Königreich hierher gemacht, um seine Weisheit mit den bescheidenen Bürgern Wiens zu teilen. Vater, dies ist meine Enkelin, von der ich Euch bereits erzählte: Elyssandria.«
»Elyssandria, so«, wiederholte der andere. »Ein ausgesprochen schöner, wohlklingender Name.« Erst da wandte er Elyssa sein Gesicht zu.
Die sachte Neigung des Kopfes, zu der sie bereits angesetzt hatte, wurde zu einem überraschten Zusammenzucken. »Ihr … Ihr seid das!«
»Ihr kennt euch bereits?«, fragte Theodor erstaunt.
Stephanus verzog die Lippen. »Wir hatten bereits das Vergnügen. Doch zu einem Austausch solcher Intimitäten wie der Namen ist es bedauerlicherweise nicht gekommen.«
Noch immer konnte Elyssa den Blick nicht von diesen dunklen, unergründlichen Augen abwenden. Es war derselbe Gast, der ihr zuvor auf das Zimmer gefolgt war. Das sollte nun also Stephanus sein, der Geistliche, den ihr Großvater angekündigt hatte? Ihr Verstand hatte ernste Probleme, diesen Menschen mit jenem Würdenträger, der wie von selbst vor ihrem geistigen Auge entstanden war, in Einklang zu bringen. Vor ihr saß ein schlanker Mann von mittlerem Wuchs mit sehnigen Muskeln, dessen Körper die gezügelte Kraft eines Raubtiers ausstrahlte. Er hatte langes, dunkles Haar, das ihm fast bis an die Schultern reichte. Sein einfacher Umhang war ebenfalls schwarz und bodenlang. Darunter trug er eine Robe derselben Farbe. Der einzige Schmuck, den Elyssa an ihm entdecken konnte, war ein schlichtes Holzkreuz an seiner Brust. Was sie jedoch am meisten irritierte, war sein Gesicht. Es besaß feine, aristokratische Züge, die eine höhere Abstammung verrieten, als seine einfache Kleidung suggerierte. Elyssa versuchte, sein Alter zu schätzen, doch es gelang ihr nicht. Sein faltenloses Gesicht hätte einem Zwanzigjährigen gehören können, Augen und Mimik dagegen sprachen für einen weit reiferen Mann, der das Doppelte an Jahren zählen mochte.
»Elyssa, starr unseren Gast nicht so an«, mahnte Theodor.
»Ich … verzeiht. Ich war nur so …«
»Es ist gut«, meinte Stephanus. »Ich kann Euch verstehen. Aber Vorurteile, meine liebe Elyssandria, sind eine schlimme Sache.« Stephanus schenkte ihr einen sonderbaren Blick, und sie senkte den Kopf, um den Augenkontakt zu brechen, der ihr ein heftiges Unwohlsein bereitete.
»Doch sprechen wir lieber über Angenehmeres. Ich bin äußerst erfreut, nun offiziell Eure Bekanntschaft machen zu dürfen, teure Elyssandria.«
»Elyssa«, verbesserte sie reflexartig.
»Warum einen so wunderbaren Namen kürzen?«, fragte Stephanus verwundert. »Gefällt er Euch denn nicht?«
»Doch, das tut er, aber ich …«
»Dann sehe ich keinen Anlass, ihn nicht zu benutzen.« Stephanus zeigte seine makellosen Zähne.
Elyssa sah ein, dass es keinen Sinn hatte, mit dem Dominikaner zu diskutieren. Außerdem fing sie einen warnenden Seitenblick ihres Großvaters auf, der offenbar fürchtete, Elyssa würde wegen einer solchen Banalität einen Streit vom Zaun brechen.
»Wie Ihr meint.«
Theodor nahm das kurze Schweigen zwischen Elyssa und Stephanus zum Anlass, selbst das Wort zu ergreifen. »Darf ich fragen, was Euch nach Wien führt, Herr?«
»Selbstverständlich darfst du fragen.«
Der alte Schankwirt wartete höflich, doch Stephanus machte keine Anstalten, fortzufahren. Unbehaglich räusperte Theodor sich. Sein Respekt vor dem Geistlichen war zu groß, als dass er gewagt hätte, tiefer in ihn einzudringen.
»Seid Ihr das erste Mal in unserer Stadt zu Gast, Vater? Ich bin sicher, meine Enkelin würde Euch gerne ein wenig herumführen. Wien verfügt über einige großartige kulturelle Sehenswürdigkeiten, müsst Ihr wissen.«
»Das bezweifle ich nicht«, erwiderte Stephanus. »Und nur zu gerne würde ich mir von diesem bezaubernden Wesen die Stadt zeigen lassen. Doch ich weiß nicht, ob ich die Zeit dafür entbehren kann. Obwohl man es mir nicht ansehen mag, bin ich ein vielbeschäftigter Mann.«
Elyssa schluckte das zweifelhafte Kompliment wie bittere Medizin.
»Gewiss, Vater«, beeilte Theodor sich zu sagen, der spüren musste, wie Elyssa sich neben ihm versteifte. »Doch die wenigen Stunden für einen kurzen Blick auf die ehrgebietenden Mauern des Stephansdoms werdet Ihr doch wohl entbehren können? Auch unsere erst kürzlich gegründete Universität ist einen Besuch wert, wenn Ihr mir die Bemerkung erlaubt. Gerade ein Mann des Wissens, der Ihr ja augenscheinlich seid, wird daran gewiss seine Freude haben.«
»Ich werde darüber nachdenken. Sofern Elyssandria nichts dagegen einzuwenden hat«, fügte er hinzu.
Sie setzte dazu an, etwas zu entgegnen, als sie Theodors Blick auffing, in dem etwas Flehendes lag. Im letzten Moment schluckte sie die schroffen Worte hinunter, die ihr bereits auf der Zunge gelegen hatten. »Oh, es wäre mir eine außerordentliche Ehre, Euch durch Wien zu begleiten … Vater.«
»Damit bereitet Ihr mir wahrlich große Freude.« Er wandte sich an Theodor. »Der Aufenthalt in dieser schönen Stadt will gefeiert sein. Sei doch so nett und bring einen Krug Wein und zwei Becher.«
Theodor deutete eine Verbeugung an. »Selbstverständlich, Vater. Erwartet Ihr etwa noch jemanden?«
»Das kann man nie wissen«, erwiderte Stephanus kryptisch.
Der Wirt fragte nicht weiter nach, sondern ging, um den Wunsch des Predigers zu erfüllen.
Elyssa machte Anstalten, ihren Großvater zu begleiten, doch Stephanus bedeutete ihr mit einer Geste, zu bleiben. »Bitte leistet mir Gesellschaft. Ich möchte mich nur zu gerne über Euer … Euer Talent unterhalten.«
Wäre das nicht völlig abwegig gewesen, Elyssa hätte gedacht, Stephanus wollte sie nicht als Schwertkämpferin, sondern als Frau sprechen. Doch das war Unsinn. Der Mann war ein Geistlicher, es war ihm gar nicht gestattet, Interesse am weiblichen Geschlecht zu zeigen. Allerdings hatte Elyssa schon von Gottesmännern gehört, die sich schamlos Konkubinen hielten, oftmals sogar mehr als nur eine. Pfaffen konnte man nicht trauen.
Sie legte sich ihre Worte sorgfältig zurecht. Geistlicher oder nicht, das Wort »Nein« schien für die meisten Männer gleichbedeutend mit einem Blankziehen des Hinterteils zu sein. »Nur zu gerne, Vater, aber ich fürchte, ich habe zu tun. Gegen Abend wird es hier immer besonders voll.«
»Ich verstehe.« Stephanus wirkte weder enttäuscht noch sonderlich überrascht. »Das ist in der Tat äußerst bedauerlich. Aber ich sehe ein, dass Ihr zu arbeiten habt. Vielleicht ein anderes Mal?«
»Vielleicht«, bestätigte Elyssa unbehaglich.
Stephanus lehnte sich leicht vor. »Dann wünsche ich Euch noch einen angenehmen Abend, teure Elyssandria.«
Für einen Moment war sie sicher, ein verdächtiges silbernes Aufblitzen unter seinem Umhang wahrgenommen zu haben. Irritiert verharrte ihr Blick an der Stelle, doch sie konnte nichts Ungewöhnliches mehr entdecken. Was nichts an der Tatsache änderte, dass sie wusste, was sie gesehen hatte.
Na und? Dann trug Stephanus eben eine Waffe. Nur weil er ein Geistlicher war, bedeutete das noch lange nicht, dass er sich nicht ebenso verteidigen musste wie jeder andere Reisende auch. Weshalb also beunruhigte Elyssa dieser Umstand so?
Sie blickte auf, direkt in Stephanus’ pechfarbene Raubtieraugen.
»Ich … danke«, antwortete sie mit einiger Verspätung. »Den wünsche ich Euch auch.« Dann wandte Elyssa sich ab und floh förmlich vor dem Mann, der ihr mit seinem stummen Lächeln nachblickte, das warm war und sie doch innerlich zu Eis erstarren ließ.
Den ganzen restlichen Abend hatte Elyssa das intensive Gefühl, angestarrt zu werden.
II.
Ungeduldig harrte Elyssa in ihrer Bettstatt aus, bis sie sicher war, dass Theodor tief und fest schlief. Schließlich richtete sie sich auf ihrer Pritsche auf und schwang die Beine über den Rand. In diesem Moment ächzte Theodor im Schlaf und wälzte sich auf der Strohmatratze. Elyssa erstarrte.
Obwohl ihnen zahlreiche Zimmer gehörten, die sie an Reisende vermieteten, hatte ihre Familie dennoch stets nur einen einzigen Raum zum Schlafen zur Verfügung gehabt. Bis zu dem Zeitpunkt, als Philipp geheiratet hatte, hatte Elyssa sich das Bett mit ihrem Cousin geteilt, und manchmal wachte sie immer noch nachts auf und spürte die Einsamkeit wie einen schmerzhaften Stich in ihrer Brust, wenn Philipps Arme nicht um ihren Körper lagen.
Als Theodor sich kein weiteres Mal bewegte, entzündete sie ein Talglicht, kleidete sich an und verließ lautlos das Zimmer. Der Gang war erfüllt vom vielstimmigen Schnarchen der Gäste, das durch die geschlossenen Türen drang. Irgendwo murmelte jemand undeutlich im Schlaf.
Auf leisen Sohlen schlich Elyssa den Flur entlang und huschte die Treppe hinunter, wobei sie sorgsam darauf achtete, die Stufen auszulassen, von denen sie wusste, dass sie knarrten. Im Erdgeschoss war das Schnarchen noch lauter und durchdringender. Unbemerkt schlüpfte Elyssa durch die Tür nach draußen in die Dunkelheit.
Sie und ihr Großvater lebten nahe genug an der Peripherie, um von den üblichen Unannehmlichkeiten der Hauptstadt verschont zu bleiben. Der verwilderte Hinterhof der Taverne grenzte direkt an ein Waldstück, das nicht mehr zu ihrem Besitz gehörte und von niemandem genutzt wurde. Die Fläche des Forstes war zu gering, als dass sie genügend Lebensraum für Wild geboten hätte, und der Ertrag, den das Holz brächte, würde man es verarbeiten, wog die Arbeit, die Bäume zu fällen und die Stämme anschließend fortzuschaffen, nicht auf. Daher blieb diese Ansammlung von Laub- und Nadelbäumen ein unberührter Flecken Natur.
Wenn man dem Waldrand etwa eine Viertelstunde folgte, erreichte man eine Lichtung, die von einem klaren Bach gespeist wurde. Dieser schmale Flusslauf mündete bereits nach wenigen hundert Schritten in einen Teich, an dem ein geduldiger Beobachter die verschiedensten Wasservögel entdecken konnte, manche so exotisch, dass Elyssa ihnen keinen Namen zuzuordnen wusste.
Dies war der Platz, an dem sie sich mit Philipp traf, um ihre geheimen Duelle auszufechten. Dort waren sie sicher vor dem Blick neugieriger Fremder, schließlich war es nur natürlich, dass ein Wanderer den kleinen Umweg in Kauf nahm, um sich den Gewaltmarsch durch den von Wurzelgeflecht und Hügeln durchwachsenen Boden zu ersparen. Niemand wählte eine Route durch unbekanntes Gebiet, wenn er ebenso gut einem gesicherten Pfad folgen konnte.
Zumindest war Elyssa bis zum gestrigen Tag fest davon überzeugt gewesen.
Elyssa seufzte tief und legte den Kopf in den Nacken, um in den wolkenlosen Nachthimmel zu blicken, als fände sich die Antwort auf ihre Fragen in den Gestirnen. Die Lichtung lag nun unmittelbar vor ihr. Sie ging in die Hocke, stellte das Talglicht im Gras ab und begann, mit den Händen nach dem Schwert zu tasten.
Plötzlich raschelte es im Unterholz. Zuerst nahm Elyssa an, es sei ein Tier, das, von ihrer Anwesenheit aufgescheucht, die Flucht ergriff. Bereits im nächsten Moment erkannte sie ihren Irrtum. Das Knacken der Äste wurde eindeutig von einem schweren Körper verursacht – erheblich größer als ein Fuchs oder ein Hase, und größeres Wild gab es hier nicht. Außerdem bewegte sich das Geräusch in ihre Richtung, statt sich von ihr zu entfernen. Etwas schlich sich an sie heran.
Elyssa erstarrte zu absoluter Reglosigkeit und konzentrierte sich vollkommen auf die Laute hinter sich. Ihre Muskeln spannten sich an. Mit den Augen fixierte sie einen robusten Ast, der eine halbe Armeslänge von ihr entfernt im taufeuchten Gras lag. Wenn ihr unsichtbarer Verfolger dachte, leichtes Spiel mit der jungen Frau zu haben, die sich des Nachts allein vor die Tür gewagt hatte, würde er eine böse Überraschung erleben.
Da teilte sich das Gebüsch vor ihren Augen, und eine dunkel gekleidete Gestalt trat mit gezogener Waffe hervor. Das Licht, das zwischen ihnen im Gras stand, war kaum ausreichend, um das Gesicht des Mannes zu erhellen, dennoch erkannte Elyssa ihn augenblicklich.
»Was tut Ihr hier?«, fragte sie scharf. Ihre Rechte näherte sich dem Ast und schloss sich darum. »Seid Ihr mir etwa gefolgt?« Schon wieder?
Stephanus antwortete nicht. Schweigend rückte er näher, ein schwarzer, bedrohlicher Schatten, auf dessen silbriger Klinge sich das fahle Mondlicht brach.
»Was habt Ihr vor? Keinen Schritt näher, ich warne Euch!«
Stephanus hob seine Waffe. Elyssa reagierte, ohne nachzudenken. Mit einem Satz sprang sie vor und schlug zu. In einer Bewegung, die so rasch war, dass Elyssa sie nur als verschwommenen Schemen wahrnehmen konnte, riss Stephanus den Arm hoch und blockte den Schlag, dessen Kraft hätte ausreichen müssen, ihm den Knochen zu brechen, beiläufig mit dem bloßen Arm ab. Gleichzeitig versetzte er ihr einen Stoß, sodass sie nach hinten taumelte und zu Boden fiel. Vor Überraschung, aber auch vor Schmerz schrie Elyssa auf.
Mit einem Satz war Stephanus über ihr, und Elyssa schloss in Erwartung des tödlichen Stichs die Augen. Stahl traf auf Fleisch.
Ein schmerzerfülltes Grunzen ließ Elyssa die Augen aufschlagen. Stephanus hatte die Hand im Kragen eines Fremden vergraben, der sich ihr unbemerkt von hinten genähert haben musste. In seinem Arm klaffte ein heftig blutender Schnitt.
»Was suchst du hier?«, herrschte Stephanus ihn an. »Stellst du der Dame etwa nach?«
Der in Fetzen gekleidete Fremde antwortete nicht.
»Sei froh, dass ich ein rechtschaffener Christ bin, sonst würde ich dir hier und jetzt das Fell gerben!« Stephanus versetzte dem anderen einen Stoß. »Mach, dass du verschwindest, und lass dich hier niemals wieder blicken! Sollte ich deine Visage noch einmal sehen, dann Gnade dir Gott!«
Der Fremde stolperte einige Schritte rückwärts. Für die Dauer eines Herzschlages verharrte er noch unentschlossen, die Hand auf seinen verletzten Arm gepresst, dann fuhr er auf dem Absatz herum und hastete davon.
Seufzend wischte Stephanus seine blutbesudelte Klinge im Gras ab, schob seine Waffe zurück unter sein Gewand und drehte sich zu Elyssa herum. »Seid Ihr verletzt?«
Elyssa ignorierte seine hilfreich ausgestreckte Hand, rappelte sich aus eigener Kraft auf und schüttelte den Kopf. Es fiel ihr noch immer schwer, zu begreifen, was soeben geschehen war.
»Wer … wer war dieser Mann?«
»Das weiß ich auch nicht. Er schlich schon den ganzen Abend um die Taverne herum wie ein ausgehungerter Wolf. Als ich hörte, wie jemand das Haus verließ, sah ich nach draußen und konnte beobachten, wie dieser Wicht Euch folgte. Ich hoffe, ich habe Euch keine Angst eingejagt.«
Elyssa schnaubte und rückte ihre Kleider zurück. »Ganz und gar nicht. Ich bin lediglich verärgert, dass Ihr mir nachgeschlichen seid. Ich kann mich nicht erinnern, um Euren Schutz gebeten zu haben.«
»Verzeiht, dass ich Eure traute Zweisamkeit mit diesem sympathischen Gesellen gestört habe.« Stephanus hob eine Augenbraue. »Das nächste Mal werde ich mich zurückhalten.«
»Ihr tätet besser daran«, bestätigte Elyssa grimmig. Ihr Blick fiel auf einen schwachen Lichtreflex im Gras, und als sie sich danach bückte, entdeckte sie ihr Schwert, das noch immer senkrecht in der Erde stak. Mit einem Ruck zog sie es heraus, wickelte die Klinge in das mitgebrachte Leinen und schob es unter ihren Gürtel. Beinahe augenblicklich beruhigten sich ihre flatternden Nerven ein wenig.
Sie gestand es sich selbst nur ungern ein, doch die Begegnung hatte sie aufgewühlt. Wenn sie darüber nachdachte, zu welchem Zweck der Unbekannte ihr nachgestellt haben könnte, kribbelte ihre Haut am ganzen Körper.
Stephanus schien ihre Stimmung zu spüren. »Ich bezweifle, dass er zurückkommen wird. Er wirkte nicht unbedingt wie ein Mann, dem nach einer fairen Auseinandersetzung dürstet. Bestimmt haben wir ihm ausreichend Angst eingejagt, dass er sich ein lohnenderes Opfer suchen wird.«
Musste sie ihm anrechnen, dass er wir sagte?
»Da habt Ihr wohl recht.« Sie betrachtete Stephanus im schwachen Schein des Talglichts, das zwischen ihnen stand. »Wie geht es Eurem Arm?«
Anstelle einer Antwort krempelte er den Ärmel seiner Robe hoch. Darunter kam matt glänzender Stahl zum Vorschein.
»Glaubt nicht, ich hätte den Schlag nicht trotzdem gespürt.« Stephanus bedachte Elyssa mit einem Blick, in dem ein sanfter Vorwurf lag. »Das gibt einen prächtigen blauen Fleck.«
»Ihr tragt eine Rüstung?«, fragte Elyssa irritiert.
»Nur einen Armschutz.«
»Warum?«
»Weil ich wahrlich keine Lust habe, all das Metall mit mir herumzuschleppen. Mit diesem Gewicht um die Hüften wäre ich schon halb tot, bevor ich meinen Gegner auch nur erreicht hätte. Ehrlich gesagt verstehe ich gar nicht, was die abendländische Kultur an diesen scheußlichen Ein-Mann-Käfigen findet.«
»Nein, das meine ich nicht. Warum trefft Ihr überhaupt solche Vorkehrungen? Ihr seid doch ein … Mann Gottes?«
»Und deshalb muss ich automatisch der Ansicht sein, dass jeder böse Mensch sich in Schwefel und Rauch auflöst, sobald ich ihn mit Weihwasser bespritze?«
»Nein, natürlich nicht, aber …«
»Aber?«
»Es erscheint mir einfach … nicht richtig.« Sie schüttelte den Kopf. »Ihr hattet recht. Ihr seid wahrlich kein gewöhnlicher Mann.«
»Ihr schmeichelt mir.«
»Das lag nicht in meiner Absicht.«
Schweigend starrten sie sich an. Das Gesicht des Dominikaners war eine undurchdringliche Maske aus Elfenbein.
Stephanus räusperte sich. »Wahrscheinlich sollte ich jetzt besser gehen. Lebt wohl, Elyssandria.« Er wandte sich um.
Elyssa unterdrückte einen Fluch. Ob es ihr gefiel oder nicht, dieser Mann hatte sie vor einer überaus unangenehmen Auseinandersetzung bewahrt.
»Wartet.« Sie knirschte mit den Zähnen, knetete ihre Hände. »Ich … denke, ich schulde Euch Dank.«
»Ihr schuldet mir nichts.«
»Doch, das tue ich. Danke, und … entschuldigt mein Betragen. Das war ungebührlich. Es ist nur so, dass ich empfindlich auf Männer reagiere, die sich zu meinen Beschützern stilisieren wollen.«
Stephanus wirkte ehrlich überrascht. »Was ich getan habe, hatte nichts damit zu tun, dass Ihr eine Frau seid, Elyssandria. Selbst die Chancen eines ausgebildeten Soldaten stehen schlecht, wenn der Feind sich unbemerkt von hinten anschleicht.«
»Das ist wohl wahr.« Hatte sie den Dominikaner falsch eingeschätzt? Auf einen Schlag hatte Elyssa ein schlechtes Gewissen. »Wenn Euer Angebot noch steht«, fuhr sie fort, »würde ich sehr gerne einmal einen Becher Wein mit Euch trinken.«
»Tatsächlich?«
Elyssa nickte. »Wenn Ihr also morgen eine Stunde entbehren könnt …«
»Warum bis morgen warten?« Stephanus begann die aus groben Lederflicken genähte Tasche zu durchsuchen, die er bei sich trug. Als seine Hand erneut zum Vorschein kam, fand sich eine sorgsam verkorkte Tonflasche darin.
»Ich habe diese Flasche bei Eurem verehrten Großvater erstanden«, erklärte er. »Wiener Wein gilt als ganz besonderer Tropfen in meiner Heimat – wie hätte ich da widerstehen können, etwas davon auf meiner Reise mitzunehmen?«
»Ihr wollt hier trinken, mitten in der Wildnis?«, fragte Elyssa zweifelnd.
»Hier wären wir vollkommen ungestört und müssten uns keine Sorgen machen, dass jemand etwas von unserem Gespräch aufschnappt. Das ist doch gewiss in Eurem Sinne.«
»Nun, warum eigentlich nicht? Ich verbringe ohnehin schon zu viel Zeit in dieser finsteren Spelunke.«
Stephanus breitete seinen Umhang im taufeuchten Gras aus. Elyssa stellte das Talglicht in der Mitte ab. Anschließend ließen sie sich auf dem Stoff nieder. Die Nacht war angenehm lau, und um sie herum zirpten die Grillen.
»Für einen Pfaffen seid Ihr erstaunlich nahbar.« Die Bemerkung war ihr herausgerutscht, bevor sie sie zurückhalten konnte.
»Ihr mögt wohl keine Geistlichen?« Wenn Stephanus sich dadurch beleidigt fühlte, zeigte er es nicht.
»Nicht sonderlich, nein.«
»Gibt es dafür einen Grund?«
Elyssas Blick schweifte ab, verschwand in der Schwärze, die sich zwischen den dicht an dicht stehenden Baumstämmen am Ende der Lichtung sammelte. »Ich nehme an, ich habe bislang einfach keine sonderlich vorbildlichen Vertreter dieses Standes getroffen. Als ich ein Kind war, hätte ich die Führung und Wohltätigkeit einer frommen Seele dringend nötig gehabt. Dabei lernte ich, dass jemand, der viel hat, nur das Ziel verfolgt, es zu behalten – selbst wenn er sich in noch so salbungsvolle Worte kleidet.«
»Verzeiht meine Neugier, Elyssandria, doch diese Geschichte würde ich gerne in Gänze hören. Falls Ihr sie erzählen wollt.«
Elyssa wollte nicht. Dennoch sprach sie weiter. Sie hatte das Gefühl, als wäre sie Stephanus zumindest einen Teil der Wahrheit schuldig. »Meine Eltern starben, als ich ein Mädchen war. Die Pest. Ich verbrachte mehrere Tage mit ihren Leichen in unserem Haus, so lange, bis kein Essen mehr da war und der Hunger mich hinaus in die Kälte trieb. Als ich an den Toren einer nahen Kirche um Brot bettelte, wurde ich mit Schmutzwasser übergossen und unter Androhung von Stockschlägen fortgejagt. Hätte mein Großvater mich nicht bald darauf gefunden und bei sich aufgenommen, ich wäre verhungert oder erfroren.«
»Es tut mir leid, dass Ihr diese Erfahrung machen musstet. Das ist grässlich.« Stephanus’ Anteilnahme klang aufrichtig.
»Aber nicht Eure Schuld.«
Für eine Weile schwiegen sie, doch erstaunlicherweise war es kein unangenehmes Schweigen.
Elyssa legte den Kopf in den Nacken und starrte hinauf in den Himmel, versuchte, einen Blick hinter die aus purer Schwärze gegossene Kuppel der Nacht zu werfen, die über dem Wald thronte. Dann wandte sie sich wieder Stephanus zu, und in seinen Augen funkelte die Reflexion der Flamme des Talglichts.
»Ihr spracht von Wein?«, erinnerte sie ihn.
Stephanus reichte ihr die Flasche. Mit dem Geschick langjähriger Erfahrung entkorkte Elyssa sie mit den Zähnen, nahm einen kräftigen Schluck und reichte sie an Stephanus weiter.
Er trank.
»Erzählt mir mehr von Euch«, bat er dann. »Wer Ihr seid und was Euch antreibt. Ich möchte Euch verstehen.«
»Mich verstehen?«, wiederholte sie verblüfft.
»Bin ich zu dreist?«
»Nein. Nur … sonderbar.«
Stephanus gab ihr die Flasche zurück. »Ich hatte Euch gewarnt.«
Elyssa musste lächeln.
Das Kitzeln warmer Sonnenstrahlen in ihrem Gesicht weckte sie. Noch benommen vom Schlaf – und wohl auch vom bittersüßen Wein, dem sie gestern im Übermaß zugesprochen hatte – blinzelte sie ins Tageslicht.
Etwas stimmte nicht.
Elyssa runzelte die Stirn und versuchte zu begreifen, was sie störte. Doch die träge in ihrem Verstand treibenden Gedanken weigerten sich, in geregelte Bahnen zurückzufinden. Ungelenk wälzte sie sich auf den Rücken und stemmte sich hoch. In ihrem Kopf drehte sich alles, und auf ihrer Zunge lag ein fauliger Geschmack. Eine quälende Übelkeit drängte ihre Kehle empor und wollte an die Oberfläche brechen.
Bei Gott, wie viel hatte sie gestern getrunken?
Sie erinnerte sich nicht mehr daran, so wie sie sich an vieles nicht mehr erinnern konnte, das geschehen war, nachdem sie diese verteufelte Flasche geöffnet hatte.
Als sie den Blick über die Lichtung schweifen ließ, bemerkte sie, dass sie allein war.
Natürlich war sie das. Erwartete sie etwa allen Ernstes, Stephanus hätte aus reiner Höflichkeit die Nacht hier draußen ausgeharrt, in der feuchten, beißenden Kälte des Waldes, und das neben einer besoffenen Schankmagd, die ihm um ein Haar den Arm gebrochen hätte, weil er den Fehler begangen hatte, sich um sie zu sorgen? Wahrscheinlich war er gegangen, kaum dass Elyssa eingeschlafen war.
Aus trüben Augen starrte sie durch das verwaschene Wolkengeflecht, das sich über den Horizont spannte.
Elyssa stutzte. Etwas an ihren Gedanken stimmte nicht. Wolkengeflecht? Nein. Das dort oben waren keine Wolken. Dafür bewegte es sich zu schnell, rollte zu dunkel und bedrohlich über den ansonsten klaren Himmel …
Und es stank.
Da wusste sie, was es war, und die Müdigkeit fiel von ihr ab, als wäre sie nichts weiter gewesen als ein Bleigewicht, das man an ihre Glieder gebunden hatte und dessen Schnur nun gekappt war.
Rauch. Der ganze Himmel war voll davon, und nun, da sie ihn erkannt hatte, konnte sie ihn auch deutlich riechen – den schweren, beißenden Geruch von Qualm.
Es brannte. Es brannte lichterloh. Wie hypnotisiert folgte ihr Blick der Quelle des Rauches, die östlich der Taverne lag. In diesem Teil Wiens gab es nur wenige bewohnte Häuser. Auf einen Schlag war sie nüchtern.
»Philipp«, hauchte sie.
Es gab keine logische Erklärung für die absolute Sicherheit, mit der sie spürte, dass ihr Cousin in Gefahr war. Die grimmige Gewissheit eines geschehenen Unglücks überfiel sie unerwartet und heftig wie ein Tier.
Elyssa zögerte nicht länger. Ohne nachzudenken, wählte sie den direkten Weg, quer durch den Wald, Gestrüpp und Wurzeln ignorierend, die sie zu Fall zu bringen drohten.
Sie würde zu spät kommen. So, wie nichts ihre Eltern hatte retten können, so würde auch Philipp nichts mehr retten können. Sie alle waren vollkommen machtlos gegen das Schicksal, wenn es erst zu einem Hieb gegen sie ausgeholt hatte.
Die Luft wurde zunehmend dicker, und der Rauch, der sich siedend heiß auf Elyssas Lungen legte, nahm überhand. Und dann war sie da, so plötzlich, dass sie mitten im Schritt erstarrte.
Wie oft war Elyssa bereits hier gewesen, hatte Philipp und seine Familie besucht, um teilzuhaben an ihrem perfekten Glück? Wie oft hatte sie hier gestanden, genau an dieser Stelle, kurz bevor Philipp ihr entgegengekommen war und sie in Empfang genommen hatte? All diese unzähligen Besuche schmolzen nun zusammen, reduzierten sich auf diesen einen, endlos erscheinenden Augenblick.
Philipps Haus war nicht wiederzuerkennen. Vor ihr lag eine ausgebrannte Ruine, nicht mehr als ein qualmender Trümmerhaufen. Der Gestank nach verbranntem Fleisch hing in der Luft, vermischt mit jenen lebensgefährlichen Gasen, die der Brand ausgeatmet hatte. Das Feuer hatte sich mittlerweile selbst verzehrt, doch nicht ohne alles mit sich in den Tod zu reißen, was in Reichweite seiner Klauen geraten war. Das Obergeschoss des Hauses hatten die Flammen vollkommen verschlungen und kaum mehr zurückgelassen als Asche, die der Wind in alle Himmelsrichtungen vertrug. Vom Fundament standen nur noch geschwärzte Trümmer, die wie die verwesten Knochen eines Drachens in den grauen Himmel ragten. Von Philipp und seiner Familie war keine Spur zu entdecken.
Wie durch ein Wunder hatte das Feuer nicht auf die wenigen umliegenden Häuser übergegriffen – als hätte eine flammende Hand gezielt nach diesem einen Gebäude geschlagen.
Nur am Rande ihrer Wahrnehmung bemerkte Elyssa die vereinzelten Nachbarn, die die Katastrophe aus sicherer Entfernung beobachteten. Nicht einem schien der Gedanke zu kommen, seine Hilfe anzubieten oder wenigstens nach der Stadtwache zu schicken. Elyssa war nicht einmal wütend deswegen – ihre Gedanken kreisten um wichtigere Dinge.
Mit bewusster Anstrengung zwang sie sich, die unsichtbare Grenze zu überwinden, die die umstehenden Menschen zurückzuhalten schien. Wenn hier noch irgendjemand lebte, dann würde sie ihn finden. Ohne auf die giftigen Dämpfe zu achten, die das Grundstück noch immer in einen dichten Nebel hüllten, durchstreifte sie das Gelände auf der Suche nach einem Lebenszeichen ihres Cousins oder seiner Familie. Sie rief ihre Namen, die der Kinder, den Magdas und immer wieder den Philipps, stolperte über niedergebrannte Mauerreste und kämpfte sich hustend durch den Trümmerwald, der ihr Sicht und Weg versperrte.
Philipp durfte nicht tot sein. Wenn er tot war, dann wäre ihr letzter Wortwechsel ein dummer Streit gewesen.
Da bemerkte sie etwas inmitten dieser öden, trostlosen Landschaft, das ihre Aufmerksamkeit erregte, ein heller Fleck in einer Welt aus Schwarz-Grau und Grau-Schwarz. Deutlich zeichneten sich die Umrisse eines menschlichen Körpers unter den Trümmern ab. Hals über Kopf stürzte sie darauf zu.
Wenige Schritte später erstarrte sie, und eine harte, eisige Hand schien ihr die Kehle zuzupressen. Ohne Zweifel handelte es sich bei dem Mann, der dort reglos zwischen den verkohlten Mauerresten lag, um ihren Cousin, doch der eiskalte Atem des Todes hatte seine Züge grässlich verzerrt und aus seinem vertrauten Antlitz etwas Obszönes gemacht. Seine Haut war übersät von Brandwunden. An mehreren Stellen war das blanke, nässende Fleisch zu sehen. Doch so schwer diese Verletzungen auch sein mochten, getötet hatte ihn etwas gänzlich anderes.
Knapp unterhalb seines Herzens klaffte eine tiefe, bis auf den blanken Knochen reichende Wunde. Eine halbe Elle von seiner rechten Hand entfernt lag seine Bauernwehr – die Klinge blank, nur der Griff mit halb geronnenem Blut befleckt. Er hatte keine Chance gegen seinen Angreifer gehabt.
Elyssa ließ sich neben Philipp in die noch heiße Asche sinken. Behutsam fuhr sie über das besudelte Leder des Hefts, und als sie die Hand zurückzog, schimmerten ihre Finger in feuchtem Rot. Wenn sie nur ein wenig früher gekommen wäre …
»Es tut mir ja so leid«, wisperte sie. »So unendlich leid.«
In diesem Moment schlug der Totgeglaubte die Augen auf und starrte Elyssa mit trübem, wirrem Blick an.
»Philipp«, flüsterte sie und beugte sich tiefer zu ihrem Cousin hinab.
Der Blick des Mannes wanderte haltlos durch die Unendlichkeit, suchte nach einem Punkt, an dem er festhalten konnte, um nicht in die verzehrende Schwärze des Todes abzugleiten.
»El… El… El… …ys… …ssa?« Der Klang seiner Stimme erschreckte sie – ein raues, tonloses Krächzen.
»Elyssa? Elyssa?« Seine glasigen Augen tasteten nach ihrem Gesicht und fanden es. Dann sagte er zum vierten Mal, in einem Ton, der erleichtert klang: »Elyssa.«
»Sprich nicht. Du musst deine Kräfte schonen.«
Ein verunglücktes Lächeln zerschnitt Philipps zerstörtes Gesicht. »Unsinn. Ich sterbe sowieso.«
»Du stirbst nicht«, behauptete Elyssa. »Solange ich da bin, stirbst du nicht. Das erlaube ich dir nicht.«
Sie tastete nach Philipps Hand und packte zu, als wäre sie in der Lage, ihren Cousin auf diese Weise im Diesseits festzuhalten. Seine Haut fühlte sich rau und heiß an, wie Pergament, das zu lange in der Sonne gelegen hatte. Hätte sie eines der Trümmer angefasst, hätte sie kaum einen Unterschied ausmachen können.
»Philipp, was ich gestern über dich und Magda gesagt habe …«
Mit den Augen deutete Philipp ein Kopfschütteln an. »Schweig. Für so etwas ist jetzt keine Zeit. Du kannst nicht hierbleiben.«
»Warum?«, fragte Elyssa. »Philipp, was ist passiert?«
Über das Antlitz des Mannes huschte ein Schatten. Sein Blick glitt von ihrem Gesicht ab, verlor sich in einem Bild, das Elyssa verborgen blieb. »Ich konnte nichts tun. Sie waren plötzlich da. So viele. Viel zu viele. Sie haben …« Er atmete scharf ein und schloss die Augen. Seine Brust hob und senkte sich in hektischen, schweren Stößen. »Sie haben sie getötet. Magda, die Kinder, die Knechte … Alle … Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber ich war zu schwach.«
»Wer?«, fragte Elyssa eindringlich. »Von wem sprichst du?«
»Ich … weiß nicht«, antwortete Philipp mühsam. Es schien ihm immer schwerer zu fallen, verständliche Worte zu formulieren. »Kenne sie nicht. Was sie wollten … weiß nicht … Haben Feuer gelegt … getötet … alle getötet …«
Plötzlich ging ein Ruck durch Philipps Körper, und er umklammerte Elyssas Arm mit einer Kraft, als wollte er ihn brechen. Sein heißer, übelriechender Atem schlug ihr ins Gesicht.
»Elyssa«, keuchte Philipp, »du musst zurück zur Taverne! Diese Kerle … Ich habe gehört, wie sie darüber sprachen. Sie wollen dort einfallen. Ich weiß nicht, wer sie waren oder was sie wollten, ich weiß nur, dass sie noch weiter morden werden. Sie sind viele, sie bewegen sich langsam. Wenn du dich beeilst, erreichst du Großvater, bevor sie es tun. Du musst ihn warnen, beim Allmächtigen!«
»Ich kann dich doch nicht einfach hier zurücklassen!«, protestierte sie.
»Du musst«, sagte er bloß. »Bevor es zu spät ist.«
Philipp hatte recht, ihr blieb keine andere Wahl. Sie musste retten, was noch zu retten war – und Philipp, das wusste sie nur zu gut, war längst verloren.
»Leb wohl«, sagte sie, als sie aufstand und sich abwandte.
Anders als Lots Frau in der Heiligen Schrift blickte sie nicht zurück auf die Verwüstung, die sie hinter sich zurückließ.
III.
Als sie die Tür zum Schankraum aufstieß, war sie in Schweiß gebadet. Theodor, der bereits auf sie gewartet haben musste, kam hinter dem Tresen hervor.
»Guter Gott, Kind, was ist denn mit dir passiert? Wo bist du nur gewesen?«
Sie sah sich um und stellte erleichtert fest, dass sie rechtzeitig gekommen war – zum ersten Mal in ihrem Leben.
Einige der Gäste wandten den Kopf und starrten Elyssa an. Sie gewahrte Gesichter, in denen deutlich der Unmut über diese Störung geschrieben stand, doch in manchen Zügen las sie auch Beunruhigung, ja, sogar so etwas wie Furcht. Ein paar wenige erhoben sich zögernd von ihren Tischen, um die Taverne zu verlassen oder das Gespräch besser mitverfolgen zu können.
Theodor hatte sie erreicht und legte Elyssa beruhigend die Hände auf die Schultern. »Kind, wie siehst du denn aus? Mein Gott, du zitterst ja! Ist das Blut an deinem Arm? Bist du verletzt? Nun setz dich doch erst einmal! Ich hole dir etwas zu trinken.«
»Dafür ist keine Zeit«, fuhr Elyssa dazwischen, und sie war beinahe selbst überrascht, wie sicher und fest ihre Stimme klang. Noch mehr erstaunten sie ihre folgenden Worte. »Philipp ist tot.«
Theodors Miene gefror, und die dürren Greisenhände auf ihren Schultern verkrampften sich so fest, dass es schmerzte. Für die Dauer eines Herzschlages stand er einfach nur da und starrte Elyssa an. »Wie … wie bitte?«, brachte er mühsam hervor.
»Ich erkläre dir alles später. Die Zeit drängt. Sie werden bald hier sein.«
»Sie?«, wiederholte Theodor hilflos. »Wer sind sie?«
In diesem Moment flog die Tür auf, und ein gutes Dutzend bewaffneter Männer stürmte den Schankraum. Elyssa hatte bereits mit ihrem Eindringen gerechnet, und so zog sie ihre Waffe und wollte sich der Meute entgegenstellen. Da packte Theodor ihr Handgelenk. Sein Gesichtsausdruck war flehend, sein Griff so fest, dass sie Gewalt hätte anwenden müssen, um ihn zu lösen. Elyssa blieb nichts anderes übrig, als tatenlos zuzusehen, wie die Kerle sich in dem Raum ausbreiteten, Tische umstießen und die Gäste mit ihren Waffen bedrohten.
Die Eindringlinge waren alle in dieselben, eintönig braunen Beinkleider und einheitlich weißen Hemden gehüllt, und an ihren Waffengurten erspähte Elyssa mehrere Klingen, einige davon unterarmlang – sogenannte Lange Messer, die nichts anderes waren als minderwertige Hieb- und Stichwaffen, die das gemeine Volk als Schlupfloch benutzte, um das Schwertverbot zu umgehen. Auch die eine oder andere Armbrust konnte sie ausmachen.
Der Kampf war entschieden, ehe er richtig begonnen hatte. Innerhalb kurzer Zeit hatten die Unbekannten die Gäste unter Kontrolle gebracht, indem sie ihnen die Klingen an die entblößten Kehlen setzten oder ins gekrümmte Rückgrat drückten.
Einer der Männer kam auf Theodor zu und baute sich vor ihm auf. Er hatte ungepflegtes, rostrotes Haar, das seine Schultern nicht ganz erreichte, und die unrasierte Visage eines gemeinen Straßenräubers.
»Bist du der Wirt dieser Kaschemme, alter Mann?« Seine Stimme kam Elyssa seltsam bekannt vor, doch sie wusste nicht woher.
Theodor nickte gefasst.
Der Fremde, offenbar der Anführer des Trupps, gab einem der Männer einen Wink, der daraufhin Theodor von Elyssa wegzog. Sie wollte sich auf den Mann stürzen, aber der Rothaarige versperrte ihr den Weg. Dabei bemerkte sie einen langen Riss in seinem rechten Ärmel, unter dem ein kaum verschorfter Schnitt zu sehen war. Mit einem Mal fiel es ihr wie Schuppen von den Augen.
»Ich kenne dich! Du hast mir gestern im Wald nachgestellt!«
»Scharf erkannt, Weib«, gab der andere zurück. »Ich musste mir schließlich ein Bild von der Lage machen, ehe ich mit meinen Männern hier einfalle. Ich gebe zu, dieser Schweinepriester hat mich überrascht. Doch der ist ja nun nirgends zu sehen.« Genüsslich kneteten seine Hände den Griff seines schartigen Schwertes. Kein Langes Messer oder ein anderer Trick der bürgerlichen Schmiedekunst, sondern ein tatsächliches Schwert. Unfreiwillig fragte Elyssa sich, wen er dafür getötet hatte.
»Wer seid ihr, und was wollt ihr hier?«, fragte sie scharf. »Es gibt hier nichts von Wert. Ihr habt den Weg umsonst gemacht.«
»Vielleicht kommen wir nicht wegen des Goldes. Vielleicht suchen wir nur das Vergnügen.«
»Sagt, was ihr wollt!«, forderte Elyssa ein weiteres Mal. »Sprecht es nur aus. Ich werde es euch geben, ihr verschwindet, und jeder ist zufrieden.«
Ein vielstimmiges, grölendes Lachen brach über sie herein. Elyssa spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg – vor Scham, aber auch vor Zorn.
»Was ist so komisch?«, verlangte sie barsch zu wissen.
»Ein Weibsbild mit einem Schwert in der Hand, das Forderungen stellt«, antwortete der Rothaarige. »Und denkt, es könnte den Respekt von fünfzehn bis an die Zähne bewaffneter Männer damit gewinnen.«
Elyssa ließ sich nicht beirren. »Dein Name und dein Begehr«, sagte sie übermäßig betont.
Ihr Gegenüber runzelte verärgert die Stirn, hatte sich aber sofort wieder in der Gewalt. »Wir sind Söldner im Dienste von Erzherzog Rudolf IV.«, verkündete er, »und wir sind gekommen, um seine Botschaft im Land zu verbreiten.«
»Und die lautet?«, fragte Elyssa.
Der Mann gab seinem nächsten Nachbarn einen Wink. Dieser nickte kaum merklich und schnitt seiner Geisel beiläufig die Kehle durch.
Ein vielstimmiger Aufschrei vermischte sich mit dem dumpfen, schweren Laut, mit dem der Leib auf dem Boden aufschlug. Für die Dauer einiger Herzschläge wand sich der Mann noch, versuchte verzweifelt, den sprudelnden Fluss des Blutes zum Versiegen zu bringen, indem er beide Hände um den Hals verkrampfte. Dann erschlafften seine Bewegungen.
Mit einem gellenden Schrei und blanker Klinge stürzte Elyssa sich auf den Rothaarigen. Die übrigen Geiseln nutzten die durch die unerwartete Ablenkung entstandene Chance und versuchten ihrerseits, sich aus den Fängen ihrer Peiniger zu befreien, und kaum einen Lidschlag später war der Schankraum erfüllt vom Brüllen und Schreien der Kämpfenden.
Elyssas Gegner reagierte viel schneller, als sie erwartet hatte. Nicht im mindestens überrascht von ihrem Angriff, brachte er sein eigenes Schwert zwischen sich und Elyssa und blockte ihre Klinge mit einer nachlässigen Bewegung ab. Jede Spur höhnischer Herablassung war aus seinen Zügen verschwunden. Er hatte begriffen, dass die Waffe in ihren Händen mehr war als ein Schmuckstück.
Elyssa duckte sich unter dem Stoß ihres Gegners hinweg und versetzte ihm aus derselben Bewegung heraus einen Tritt vors Knie, der ihn wanken und zurücktaumeln ließ. Er grunzte wie ein Eber, den man mit einem Kieselstein beworfen hatte; nicht ernsthaft verletzt, nur gereizt und dadurch noch gefährlicher. Bevor Elyssa zu einem weiteren Schlag gegen ihn ansetzen konnte, führte er seinerseits einen wuchtigen Hieb gegen sie, der ihr glatt den Kopf von den Schultern getrennt hätte, wäre es ihr nicht mit mehr Glück als Geschick gelungen, ihre Klinge im letzten Moment nach oben zu reißen. Elyssa schrie auf und hätte beinahe ihr Schwert fallen gelassen. In ihrem Handgelenk