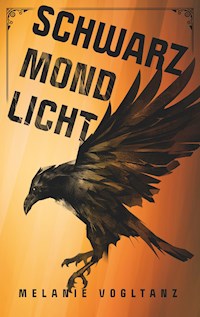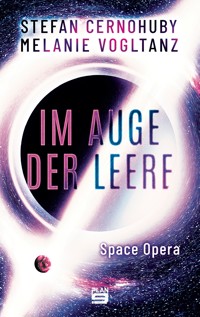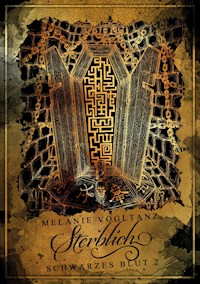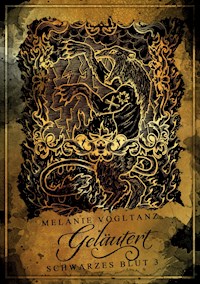
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Schwarzes Blut
- Sprache: Deutsch
Florenz im Jahr 1689: Frieden. Mehr wünscht die Strigoi Elyssandria sich nach einem Leben voller Gewalt nicht von ihrer unsterblichen Existenz. Doch ihr Wunsch rückt in weite Ferne, als eine fanatische Bruderschaft auf sie aufmerksam wird, die sich selbst »Genuinità« nennt. Ihr Ziel: eine »Reinigung« der Welt von allen Trägern des schwarzen Bluts. In ihrem letzten und bislang härtesten Kampf muss Elyssandria sich nicht nur ihren bisher mächtigsten Gegnern stellen, sondern auch jenem dunklen Geheimnis, das sie ein Jahrhundert lang gehütet hat. Vollständig überarbeitete Neuauflage von »Schwarzes Blut: Munditia«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über die Autorin
Melanie Vogltanz hat ihren Magister in Deutscher Philologie, Anglistik und LehrerInnenbildung an der Universität Wien gemacht. Sie wurde 1992 in Wien geboren und hat den berühmt-berüchtigten Wiener Galgenhumor praktisch mit der Muttermilch aufgesogen. Dem klassischen Happy End sagt sie im Großteil ihrer Geschichten den Kampf an, denn auch das Leben endet selten gut.
2007 veröffentlichte sie ihr Romandebüt; weitere Veröffentlichungen im Bereich der Dunklen Phantastik folgten. 2016 wurde sie mit dem »Encouragement Award« der European Science Fiction Society ausgezeichnet. Ihre Bücher wurden für verschiedene Genre-Preise nominiert, darunter für den Seraph und den Deutschen Science Fiction-Preis.
Mehr Informationen auf: http://www.melanie-vogltanz.net
Inhaltsverzeichnis
Wann sterben Geschichten?
Erstes Buch: Verleugnung
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Zweites Buch: Verhandlung
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Drittes Buch: Abschied
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Wann sterben Geschichten?
Ein Vorwort
Die »Schwarzes Blut«-Reihe ist ein Mammut-Projekt, das mich schon seit Beginn meiner Schreibkarriere begleitet. Der erste Band, damals noch unter dem Titel »Maleficus«, entstand bereits im Jahr 2007. 2014 wurde es erstveröffentlicht, und seither ist die Welt erheblich gewachsen. Obwohl Elyssas Geschichte mittlerweile zu Ende erzählt ist, lassen manche Charaktere und Welten einen nie wirklich los, und gerade das Universum von »Schwarzes Blut«, das bevölkert von niemalssterbenden Wesenheiten ist, die voller Hunger nach mehr ihrem Ende trotzen, bietet nach all den Jahren immer noch neue Anreize, neue Winkel, die es zu erforschen gilt. Für mich persönlich liegt der besondere Reiz dabei im Balanceakt zwischen historischer Realität und Fiktion, und über die Jahre hat sich eine Art westliche Alternativgeschichte herausgebildet, die im Spätmittelalter ihren Anfang nimmt und sich bis in die Moderne zieht.
Wann sterben Geschichten? Wenn sie nicht mehr erzählt werden wollen, wenn sie sich leergelaufen haben, aus der Welt gealtert sind. »Schwarzes Blut« ist keine solche Geschichte. Wie die Strigoi und Hemykinen, die sie bevölkern, ist sie immer noch hungrig nach mehr.
Mit »Geläutert« endet Elyssas Geschichte nun zum zweiten Mal, doch was für die einen ein Ende ist, das mag für andere ein neuer Anfang sein. Mehr dazu werde ich erst am Ende enthüllen, denn wie auch meine Geschöpfe, so liebe auch ich das Kryptische.
Nun aber genug der langen Vorrede – ich wünsche viel Vergnügen mit dem Finale der »Schwarzes Blut«-Trilogie!
Erstes Buch
Verleugnung
I.
Ihre Hand war um die heftig blutende Wunde in ihrer Bauchdecke verkrampft. Von ihren Brüsten bis zu ihrem Schoß war der Stoff ihres Kleides schwer und schwarz von Blut, und auch zwischen ihren Beinen spürte sie warme, klebrige Nässe. Eine Wehe durchzuckte ihren Leib. Sie brüllte und krümmte sich. In ihrer Körpermitte spürte sie das Strampeln einer winzigen, im Sterben liegenden Kreatur, die noch nicht das Antlitz der Welt geschaut hatte und dennoch bereits um ihr Leben kämpfte. Obwohl die Schmerzen unerträglich waren und ihr vom Blutverlust schwindelte, zwang sie ihre Beine, weiterzulaufen. Sie wusste, sollte sie stehen bleiben, würden in dieser Nacht zwei Herzen aufhören zu schlagen.
Der Wolf war ihnen dicht auf den Fersen.
Da stolperte sie und fiel der Länge nach hin, die Arme um den geschwollenen Bauch geschlungen.
»Nimm es mir nicht.« Sie gurgelte die Worte mehr, als dass sie sprach, ertrank in ihrem eigenen Blut. »Nimm mir nicht das Letzte, das ich liebe.«
Sie rollte sich herum, versuchte sich aufzurichten, sackte jedoch sofort wieder zusammen. Hart landete sie auf dem Rücken. Ihre Hände tasteten über ihre Bauchdecke, fanden die Verletzung, die ihr der Vater ihres Kindes mit einem schartigen Messer zugefügt hatte. Die Wunde hätte sich längst schließen müssen, doch das tat sie nicht. Mehr und mehr Blut quoll daraus hervor, sehr viel mehr, als ein gewöhnlicher menschlicher Körper fassen konnte.
Es ist auch sein Blut, erkannte sie. Das Messer hat seinen Leib durchdrungen, und nun verblutet er in mir. Mein Sohn. Mein Kind.
Da schoss eine winzige, feucht-rote Hand aus dem Loch in ihrer Bauchdecke und packte ihr Handgelenk. Eine zweite Hand folgte, und dann begann das Wesen, das sie für acht Monde in sich getragen und genährt hatte, ihre Bauchdecke aufzureißen und den Kopf aus der klaffenden Wunde zu pressen. Als sie die blutverschmierte, zu einem Knurren verzerrte Wolfsfratze inmitten ihres zerrissenen Gewebes erblickte, brach ein spitzer Schrei aus ihr hervor.
Florenz, Großherzogtum Toskana, 1689 n. Chr.
»Donna. Donna, wacht auf!«
Stöhnend wälzte Elyssandria sich herum und schlug die Augen auf. Vor ihr schwebte das dunkle Gesicht eines Mädchens, dessen Stirn in Sorgenfalten lag.
»Ihr habt ganz fürchterlich geschrien. Hattet Ihr schon wieder einen schlechten Traum?«
Elyssandria versuchte, ein beruhigendes Lächeln aufzusetzen, doch der Schreck des Nachtmahrs saß zu tief. Noch immer glaubte sie, die ziehenden Schmerzen in ihrem Unterleib zu fühlen.
»Es ist schon gut, Esta. Träume bedeuten nichts. Geh wieder ins Bett, ich werde dasselbe tun.« Sie wischte sich den klebrigen Schweiß von der Stirn.
»Das kommt gar nicht infrage, Donna. Es ist schon helllichter Tag.« Das Mädchen mit dem krausen, schwarzen Haar wirbelte herum und zog ruckartig die Vorhänge auf. Gleißendes Sonnenlicht flutete die Kammer, und Elyssandria kniff zischend die Lider zusammen.
»Ja, das kann ich deutlich sehen.«
»Ich bin schon seit Stunden wach und warte voller Ungeduld auf Euch! Ebenso wie Euer Frühstück, und Eure Kleider, die ich Euch schon bereitgelegt habe. Selbstredend. Von dem Markt habe ich uns süße Orangen aus dem spanischen Königreich mitgebracht, die werden Euch auf der Zunge zergehen! Donna, wann gehen wir wieder einmal auf Reisen? Ihr habt diese alte, zugige Hütte jetzt schon seit Monaten nicht verlassen. Wäre es nicht herrlich, einmal wieder fremde Zungen zu hören und neue Menschen kennenzulernen? Ihr sprecht doch so viele Sprachen, Ihr werdet sie alle vergessen, wenn Ihr sie nicht benutzt! Am Ende der Straße hat ein neues Kaffeehaus eröffnet, wir könnten uns den Orient dampfend heiß in Becher füllen lassen. Ja, das ist eine wunderbare Idee, das werden wir tun! Aber dafür müssen wir Euch erst anziehen. Ihr seid ja noch immer im Bett, Donna.«
Vorwurfsvoll stemmte Esta die Hände in die Hüften und blickte streng auf Elyssandria herab, die sich tatsächlich wieder in die Kissen hatte zurücksinken lassen.
»Später, Esta«, seufzte Elyssandria. »Gib mir noch ein, zwei Stunden.«
»Ihr habt genug geschlafen, so viel Untätigkeit tut Eurem Verstand nicht gut. Rasch, zieht Euch an! Es sei denn, Ihr wollt, dass ich das für Euch erledige«, fügte sie mit sanftem Spott hinzu.
Gemächlich schwang Elyssandria die Beine über den Rand des Bettes und tastete nach den Kleidern, die Esta über einen Stuhl beim Bettende gelegt hatte.
»Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst mir kein Essen besorgen? Du weißt doch, dass mein Magenleiden mir die meisten Gaumenfreuden versagt.«
»Ihr esst viel zu wenig«, beschwerte Esta sich. »Deshalb seid Ihr auch so bleich und mager. Eines Tages werdet Ihr gewiss vor dem vollen Teller verhungern. Warum tut Ihr nicht, was ich Euch rate, und geht zu einem vernünftigen Leibarzt? Der wird Euer Leiden ganz gewiss kurieren.«
»Mein Leiden kann kein Arzt kurieren«, erwiderte Elyssandria halblaut, während sie aufstand und ihr einfaches Leinenkleid überstreifte. Auf dem ungefärbten Stoff waren einige rostrote Flecken zu sehen, die auch mehrfaches Waschen nicht vollständig entfernen würde.
»Oh«, machte Esta, als sie den langen Riss an der Taille entdeckte. »Das Kleid ist ja völlig ruiniert.«
»Du kannst es später nähen.«
»Wie ist das denn passiert?«
Elyssandria dachte an die vergangene Nacht zurück, in der sie einen fahrenden Händler in eine einsame Seitengasse gelockt hatte, um sein venezianisches Blut zu trinken. Unglücklicherweise war der Mann mit den Gefahren dunkler Seitengassen vertraut gewesen und hatte ein Messer bei sich getragen. Wäre sie ein einfacher Straßenräuber gewesen, hätte sie diese Begegnung nicht überlebt.
»Ich muss an einem Nagel hängen geblieben sein«, log sie. »Keine Tragödie, deine Nähkünste haben schon schlimmer zugerichtete Kleider gerettet.«
»Ihr sollt doch vorsichtiger mit Euren Sachen umgehen! Das habe ich Euch schon so oft gesagt, Donna. Wir müssen ein neues Kleid in Auftrag geben lassen. Dieses hat schon so viele Nähte und Flicken, dass man Euch für einen Vaganten halten könnte. Außerdem ist es voller hässlicher Flecken. So kann doch eine Dame wie Ihr nicht herumlaufen.«
»Eine gute Idee.« Elyssandria drückte dem Mädchen eine der Goldmünzen in die Hand, die noch nachts zuvor den Beutel des venezianischen Händlers gefüllt hatten. »Lauf gleich los und erledige das. Und lass dir ruhig viel Zeit dabei, eine so wichtige Aufgabe sollte nicht überstürzt werden.«
»Aber Donna, wir brauchen doch Eure Maße, und …«
»Mein Schneider kennt meine Maße«, fuhr sie Esta über den Mund. Sie hätte ihr die Münze zwischen diese niemals ruhenden Lippen schieben sollen. »Ich vertraue dir, Esta. Du wirst sicher einen schönen Stoff aussuchen.«
Esta nickte eifrig und steckte das Gold ein. »Natürlich, Donna.« Sie war bereits auf dem Weg zur Tür, als sie sich noch einmal umwandte. Eine steile Falte erschien zwischen ihren Augenbrauen. »Ihr schickt mich aber nicht bloß weg, weil Ihr wieder den ganzen Tag im Bett verbringen wollt?«
Elyssandria lächelte müde. So eine kleine Füchsin. »Geh endlich. Wenn du dich beeilst, bist du rechtzeitig zurück, um mich aus meinem Mittagsschlaf zu reißen.«
»Oh, das bin ich gewiss, Donna!« Und damit verschwand Esta.
Sobald die Tür ins Schloss gefallen war, ließ Elyssandria sich mit einem schweren Seufzer rücklings ins Bett fallen. Esta war ein gutes Mädchen, und das Beste, das Elyssandria in ihrem über dreihundert Jahre andauernden Leben widerfahren war. Nur zu gut erinnerte sie sich noch an den Tag, als sie das erste Mal auf Esta getroffen war. Sie musste etwa fünf gewesen sein. Ihr magerer, schmutziger Körper war in Lumpen gehüllt gewesen, ihr schwarzer Lockenkopf ungekämmt und voller Flöhe, Arme und Gesicht von zahlreichen Blutergüssen bedeckt, die Füße nackt und zerschunden. Damals hatte nicht viel auf das lebenslustige, pausenlos plappernde Mädchen hingewiesen, das sie heute war.
Elyssandria hatte sich bereits eine knappe Woche in Rom aufgehalten – nur eine von vielen Städten, die sie durchstreift hatte, seit sie Ungarn und ihrer Grafschaft vor mehr als einem Menschenleben den Rücken gekehrt hatte. Auf dem Markt hatte das schmutzige Kind sie angerempelt und ihren Geldbeutel vom Gürtel geschnitten. Obwohl es Elyssandria keine große Anstrengung gekostet hätte, die Diebin am Arm zu packen und ihr das Diebesgut wieder zu entwinden, hatte sie keinen Finger gerührt, sondern dem Mädchen nur schweigend nachgestarrt, während es geduckt in der Menge untertauchte.
Sie folgte dem Kind nicht – das war auch gar nicht notwendig. Nach Einbruch der Dämmerung machte sie seine Spur mit ihren feinen Sinnen ausfindig. Das Mädchen hatte sich in eine verfallene Ruine zurückgezogen, eingewickelt in eine schäbige Decke, die nach Pferd stank. Als Elyssandria sie sah, vergaß sie augenblicklich, aus welchem Grund sie sich auf die Suche nach der kleinen Diebin begeben hatte. Hatte sie sie töten wollen? Wenn der Hunger auf das reine, süße Kinderblut sie gelockt hatte, dann war dieses Verlangen im selben Moment erloschen, als sie den dürren Körper unter der von Wanzen wimmelnden Pferdedecke gewahrte. Auch die Münzen, die das Mädchen sich angeeignet hatte, spielten keine Rolle. Elyssandria hatte sie aus den erstarrenden Händen blutleerer Leichen gelöst, sie in Häusern aus staubigen Verstecken gesammelt, deren Besitzer währenddessen ihr Leben in ihren kalten, klammen Laken ausgehaucht hatten. Keine davon hatte ihr jemals rechtmäßig gehört, und zweifellos hatte das Kind das Gold nötiger als sie.
Eine ganze Weile stand Elyssandria wie erstarrt vor dem improvisierten Lager der kleinen Diebin und wachte über ihren unruhigen Schlaf. Die Art und Weise, wie das Mädchen sich in seiner schäbigen Decke von einer Seite auf die andere warf, kam Elyssandria unangenehm bekannt vor. Sie selbst schlief oft tagelang nicht, um den Geistern ihrer Vergangenheit keine Gelegenheit zu geben, ihre geschärften Klauen in Elyssandrias Verstand zu schlagen. Natürlich versuchten sie dies auch, wenn Elyssandria wach war – doch in Morpheus’ Reich war Elyssandria ihnen hilflos ausgeliefert.
Während sie dem schmalen Kinderkörper dabei zusah, wie er sich unter nächtlichen Schreckensbildern aufbäumte, kam sie nicht umhin, sich zu fragen, welcher Natur wohl die Erinnerungen waren, die einen so jungen Geist quälten. Vielleicht waren es auch gar keine vergangenen Geschehnisse, sondern die Angst vor zukünftigem Elend, die die nächtliche Ruhe des Mädchens störte?
Erst, als sich der Himmel jenseits der modernden Mauerreste grau färbte, verließ Elyssandria die Bettstatt und verschwand ebenso lautlos, wie sie gekommen war, ohne dem Kind ein Haar zu krümmen.
Sie hätte nicht erwartet, dass sie das Mädchen jemals wiedersehen würde.
Damals unterschied sich Elyssandrias Leben kaum von dem einer gemeinen Zecke: Sie setzte sich im Nacken einer Stadt fest, bis ihr Leib rund und schwer vom Blut war, um dann abzufallen und nach einem neuen Wirt zu suchen. So handhabte sie es seit Jahrzehnten. Indem sie immer in Bewegung blieb, sich nicht an einen Ort oder gar an einen Menschen band, konnte niemand auf die namenlose Frau mit dem schlohweißen Haar aufmerksam werden, die auf dem Markt den Einkäufern mehr Beachtung schenkte als den Waren. Die Toten, die sie auf ihrem Weg hinterließ, waren nie zahlreich genug, um die Bürger in Unruhe zu versetzen, und auf diese Weise entdeckte niemand das saugende Ungeziefer oder versuchte gar, es mit der Klinge aus dem Fleisch zu lösen. Es war kein befriedigendes Leben – aber zumindest ein ungestörtes.
Als einige Wochen später die Zeit gekommen war, Rom den Rücken zu kehren und weiterzuziehen, passierte Elyssandria erneut den Marktplatz. Schon von weitem hörte sie das regelmäßige Klatschen von Haut auf Haut, das ihre Aufmerksamkeit sofort auf sich zog. Schon so manches Opfer einer außer Kontrolle geratenen Schlägerei hatte ihren Bauch gefüllt, es lohnte sich immer, Kampfgeräuschen zu folgen. Innerhalb weniger Lidschläge hatte sie die Quelle des Geräusches im Markttrubel ermittelt: Ein breit gebauter, stämmiger Händler hatte die kleine Diebin am Handgelenk gepackt und prügelte mit der freien Rechten ohne Unterlass auf sie ein. Weitere Händler hatten sich um die beiden geschart, die Mienen finster und zornig. Elyssandria wusste sofort, dass ihr Unmut keineswegs dem bulligen Kerl galt, der auf ein schutzloses Kind eindrosch. Das Mädchen hatte Lider und Lippen fest zusammengepresst, stur jeden Schmerzlaut unterdrückend. Es bat nicht um Hilfe oder Gnade, denn es wusste, es würde nichts davon erhalten.
Beim Anblick des hilflosen Kindes, das dem Jähzorn all dieser Erwachsenen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war, kochte eine weißglühende Wut in Elyssandrias Magen empor.
»Was soll das werden?« Ihre Stimme zuckte wie ein Peitschenschlag über die Köpfe der Händler hinweg.
Der Mann, der die Kleine geschlagen hatte, hob den Kopf. Sein Atem ging schwer vor Anstrengung. Auf seiner behaarten Oberlippe perlte Schweiß. »Misch dich nicht in Dinge ein, die du nicht verstehst, Weib. Seit Monaten rafft die Göre hier auf dem Markt zusammen, was sie in ihre schmutzigen Finger kriegen kann. Dieses Balg hat uns zum letzten Mal bestohlen. Es kann doch nicht angehen, dass rechtschaffene Kaufleute wie wir uns das Verhalten dieser miesen Elster gefallen lassen müssen.« Um seine Worte zu unterstreichen, langte er noch einmal zu. Das Mädchen knickte in die Knie, aber außer einem dünnen Blutsfaden drang nichts über seine Lippen.
Elyssandria verschränkte die Arme vor der Brust und ließ ihren Blick über die Gesichter der Umstehenden schweifen. »Dann haltet ihr dies also für eine angemessene Strafe für ihre Vergehen, Signori?«
Die Männer nickten einhellig.
»Ich verstehe. Obgleich ich zugeben muss, dass ihr die Messlatte für eure eigene Strafe damit reichlich hoch ansetzt.«
Verständnislos sahen die Händler einander an. Als Elyssandria lächelte, brachen die Männer in unsicheres Gelächter aus. Einen Herzschlag später war ihnen jedes Lachen im Halse stecken geblieben.
Elyssandria befand es nicht einmal für nötig, ihr Schwert zu ziehen. Mit bloßen Händen streckte sie zwei Händler gleichzeitig nieder. Als ein dritter einen Arm um ihre Hüfte schlang, rammte sie ihm das Knie in seine Männlichkeit. Anders als die Diebin schrien die Händler spitz und schrill, und nicht wenige nahmen hastig Reißaus, nachdem sie gesehen hatten, was ihren Zunftbrüdern widerfahren war. Zum Schluss blieb nur der bullige, behaarte Mann übrig, der das Mädchen an den Haaren gepackt hielt und Elyssandrias Treiben mit einer Mischung aus Zorn und Fassungslosigkeit beobachtet hatte.
Elyssandria fixierte seinen Blick mit ihrem. »Gib mir das Mädchen.«
Er ließ die Kleine los, die kraftlos auf dem Pflaster zusammenbrach. Das Mädchen hatte den Schlägen tapfer standgehalten, doch es war und blieb ein Kind.
»Komm her und hol sie dir, du verrücktes Weibsstück!«, forderte der Händler und zog ein Messer aus seinem Gürtel.
»Ein schönes Messer«, sagte Elyssandria. »Bestimmt macht es sich hervorragend in deinen Eingeweiden.«
Mit einem röhrenden Brüllen stürmte er auf sie zu. Ohne auch nur zu versuchen, auszuweichen, fing sie seinen Arm in der Luft ab, machte einen Schritt vorwärts und verdrehte ihn mit einem harten Ruck, bis das Gelenk knackte. Der Kampfschrei des Händlers verwandelte sich in ein schrilles Kreischen, das Messer entglitt seinem Griff.
»Willst du tanzen?«, hauchte sie ihm ins Ohr.
»Lass los!«, jammerte er. »Du wirst mir den Arm brechen!«
»Danke für diesen ausgezeichneten Rat.«
Sie verstärkte den Druck, und ein helles Knacken ertönte. Die Schreie des Mannes verstummten abrupt, er verdrehte die Augen und kippte zur Seite. Elyssandria ließ ihn los, sodass er hart auf dem Boden aufschlug.
»Ein erbärmlicher Tänzer«, stellte sie trocken fest. Sie bückte sich nach dem Messer, schob es unter ihren Mantel und stieg über den Händler hinweg, ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen.
Das Mädchen arbeitete sich mühsam in eine sitzende Position hoch. Seine Augen waren ebenso schwarz wie sein Haar und wurden riesig, als es Elyssandria nahen sah. In einer Armeslänge Abstand ging sie in die Hocke, sodass sie sich auf Augenhöhe befanden.
»Ich bin Elyssandria. Wie ist dein Name?«
»Esta.«
»Wo sind deine Eltern, Esta?«
»Tot. Schon lange. Die Pest, glaub ich.«
Elyssandria nickte. Auch ihre eigenen Eltern waren einst der Pest zum Opfer gefallen. Die Erinnerung daran lag bereits so weit zurück, dass nur der intensive Verwesungsgestank ihrer von Beulen zersetzten Kadaver in ihrem Gedächtnis haften geblieben war. Alles andere hatte die Zeit fortgewischt wie Linien in einer Schicht aus Asche. Seit jener verheerenden Epidemie hatten die Menschen die tödliche Krankheit wieder und wieder zurückschlagen können, doch die Ärmsten der Bevölkerung waren noch immer nicht gefeit vor dem Schwarzen Tod. Elyssandria war in den vergangenen Jahrzehnten an zahlreichen Orten gewesen, und die Seuche hatte ihr aus allen Teilen Europas mit fauligen Zähnen zugegrinst.
»Hast du Angst vor mir?«, fragte sie.
Esta schüttelte mehrmals heftig den Kopf, dass den Flöhen in ihrem Haar schwindeln musste.
Elyssandria lebte bereits zu lange auf dieser Welt, um noch an so etwas wie Zufälle zu glauben. Als sie dieses energische Kopfschütteln und die Glut in den dunklen Augen sah, die rasch zu einem lodernden Feuer emporwachsen konnte, wusste Elyssandria, dass ihre Zeit in Einsamkeit vorüber war.
Seit jenem Tag auf dem römischen Markt war Esta nicht mehr von ihrer Seite gewichen. Sie war zu ihrem Schatten geworden, ihrer Dienerin, wenn man das Kind selbst fragte. Elyssandria hatte mehrmals versucht, sie von dieser fixen Idee abzubringen, doch Esta war der festen Überzeugung, dass jemand, der einem das Leben rettete, dieses Leben besaß, und nichts hätte sie vom Gegenteil überzeugen können.
Für Elyssandria selbst jedoch war sie keine Dienerin.
Sie war ihr Leben.
Elyssandria erhob sich seufzend von ihrem Bett und ging zu dem in Messing eingefassten, mannshohen Spiegel. Von einer Kommode aus dunklem Eichenholz nahm sie eine Bürste, die sie durch ihr schlohweißes, langes Haar zog.
Nicht nur Estas Leben gehörte Elyssandria, auch Elyssandrias Leben lag seit diesem Tag in den Händen des Mädchens. Fast zehn Jahre war es her, dass sie die junge Diebin unter ihre Fittiche genommen hatte, und seither hatte sich ihr Alltag rapide gewandelt.
Sie stockte mitten in der Bewegung. Ihre Finger spielten um den Bürstengriff, als die Erinnerungen aus ihrem Unterbewusstsein emporschwappten wie Jauche aus einer Sickergrube. Seit man sie als Gräfin Báthory in ungeweihter Erde verscharrt hatte, war mehr als ein Menschenleben vergangen. Christian, der Mann, den sie einst geliebt hatte, hatte sie an den Palatin verraten und sie einem grässlichen Ende überantwortet. Seit ihrer Auferstehung von den Toten hatte sie jeden Tag damit gerechnet, dass er sie wieder aufspüren und beenden würde, was sie beide einst vor so langer Zeit begonnen hatten. Aber während ihrer rastlosen Reise über die Kontinente war sie ihm kein einziges Mal begegnet.
Hatte er sie aufgegeben? Oder war er selbst nicht mehr am Leben?
Die Wahrheit war wohl, dass er nie die Kraft gehabt hatte, es zu beenden. Obgleich er ihr mehrfach den Tod wünschte, gelang es ihm nicht, den entscheidenden Schritt zu wagen, sie endgültig aus dieser Welt ins Nichts zu verbannen. Dafür liebte er sie zu sehr, trotz allem. Er konnte ihr nicht verzeihen, aber er wollte sie auch nicht hassen, nicht mit ihr kämpfen, sie nicht töten.
Er war schon immer der Schwächere gewesen. Anders als Christian hatte sie den Mut gehabt, ihn für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen, Leben für Leben zu vergelten. Sie hatte die Konsequenzen gezogen.
Unbewusst fasste sie nach ihrem Bauch, in dem sie noch immer ein Echo der Schmerzen aus ihrem Traum zu spüren glaubte.
Seit ihrer Auferstehung auf ungarischem Boden war Elyssandria eine rastlos Reisende gewesen. Sie hatte halb Europa gesehen, hie und da ein Leben gestohlen, da und dort eines geschont, und auf diese Weise waren die Jahrzehnte an ihr vorübergezogen. Manche Tage waren finsterer als andere, ihre Glieder schienen das Dreifache zu wiegen und verbotene Gedanken krochen durch ihr Hirn wie hungrige Nacktschnecken. An solchen Tagen war die Versuchung groß, ihre Tarnung endgültig fahren zu lassen, sich der Menschheit zu offenbaren und ihre überflüssige Existenz in einem Leuchtfeuer enden zu lassen.
Aber irgendwie hatte sie diesen Gedanken immer entfliehen können – hatte fremde Orte aufgesucht, deren Reize ihren Verstand zu stark beschäftigten, als dass er sich auf gefährliche Pfade verirren konnte, hatte sich in unterschiedlichen Fertigkeiten erprobt oder neue Sprachen gelernt. Nichtsdestotrotz hatte sie in den vergangenen Jahrzehnten erfahren, dass Christian recht gehabt hatte.
Nur ein Narr wollte ewig leben.
Doch manchmal, wenn man Glück hatte, bekam man etwas Aufschub geschenkt. Esta war ihr Aufschub.
Schon bald, nachdem Elyssandria die kleine Diebin von der Straße geholt hatte, entfaltete sich ihr kompromisslos fröhliches Wesen. Ihre Redseligkeit, Freundlichkeit und Heiterkeit machten es Elyssandria beinahe unmöglich, in eine trübsinnige Stimmung zu verfallen. Wie ein Hund, der ein nahendes Erdbeben spürt, vermochte Esta Elyssandrias Launen zu wittern und wirkte so dem schlimmsten Schaden entgegen. Gleichzeitig hatte Elyssandria niemals den Eindruck, dass Estas Einstellung zum Leben naiv war – sie hatte ein geradezu beängstigendes Talent dafür, Dinge, die ernsthaften Grund zur Sorge gaben, von Banalitäten zu unterscheiden. Wenn Not am Mann war, hielt sie sich nicht mit leeren Phrasen auf, sondern packte mit an und war mit Lösungsvorschlägen zur Stelle. Anders als Elyssandria hielt Esta nichts davon, Problemen auszuweichen. Wenn ich nicht auf sie zugehe, sondern an ihnen vorbei, fallen sie mir irgendwann in den Rücken, wurde sie nie müde zu sagen; eine überraschend vorausschauende und reife Sichtweise für ein Mädchen ihres Alters.
Elyssandrias Bewunderung für das Kind wandelte sich mehr und mehr in warme Zuneigung, ohne dass sie es bewusst registrierte. Erst die Angst, ihre Begleiterin wieder zu verlieren, hatte ihr ihre eigenen Empfindungen vor Augen geführt. Eines Nachts, etwa ein Jahr, nachdem sie Rom gemeinsam den Rücken gekehrt hatten, hatte bellender Husten Elyssandria aus dem Schlaf gerissen. Estas glühend heiße Stirn und das Rasseln in ihrem Brustkorb erschreckten sie zu Tode. Tagelang harrte sie an ihrem Lager aus. Ihren Unterschlupf verließ sie nur, um Medizin zu besorgen.
In dieser Zeit war Elyssandria zum ersten Mal klar geworden, wie viel das Kind ihr wirklich bedeutete. Esta war nur ein einfaches Menschenmädchen, aber sie war auch Elyssandrias einzige Verbindung zu einem normalen Leben, ihr Anker, der sie davon abhielt, von der tosenden Brandung ihrer Erinnerungen mitgerissen zu werden. Als Estas Fieber endlich wieder sank, war Elyssandrias Erleichterung unbeschreiblich gewesen.
In diesen Nächten hatte sie begriffen, was es bedeutete, die Verantwortung für ein sterbliches Leben zu tragen. Sie unternahm keine großen Reisen mehr, ihre Aufenthalte in den einzelnen Städten wurden ausgedehnter. Anstatt die Nächte durchzuwandern, mietete oder kaufte sie kleine Häuschen an der Peripherie, die sie mit bescheidenem Mobiliar ausstattete. Übernachtungen in schäbigen Ruinen, unter Brücken oder unter freiem Himmel gehörten fortan der Vergangenheit an. Sie begann, einen bescheidenen Besitz anzuhäufen und das Gold zu sparen, das sie ihren Opfern abnahm. Aus Gewohnheit wechselte sie weiterhin alle paar Jahre ihren Standort, doch die Abstände, die sie zwischen ihre bereits gewilderten Gebiete brachte, schrumpften mit jedem Umzug weiter.
In diesem Haus an der Stadtgrenze von Florenz lebten sie nun bereits vier Jahre lang, und je mehr Zeit verging, desto mehr ließ Elyssandrias Bedürfnis nach, diesen Ort wieder zu verlassen. Zu einem großen Teil war dies Estas Verdienst. Mit dem Mädchen an ihrer Seite verspürte sie nicht mehr jenen Drang, vor sich selbst zu fliehen, ihre Todessehnsucht verflüchtigte sich. Ein neues, bislang unbekanntes und durch und durch menschliches Sehnen erwachte in ihrer Brust: der intensive Wunsch, anzukommen. Tief in seinem Herzen, so dachte Elyssandria, sehnte sich jeder Mensch nach einem Platz auf der Welt, der ihm ganz allein gehörte, an dem er sich sicher fühlte und geborgen. Diese bescheidene Hütte am Rande von Florenz konnte dieser Ort sein. Sie musste es nur zulassen.
Elyssandria war so tief in Gedanken versunken, dass sie kaum bemerkt hatte, wie sie die Bürste wieder an ihren Platz gelegt und sich an den Rand ihres Bettes gesetzt hatte. Wie von selbst war ihre Hand in die Spalte zwischen Matratze und Wand geglitten. Ihre Finger schlossen sich um den Griff der Waffe, die sie dort aufbewahrte, und zog sie hervor. Liebevoll strich sie über den zweifarbigen Stahl. Dieses Schwert war ihr länger treu gewesen als jeder Mensch, dem sie in ihrem langen Leben begegnet war. Nach all den Jahren war es noch immer scharf und tödlich, der Stahl mit den feinen Gravuren darin makellos. Zahlreiche Schmiedehände hatten es gewetzt, hatten Schrammen ausgebessert und den Stahl poliert, sodass die Klinge im Laufe der Jahre dünner und leichter geworden war. Das Leder, das das Heft umgab, war bereits Dutzende Male ausgetauscht worden. Als Elyssandria ihren Griff verstärkte, knarzte es leise – wie ein Freund, der wohlmeinend seufzte.
Ein leises Lächeln breitete sich auf ihren Lippen aus. Seit sie mit Esta zusammenlebte, trug sie das Schwert nur noch selten. Durch ihr Zusammenleben mit dem Mädchen hatte sich so manches geändert – vieles zum Guten.
Nachdem sie es sorgfältig poliert hatte, verbarg sie das Schwert wieder in seinem Versteck und strich sorgfältig das Leinen glatt. Dann stand sie auf und wühlte in der Truhe, die ihren bescheidenen Besitz beinhaltete, nach einem Bogen Papier und einem halb aufgebrauchten Kohlestift. Bereits in den ersten Jahren ihrer einsamen Reise hatte sie entdeckt, dass Malen ein wirksames Mittel gegen die Melancholie darstellte. Durch ihre nächtlichen Raubzüge besaß sie immer ausreichend Gold, um sich die kostspieligen Materialien leisten zu können.
Obwohl Elyssandria noch nie die Meinung eines Außenstehenden zu ihrem Schaffen gehört hatte, wusste sie dennoch, dass sie ein gewisses zeichnerisches Talent hatte. Vielleicht lag es daran, dass sie in ihrem langen Leben schon mehr von der Welt gesehen hatte als irgendein Mensch, vielleicht sahen ihre messerscharfen Augen auch Details, die denen der Sterblichen verborgen blieben. Gleichwie, Elyssandria genoss es, sich in den schwarz-weißen Silhouetten auf dem Papier zu verlieren. Auf diese Weise konnte sie Stunden zubringen.
Sorgsam legte sie den Bogen auf dem Schreibpult zurecht und setzte den Kohlestift auf. Durch das geöffnete Fenster strömte warmes Sonnenlicht herein und beleuchtete das Papier, sodass es von innen heraus zu strahlen schien. Elyssandria schloss die Augen und ließ die Bilder ihren Verstand fluten, bis sie eines gefunden hatte, das ihr gefiel. Als die Kohle in ihrer Hand über das Blatt zu fliegen begann, war der grässliche Albtraum bereits vollständig aus ihrem Gedächtnis gelöscht.
II.
Die Sonne war seit Stunden hinter dem Horizont versunken, und Esta schlief tief und fest, wie jede Nacht. Das Gewicht der Waffe an Elyssandrias Seite, die sie mehr aus nostalgischen Gründen denn aus Notwendigkeit umgelegt hatte, wirkte vertraut und beruhigend. Es war Elyssandrias Glück, dass das Mädchen sich am Tage so sehr verausgabte, dass es nach Einbruch der Dunkelheit schlief wie ein Stein. Nicht einmal ein Erdbeben hätte es aus ihrem tiefen Schlummer reißen können, und darüber war Elyssandria heilfroh. Wäre es anders gewesen, hätte sie niemals zehn Jahre lang ihr finsteres Geheimnis vor Esta verbergen können. Aber Elyssandria machte sich nichts vor. Das Mädchen hatte nicht nur wie ein Rabe gestohlen, es verfügte auch über denselben tückischen, messerscharfen Verstand. Sie war bereits fünfzehn, fast eine junge Frau, und bald wäre auch der letzte Rest kindlicher Naivität von ihrem Geist abgefallen. Früher oder später musste sie die Wahrheit erfahren, und wenn es soweit war, würde sich zeigen, wie unerschütterlich ihr Vertrauen in ihre Donna tatsächlich war.
Elyssandria verdrängte diese unangenehmen Gedanken und konzentrierte sich wieder auf den Weg, der vor ihr lag. Da sie nun schon seit einigen Jahren in Florenz lebte, wurde es zunehmend schwieriger, passende Opfer ausfindig zu machen. Vor einem knappen Jahr war sie dazu übergegangen, ihre Raubzüge auf die Nachbarortschaften auszudehnen, doch ihre Möglichkeiten waren stark begrenzt. Sollte sie nicht vor Sonnenaufgang zurück sein, würde Esta Verdacht schöpfen oder, noch schlimmer, sich Sorgen machen, und so blieb nur eine Handvoll kleiner Siedlungen, die in ihrer Reichweite lagen. Gleichzeitig wuchs mit jedem Opfer, das sie nahe ihrem eigenen Nest riss, die Gefahr, entdeckt zu werden. Seit Stephanus sie vor über dreihundert Jahren verwandelt hatte, war das Wissen der Menschen über die Unsterblichen beängstigend angewachsen, und obwohl das Meiste abergläubischer Humbug war, hatte ein Strigoi es in diesem Zeitalter um ein Vielfaches schwerer als in den alten Tagen.
Es war eine vorzügliche Nacht für ein gepflegtes Mahl. Der Himmel war klar und voller Sterne, die neugierig auf Elyssandria herablugten, der Mond eine weiße, strahlende Sichel, die wie ein grinsendes Maul am Firmament prangte. Sein Licht war hell genug, dass ihre scharfen Augen der Finsternis jedes Geheimnis entlocken konnten, würde einem menschlichen Blick jedoch nur diffuse Schatten enthüllen. Das Raubtier, das sie tagsüber so sorgsam in der hintersten Ecke ihres Bewusstseins wegschloss, rekelte sich.
Mit angespannten Sinnen folgte Elyssandria dem Lauf des Arnos, der sich wie eine pulsierende, blaue Vene durch Florenz zog. Das leise Plätschern des Stromes und die gedämpften Laute der Schläfer in den Häusern ringsum waren die einzigen Geräusche, die Elyssandria begleiteten. In dieser Nacht, so beschloss sie, würde sie wagen, sich direkt an der reichgedeckten Tafel der Stadt zu bedienen.
Sie war kaum eine Stunde unterwegs, als ein aufwallender Windstoß plötzlich den unverkennbaren Geruch von frischem Blut an ihre Nase trug. Unvermittelt versteiften sich ihre Muskeln, jeder rationale Gedanke gefror in ihrem Verstand. Wie von selbst setzte sich ihr Körper in Bewegung.
Der Blutgeruch wurde intensiver, und je näher sie kam, desto mehr zweifelte sie daran, dass es sich um das Blut eines Menschen handelte. Eine düstere Vorahnung nahm in ihrem Kopf Gestalt an. Sie war nicht so naiv, anzunehmen, dass sie der einzige Strigoi in der ganzen Toskana war, dennoch verstörte sie diese Witterung. In dieser Hinsicht waren Strigoi wie Katzen: Jeder beanspruchte sein eigenes Revier, und sollte er einen Eindringling wahrnehmen, waren die einzigen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen, sich zu trollen oder den anderen auszuschalten. Da Elyssandria zu den ältesten und mächtigsten Vertretern ihrer Art zählte, zogen es die meisten Blutsauger vor, einen weiten Bogen um sie zu machen.
Die Fährte führte sie zu einer niedrigen Brücke, die sich wie ein tastender Arm über den Arno spannte. Mit einem Mal war sie heilfroh, dass sie ihr Schwert bei sich hatte.
Unter der Brücke lag ein lebloser Körper. Elyssandria musste nicht näher hinsehen, um zu wissen, dass der intensive Gestank von ihm ausging. Sie bückte sich, packte den Strigoi im Nacken und zog ihn hoch. Dabei rollte sein Kopf von einer Seite zur anderen, und halb geronnenes Blut lief aus seinem Mundwinkel. Seine Augen waren weit und starr, in seiner Kehle klaffte eine fleischige, ausgefranste Wunde. Was Elyssandria jedoch weit mehr beunruhigte, war die Farbe seines Haares: schmutzig-grau.
Beinahe angewidert ließ sie los, und der Tote landete mit einem weichen, dumpfen Laut auf dem Pflaster. Die Wunde, die der Strigoi erlitten hatte, mochte tief sein, doch es benötigte weit mehr, um einem Unsterblichen das Lebenslicht auszublasen – es sei denn, er war nicht mehr unsterblich gewesen, als ihm jemand die Kehle zerrissen hatte. Elyssandria kannte nur einen einzigen Menschen, der die Mittel für eine solche Tat besaß.
Hinter ihr platschte ein Stein ins Wasser.
Blitzschnell wirbelte sie herum und zog in derselben Bewegung ihr Schwert. »Eric?«, fragte sie zweifelnd.
Ein vibrierendes, dunkles Grollen antwortete ihr, ein Laut, der an einen tiefliegenden Urinstinkt in ihrem Körper rührte. Sofort stellten sich die feinen Härchen in ihrem Nacken auf.
Nicht Eric, dachte sie grimmig.
»Wer ist da?«
Das Grollen wurde lauter. Da löste sich ein gedrungener Schatten aus der Finsternis und warf sich ihr entgegen. Elyssandria hatte den Angriff erwartet und empfing den anderen mit blankgezogener Klinge. Ein großer, fellbedeckter Körper prallte gegen sie, und Stahl traf auf Kiefer. Aus dem Brustkorb des Angreifers drang ein schrecklich anzuhörendes, rasendes Kreischen, wie Elyssandria es noch nie von einem Wesen gehört hatte. Der Leib des anderen schien nur aus wirbelnden Klauen und schnappenden Fängen zu bestehen.
Vom Ungestüm des anderen vor den Kopf gestoßen, wich Elyssandria einen schwankenden Schritt zurück. Der Wolf hatte seine Kiefer fest um ihre Klinge geschlossen, seine gewaltigen Pranken lagen auf ihren Schultern und rissen ihr Kleid und die Haut darunter in Fetzen. Für die Dauer weniger Herzschläge war sie dem anderen so nahe, dass sie ihr eigenes Spiegelbild in seinen riesigen, pechschwarzen Augen erkennen konnte.
Mit einem atemlosen Schrei stieß sie den Hemykin zurück, der einige Ellen nach hinten geschleudert wurde und dann sicher auf allen Vieren aufkam. Sein Kopf war gesenkt, die Ohren angelegt, und aus seinem Maul troff dunkles Blut. Ihre Klinge musste ihm verheerende Wunden an Zahnfleisch und Gaumen zugefügt haben, doch er schien den Schmerz nicht einmal wahrzunehmen.
»Wer bist du?«, fragte sie, diesmal lauter. Und eine innere Stimme fügte hinzu: Was bist du?
Der Körper des Wolfes war von schneeweißem Fell bedeckt, seine Augen schwarz wie Kohlen. Selbst für einen Hemykin war er riesig; in geduckter Haltung reichte sein Kopf bis an ihr Kinn. Von der Nase bis zur Schwanzspitze musste er mindestens zwei Manneslängen messen. Was sie jedoch am meisten irritierte, war der durch und durch unbekannte Geruch, der von ihm ausging. Kein Hemykin, den sie je in ihrem Leben getroffen hatte, und das waren zahlreiche gewesen, hatte vergleichbar gerochen. Hätte sie die Augen geschlossen, wäre es ihr unmöglich gewesen, zu sagen, welcher Art ihr Angreifer angehörte.
»Hast du diesen Strigoi vergiftet und getötet?«, fragte sie, ohne das Schwert auch nur einen Fingerbreit zu senken.
Die Augen des Weißen zuckten umher, suchten fieberhaft nach einer Schwachstelle in ihrer Verteidigung. Er wusste ebenso gut wie Elyssandria, dass er seine Chance, sie zu überwältigen, vertan hatte. Zuvor hatte er den Vorteil der Überraschung auf seiner Seite gehabt. In einem Zweikampf jedoch würde er, unbewaffnet, wie er war, unterliegen müssen.
Sie machte einen Schritt auf ihren Gegner zu. »Antworte!«, verlangte sie.
Der Hemykin legte die Ohren an und stieß ein langgezogenes, melodisches Heulen aus. In der Befürchtung, dass er Verstärkung anforderte, machte sie einen Satz nach vorne und ließ ihr Schwert in einem beidhändigen, kraftvollen Schwung auf ihn niedergehen. Sie verfehlte ihn um Haaresbreite. Mit einem Knurren wirbelte er um die eigene Achse und stürmte davon.
»Bleib hier!«, schrie Elyssandria und setzte zur Verfolgung an.
Da ertönte ein schweres Klatschen. Der Wolf war in den Arno gesprungen und entfernte sich rasch paddelnd. Ungehemmt fluchte sie. Sie hätte ihm nachspringen können, doch durch das Gewicht von Waffe und Kleidung war sie im nassen Element klar im Nachteil. Selbst wenn sie ihn einholte, würde er sie mit seinem starken Kiefer in Stücke reißen, während sie noch darum kämpfte, an der Oberfläche zu bleiben.
Tatenlos musste sie zusehen, wie der weiße Wolf in die Nacht verschwand.
Nach dieser Begegnung versuchte Elyssandria nicht einmal, Schlaf zu finden. Wie so oft, wenn ihre Gedanken rastlos waren, arbeitete sie weiter an ihrem Bild. Als sie es an diesem Morgen angefangen hatte, waren die groben Konturen eines Wolfes zu erkennen gewesen. Nun, da sie im Schein einer Öllampe die Einzelheiten herausarbeitete, nahm das Abbild mehr und mehr die Züge des weißen Riesen an, der ihr unter der Brücke begegnet war. So sehr sie es auch versuchte, es gelang ihr einfach nicht, diese tiefschwarzen, starren Augen aus ihrem Gedächtnis zu verbannen. Dachte sie an diesen wilden Blick, spürte sie überdeutlich, wie sich eine nahende Bedrohung wie ein Gewitter über ihrem Kopf zusammenbraute. Zum ersten Mal wünschte sie, sie hätte Esta nicht in ihre Obhut genommen. In ihr lauerte die düstere Gewissheit, dass sie das Mädchen vor dem, was da nahte, nicht beschützen konnte.
Es war nicht einmal der Wolf alleine, der sie beunruhigte. Noch viel beängstigender war die Art und Weise, wie der Strigoi zu Tode gekommen war. Gedankenverloren ließ Elyssandria ihre Finger durch ihr schlohweißes Haar gleiten – ein Andenken an ihre Begegnung mit einer für Unsterbliche hochgefährlichen Substanz, die sie nur knapp überlebt hatte. Mortalitas hatte Eric seine leichtsinnige Schöpfung genannt – die Sterblichkeit. Ein allzu passender Name.
Nur widerstrebend dachte sie an jene Zeit zurück, als sie nicht nur wieder sterblich gewesen, sondern obendrein mit rasender Geschwindigkeit gealtert war. Angst, Hilflosigkeit und Verzweiflung waren ihre ständigen Begleiter gewesen. Es hätte nicht viel gefehlt und diese Erfahrung wäre ihre letzte gewesen. Seit Jahrzehnten versuchte ihr Geist, diese Zeit aus ihren Erinnerungen zu verbannen, aber jedes Mal, wenn sie in einen Spiegel blickte oder ein Windstoß ihr Haar vor ihre Augen wehte, gemahnten die Spuren des Alters sie an ihre eigene Verwundbarkeit.
In Gedanken versunken versah sie den Pelz ihres Wolfes mit Details, schraffierte die feinen Härchen in der drohend gesträubten Nackenmähne. Dass das Gift nach all der Zeit in Florenz auftauchte, konnte einfach nichts Gutes bedeuten. Bei dem bloßen Gedanken daran, dass sie es wieder mit der Mortalitas zu tun bekommen könnte, wurde ihr übel.
»Donna?«, riss sie eine verschlafene Stimme aus ihren Grübeleien.
Ertappt zuckte Elyssandrias Kopf hoch. Vor ihr stand Esta, eingehüllt in ein langes, weißes Nachthemd, das viel zu groß für ihren knabenhaften Körper war. Ihre Augen waren noch gerötet vom Schlaf, ihr Haar auf einer Seite vom Kissen plattgedrückt.
»Ihr seid schon wach?«
Automatisch deckte Elyssandria ihre Zeichnung mit einer Hand ab. »Geh wieder ins Bett, Esta.«
Warum hatte sie das Mädchen nicht kommen gehört? Waren ihre Sorgen so laut und eindringlich gewesen, dass sie sogar die Schritte von Estas nackten Füßen auf den Dielen übertönt hatten? Es musste wohl so sein.
»Aber Donna, Euer … Euer Kleid!«
Elyssandria zerbiss einen Fluch auf den Lippen. Die Begegnung mit dem Hemykin hatte ihre Gedanken so stark vereinnahmt, dass sie vergessen hatte, sich umzuziehen. Sie trug noch immer das verschmutzte, von Wolfsklauen zerfetzte Kleid, in dem sie gegen den Weißen gekämpft hatte. An den Schultern war eine beunruhigende Menge eingetrockneten Blutes zu sehen, wo die Krallen ihre Haut zerrissen hatten.
»Das ist nicht schlimm, Esta. Du hast doch ein neues in Auftrag gegeben.«
Esta schüttelte den Kopf, dann überlegte sie es sich anders und änderte die Bewegung in ein Nicken, den Mund ein wenig geöffnet, als wollte sie etwas sagen, konnte aber nicht die richtigen Worte finden. Zum ersten Mal seit vielen Jahren erlebte sie das Mädchen sprachlos.
»Euer … Kleid«, sagte sie nochmals, als ihr nichts anderes einfiel.
Ist dies der Zeitpunkt?, fragte eine ängstliche Stimme in Elyssandrias Hinterkopf. Ist nun der Punkt gekommen, an dem ich das Geheimnis nicht länger wahren kann?
»Die Sonne wird erst in ein paar Stunden aufgehen. Du bist noch jung und brauchst deine Nachtruhe.«
»Das neue Kleid«, sagte Esta, sehr langsam, als müsste sie jede Silbe sorgfältig abwägen. »Es wird noch … Tage dauern, ehe es fertig ist. Was wollt Ihr bis dahin … anziehen?«
Ich muss es ihr sagen.
»Darum kümmere ich mich schon. Du siehst ja, dass ich noch Arbeit vor mir habe, also geh jetzt ins Bett. Sofort, Esta«, fügte sie etwas schärfer hinzu.
»Ja, Donna.« Ihre Lippen waren zu einem schmalen Strich zusammengepresst, als sie eine Verbeugung andeutete, sich umwandte und den Raum verließ.
Ich hätte es ihr sagen sollen.
Esta hatte darauf gewartet, Elyssandria hatte es deutlich sehen können. Nun war es zu spät.
Ruckartig riss sie den Bogen Papier mit der Wolfsfratze vom Pult und zerriss ihn in Fetzen.
Esta wagte sich erst wieder aus ihrer Kammer heraus, als die Sonne über den Horizont lugte. Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen wünschte sie Elyssandria einen wundervollen Morgen und begann, eine Orange in Scheiben zu schneiden. Der süßlich-saure Geruch, der bald darauf die Hütte erfüllte, brannte in Elyssandrias Nase und Rachen.
Unter Elyssandrias starrenden Augen aß sie stur lächelnd, doch schweigend. Die Stille schnitt Elyssandria beinahe schlimmer als die Tatsache, dass Esta ihr zum ersten Mal in zehn Jahren kein Frühstück angeboten hatte. Sie musste entweder sehr wütend sein oder sehr verletzt.
Als das Mädchen fertiggegessen hatte, räusperte Elyssandria sich. »Ich … habe heute noch einige Korrespondenzen zu erledigen, Esta. Ich würde es daher sehr begrüßen, wenn du an meiner statt ein paar Erledigungen machen könntest.«
»Selbstverständlich, Donna. Alles, was Ihr wünscht.« Estas Lächeln blieb unverändert.
Ohne die Münzen abzuzählen, reichte Elyssandria ihr eine halbgefüllte Geldkatze. »Ich möchte, dass du zum Schneider gehst und ihm das Doppelte seines sonstigen Lohns anbietest, wenn er das Kleid bis heute Abend fertigstellt. Außerdem brauche ich neues Papier, Kohlestifte und Tinte. Auf dem Markt besorgst du Pökelfleisch, Brot, Käse und etwas Wein, und zwar reichlich von allem. Wenn du schöne, saftige Früchte siehst, die dir gefallen, kannst du auch die mitnehmen. Ach ja, und ein wenig Zuckerwerk wäre auch nicht verkehrt.«
Estas Lächeln entgleiste. »Fühlt sich Euer Magen heute wohl, Donna?«
Elyssandria schüttelte den Kopf. »Mir ist aufgefallen, wie mager du geworden bist, Kind. Ich weiß, wir kochen praktisch nie, aber nur, weil ich wenig esse, solltest du nicht mit mir hungern müssen. Also tu mir den Gefallen und sieh zu, dass du etwas Fleisch auf die Rippen bekommst.«
Für gewöhnlich hätte Esta nun protestiert oder darauf bestanden, dass auch Elyssandria selbst dringend zulegen müsse, doch heute nickte sie nur knapp, steckte das Geld ein und verabschiedete sich. Als sie die Tür ins Schloss zog, fragte Elyssandria sich, ob sie eben einen Fehler begangen hatte, indem sie Esta nicht nur fortgeschickt, sondern obendrein dafür mit Gold bezahlt hatte.
Doch selbst wenn dem so wäre, hatte sie im Augenblick dringendere Probleme, um die sie sich sorgen musste. Aus ihrer Truhe grub sie einen Mantel aus dünnem Leinenstoff hervor, der die blutdurchtränkten Löcher in ihrem Kleid notdürftig verdecken würde. An der drückenden Schwüle, die sich im Haus angestaut hatte, erkannte sie, dass Florenz ein brütend heißer Tag bevorstand. In der Spätsommerhitze würde der Mantel auffallen, doch noch weit auffälliger wäre zweifellos ihr zerfetztes Kleid mit den dunkelbraunen Schlieren.
Ihr erstes Ziel war die Brücke, unter der sie in der Nacht zuvor auf den toten Strigoi und den Hemykin gestoßen war. Wie sie bereits befürchtet hatte, war die Leiche verschwunden. Nur noch ein dunkler Blutfleck, vermutlich aus dem zerschnittenen Maul des Wolfes, zeugte von ihrer nächtlichen Begegnung. Der Weiße oder einer seiner Kumpane musste vor Sonnenaufgang zurückgekehrt sein, um den Körper zu beseitigen, ehe die Stadtwache darauf aufmerksam werden konnte. Dennoch war Elyssandria noch nicht gewillt, aufzugeben. Ein knapp zwei Manneslängen messender Wolf, der durch eine dicht besiedelte Stadt zog und Strigoi abschlachtete, musste irgendwelche Spuren hinterlassen, zumindest aber Zeugen. Da er sich vor Elyssandria in den Fluss gerettet hatte, beschloss sie, vorerst dem Verlauf des Arnos zu folgen.
Sie war bereits einige hundert Schritte gegangen, als dunkle Flecken am Pflaster ihre Aufmerksamkeit erregten. Elyssandria ließ sich in die Hocke sinken und sog tief die Luft durch die Nase ein. Der Geruch war verschwindend schwach, dennoch erkannte sie zweifelsfrei die ungewöhnliche Witterung des weißen Wolfes wieder. Sie vermutete, dass er an dieser Stelle den Fluss verlassen und sich das Wasser aus dem Fell geschüttelt hatte; dabei mussten einige Tropfen aus seinem blutenden Maul auf dem Pflaster gelandet sein.
Sie richtete sich auf und verschaffte sich einen Überblick über ihre Umgebung. Es war unverkennbar, dass diese Gegend nicht zu den wohlhabendsten Bezirken Florenz’ gehörte. Die Häuser im Umkreis befanden sich in einem erbärmlichen Zustand. Die hölzernen Fensterläden hingen schief in den Rahmen oder fehlten gänzlich. An den Fassaden blätterte großflächig der Putz ab, auf den Dächern waren gesprungene oder fehlende Ziegel auszumachen und zwischen den Pflastersteinen, die die Wege bedeckten, spross an zahlreichen Stellen robustes Unkraut hervor.
Mit anderen Worten: Dieser Ort bot ideale Versteckmöglichkeiten für ihren neuen Freund. Es würde sie nicht verwundern, wenn sich hier sein Bau befand. Offensichtlich waren in diesem Viertel mehr Häuser leer als bewohnt. Er hätte nicht nur eine einigermaßen komfortable Unterkunft, es fehlte auch an neugierigen Nachbarn, die seine Handlungen überwachen konnten. Wäre Elyssandria alleine gewesen, als sie nach Florenz gekommen war, hätte sie sich zweifellos dieses Gebiet als ihren Sitz auserkoren, um ungestört ihren blutigen Geschäften nachgehen zu können.
Während sie ein Haus nach dem anderen untersuchte, bewegte sie sich mit der Umsicht und Lautlosigkeit einer Raubkatze. Sie nutzte jede Deckung, verschmolz mit den Schatten ringsum und verbrachte nur so viel Zeit in einem Haus wie unbedingt nötig, um auszuschließen, dass der Weiße sich darin befand.
Rasch stellte Elyssandria fest, dass die Gegend zwar heruntergekommen, aber nicht vollständig ausgestorben war. Einige der Häuser, obgleich sie nicht danach aussahen, waren tatsächlich bewohnt. Mit ihren scharfen Ohren nahm Elyssandria überdeutlich das Pochen der Herzen wahr, die sich hinter zerfallenden Mauern befanden, und der süßliche Geruch lebendiger Beute füllte ihre Nase. Diese Häuser sparte sie aus; dass der Weiße seinen Unterschlupf mit einem Sterblichen teilte, war für sie undenkbar.
Elyssandria durchsuchte das Viertel überaus gründlich, und so dauerte es mehrere Stunden, ehe sie in einem Teil der Stadt angelangt war, wo die Straßen belebter wurden. Die Sonne war bereits so tief gesunken, dass sie sich auf gleicher Höhe mit den Dächern befand und unangenehm in ihre Augen stach. Das Ende des Tages war nicht mehr fern, und Elyssandria hatte keine andere Wahl, als ihre Suche abzubrechen.
Auf dem Rückweg kam ihr Esta wieder in den Sinn. Obwohl sie sich die größte Mühe gegeben hatte, es sich nicht anmerken zu lassen, war ihre Enttäuschung unübersehbar gewesen. Jahrelang hatte sie sich die Frage gestellt, wie sie den richtigen Moment erkennen sollte, um Esta in ihr Geheimnis einzuweihen, und nun hatte sie ihn versäumt. Elyssandria beschloss, dass sie sich mit Esta aussprechen musste. Vielleicht war es längst zu spät dafür, doch je länger sie wartete, desto mehr Schaden würde sie anrichten.
Als sie ihre Hütte erreichte, war Esta nicht da. Elyssandria war nicht weiter überrascht. Da sie dem Mädchen eine ganze Liste an Aufgaben gegeben hatte, war es gut möglich, dass es noch immer unterwegs war. Also machte Elyssandria sich auf den Weg zum Marktplatz. Mit etwas Glück würde Esta sich freuen, dass ihre Donna ihr entgegenkam, um mit ihr gemeinsam den Heimweg anzutreten. Das würde das bevorstehende Gespräch erheblich erleichtern.
Der Marktplatz begann um diese Tageszeit bereits, sich zu leeren. Die Händler packten ihre Waren ein und bedeckten ihre Stände mit großen Stoffplanen. Die verbliebenen Käufer schlenderten ohne sichtbares Ziel zwischen den Ständen umher, plauderten ein wenig oder feilschten um die letzten Waren. Esta war nicht unter ihnen.
Elyssandria wusste nicht, warum dem so war, doch diese Erkenntnis erweckte in ihrer Magengegend ein schmerzhaftes Ziehen.
Ohne weiter darüber nachzudenken, hielt sie geradewegs auf einen der Verkäufer zu. Die meisten Händler hatten ihre Augen und Ohren überall, und das mussten sie auch, wenn sie in einer dichtbesiedelten Stadt wie Florenz nicht mehrmals täglich beraubt werden wollten.
»Guten Abend, Signor.«
Der Mann, der bislang mit dem Verräumen seiner Waren beschäftigt gewesen war, wandte den Kopf und musterte ihre zerrissenen, blutbesudelten Ärmel. Nach einer empfindlich langen Pause nickte er. »Signora.«
»Ich suche ein Mädchen mit schwarzem, lockigem Haar. Sie muss hier einige größere Besorgungen gemacht haben. Habt Ihr sie gesehen?«
Der Händler runzelte die Stirn und kraulte sein Stoppelkinn. »Ich erinnere mich an ein Mädchen mit schwarzem Krausehaar. Sie schleppte sich mit einem viel zu großen Korb ab und kaufte eine ganze Menge. Ich habe sie noch gut im Gedächtnis, da ich mich fragte, wie eine solche Göre an so viel Gold kommt. Wahrscheinlich die Bedienstete einer adeligen Familie.« Oder eine Diebin, fügten seine Augen hinzu.
»Wann ist sie gegangen?«
Der Händler zuckte mit den Schultern. »Ihr habt sie gerade verpasst, Signora. Sie ist vor einer knappen halben Stunde gegangen.«
»Danke, Ihr habt mir sehr geholfen.« Sie schnippte ihm eine Münze zu, die seine schmutzigen Finger blitzschnell aus der Luft schnappten.
»War mir ein Vergnügen, Signora.« Er entblößte zwei Reihen braunfleckiger Zähne.
Im Laufschritt eilte Elyssandria über den Marktplatz. Ohne ihr Zutun beschleunigten sich ihre Schritte, bis sie schließlich rannte. Köpfe drehten sich nach ihr um, als sie sich unsanft ihren Weg durch die herumstehenden Einkäufer bahnte. Aus dem unruhigen Ziehen in ihrem Magen war ein beklemmendes Gefühl in ihrem Brustkorb geworden, das ihr beinahe den Atem abschnürte.
Natürlich war es möglich, dass Esta sie bereits zu Hause erwartete. Doch mit jedem Schritt, den sie tat, glaubte sie weniger daran. Warum war Esta ihr auf dem Heimweg nicht entgegengekommen? Hatte sie einen anderen Weg genommen als üblich? Und weshalb sollte sie das tun?
In ihrem mehrere Jahrhunderte andauernden Leben hatte Elyssandria gelernt, auf ihre Intuition zu hören und selbst die kleinsten Signale ihres Körpers zu deuten. Etwas stimmte nicht.
»Esta!«, rief sie. Noch mehr Menschen drehten sich nach ihr um und glotzten ihr verständnislos hinterher, doch es war ihr gleichgültig. »Esta?«
Zu spät, pochte es hinter ihrer Stirn. Du bist zu spät, zu spät. Wie immer zu spät.
Vor einer scharfen Biegung blieb sie abrupt stehen. Übelkeit kroch in ihrer Speiseröhre empor, als sie den in den Staub getretenen Brotlaib zu ihren Füßen entdeckte. Er wirkte wie ein blasses, totes Tier. Natürlich konnte Elyssandria es nicht mit Sicherheit wissen, doch sie vermutete, dass er bereits hier gelegen hatte, als sie auf dem Weg zum Marktplatz gewesen war. Sie hatte ihn nur übersehen.
Quälend langsam, als würde sie sich durch tiefe Gewässer bewegen, bog sie in die Seitengasse ein. Noch mehr verstreute Einkäufe bedeckten hier das Pflaster: zertrampelter Käse, bräunlich-matschige Äpfel und ein zersplittertes Tintenglas, dessen schwarzer Inhalt wie Blut über die Steine gespritzt war. Der Korb lag einige Schritte weiter, neben einer schlaffen, reglosen Hand. Elyssandria schluckte hart. Sie wollte nicht hinsehen. Und doch musste sie.
Einer zerschmetterten Gliederpuppe gleich lag das Mädchen auf der Straße. Seine Augen waren halbgeöffnet, sein sonst niemals stillstehender Mund zu einem hauchdünnen Strich zusammengepresst. Das jugendliche Gesicht war von Schmerz zerfurcht, was es um Jahre gealtert erscheinen ließ. In dem Leinenkleid waren mehrere tiefrote Blumen gewachsen, die alle Farbe aus seinem restlichen Körper gesaugt haben mussten.
Absurderweise beruhigte die Gewissheit Elyssandria augenblicklich. Auf unheimliche Weise gefasst trat sie vollends an Esta heran und ließ sich neben ihr in die Hocke sinken. Ihr Herz schlug noch, ein schwaches, unregelmäßiges Pumpen, das Elyssandria bewies, dass bereits der Tod seine eiskalten Klauen um ihre Seele gelegt hatte. Mit kundigen Griffen betastete sie den von Messerstichen übersäten, mageren Körper. Die meisten Stiche waren nur oberflächlich und nicht lebensgefährlich, doch einer hatte eine Arterie in ihrem Unterbauch angeritzt. Dickes, dunkles Blut quoll aus der Wunde hervor und vermischte sich mit der schwarzen Tinte.
Kurzentschlossen riss Elyssandria den Ärmel ihres Kleides ab, knüllte den Stoff zusammen und presste ihn gegen die Wunde. Innerhalb weniger Herzschläge hatte sich das Leinen mit Blut vollgesogen. Elyssandria seufzte schwer. Sie kannte den menschlichen Körper und wusste, wann seine Grenzen erreicht waren. Esta würde die Nacht nicht überleben.
»Wer würde so etwas tun?«, fragte sie leise, und doch kannte sie die Antwort bereits. Nur um sicherzugehen, tastete sie Estas Gürtel ab und fand nichts. Die halbgefüllte Geldkatze, die sie ihr für ihren Einkauf überlassen hatte, war fort. Ein Überfall. Was hatte Elyssandria auch erwartet? Sie hatte ein Kind ohne Begleitung mit einem kleinen Vermögen quer durch Florenz geschickt. Kein Dieb, der bei Verstand war und über intaktes Augenlicht verfügte, hätte solch eine Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen. Auch Elyssandria wäre dies klar gewesen, wären ihre Gedanken nicht um den verfluchten weißen Wolf gekreist. Die übermächtigen Gegner hatten sie die alltäglichen Gefahren eines Menschenlebens vergessen lassen.
»Du hast ihm das Geld nicht gegeben, nicht wahr?«, fragte sie, und ein schwaches Lächeln zuckte über ihre Lippen. »Nein. Du bist viel zu pflichtbewusst, um das Geld deiner Donna einem dahergelaufenen Strauchdieb mit einer Klinge zu überlassen. Bestimmt hast du ihn ordentlich ins Schwitzen gebracht, bevor er dich in die Knie zwang.«
Als sie auch noch den zweiten Ärmel abriss und auf den ersten Stoffballen drückte, gab Esta ein gequältes Stöhnen von sich.
»Alles wird gut«, log Elyssandria und strich ihr mit einer von feuchtem Rot überzogenen Hand über die schweißnasse Stirn. »Jetzt bringen wir dich erst einmal nach Hause, Kind. Das wird schon wieder.«
Behutsam schob sie ihre Hände unter Estas schmalen Körper und hob ihn hoch. Er war leicht wie eine Feder.
Das schlaffe, heftig blutende Mädchen in den Armen, machte Elyssandria sich auf den Heimweg. Hinter ihr zurück blieb ein umgekippter Korb, zertretene Lebensmittel und eine schillernde Lache aus schwarzer Tinte.
III.
Seit sie Esta auf ihr Bett gelegt hatte, war ihre Atmung deutlich ruhiger geworden. Der Schweiß auf ihrer Stirn trocknete allmählich und die schmerzverzerrte Grimasse war von ihren Gesichtszügen verschwunden. Wenn man sie nun betrachtete, war es einfach, sich vorzustellen, dass sie lediglich schlummerte.
Elyssandria hatte die Verletzung im Bauchraum provisorisch verbunden und die Stiche gereinigt. Ob sie Estas Schmerzen damit gelindert hatte, wusste sie nicht – ihre Wunden heilten von selbst, daher hatte sie keine Erfahrung mit dem Versorgen von Verletzungen. Hätte sie allerdings nichts getan, hätte sich Hilflosigkeit wie ein schleichendes Gift in ihrer Seele ausgebreitet, und zumindest eines wusste sie mit Sicherheit: Schaden konnte sie Esta an diesem Punkt nicht mehr.
Zum wiederholten Mal prüfte Elyssandria den Verband um Estas Körpermitte. Der Blutfluss war versiegt – unter den meisten Umständen ein gutes Zeichen. Doch nicht diesmal. Es bedeutete nur, dass nichts mehr in Estas Adern war, das ihren Körper verlassen konnte.
Behutsam strich sie über Estas Stirn. Anfangs hatte ihre Haut förmlich geglüht, nun kühlte sie rapide ab. Ihr Herzschlag war so schwach geworden, dass Elyssandria genau hinhorchen musste, um noch etwas wahrzunehmen.
»Gleich wird es dir besser gehen«, sagte sie und stellte überrascht fest, dass ihre Stimme schwer von Tränen war. »Du wirst nun an einen Ort gehen, den nicht einmal ich kenne. Und so, wie ich dich kenne, wirst du auch dort alles auf den Kopf stellen.«
Es war nicht richtig, dass es so endete. Esta war noch jung, sie hätte noch ein ganzes Leben vor sich haben müssen. Viele Sterbliche würdigten die Zeit nicht, die ihnen auf dieser Welt gegeben war, doch Esta war keiner dieser Menschen gewesen. Sie hatte jeden Augenblick gefeiert. Ein Tag, an dem sie nicht herzlich gelacht hatte, war ein verlorener Tag für sie gewesen. Sie hatte es nicht verdient, so plötzlich aus dem Leben gerissen zu werden.
Mit einem Mal kam Elyssandria etwas in den Sinn, das ihr Schöpfer, schon lange tot, einst zu ihr gesagt hatte: Der Sensenmann wird auch dich begleiten, Elyssa. Er lässt sich nicht betrügen, und wenn er das von ihm auserkorene Leben nicht haben kann, wird er sich zur Entschädigung etwas anderes, Gleichwertiges nehmen. Und je mehr Jahre du dem Tod stiehlst, desto höher wird der Preis steigen.
Eine einzelne Träne landete auf ihrer geballten Faust und zerplatzte. Er hatte recht gehabt. Das Schicksal hatte ihr alles genommen. Ihre Familie. Ihre Freunde. Ihr einziges Kind. Und nun Esta.
»Bin ich denn dazu verdammt, die Ewigkeit in Einsamkeit zu verbringen?«, fragte sie erstickt in den leeren Raum hinein. »Ist es meine Bestimmung, schweigend und in Demut zu leiden, zu ertragen? Ist das der Preis, den ich zahle, für eine Existenz, die ich mir niemals ausgesucht habe?«
Sie starrte aus brennenden Augen auf Esta herab, die sich unruhig regte, fast so, als würde sie auf den Zorn in Elyssandrias Stimme reagieren.
»Es ist meine Schuld, dass sie im Sterben liegt«, sagte Elyssandria, und als sie es aussprach, wurde es schmerzhaft real. Es war nicht einmal die Tatsache, dass sie das Mädchen mit dem Geld in die Stadt geschickt hatte. Allein in ihr Leben zu treten, hatte das Kind verdammt. Elyssandria hatte gedacht, sie könnte die alten Regeln ändern, könnte das Mädchen benutzen, um ein normales, sterbliches Leben zu mimen, doch sie hatte sich selbst belogen.
Ja, Stephanus hatte die Wahrheit gesagt: Dies war der Preis für ihre absurd lange Existenz. Und mit einem Mal begriff Elyssandria, dass sie nicht länger willig war, ihn zu bezahlen.
»Nicht noch ein Leben. Nicht Esta.«
Elyssandrias Augen zuckten nervös hin und her, als erwartete sie, dass jemand kommen und sie von ihrem Vorhaben abhalten würde. Als das nicht geschah, beugte sie sich herab und flüsterte in Estas Ohr: »Ich werde nicht einfach so aufgeben. Dieses Mal nicht. Wir lassen uns das nicht länger gefallen, Esta. Nein.«
Als Elyssandrias Zähne in das empfindliche Fleisch ihrer Kehle drangen, trat kaum Blut aus der Wunde, das sie hätte aufnehmen können. Es war auf ihren Händen, in Estas Kleidern und Verbänden und in der Seitengasse, in der der Räuber seinem Opfer aufgelauert hatte. In dem Wissen, dass es vielleicht bereits zu spät für diesen Schritt war, riss sie die blaue, dicke Ader an ihrem eigenen Handgelenk auf und hielt den entstandenen Riss über Estas leicht geöffnete Lippen. Das Mädchen reagierte nicht. Als wäre es aus Marmor, lag es still zwischen den Laken. Wirkungslos lief Elyssandrias Blut an seinem Kinn hinab.
Es wird nicht funktionieren, dachte sie. Und vielleicht war es besser so.
Da berührte Estas Zungenspitze schwach ihren Mundwinkel, in dem sich Elyssandrias Blut gesammelt hatte. Ihre Hände zuckten, ihre Brust hob und senkte sich schwer. Ein uralter Teil ihres Bewusstseins hatte das Leben gewittert, wollte darum kämpfen, es in sich hineinziehen. Immer mehr von Elyssandrias Blut tropfte auf Estas Mund und sickerte in ihren Rachen.
Plötzlich schlug sie die Augen auf. Ihre Hände schossen vor und packten Elyssandrias Unterarm, ihre Zähne versanken in der dünnen Haut ihres Gelenks, zerrten daran. Elyssandria keuchte und musste alle Selbstbeherrschung aufbieten, um ihren Arm nicht zurückzureißen. Estas Züge, die hartnäckig das Blut aus ihrem Körper saugten, taten weh. Es war, als würde flüssiges Feuer von ihrem Handgelenk aus durch ihre Adern strömen. Doch sie wusste, würde sie frühzeitig unterbrechen, könnte sie Esta ebenso gut eigenhändig töten.
Überdeutlich spürte Elyssandria, wie ihre Kräfte sie mehr und mehr verließen. Esta hingegen wurde mit jedem Schluck, den sie in sich aufnahm, lebhafter, ihr Griff fester. Als sie sich aufsetzte, löste sich der Verband um ihren Brustkorb und legte den Blick frei auf rosige, unversehrte Haut. Die Heilung hatte sich schneller vollzogen, als Elyssandria für möglich gehalten hätte.
»Lass los, Esta«, stöhnte sie. »Bitte lass los.«
Das Mädchen schien sie gar nicht zu hören. Wild, aber kalt hing sie an ihrem Fleisch, wie ein Insekt, das sich in seine Beute verbissen hatte. Unter Aufbietung all ihrer verbliebenen Kräfte ergriff Elyssandria Esta im Nacken und riss sie nach hinten. Das Mädchen stieß ein enttäuschtes Zischen aus, seine Augen rollten wild in den Höhlen. Sein Mund war rot verschmiert, sein Atem ging hektisch.
Dann, ebenso schnell, wie die Energie in ihren Körper zurückgekehrt war, wich sie wieder daraus. Mit einem letzten, schwachen Gurgeln sackte Esta in sich zusammen, ihre Lider fielen zu. Sie regte sich nicht mehr.