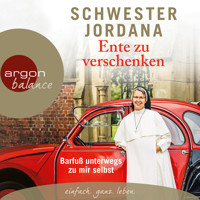10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ein göttliches Abenteuer Entlang der Stätten des ersten mittelalterlichen Kreuzzuges: Von Istanbul, der Stadt zwischen Okzident und Orient, reist Schwester Jordana bis nach Jerusalem, in einem roten Chevrolet, auf der Autobahn oder der Wüstenpiste, kreuz und quer durch die Türkei, den Libanon und Israel. Sie erlebt sechs Wochen voller spannender Ereignisse, begegnet ungewöhnlichen Menschen, lernt dabei auf besondere Art die drei großen Weltreligionen kennen und setzt sich gleichzeitig ganz persönlich mit ihrem eigenen Glauben und Ordensleben auseinander. «Als ich vor einundzwanzig Jahren in den Orden eintrat, sagte jemand zu mir: ‹Willst du die Welt besehen, musst du in ein Kloster gehen.› Wahrscheinlich kam es zu dieser Äußerung, weil Ordensfrauen häufig in die Mission gehen, nach Afrika, Asien oder Südamerika, was ich jedoch keineswegs vorhatte. Und doch sollte dieser Satz auf besondere Weise für mich wahr werden. Ich würde die weiteste Reise meines Lebens antreten! In einem roten Chevrolet, mit einem jungen Mann. Auf den Spuren mittelalterlicher Kreuzfahrer, mit Startpunkt in Istanbul und Stationen wie Konya und Antakya, Tripoli und Tyros, Hebron und Jerusalem. Hätte ich nicht Lust? Und ob ich Lust hatte. Was für eine Frage! Noch nie hatte ich mich außerhalb der Grenzen von Europa bewegt, schon gar nicht in Israel, im Heiligen Land. ‹Wann? Sofort?› Meine Begeisterung ließ mein Herz höherschlagen. Es gibt Momente, die stimmen einfach. Die landen direkt vom Himmel vor meinen Füßen und füllen den Raum, meine Sinne – und verändern mein Leben. Dies war so einer.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Schwester Jordana • mit Iris Rohmann
Auf einen Tee in der Wüste
11 000 Kilometer bis Jerusalem
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein göttliches Abenteuer
Entlang der Stätten des ersten mittelalterlichen Kreuzzuges: Von Istanbul, der Stadt zwischen Okzident und Orient, reist Schwester Jordana bis nach Jerusalem, in einem roten Chevrolet, auf der Autobahn oder der Wüstenpiste, kreuz und quer durch die Türkei, den Libanon und Israel. Sie erlebt sechs Wochen voller spannender Ereignisse, begegnet ungewöhnlichen Menschen, lernt dabei auf besondere Art die drei großen Weltreligionen kennen und setzt sich gleichzeitig ganz persönlich mit ihrem eigenen Glauben und Ordensleben auseinander.
«Als ich vor einundzwanzig Jahren in den Orden eintrat, sagte jemand zu mir: ‹Willst du die Welt besehen, musst du in ein Kloster gehen.› Wahrscheinlich kam es zu dieser Äußerung, weil Ordensfrauen häufig in die Mission gehen, nach Afrika, Asien oder Südamerika, was ich jedoch keineswegs vorhatte. Und doch sollte dieser Satz auf besondere Weise für mich wahr werden. Ich würde die weiteste Reise meines Lebens antreten! In einem roten Chevrolet, mit einem jungen Mann. Auf den Spuren mittelalterlicher Kreuzfahrer, mit Startpunkt in Istanbul und Stationen wie Konya und Antakya, Tripoli und Tyros, Hebron und Jerusalem. Hätte ich nicht Lust? Und ob ich Lust hatte. Was für eine Frage! Noch nie hatte ich mich außerhalb der Grenzen von Europa bewegt, schon gar nicht in Israel, im Heiligen Land.
‹Wann? Sofort?› Meine Begeisterung ließ mein Herz höherschlagen. Es gibt Momente, die stimmen einfach. Die landen direkt vom Himmel vor meinen Füßen und füllen den Raum, meine Sinne – und verändern mein Leben. Dies war so einer.»
Über Schwester Jordana • mit Iris Rohmann
Sr. Jordana Schmidt, 1969 geboren, ist Dominikanerin von Bethanien, Dipl.-Heilpädagogin und Familientherapeutin und seit Juli 2012 Kinderdorfmutter im Bethanien Kinderdorf Schwalmtal-Waldniel. Ganz im Sinne des Predigerordens ist sie oft unterwegs, um Vorträge und Predigten zu halten.
Iris Rohmann, Jahrgang 1962, hat Germanistik studiert und lebt als freie Journalistin in Köln. Seit 1991 arbeitet sie für verschiedene Fernsehanstalten, Zeitungen und Verlage. Sie lernte Schwester Jordana Schmidt 2006 bei einem Fernsehdreh auf dem Weltjugendtag kennen, und sie sind seither befreundet.
Inhaltsübersicht
Vorwort Die weiteste Reise meines Lebens
Es war ein ganz normaler Arbeitstag. Obwohl, so ganz normal ist bei mir eigentlich nichts. Ich bin nämlich Ordensschwester, und mein Arbeitstag ist der einer Erziehungsleiterin in einem unserer Bethanien-Kinderdörfer. Nicht dass ich als Ordensschwester nicht normal wäre, aber wenn man unter normal «den Durchschnitt abbildend» versteht, dann bin ich als junge Dominikanerin und Ordensfrau wohl jenseits der Gauß’schen Normalverteilung. Und die Aufgaben einer Erziehungsleiterin sind so vielfältig, dass allein ihre Beschreibung ein ganzes Buch füllen könnte. Kein Tag gleicht dem anderen, von Normalität keine Spur.
Hier geht es aber um etwas anderes, um etwas, das an diesem Tag seinen Anfang nahm. Das Telefon klingelte. Am anderen Ende der Leitung stellte sich ein Mann namens Lutz Neumann vor, von Beruf Regisseur. Das erschien im ersten Moment nicht weiter ungewöhnlich, denn seit fast zehn Jahren bin ich im deutschen Fernsehen immer wieder bei der einen oder anderen Sendung dabei. Manche sagen sogar, wenn sie mich auf dem Bildschirm sehen: «Das ist doch die Fernsehnonne» – und ganz unrecht haben sie damit nicht. Nur dass ich keine Nonne, sondern eine Schwester bin (und meine Auftritte im Fernsehen nicht zu meinen Hauptaufgaben zählen). Und was ist der Unterschied? Schwestern sind Frauen, die in einen Orden eintreten, der sich der Arbeit mit und für die Menschen widmet. Nonnen sind diejenigen, die vorrangig beschaulich leben, gern in Klausur «hinter Klostermauern», die aber längst nicht so unüberwindbar sind, wie viele glauben. Aber auch darüber könnte man ein ganzes Buch schreiben …
Lutz Neumann hatte mich, wie er mir jetzt am Telefon erzählte, als «Fernsehnonne» entdeckt. Und zwar, als er schwitzend auf einem Trimmrad im Fitnesscenter saß, während ich alte Grand-Prix-Lieder in einer Sendung kommentierte. Er fand das so gut, dass er dachte: Die ist genau die Richtige für dein Projekt – die Dokumentation einer Reise ins Heilige Land. Lutz und das ZDF suchten eine Ordensfrau, die mitfahren würde, in einem roten Chevrolet und mit einem Comoderator (Rainer Maria Jilg), von der Kamera begleitet, auf den Spuren mittelalterlicher Kreuzfahrer, mit Startpunkt in Istanbul und Stationen wie Konya und Antakya, Tripoli und Tyros, Hebron und Jerusalem. Mehrere tausend Kilometer. Hätte ich nicht Lust, diese Ordensfrau zu sein? Und ob ich Lust hatte. Was für eine Frage! Noch nie hatte ich mich außerhalb der Grenzen von Europa bewegt, schon gar nicht in Israel, im Heiligen Land.
«Wann? Sofort?» Meine Begeisterung ließ mein Herz höher schlagen. Es gibt Momente, die stimmen einfach. Die landen direkt vom Himmel vor meinen Füßen und füllen den Raum, meine Sinne – und verändern mein Leben. Dies war so einer.
Nein, die Reise solle erst im Herbst 2011 beginnen, erhielt ich zur Antwort, also ein gutes halbes Jahr später. Und ich erfuhr noch mehr: Bei dieser Reise durch die Türkei, Syrien, den Libanon und Israel wäre ich ungefähr acht Wochen unterwegs, es ginge um ein Kennenlernen, auch um ein Auseinandersetzen mit dem Christentum, dem Islam sowie dem Judentum. Auf der Strecke würden wir immer wieder Menschen treffen, die sich – jeder auf seine Art – für ein gutes Zusammenleben der Religionen einsetzen, zum Beispiel im «Chor der Zivilisationen» in Antakya oder in der israelischen Schule «Brücke über den Wadi», in der palästinensische und jüdische Kinder gemeinsam lernen. Aber wir würden auch mit der Hisbollah konfrontiert werden, mit einem israelischen Ex-Soldaten von «Breaking the Silence» sprechen, regimekritische Künstler treffen. Wir würden tanzende Derwische sehen, auf einen Tee in die Wüste Negev zu den Beduinen gehen, dem «Peace Village» der Black Hebrews in Israel einen Besuch abstatten. Dabei würden wir hoffentlich nicht nur etwas über andere Kulturen und Denkweisen erfahren, sondern auch einiges über uns selbst. Je mehr Lutz erzählte, umso spannender klang es! Und ICH, wirklich ICH, war gefragt. Es war wie ein Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk zusammen und eigentlich noch mehr. Da habe ich spontan ja gesagt. Natürlich!
Es ist so eine Sache mit der Spontaneität, wenn einen dann der «normale» Alltag einholt. Direkt nachdem das Telefonat beendet war, erhob sich vor mir ein Berg – und damit eine Menge an Herausforderungen. Der erste Gedanke: Ich stehe voll in der Arbeit – wie soll das gehen, zwei Monate einfach weg zu sein? Quillt doch mein E-Mail-Postfach schon nach einer Woche Abwesenheit über, und viele Aufgaben würden nicht erledigt werden oder ungeduldig darauf warten, dass dies geschähe, sodass ich bei meiner Rückkehr schier außer Atem geraten könnte. Bevor mich weitere Gedanken überfluteten, holte ich tief Luft. Wenn diese Anfrage vom Himmel kam, dann würde der Himmel auch eine Lösung finden. Bisher war ich in dieser Hinsicht nicht enttäuscht worden.
Der erste Anruf galt meiner Generalpriorin. Bei solch gewichtigen Entschlüssen hatte ich sie um Erlaubnis zu fragen, gelobte ich doch, als ich mich auf Lebenszeit an den Orden gebunden hatte (fast wie ein Eheversprechen), Gehorsam. Das heißt natürlich nicht, dass ich auf Knien liegend alles mache, was man mir sagt. Das wäre ein Klischee. Was Gehorsam beinhaltet, darüber gibt es innerhalb der einzelnen Orden unterschiedliche Auffassungen – in unserer Gemeinschaft der Bethanien-Schwestern sprechen wir von einem «dialogischen Gehorsam». Das bedeutet, dass ich die meisten Entscheidungen zusammen mit meinen Mitschwestern und Oberen treffe. Gegenseitige Akzeptanz und das Hören aufeinander sind die Basis unserer Gemeinschaft, und die Berücksichtigung der persönlichen Situation selbstverständlich. Dennoch gibt es Situationen, die von der Ordensleitung allein bestimmt werden – meine Reise wäre ein solcher Fall. Ich überlegte mir, wie ich sie begründen konnte, denn wichtig bei uns ist, was allen dient.
Es konnte passieren, dass meine Ordensleitung gegen eine zweimonatige Abwesenheit meinerseits entscheiden würde, weil diese wenig für die anderen dienlich wäre, deshalb hatte ich ein bisschen Herzzittern, als das Freizeichen ertönte. Aber ich brauchte gar keine schlagkräftigen Argumente. Meine Generalpriorin gab mir sofort und freudig ihr Einverständnis: «Jordana, das ist so eine tolle Chance, das musst du machen!» Juchu! Dieselbe Antwort erhielt ich wenig später auch von meinem Chef, dem Leiter des Kinderdorfes. Ihm schuldete ich zwar keinen Gehorsam, jedoch Kollegialität. Der Himmel stand damit weiterhin offen. Selbst die schwierige Aufgabe meiner Vertretung ließ sich problemlos lösen, es schien, als hätte man alles von langer Hand geplant: Eine meiner Kolleginnen konnte ihre Stellenreduzierung um ein paar Monate nach hinten verschieben, sodass sie Luft für Vertretungsarbeiten hatte. Eine neue Kollegin stieg ein, die den Rest übernahm. Meine Kinderdorfgruppen waren in guten Händen, ich konnte ohne schlechtes Gewissen fahren. Zugleich hatte ich etwas Wichtiges gelernt: nämlich dass das Kinderdorf auch längere Zeit ohne mich auskommen kann. Wenn man tagaus, tagein in Verpflichtungen steckt, kann man das leicht vergessen. Ich denke dann, dass die Sonne nur aufgeht, wenn ich persönlich den Wecker stelle …
Als ich vor einundzwanzig Jahren in den Orden eintrat, sagte jemand zu mir: «Willst du die Welt besehen, musst du in ein Kloster gehen.» Wahrscheinlich kam es zu dieser Äußerung, weil Ordensfrauen häufig in die Mission gehen, nach Afrika, Asien oder Südamerika, was ich jedoch keineswegs vorhatte. Und doch sollte dieser Satz auf besondere Weise für mich wahr werden: mit dieser Fernsehdokumentation. Ich würde die weiteste Reise meines Lebens antreten! In einem Auto, noch dazu zusammen mit einem jungen Mann. In der Tat ein wenig ungewöhnlich für eine Schwester, aber warum nicht. Es versprach jedenfalls viele neue Erfahrungen von einem Miteinander auf engstem Raum. Eine meiner Mitschwestern machte sich Sorgen um mein Zölibatsgelübde, das zweite Gelübde, das ich abgelegt habe, neben dem Gehorsam: «Mit einem Mann? Alleine? So lange Zeit?» Ich konnte sie beruhigen, meinte, ich würde gern im Orden leben und wäre nicht auf der Suche nach einer Alternative. Eine andere Schwester gab mir als Rat mit auf dem Weg: «Bleib katholisch!» Befürchtete sie, ich könnte zum Islam übertreten? Es war jedenfalls spannend, mitzubekommen, wie viele Gedanken sich meine Schwestern machten, die mir gar nicht eingefallen wären. Ich spürte aber auch, dass alle sich mit mir freuten. Wie gern hätte ich es meinen Lieben ermöglicht, mich zu begleiten, denn vielen, denen ich davon erzählte, stand das Fernweh in den Augen. Aber das ging ja nicht.
Bald purzelten die praktischen Fragen ins Haus, Vorbereitungen mussten getroffen werden: Was sollte ich auf eine solche Reise mitnehmen? Auch wenn ich Armut gelobt hatte – das dritte Gelübde –, besitze ich doch mehr als ein paar Schuhe und eine Kleidergarnitur. Mit dem Filmteam hatte ich inzwischen geklärt, dass ich das Bild einer «Nonne» nicht ganz erfüllen würde, die meiste Zeit würde ich nämlich «normale» Kleidung tragen. Das ist auch etwas, was mich nicht ganz den Vorstellungen von einer «normalen» Ordensfrau entsprechen lässt. Wir Dominikanerinnen von Bethanien können zwischen Ordenskleid, dem Habit, und Zivilkleidung wählen. Das dominikanische Ordensgewand ist weiß, ursprünglich bestand es mal aus ungefärbter Wolle und stellte ein alltagstaugliches Arbeitskleid dar. Billig, strapazierfähig. Das sind die Kriterien, die ein Ordenskleid erfüllen muss. Heute tun das auch Jeans und T-Shirts. Aus diesem Grund trage ich den weißen Habit mit dem schwarzen Schleier nur zu besonderen oder liturgischen Anlässen. Ansonsten ist mein Erkennungszeichen allein das schwarz-weiße Lilienkreuz, welches mich als Dominikanerin erkennbar macht und das ich immer um den Hals trage. Auf bunte Farben wollte ich bei meinen Outfits allerdings verzichten, denn ein wenig sollte ja das Bild von mir als einer Schwester deutlich werden.
Nach der Kleiderfrage fing ich an, darüber nachzudenken, was ich eigentlich über den Islam und das Judentum wusste – und stellte fest, dass es erschreckend wenig war. Klar hatte ich mich schon mit Muslimen und Juden unterhalten, aber religiöse Themen hatten da nicht im Vordergrund gestanden, eher praktische Fragen. Wir haben einige muslimische Jungen und Mädchen im Kinderdorf, und wir achten zum Beispiel darauf, dass sie kein Schweinefleisch essen müssen, oder beschenken sie zum Zuckerfest mit Süßigkeiten. Aber sonst? Natürlich wusste ich von religiösen Gemeinsamkeiten und dass wir uns zum Teil auf dieselbe Heilige Schrift beziehen, auf Abraham als den gemeinsamen Stammvater. Auch auf die Übereinstimmung, dass wir an einen (und nur an einen) barmherzigen und gütigen Gott glauben, der die Welt erschaffen hat und der Bewahrer und Richter aller Menschen ist, weil er uns liebt, können wir bauen, wenn wir uns begegnen. Und das bedeutet viel mehr Gemeinsamkeit, als ich zum Beispiel mit einem Hindu oder Buddhisten hätte. Denn die Hindus verehren verschiedene Götter, und die Buddhisten stellen sich im Grunde gar keinen Gott vor, selbst wenn es Länder gibt, in denen Buddha wie ein Gott verehrt wird – ursprünglich war das aber nicht so.
Und so kam es, dass ich mir Gedanken über die drei Buchreligionen machte, so ausführlich wie nie zuvor. Mir fiel auf, dass ich in meinem Lebensalltag wenig Berührung mit Gläubigen anderer Religionen hatte, dass wir in Deutschland unsere verschiedenen religiösen Rituale kaum zusammen zelebrieren, unsere Feste nicht gemeinsam feiern. Wir leben eher nebeneinanderher – aus heutiger Sicht würde ich sagen: ein großer Fehler. Dass das auch anders möglich ist, habe ich während meiner Reise immer wieder mit Staunen feststellen können. Ich traf etliche Christen, die mit ihren Nachbarn oder Freunden in die Moschee gingen und umgekehrt. Bei diesem ungewöhnlichen «Roadmovie» sollte ich selbst auch zum ersten Mal in meinem Leben eine Moschee oder Synagoge betreten.
Zum Glück machte ich mir noch vor Reiseantritt bewusst, dass ich unterwegs in erster Linie Menschen begegnen sollte; es ging nicht darum, religiöse Claims abzustecken. Das wäre auch gar nichts für mich gewesen. Ich wünschte mir, als Jordana zu reisen, nicht als Abgesandte der katholischen Kirche – wenngleich als ein lebendiges Mitglied von ihr. Ich wollte lernen und nicht belehren oder Vorurteilen folgen. Daher verzichtete ich darauf, vorab theologische Einführungen zu studieren (und wer in diesem Buch kluge Gedanken dieser Art erwartet, den kann ich gleich enttäuschen, dann ist es später nicht mehr so schlimm).
Im Lauf der Wochen wuchs der Berg an Dingen, die in den Koffer mussten. Bald schien es unmöglich, alles in diesen zu bekommen. Aber mehr als ein Gepäckstück wollte ich partout nicht mitnehmen. So teilte ich den Berg in zwei Stapel auf: «unbedingt» und «vielleicht». Auf jeden Fall brauchte ich eine Sonnencreme und etwas gegen Insektenstiche. Auch warme Kleidung, denn abends kann es in diesen heißen Ländern empfindlich kalt werden, so hatte ich mir sagen lassen. Ich benötigte feste Schuhe, aber auch Sandalen. Die Reisebibel (im Kleinformat) und mein Brevier (das Gebetbuch der Kirche) gehörten ebenso auf den Stapel «unbedingt». Außerdem ein Tagebuch und ein Aufnahmegerät für die Interviews mit meinen Gesprächspartnern gegen das Vergessen sowie ein Kartenspiel – man wusste ja nie. Das sollte reichen, und wenn nicht, dann war es so. Schon häufig hatte ich die Erfahrung gemacht, dass, ist man erst einmal unterwegs, vieles sich von selbst findet, wenn man es hinnimmt, wie es kommt. Und wenn etwas fehlt, dann fehlt es eben. Außerdem: Ich fuhr nicht in den Dschungel!
Am Ende schaffte ich es, den Kofferinhalt auf vierzehn Kilo zu reduzieren, was ich, angesichts der Länge der Reise, durchaus bemerkenswert fand. Dennoch: Die Zeiten, in denen sich die Jünger Jesu ohne Vorratstasche und ohne Gepäck aufmachen, sind definitiv vorbei.
Inzwischen hatte sich die politische Situation insbesondere in Syrien radikal verändert. Angesteckt durch den «Arabischen Frühling», begannen in diesem Land Demonstrationen für mehr Freiheit, die gewaltsam durch das Regime verhindert wurden. Das machte eine Durchfahrt durch Syrien mit einem Kamerateam von Tag zu Tag unwahrscheinlicher. Angesichts dieser Entwicklung wurde mir ein bisschen bang. Was würde da wohl auf mich zukommen? Muslime in Deutschland zu treffen war etwas anderes, als muslimische Länder zu bereisen – noch dazu als katholische Ordensfrau. In Ägypten hatte es nach dem Umsturz des Regimes viele Angriffe auf christliche Kopten gegeben, die während der Revolution noch Mitstreiter gegen den einstigen Präsidenten Husni Mubarak gewesen waren. Christen erlebten dort keinen Arabischen Frühling, und sosehr ich die Demokratiebewegung mit dem Herzen unterstützt hatte, so schrecklich fand ich die Übergriffe auf meine Glaubensbrüder und -schwestern. Konnte es in Syrien ähnlich sein? Ich wollte niemanden unnötig provozieren. Das Filmteam beruhigte mich, trotzdem blieb die Lage heikel für alle westlichen Reisenden. An der türkisch-syrischen Grenze sollten wir später ein Flüchtlingslager besuchen. Im Herbst 2011 lebten achttausend Flüchtlinge in ihm, die aktuellen Zahlen kenne ich nicht, kaum werden es jedoch weniger Menschen sein. Seitdem sind jedenfalls mehr als 200000 Syrer ins Nachbarland geflohen. Der Bürgerkrieg in Syrien hat sich längst im Libanon ausgebreitet, die Gewalt im Nahen Osten hat überhaupt zugenommen. Israel bombardierte erneut Gaza und die Palästinenser Israel.
Viele Menschen, die ich auf der Reise traf, sind durch die verschärfte politische Lage heute in großer Gefahr. Ich denke an sie, und ich bete für sie. Wo es möglich ist, stehen wir über das Internet weiter in Verbindung. Die Sehnsucht nach einem friedlichen Miteinander der Religionen und der Völker war Grundthema aller Gespräche, die wir führten, der Krieg mit unserem Aufenthalt im Libanon allgegenwärtig. Ich bin keine politische Berichterstatterin, trotzdem habe ich versucht, die Konflikte zu verstehen, da mir vieles unter die Haut gegangen ist.
In diesem Buch möchte ich wiedergeben, was ich gesehen habe, was andere mir erzählt haben – vor und hinter der Kamera. Diese Reise hat mich erschüttert und zugleich mein Leben ungemein bereichert. Vielleicht kann ich durch meine Erlebnisse andere ein bisschen anstecken, neugierig zu werden auf das Fremde – im eigenen Land, in der eigenen Religion, sogar im eigenen Inneren – und Fremden mit derselben Offenheit und Gastfreundschaft zu begegnen, die mir während all der Wochen des Unterwegsseins immer aufs Neue so großzügig gewährt wurden.
1Es müffelt ein wenig – zum ersten Mal in einer Moschee
Einchecken in der Vorfreude auf eine große Reise ist wunderbar. Mein erster Flug Non-EU! Genüsslich schlürfe ich an diesem ersten Septembertag einen völlig überteuerten Tee mit Blick auf das nebelige Rollfeld des Flughafens. Frauen mit Kopftuch, Männer in dunklen Jacketts, ein paar frühe Businesstypen mit Computertasche, junge Menschen mit Rucksack – und dazwischen ich. Schauer der Dankbarkeit laufen mir über den Rücken, und ich kann nur mit den Worten einer Mitschwester sagen: «Unglaublich, was Berufung alles beinhaltet!» Berufung zum Ordensleben scheint erst einmal mit Verzicht zu tun zu haben. Auf den zweiten Blick aber ist es pure Fülle. Wie in diesem Augenblick. Denn jetzt wartet die Türkei auf mich – Sehnsuchtsziel für so manchen im Viel-Regen-Land Deutschland. Ich kenne es von verlockenden Prospekten, auf denen mir weiße Strände und ein blaues Meer entgegenlachen. Die Fernsehdokumentation wird natürlich kein Urlaub sein, so viel steht fest. Filme machen ist Arbeit. Und die Strecke, die wir vor uns haben, ist nicht ohne. An die Länder, die man mit dem Label «Nahost-Konflikt» beklebt, möchte ich aber jetzt noch nicht denken. Die Türkei ist für den Anfang aufregend genug.
Landeanflug Istanbul: so weit das Auge reicht, nur Häuser. Ein Meer von Häusern. Und mittendrin das blaue Band des Bosporus mit den zwei Brücken. Sie spannen sich wie dünne Arme über das Wasser. Schon während des Flugs habe ich Ausschau nach Menschen gehalten, die mir vielleicht zur Seite stehen könnten. Denn ehrlich gesagt schwindet mein Mut mit jeder zurückgelegten Flugmeile – der Flughafen Istanbul-Atatürk ist schließlich einer der größten in Europa! Und nun stehe ich allein am Gepäckband und warte auf meinen Koffer. Vielleicht ist es meine hilflose Ausstrahlung oder aber wieder ein Geschenk des Himmels, dass mich just in dieser Situation ein Mann anspricht: «Brauchen Sie Hilfe?»
Er stellt sich als Mohammed vor, ein Mann in Geschäftsoutfit, etwa Mitte vierzig, mit einem sympathischen Lachen. Er lebt in Krefeld und besucht, auf der Durchreise nach Asien, seine Familie in Istanbul. Es sei nämlich Zuckerfest, erklärt er, mit dem man ja das Ende des Ramadan feiere, und da besuche man seine Familie, in der Regel die jüngeren die älteren Leute. Plausibel. Viele der deutsch-türkischen Mitreisenden im Flugzeug waren mittleren Alters, wahrscheinlich alles Zuckerfest-Besucher.
«Gott hat Sie zu mir geschickt, damit ich Ihnen helfe», bemerkt mein Begleiter. Ich weiß nicht, warum er das sagt, aber ich kann es kaum glauben – ich trage nicht einmal meinen Habit! Hat in Deutschland je ein Mensch so etwas zu mir gesagt? Just in diesem Moment kommt auch mein Koffer, den der Herr Mohammed vom Band hievt. Danke, Gott! Du hast mich also hier schon erwartet!
«Vielen Dank, Mohammed», sage ich.
«Kein Problem», antwortet er und holt seinen eigenen Koffer, bevor er mich fragt: «Und wohin wollen Sie in Istanbul?»
Ich krame den Zettel mit der Hoteladresse aus meiner Tasche und zeige ihn meinem Engel in Menschengestalt. Mohammed liest stirnrunzelnd, dann lacht er und sagt: «Das ist bei den großen Moscheen, ganz leicht zu finden. Kommen Sie, die Bahn fährt dort vorn.» Mit Riesenschritten zieht er los, sodass ich gar nicht in der Lage bin, ihn zu fragen, was er denn mit den großen Moscheen meinen würde. Egal. Mohammed kauft mir ein Ticket, weil ich noch kein türkisches Geld habe, und begleitet mich bis zu der Station, an der ich umsteigen muss, nicht ohne mir seine Telefonnummer zu geben, mit dem Hinweis, dass ich ihn jederzeit anrufen könne, wenn ich Hilfe bräuchte. Zum Glück hatte ich mich im letzten Augenblick entschlossen, mein Handy mitzunehmen, und nicht, wie ursprünglich geplant, alles hinter mir zu lassen. Sorgfältig programmiere ich die Telefonnummer, sehr beruhigend ist das. Man sagt ja, der erste Eindruck ist wichtig. Mein erster Eindruck von der Türkei: die Freundlichkeit und ungewöhnliche Hilfsbereitschaft von Mohammed aus Krefeld. Das macht mein Herz weit und offen.
Das Hotel finde ich ohne große Probleme. Mein Zimmer besteht aus einem großen Doppelbett, einem wackeligen Kleiderschrank mit leicht klemmender Tür, weiß getünchten Wänden und einem goldgerahmten Bild: Menschen mit Turbanen sind darauf zu sehen, eine Menge Obst auf einem Tisch, Frauen in langen und farbenfrohen Gewändern, leicht verschleiert – wahrscheinlich die türkische Version des deutschen Hotelklassikers «Röhrender Hirsch». Die Aussicht aus dem Fenster lässt allerdings jede Möblierung augenblicklich unwichtig erscheinen: Ich schaue direkt auf den Bosporus, es ist ein beeindruckender Anblick, dort fahren Ozeanriesen, Fähren und eine Menge Tanker; die Meerenge ist breiter als jeder Fluss, den ich bisher gesehen habe. Ich packe meine Sachen aus, während mir das Wasser die Stirn herunterläuft, denn im Zimmer ist es heiß. Dass es eine Klimaanlage gibt, bemerke ich erst am nächsten Morgen, nach einer stickigen Nacht. Jetzt ist aber erst einmal Mittag, und ich eile nach draußen, in der Hoffnung auf etwas frische Luft.
Eine Stadt wie Istanbul bietet Sehenswürdigkeiten für mehrere Monate. Doch weil ich keine Kulturtouristin bin, mache ich mich ohne Reiseführer auf den Weg, einfach der Nase nach. Auf dem Sultan-Ahmed-Platz verweile ich erst einmal, um mich an die heiß strahlende Sonne zu gewöhnen, die von einem wolkenlosen Himmel sticht. Frische Luft ist etwas anderes. Dafür Palmen überall (ich liebe Palmen!), Brunnen mit sprudelnden Wasserfontänen, Blumen und Menschen – viele Menschen, meist in großen Gruppen, darunter erstaunlich wenig Mitteleuropäer. Von Mohammed habe ich erfahren, dass mindestens vierzehn Millionen Menschen hier leben, davon nur 80000 bis 100000 Christen – enorm wenig, wie ich finde. Jetzt weiß ich auch, welche «großen Moscheen» dieser menschliche Engel gemeint hat, denn hier befinden sich die Hagia Sophia und die Blaue Moschee in Sichtweite, sie liegen sich direkt gegenüber. Ich überlege, ob ich in eines der beiden Gebäude hineingehen soll, verschiebe es aber auf später. Ich muss erst einmal mit den Straßen vertraut werden.
Laut ist es. Das fällt mir sofort auf. Man unterhält sich, man begrüßt sich mit Küssen und Umarmungen, gestikuliert und fällt einander ins Wort, lacht, hält die Hand des anderen, während man ein lockeres Gespräch beginnt, auch oder gerade die Männer! Undenkbar wäre das bei uns, und es gefällt mir. Langsam schlendere ich weiter, um meine Schweißdrüsen nicht unnötig zu provozieren. Anstatt Kirchtürme sehe ich überall Minarette aus dem Häusermeer hervorragen – wie Zeigefinger weisen sie gen Himmel, und ihre nadelförmigen Spitzen erinnern mich an Mondraketen. Wenig später wird zum Gebet gerufen. Zum ersten Mal höre ich den Adhan, den Gebetsruf des Muezzins, der die Gläubigen sammelt. «Allah ist der Allergrößte! Ich bezeuge, dass Allah der einzige Gott ist. Ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist! Kommt her zum Gebet! Kommt her zum Heil! Hajja’ala-salah! Hajja’ala-l-falah! Es gibt keinen Gott außer Allah!» Wenn das hierzulande auch so wäre, würde es wahrscheinlich Beschwerden hageln, weil wir eine viel weltlichere Gesellschaft sind. Anfänglich bereitet mir der Gebetsruf ein Gefühl der Fremdheit, aber im Lauf der Wochen wird es sich legen.
Während ich weiter alles mit Augen und Ohren aufsauge, denke ich über den Ramadan nach. Der Fastenmonat ist ein heiliger Monat, er gehört zu den fünf wichtigen Säulen des Islams. Die vier anderen sind das Gebet, das Glaubensbekenntnis, die Pilgerfahrt nach Mekka (Haddsch) und die Almosen an die Armen (Zakat). Während der Fastenzeit wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder etwas gegessen noch getrunken, es sei denn, man ist krank. Wie man das bei dieser Hitze schaffen und dabei noch normal arbeiten kann, ist mir ein Rätsel. Hut ab! Mit Einbruch der Dunkelheit ist dann alles wieder erlaubt. Letztens traf ich in Köln einen jungen Türken, der am späten Abend mit Riesenbissen einen Döner in sich hineinstopfte – aber anstatt mich über seine schlechten Essensmanieren aufzuregen, verstand ich seine Situation. Er hatte seit achtzehn Stunden nichts mehr zu sich genommen. Ich nickte mitfühlend und sagte: «Ramadan!» Er nickte mit vollen Backen und freute sich sehr, dass ich Bescheid wusste, dann kam der nächste große Bissen.
Das Fasten betrifft aber auch das eigene Verhalten: Man soll nicht lügen und betrügen, keine Sünden begehen und sich der Sexualität enthalten. Im Koran steht, dass das Fasten Gott gefällt, Ähnliches gilt für Christen: «Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler», sagt Jesus im Matthäusevangelium. «Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten … Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht; und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.» Der Prophet Mohammed hat regelmäßig gefastet, ebenso Jesus: Vierzig Tage lang war dieser allein in der Wüste, um innere Klarheit über seinen Weg zu finden. Fasten macht den Kopf klar und den Geist empfänglich. Als Christen haben wir unsere Fastenzeit vor dem Osterfest, um Jesus auf seinem bevorstehenden Leidensweg gewissermaßen «beizustehen», um mit unseren «kleinen Leiden» sein «großes Leiden» nachzuvollziehen und das große Fest der Auferstehung in aller Tiefe empfinden zu können.
In unserer dominikanischen Gemeinschaft fasten wir nicht mehr so streng, wie es traditionell einmal war; ich selbst verzichte grundsätzlich nicht ganz aufs Essen oder Trinken. Dabei geht es mir nicht gut. Aber ich esse viel weniger Fleisch, als ich es sowieso tue, und versuche keine Süßigkeiten zu naschen, Alkohol trinke ich sowieso kaum. Viel wichtiger sind mir ein innerliches Hinschauen und «Entrümpeln». Und vor allem nehme ich mir mehr Zeit zum Gebet und zur inneren Wachsamkeit, lese ein gutes geistliches Buch als Fastenlektüre und erneuere meine Gottesbeziehung. Die Disziplin beim Fasten ist mir weniger wichtig, obwohl sie sicherlich ihren Wert hat. Mein Ziel ist, wieder mehr Einfachheit im Leben zu gewinnen. Denn was passiert, wenn ich durch den Verzicht auf äußere Dinge und auf Ablenkungen auf mich selbst zurückfalle? Sehr viel, kann ich nur sagen: Es kommen andere Dinge zum Vorschein, und es sprechen andere Stimmen in mir. Und so verstehe ich auch Jesus in der Wüste. Zu ihm kam der Teufel und bot ihm Reichtum, Macht, Herrlichkeit und Zauberkräfte an, wenn er doch von Gott abließe und stattdessen ihn anbeten würde. Hat er natürlich nicht, denn er sagte: «Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt.» Ich brauche Gott – existenziell. Und das versuche ich in der Fastenzeit wieder erfahrbar zu machen, wenn es im Lauf des Jahres mal wieder im Alltag weniger wird. Ich bin sicher, dass ein großer Teil unserer Erschöpfung, von der so viel die Rede ist, ihren Grund darin hat, dass wir uns permanent berieseln lassen und uns irgendwelchen Reizen aussetzen. Gehirnforscher haben bewiesen: Jeder Mensch braucht Zeiten, wo er gar nichts tut. Wo auch das Gehirn gleichsam fastet. Und ich habe erfahren: Ich brauche Gott!
Ist das Fasten vorbei, kehrt man als Verwandelter in die Welt zurück – so die Theorie. In der Praxis stopfen Christen ebenso wie Muslime beim Fastenbrechen Unmengen von Süßigkeiten in sich hinein, und die müssen verdaut werden – daher wohl all die vielen Spaziergänger um mich herum.
Gemächlich zieht es mich durch die historische Altstadt Richtung Norden, bis zum Goldenen Horn. Ziemlich schnell werde ich als Deutsche identifiziert: Ich trage kein Kopftuch, bin auch nicht so schick gekleidet wie viele der Frauen, die mir hier in diesem Stadtteil begegnen. Diese sind entweder in größeren Gruppen unterwegs oder aber mit ihren Männern. Keine einzige Frau ist allein unterwegs. Das verunsichert mich: Fühlt man sich so, wenn man als Muslimin nach Deutschland kommt? Fremd? Jetzt kenne ich das Empfinden andersherum. Aber immer, wenn ich anfange, mich richtig unwohl zu fühlen, werde ich von Menschen gegrüßt, die sich offenbar freuen, mich zu sehen. «Hallo! Kommen Sie aus Deutschland?» – «Ja!» – «Wir auch. Wie gefällt es Ihnen bei uns?» – «Sehr gut, danke!» Nach einer Weile gewöhne ich mich daran, wie auf einem Präsentierteller durch die Stadt zu marschieren. Trotzdem: Gut, dass morgen mein Team ankommt!
Auf der anderen Seite der Wasserstraße ragt der Galataturm über die Dächer von Beyoğlu hervor, der Christusturm, den Bewohner der genuesischen Handelssiedlung Galata dort errichteten. Die Galater waren Nachfahren keltischer Söldner, sie kommen auch in der Bibel vor. Der heilige Paulus schrieb einen Brief an die Galater, er ist im Neuen Testament zu finden. Manche sagen, dass die Galater ursprünglich in dieser Gegend gelebt haben. Der Galataturm ist ein Überbleibsel der Epoche, als die Stadt Istanbul noch Konstantinopel hieß und die Hagia Sophia die wichtigste Kirche der Christenheit war – bis die Osmanen kamen.
Es ist ja so, dass Christen und Muslime eine gemeinsame kriegerische Vergangenheit haben; jeder von ihnen ist der Meinung, die einzig «richtige» Offenbarung zu besitzen. In dem Galaterbrief spricht Paulus aber über die Liebe: «Durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in ‹einem› Wort erfüllt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst! Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom andern aufgefressen werdet.» Christen und Muslime – auch in Deutschland ist das wieder verstärkt ein Reizthema, seit wir uns mit radikalen islamischen Gruppen wie den Salafisten auseinandersetzen müssen. Als Ex-Bundespräsident Christian Wulff erklärte, der Islam gehöre zu Deutschland, gab es jedenfalls längst nicht nur freundliche Rückmeldungen – aber auch nicht, als er kurze Zeit später in der Türkei verkündete, das Christentum gehöre zur Türkei. Unabhängig davon: Mit Absolutheitsansprüchen kommen wir auf Dauer nicht weiter.
Ich genieße es, versunken in Überlegungen, mich weiter treiben zu lassen. Nach geraumer Zeit spült mich der Strom dann doch an den Eingang einer großen Moschee. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich traute, aber jetzt bin ich bereit für meinen ersten Besuch in einem islamischen Gotteshaus. Wie alle anderen ziehe ich die Schuhe aus und lege sie in einen Plastikbeutel, lasse mir ein Kopftuch geben und gehe hinein. Die jungen Mädchen hinter mir müssen ihre nackten Beine mit einem langen Stoff verhüllen. In den Petersdom kommt man auch nicht mit Shorts hinein. Ich finde das gut.
Vorsichtig betrete ich einen wunderschönen Raum mit Teppichboden, der ganz weich unter den Füßen und über und über mit prächtigen Mustern geschmückt ist. Die Kuppel wölbt sich über meinem Kopf, und ich muss ihn ganz zurücklegen, um die blau-weißen Mosaiken zu betrachten. Keine Bilder wie in (katholischen) Kirchen. Nur Schriftzeichen und Muster. Als einziger Schmuck sind in Moscheen Zitate aus dem Koran erlaubt, Namen von großen Propheten und Sultanen oder Ornamente und Blumen; richtige «Bilder» können den Gebetsraum verunreinigen. Das kann ich nachvollziehen, denn Bilder können tatsächlich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und von der Andacht ablenken. Ich ahne zwar nicht im Entferntesten, was die kunstvollen Zeichen bedeuten, aber sie wirken erhaben auf mich. Kein Wunder: Der Koran wurde nach muslimischem Glauben unmittelbar von Gott diktiert, und viele halten ihn für den schönsten und poetischsten Text, der je in arabischer Sprache verfasst worden ist.
Interessanterweise gibt es im Koran kein konkretes Bilderverbot, anders bei Juden und Christen, die ausdrücklich aufgefordert werden, sich kein Bildnis von Gott zu machen – was die Juden auch befolgen, und die Christen … na ja. Bei dem berühmten Ordensbruder Meister Eckhart heißt es zwar auch, dass man Gott ganz und gar bildlos erkennen soll – aber von der Nüchternheit einer schmucklosen Kapelle bis hin zum fast unerträglichen «Liebes-Jesulein-Kitsch» in so mancher Barockkirche ist bei uns alles möglich. Meine eigenen Vorlieben liegen dazwischen. Auf religiösen Schnickschnack kann ich verzichten. So ganz ohne Bilder wäre es für mich aber auch schwer, mit Gott zu sein. Bilder können nämlich nicht nur ablenken, sondern auch hineinführen in das, was dann letztlich Geheimnis und unaussprechlich bleibt. Ich denke, es kommt sehr auf die Bedürfnisse, die Möglichkeiten und die Situation des Einzelnen an, wie man mit Gottesbildern umgeht. Und die Stille hinter den Bildern ist an allen heiligen Orten dieselbe.
Im Augenblick nehme ich nur die Atmosphäre dieses bildlosen Raumes in mich auf. In ihm summt es von Gebeten, ich suche nach Hinweisen, wie hier eine Art Liturgie gefeiert wird. Einen Altar gibt es ja nicht, aber dafür Kanzeln, zu denen Treppen führen. Von ihnen wird die Freitagspredigt gehalten, das Pendant zu unserer Sonntagspredigt. Ich entdecke auch Emporen, auf denen Menschen sitzen oder stehen, eine Nische, die wie eine Kapelle aussieht und besonders hervorgehoben ist. Das ist die Gebetsecke, die nach der heiligen Stadt Mekka ausgerichtet ist. Ansonsten ist die Moschee wohltuend leer, keine Stühle oder Bänke wie bei uns. Ich mag diese Weite, sie gibt der Seele die Möglichkeit, sich auszudehnen.
Ich registriere einen Bereich, den nur Männer und Kinder betreten dürfen, um dort zu beten. Für mich ist befremdlich, dass ich als Frau nicht überall hingehen darf. In unseren Kirchen hat man so etwas abgeschafft, obwohl man kaum behaupten kann, dass die (katholische) Kirche die Frau dem Mann gleichstellt. Frauen dürfen in der Kirche die Schrift auslegen – ein Recht, das jeder Christ hat. Zur Predigt können sie von Priestern beauftragt werden, aber es existieren auch konservative Richtungen, die Frauenpredigten ablehnen. Vom Frauenpriestertum ganz zu schweigen – es wird immer wieder gefordert und jedes Mal aufs Neue abgelehnt. Aber so ist es in fast allen Religionen. Sie wurden von Männern gegründet, die Hierarchien wurden und werden in der Regel von Männern angeführt, die Schriften wurden von Männern geschrieben und von ihnen interpretiert. Bis heute stellen die meisten Konfessionen die Frau unter den Mann – mal mehr, mal weniger. Das hält sich zäh, auch wenn es in meinen Augen mit Gott nichts zu tun hat. Jesus hat Männer und Frauen in seiner Zuneigung vollkommen gleichgestellt. Dass seine Jünger hauptsächlich Männer waren, liegt meines Erachtens nicht an einer Bevorzugung, sondern daran, dass sich in der jüdischen Gesellschaft Frauen nicht frei bewegen konnten. Es war also ein sozialer Grund, kein spiritueller.
Über Mohammed und die Frauenfrage wird innerhalb der islamischen Strömungen heftig gestritten. Im Koran steht zum Beispiel, dass Frauen geschlagen werden dürfen (aber nicht ins Gesicht), der Prophet selbst hat der Überlieferung nach aber niemals eine Frau geschlagen. Im Koran werden der Frau Eigentumsrechte zugesprochen, die sie vorher nie hatte. Ob der Prophet zu Lebzeiten die Ehe mit einer Minderjährigen einging oder nicht, will ich nicht beurteilen. Wenn aber heute elf-, zwölfjährige Mädchen aus religiösen Gründen zwangsverheiratet werden, sage ich ganz klar: Nein! Was damals war, ist eine Sache. Wenn Mädchen und Frauen in unserer Welt benachteiligt oder unterdrückt werden, egal, wo und aus welchen Gründen, dann ist das eine Wunde, die auf Heilung wartet.
Jesus ist unverheiratet geblieben, doch war Maria Magdalena ihm ganz nah, und wir Dominikanerinnen von Bethanien fühlen uns wiederum ihr verbunden. Das liegt in der Geschichte unserer Gemeinschaft begründet. Unser Ordensgründer, der französische Pater Jean-Joseph Lataste (1832 – 1869), gab mehrmals Exerzitien in einem Frauengefängnis. Er hatte dort mit Mörderinnen, Diebinnen, Prostituierten und Gotteslästerinnen zu tun, mit Frauen, die in irgendeiner Weise schuldig geworden waren. Und ihnen erzählte er die Geschichte von Maria Magdalena, so, wie er sie kannte: Eine stadtbekannte Prostituierte wurde zur «Apostelin der Apostel» und schließlich zur Heiligen, weil sie erlebte, dass Gott sie liebte, bedingungslos, ganz gleich, wie tief sie in den Augen der Gesellschaft «gefallen» sein mochte. Das machte einen großen Eindruck auf die gefangenen Frauen, sie fühlten sich angenommen, denn plötzlich sprach ihnen jemand einen Wert zu, den sie sich selbst längst abgesprochen hatten. Da stellte sie jemand auf eine Stufe mit Maria Magdalena und der Mutter Gottes. Gott schaut nicht auf das, was gewesen ist, sondern auf das, was ist und wie du liebst – das war eine gute Botschaft für sie. Pater Lataste wusste, dass diese Frauen im Grunde keine Chance hatten, nach ihrer Entlassung in der Gesellschaft wieder Fuß zu fassen. Also hatte er die Idee, einen Schwestern-Orden zu gründen, mit «normalen» und «gefallenen» Frauen. Die biblische Maria Magdalena hatte eine Schwester gehabt – in Bethanien, einem Ort nahe Jerusalem, wo Jesus sehr gern zu Gast war. So entstand 1866 das erste Kloster der Dominikanerinnen von Bethanien in Frankreich. Heute gibt es uns auch in der Schweiz, Italien, den Niederlanden, Deutschland und in Lettland. Und dann ist da noch eine Schwester auf Aruba, den Holländischen Antillen. Mit einem Besuch bei ihr habe ich schon immer geliebäugelt …
Aber jetzt bin ich hier. In der Moschee wende ich mich ab von den äußeren Eindrücken und spreche mit Gott. Etliche Gläubige sitzen auf der Erde, was mir sehr sympathisch ist, und so habe auch ich mich für mein Gebet auf dem Boden niedergelassen. Ich bete darum, dass Gott den Menschen Erkenntnis über unser aller Gleichheit schenkt. Über unsere Gleichwertigkeit. Dass wir eine unsterbliche Seele haben. Dass wir, ob türkisch oder deutsch oder sonst was, jenseits der Sprachen und Bilder eins sind. Und dass es der göttliche Auftrag ist, ins Paradies zurückzukehren, dies möglich zu machen – im Himmel und so auch auf Erden. Allerdings dauert meine Andacht nicht besonders lange, denn nach kurzer Zeit kriechen störende Gerüche in meine Nase. Ich begreife: Millionen von Füßen haben diesen Teppich schon betreten; historisch wichtig, aber nicht unbedingt angenehm.
Beim Verlassen der Moschee beeindruckt mich ihr Außenbereich. Ich sehe Höfe, in denen Menschen sitzen, reden, lachen und essen. Leider sind unsere Kirchen nicht mehr ein Zentrum gesellschaftlichen Lebens wie noch einst im Mittelalter. In der Mitte eines jeden Hofes befindet sich ein kunstvoll gestalteter Waschbereich, hier waschen sich die Männer (für die Frauen soll es Ähnliches an einem geschützteren Ort geben). Die Waschungen gehören als Ritual zum Gebet. Die Väter zeigen ihren Kindern, wie man es richtig macht, das Ohrenwaschen, Armewaschen, Nasewaschen und Füßewaschen. Letzteres ist auch uns Christen nicht unbekannt, Jesus hat seinen Jüngern vor dem letzten Abendmahl die Füße gewaschen. Jetzt ahne ich, woher das kommt – hier ist es staubig, man trägt Sandalen, und wenn man dann barfuß einen Gebetsraum betritt, ist es doch selbstverständlich, dass man sich vorher reinigt. Es ist eine Geste des Respekts.
Voll von diesen Eindrücken und Gedanken kehre ich zurück in mein Hotel. Noch lange schaue ich dem Treiben auf dem Bosporus zu.
2Ein ganz schöner Hingucker – in Schwesterntracht durch Istanbul
Trotz der stickigen Nacht fühle ich mich am Morgen erfrischt. Schwungvoll ziehe ich meine Schwesterntracht an und gehe die Treppen hinunter zum Frühstücksraum. Das ist mein erster «Auftritt» mit christlichem Habit in Istanbul, ich muss mich ein wenig überwinden und bin verlegen, als ich den Frühstücksraum betrete und sich alle Augen auf mich richten. Das ist in Deutschland schon manchmal unangenehm, und weil ich den Habit nicht ständig trage, bin ich nicht so sehr an die Wirkung gewöhnt, die das in Menschen auslösen kann. Hier noch mehr. Aber ich werde mit sehr viel Respekt und Freundlichkeit begrüßt, auch mit Neugierde.
Direkt von meinem Platz aus kann ich die Queen Elizabeth sehen. Ein riesengroßes Kreuzfahrtschiff. Esstechnisch halte ich mich an das, was ich kenne – Joghurt, Honig, Brot, Melone. Und endlich sind dann die anderen aus dem Fernsehteam da – mitten in der Nacht sind sie angekommen: Lutz, Coregisseur und der Mann rund ums Fotografieren, Regisseur Volker, Tom, der Produktionsleiter, Kamerafrau Sabine, ihr Kameraassistent Chris, Tonmann Mark, Ayhan, die Übersetzerin, und natürlich Rainer Maria Jilg, mein Copilot, Baujahr 1978, schlank, dunkelblond, gebürtiger Bayer und Brillenträger – sein Markenzeichen, zusammen mit einer Baseballkappe mit Sonnenschutz. Eine wunderbare Truppe, die ich schon bei einem Kennenlernen in Berlin auf Anhieb in mein Herz geschlossen hatte. Mit großem Hallo schieben wir die Tische zusammen und fangen gleich zu reden an. Wie sieht der Zeitplan aus? Wie meine Rolle? Was habe ich zu sagen?
Wir Dominikanerinnen sind Predigerschwestern, das heißt, wir haben den Auftrag zur Predigt. Ich verstehe das weniger als Mission, sondern mehr im Sinne der Verkündigung Gottes. Predigt kann ein Vortrag, ein Aktiv-Sein oder einfach meine Art der zwischenmenschlichen Begegnung sein. Entscheidend ist, dass andere Menschen an mir ablesen können, wie oder was Gott für mich ist. Und ich hoffe, dass sie an mir erkennen können, dass Gott gut ist. Meine Erfahrung mit Gott, meine Empfindung, dass ich von Gott geliebt werde, ist tief in mir verwurzelt. Jetzt sage ich dem Team, dass ich das während der Reise zum Ausdruck bringen möchte. Für mich hat Jesus auf Erden geweilt, um die Liebe Gottes zu zeigen, in ihrer menschlichen Form. Er hat vorgemacht, wie Liebe funktioniert, und ich versuche, ihm so gut wie möglich nachzufolgen. Das ist eigentlich schon alles. Doch wie schwierig kann das sein! Oder nicht? Darüber wird noch zu reden sein. Ich schaue Jesus an. In diesem schönen Frühstücksraum, gehalten in Weiß und Türkis, ist er nämlich präsent, auf einem riesigen und kitschig anmutenden Abendmahlsbild an der gegenüberliegenden Wand (im Islam ist er ein hochgeehrter Prophet). Jesus sitzt in der Mitte, die Jünger drum herum. Alles wirkt sehr orientalisch, die Menschen wie die Kleidung. Ich sitze Jesus als Schwester Jordana gegenüber, acht «Jünger» umgeben mich. Ich muss lachen. Es ist besser, wenn ich jetzt ein paar Melonenstücke verteile.
Gleich nach dem Frühstück haben wir unseren ersten Termin. Wir werden im hiesigen Dominikanerkloster erwartet, nur einen Katzensprung entfernt vom Galataturm. Von diesem Kloster aus wird meine Reise beginnen, ausgehend vom vertrauten Raum meines eigenen Ordens ins Unbekannte. Ich staune, dass es mitten in Istanbul dieses Kloster gibt, vom Baustil könnte es ebenso gut in Italien stehen. Man kann sogar Fremdenzimmer mieten.
Bruder Josef empfängt mich in der kühlen und dämmerigen Kirche mit herzlichen Worten – schlagartig sind der Lärm und die Hitze vor der Tür geblieben. Der leichte Weihrauchgeruch ist da, den meine geübte Nase sofort aufgespürt hat und mit «Zuhause» verbindet. Bruder Josef und ich müssen ein wenig radebrechen, denn er ist, wie er sagt, gebürtiger Pole, und sein Deutsch sei eingerostet. Sofort erkenne ich ein Gemälde von Katharina von Siena an der Wand, im weißen Dominikaner-Habit mit schwarzem Mantel und mit einer Lilie als Zeichen der Jungfräulichkeit. Katharina gehört zu den wichtigsten Heiligen in unserem Orden, sie ist in fast jeder dominikanischen Kirche zu finden und hat zu ihrer Zeit viel bewegt. Von ihr stammt der Satz: «Gebt euch nicht mit Kleinem zufrieden, Gott erwartet Großes!», und sie selbst hat es so gehalten. Sie reiste viel, war als Predigerin unterwegs – eine Besonderheit, da diese Aufgabe – wie schon gesagt – in der Regel Männer ausübten. Insofern war sie, eine Frau aus dem 13. Jahrhundert, bereits sehr modern, emanzipiert und unabhängig. Sie stand im Briefkontakt mit den Päpsten, vermittelte zwischen Staatsoberhäuptern und nahm kein Blatt vor den Mund – ähnlich wie Hildegard von Bingen. Sie muss sehr überzeugend gewesen sein, sodass der Papst sie mit außerordentlichen Privilegien ausstattete. Katharina von Siena gehört zu den wenigen Frauen in der katholischen Kirche, die zur Kirchenlehrerin erhoben wurde. Immerhin! Ich finde ihr Lebensbeispiel ermutigend. Ich darf als kleiner Mensch groß denken. Ich darf den Mut zur Veränderung haben und nach außen tragen. Ich gehe zu ihrem Bildnis, bleibe davor stehen und bitte sie um Beistand auf meiner Reise. Möge ich so ehrlich und mutig sein wie sie – das wünsche ich mir.
«Früher waren wir in diesem Kloster noch viel mehr», sagt Bruder Josef, der neben mich getreten ist und gemeinsam mit mir das Antlitz von Katharina von Siena betrachtet. «Jetzt sind wir nur noch zu fünft. Es gibt kaum Nachwuchs in den letzten Jahren.» Wahrscheinlich hat er lange gebraucht, um die Sätze in seinem Kopf zu formen.
Danach stellt er mich Pater Richard Nennstiel vor, der längere Zeit in dem Kloster gelebt hat. Der Pater ist zu Besuch da, er liebt diese Stadt und würde sofort an diesen Ort zurückkehren, wie er mir anvertraut, aber der Orden braucht ihn in Deutschland. Er erzählt mir auch, dass es einen Exodus von Christen aus der Türkei gab, als Kemal Atatürk 1923 die Republik ausrief und viel kirchlicher Besitz enteignet wurde. Priester durften nicht mehr ausgebildet werden, öffentliche Feiern oder Prozessionen wurden verboten. Bis heute gibt es für christliche Geistliche keinen klaren Rechtsstatus.
«Offiziell existieren wir gar nicht», fährt Pater Richard fort, «aber dank internationalem Druck auf die türkische Regierung wurde vor kurzem ein Gesetz erlassen, nach dem die enteigneten christlichen und auch jüdischen Gebäude wieder zurückgegeben werden sollen.»
«Ist doch toll», freue ich mich.
Der Bruder lächelt fein und wedelt mit der Hand: «Versprochen heißt nicht, dass dies auch realisiert wird, noch längst nicht!» Und er erklärt mir, dass türkisches Recht nicht unbedingt dasselbe bedeutet wie türkische Realität.
Die Dominikaner leben seit dem 13. Jahrhundert in der Türkei, in ununterbrochener Folge, und seit ungefähr fünfhundert Jahren in dem Kloster in der Nähe des Galataturms. Trotz aller Schwierigkeiten fühlen sie sich sicher, der Islam in der Türkei, so Pater Richard, sei immer tolerant gewesen. Im Priestergewand gehen die Brüder trotzdem nicht auf die Straße, zwar garantiere die Verfassung Religionsfreiheit, aber nur individuell. Alle religiösen Institutionen werden vom Staat kontrolliert – auch die islamischen.
«Sollte man mich dann besser nicht im Habit filmen?», frage ich nach. «Ich will hier niemanden provozieren.» Im Anschluss an den Klosterbesuch wollte man drehen, wie ich durch Istanbuls Straßen ging.
«Kein Problem, bei Ordensfrauen drückt man ein Auge zu.»
«Gibt es dafür einen Grund?»
«Sie genießen ein hohes Ansehen. Direkt um die Ecke gibt es ein Krankenhaus, das von Lazarus-Schwestern geführt wird. Sie behandeln Arme umsonst. Auch die Mutter-Teresa-Schwestern sind in Istanbul, und sie tun viel Gutes.»
Beide sehen optisch zwar völlig anders aus als ich, überlege ich – die einen tragen Schwarz (Lazaraus-Schwestern), die anderen Weiß-Blau (Mutter-Teresa-Schwestern) –, dennoch bin ich froh, dass ich mich sozusagen unter dem Schirm ihres guten Rufs in der Öffentlichkeit im Habit bewegen kann.
In der Kirche bete ich die Laudes, gemeinsam mit den Brüdern. Es ist schön, immer wieder am Tag zur Ruhe zu kommen. Eine Zeit zu haben, um mit Gott zu sprechen. Dann naht der Abschied – viel zu schnell. Aber so wird es während der gesamten Reise sein. Meine Vorlieben werden sich regelmäßig dem Drehplan unterordnen müssen.
Am Anfang kostet es mich Überwindung, im Habit durch Istanbul zu laufen. Ich ziehe noch mehr Blicke auf mich als tags zuvor, als ich in gewöhnlicher Kleidung durch die Stadt schlenderte. Doch ständig werde ich freundlich gegrüßt. Ayhan, unsere deutsch-türkische Übersetzerin, eine zwanzigjährige dunkelhaarige Schönheit, die den Job während ihrer Semesterferien angenommen hat, erklärt fragenden Passanten, was wir hier tun. Sie kann es kaum glauben: «Jordana, die Menschen freuen sich riesig, dass du da bist.»
Zum Schluss betrete ich – für die Kamera – im Ordenskleid ein Geschäft und komme in Zivil wieder heraus. Mit Klischeevorstellungen einer Ordensfrau haben wir begonnen – Kirche, Stille, Frommsein, Beten. Nun bin ich zu einem «ganz normalen Menschen» mutiert, zu einer modernen Schwester auf ihrem Weg ins Heilige Land. Ehrlich gesagt, fühle ich mich gleich viel wohler.
Während die anderen ins Hotel zurückkehren, bummele ich noch ein bisschen weiter. In einer sehr großen Einkaufszone kann ich es kaum glauben: Was hängt denn da? Eine Riesenweihnachtsbeleuchtung! Mit künstlich vor sich hin tropfenden Eiszapfen und Eiskristallen, bei ungefähr 30 Grad im Schatten. Ob die Betreiber der Einkaufsmeile vielleicht einen Deal mit einer Stadt in Deutschland haben? Nach dem Motto: «Ihr kriegt die Beleuchtung im Winter, und wir hängen sie im Sommer auf.» Ich finde es jedenfalls sehr witzig.
Schließlich besuche ich die Hagia Sophia. Über ein Jahrtausend steht dieser Bau schon da. Einst christliche Kirche, dann Moschee, am Ende Museum. Es vereint christliche Ikonen (Bilder) und islamische Kaligraphien (Bilderverbot) zu einem harmonischen Ganzen, obwohl es in der Türkei auch Proteste gegeben hat, als Kemal Atatürk die alten christlichen Fresken wieder freilegen ließ, das weiß ich von Pater Richard. Kann ich einerseits verstehen. Es wäre auch für mich gewöhnungsbedürftig, wenn im Vatikan arabische Kaligraphien freigelegt würden. Andererseits bin ich Herrn Atatürk dankbar: Das goldene Mosaik von Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm ist wunderschön. Der Raum hat mehrere Etagen, die jeweils rund um den Innenbereich gebaut sind, sodass es eine große Halle in der Mitte gibt und einzelne Balustraden, die immer höher steigen. Ich lasse die Gesamtheit des Raumes auf mich wirken und denke: Wahrlich ein Menschheitsbau! In diesem Haus wurde zu Gott, zu Allah und sicherlich auch zu Jahwe gebetet. Tausende und Abertausende waren vor mir an diesem Ort, haben gestaunt, gefeiert, gesungen, getrauert und um die Erfüllung ihrer Herzenswünsche gebetet; sie haben alle ihre unsichtbaren Spuren hinterlassen. Und für einen Moment kommt es mir so vor, als lüfte sich der Vorhang der Zeit ein wenig, und alle kehrten sie zurück, jetzt, über die Epochen hinweg, als eine einzige Menschheitsfamilie. Vorübergehend sind Grenzen unwichtig. Lange verharre ich an diesem Ort, der so durchscheinend und transparent ist.