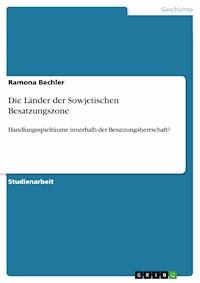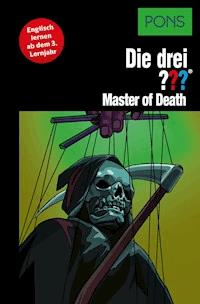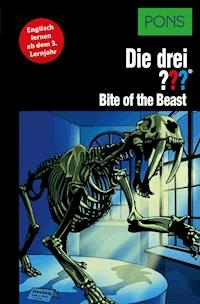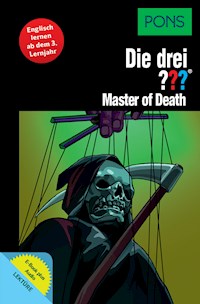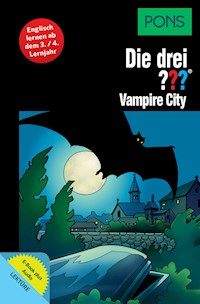36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Geschichte Europas - Neueste Geschichte, Europäische Einigung, Note: 1,1, Technische Universität Dresden, Sprache: Deutsch, Abstract: Jenseits der einzigen offiziellen Interessenvertretung für Frauen, dem Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD), entstanden in den 1980er Jahren informelle Frauengruppen in verschiedenen Städten und Regionen der DDR. Sie begannen die Stellung von Frau und Mann in der DDR-Gesellschaft zu hinterfragen und die eigene Lebensweise zu reflektieren. Als Gruppen, die sich eigenständig außerhalb des Organisationsmonopols der SED zusammenfanden, bewegten sich die Frauengruppen in einem Konglomerat von Gruppierungen, die Themen aufgriffen, welche im offiziellen Diskurs nicht erwünscht waren. Informelle Gruppierungen in der DDR sind besonders seit 1990 in den Fokus der historischen Forschung gerückt. Das zentrale Erkenntnisinteresse liegt dabei auf Fragen nach dem Oppositions- und Widerstandspotential dieser Gruppen. Die Existenz separater Frauengruppen findet gleichwohl kaum Erwähnung. Auch Studien, welche sich in den vergangenen Jahren ausführlicher mit Frauengruppen in der DDR befasst haben, setzen ihren Schwerpunkt oft nur bei den Gruppen mit dem Namen „Frauen für den Frieden“, die in verschiedenen Städten der DDR aktiv waren. Anders als die Gesamtdarstellungen zur DDR-Opposition und Bürgerbewegung werfen diese Untersuchungen aber die Frage auf, ob die Frauengruppen der DDR eine Frauenbewegung gebildet haben. Die Autorin erörtert in ihrer Arbeit zunächst die mit dieser Fragestellung verbundenen theoretischen und methodologischen Probleme – etwa in Hinsicht auf die Anwendung der Begriffe „Neue Soziale Bewegung“ und „Frauenbewegung“ auf AkteurInnen und Prozesse in einer staatssozialistischen Gesellschaft. Anschließend werden mittels Archivquellen und Zeitzeuginneninterviews fünf Dresdner Frauengruppen, die in den 1980er Jahren aktiv waren, untersucht. Die Untersuchung der Gruppen erfolgt im Hinblick auf deren Entstehung, Gründungsmotive, Aktions- und Kommunikationsformen sowie den Verbleib der Gruppen. Zwei Aspekte werden dabei besonders berücksichtigt. Erkenntnis- und Entwicklungsprozesse der Gruppen beziehungsweise einzelner Frauen in den Gruppen werden beobachtet, um mögliche DDR-spezifische Auffassungen von Geschlechterverhältnissen zu ermitteln. Im Hinblick auf die Beantwortung der Frage nach einer Frauenbewegung in der DDR wird außerdem untersucht, ob und wie Vernetzung sowie Schaffung einer (Gegen-)Öffentlichkeit unter den spezifischen Bedingungen einer Diktatur auch über Dresden hinaus statt gefunden haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Page 1
TU Dresden Philosophische Fakultät Institut für Geschichte
Magistraarbeit im HF Neuere und Neueste Geschichte
Aufbruch und Bewegung?
- Autonome Frauengruppen in Dresden 1980-1989/90
Bearbeiterin:Ramona Bechler
Abgabedatum:10.04.2008
Page 2
„Es ist in der Tat eine der größten Errungenschaften des Sozialismus, die Gleichberechtigung der Frau in unserem Staat sowohl gesetzlich als auch im Leben
„Durch Kontakte mit Frauen aus der westlichen Welt wissen wir, daß es bei uns in der DDR für die Frauen eine Reihe wirklicher Errungenschaften gibt. […] Was uns aber noch Probleme macht[,] ist die Diskrepanz zwischen dem gesetzlich verbrieften Recht2auf gleiche Rechte und Möglichkeiten und der alltäglichen Praxis.“ - Karin Dauenheimer (1987) -
1Einführung
Diesen beiden Aussagen wohnt ein Widerspruch inne. Die Feststellung Honeckers drückt die offizielle Lesart der Frauenpolitik in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) aus. Es hat den Anschein, als seien alle Wünsche und Forderungen der alten Frauenbewegung - und auch die der sich in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) gerade formierenden neuen Frauenbewegung - nach der Gleichberechtigung von Frau und Mann im sozialistischen Teil Deutschlands bereits Anfang der 1970er Jahre erfüllt gewesen. Dennoch sieht eine in der DDR lebende Frau trotz aller „Errungenschaften“ eine Diskrepanz zwischen normativer und praktischer Ebene.
Zweifel an der verwirklichten Gleichberechtigung im SED-Staat artikulierten sich in den 1980er Jahren nicht nur über die Aussagen einzelner Frauen. Jenseits der einzigen offiziellen Interessenvertretung für Frauen, demDemokratischen Frauenbund Deutschlands(DFD) entstanden informelle Frauengruppen in verschiedenen Städten und Regionen der
1Aus dem Bericht des Zentralkomitees an den VIII. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Berichterstatter: Erich Honecker. 15. Juni 1971, in: Protokoll der Verhandlungen des VIII. Parteitages der der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. 15.-19. Juni 1971, Bd. 1, Berlin 1971, S. 82. Honecker (1912-1994) war ab 1971 Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und ab 1976 Staatsratsvorsitzender. Am 18.10. 1989 trat er von allen Ämtern zurück.2Brief von Karin Dauenheimer an Chris Weedon, 30.11.1987, Grauzone A1/2776, Bl. 48. Karin Dauenheimer ist Theologin und Journalistin und lebte in den 1980er Jahren in Dresden.
Page 3
DDR. Sie begannen die Stellung von Frau und Mann in der DDR-Gesellschaft zu hinterfragen und die eigene Lebensweise zu reflektieren.
Als Gruppen, die sich eigenständig außerhalb des Organisationsmonopols der SED zusammenfanden, bewegten sich die Frauengruppen in einem Konglomerat von Gruppierungen, die Themen aufgriffen, welche im offiziellen Diskurs nicht erwünscht waren. Der Überwachung und Repression des Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi) ausgesetzt, stellten informelle Gruppen, die meist unter dem Dach der evangelischen Kirche agierten, den Versuch dar, in der DDR zivilgesellschaftliches Engagement zu etablieren.
Die Entstehung, die Zusammensetzung, der Charakter sowie die Wirkungen dieser Gruppen sind seit dem Zusammenbruch der DDR unter vielfältigen Fragestellungen untersucht worden. Im Vordergrund stehen dabei Fragen nach dem Oppositions- und Widerstandspotential dieser Gruppen.3Reine Frauengruppen finden in Darstellungen zum Thema oft nur marginale Erwähnung. Ehrhart Neubert fasst in seiner Darstellung der Opposition in der DDR die Selbstorganisation von Frauen als Emanzipationsbewegung auf und erkennt, dass auch innerhalb der Oppositionsbewegung männliche Dominanzen vorherrschten, die zu separaten Gruppengründungen durch Frauen führten.4Ausführlicher stellt
3So zahlreich wie die Veröffentlichungen mittlerweile sind, so unterschiedlich werden die Begriffe Opposition und Widerstand in ihnen verwendet. Einen kritischen Überblick liefert Eckert, Rainer: Widerstand und Opposition: Umstrittene Begriffe der deutschen Diktaturgeschichte, in: Neubert, Ehrhart / Eisenfeld, Bernd (Hg.): Macht - Ohnmacht - Gegenmacht. Grundfragen zur politischen Gegnerschaft in der DDR, Bremen 2001, S. 27-36. Wenn hier nachfolgend die Begriffe von Opposition o. ä. verwendet werden, schließe ich mich Eckerts Vorschlag an: „Widerstand bezeichnet in diesem Raster den prinzipiellen Kampf gegen die Herrschaft der SED mit dem Ziel ihrer Beseitigung, Opposition die relativ offene, zumindest zeitweilig und teilweise legale Ablehnung des Realsozialismus bzw. die Absicht zu seiner Reform und schließlich Resistenz ein nicht der Norm entsprechendes Verhalten im Alltag, passiven Widerstand, Selbstbehauptung einzelner Personen und die Abweichung von der offiziellen Ideologie. Alle diese Formen sind allerdings nicht ‚rein‘ anzutreffen, sondern überlappen sich vielfältig.“ Eckert, Begriffe, S. 35-36. Die Einordnung des Gegenstands dieser Arbeit in diesen Kontext spielt hier allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Dieser Schritt erfordert erst eine quellengesättigte Erforschung des Gegenstands, der m. E. noch nicht geleistet wurdevgl. dazu die folgenden Ausführungen.
4Vgl. Neubert, Ehrhart: Geschichte der Opposition in der DDR 1949-1989, Bonn 1997, S. 458-459.
Page 4
Neubert allerdings nur die in verschiedenen Städten agierenden GruppenFrauen für den Friedenvor.5Karin Urich belässt es in ihrer lokalen Untersuchung von Opposition und Bürgerbewegung in Dresden bei einer bloßen Nennung derFrauen für den Frieden.6Auch Sung-Wan Choi greift in ihrer Studie einzig dieFrauen für den Friedenkurz auf.7
Studien, welche sich in den vergangenen Jahren ausführlicher mit Frauengruppen in der DDR befasst haben, setzen ihren Schwerpunkt ebenfalls bei denFrauen für den Frieden.8Dort, wo die Frauengruppen-landschaft differenzierter beleuchtet wird, findet sie als Vorgeschichte desUnabhängigen Frauenverbandes(UFV) Eingang, der wesentlich ausführlicher dargestellt wird.9Eva Sänger stellt beispielsweise Kontinuitäten zwischen den informellen Frauengruppen der 1980er Jahre und dem im Herbst 1989 entstandenen UFV her. Im DDR-Kontext betrachtet Sänger den UFV „als Teil eines kollektiven, ‚bewegten‘ Handlungszusammenhangs […], dessen Wurzeln bis zu den informellen Frauengruppen in der DDR der 80er Jahre reichen. Informelle Frauengruppen kritisierten die Friedenspolitik der DDR, hinterfragten patriar-
5Vgl. Neubert, Opposition, S. 459ff und S. 579ff. Insgesamt umfasst die Darstellung der Frauenselbstorganisation in Neuberts fast 1000-seitigem Werk knapp 7 Seiten. Hinzu kommen vereinzelte Verweise auf Emanzipationsgedanken in Kunst und Literatur sowie auf Frauenaktivitäten im Herbst 1989.
6Vgl. Urich, Karin: Die Bürgerbewegung in Dresden 1989/90, Köln; Weimar; Wien 2001, S. 61 und 67. Kurz erwähnt Urich auch denUnabhängigen Frauenverband(UFV), der 1989 entstand; vgl. ebd., S. 381.
7Vgl. Choi, Sung-Wan: Von der Dissidenz zur Opposition. Die politisch alternativen Gruppen in der DDR von 1978 bis 1989, Köln 1999, S. 45f. Ähnlich verfahren weitere Autoren und Autorinnen - vgl. u. a. Joppke, Christian: East German Dissidents and the Revolution of 1989. Social Movement in a Leninist Regime, Houndsmill; Basingstoke; Hampshire u. a. 1995. Vgl. auch Pollack, Detlef: Politischer Protest. Politisch alternative Gruppen in der DDR, Opladen 2000.
8Vgl. Miethe, Ingrid: Frauen in der DDR-Opposition. Lebens- und kollektivgeschichtliche Verläufe in einer Frauenfriedensgruppe, Opladen 1999. Vgl. auch Kukutz, Irena: Die Bewegung „Frauen für den Frieden“ als Teil der unabhängigen Friedensbewegung der DDR, in: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages), hrsg. vom Deutschen Bundestag, 1995, Bd. VII, S. 1285-1408. Vgl. zudem Kukutz, Irena: „Nicht Rädchen, sondern Sand im Getriebe, den Kreis der Gewalt zu durchbrechen“. Frauenwiderstand in den achtziger Jahren, in: Poppe, Ulrike / Eckert, Rainer / Kowalczuk, Ilko-Sascha (Hg.): Zwischen Selbstbehauptung und Anpassung: Formen des Widerstands und der Opposition in der DDR, Berlin 1995, S. 273-283.
9Vgl. Hampele Ulrich, Anne: Der Unabhängige Frauenverband: ein frauenpolitisches Experiment im deutschen Vereinigungsprozeß, Berlin 2000, S. 54. Vgl. auch Sänger, Eva: Begrenzte Teilhabe. Ostdeutsche Frauenbewegung und Zentraler Runder Tisch in der DDR, Frankfurt/Main; New York 2005.
Page 5
chale Strukturen in der evangelischen Kirche und die offizielle Definition von Fraueninteressen. Sie stellten eine entscheidende Mobilisierungsressource für die Gründung des Unabhängigen Frauenverbandes dar.“10
Einzig Samirah Kenawi ist es aber bisher gelungen, einen umfassenden Überblick über die Frauengruppen in der DDR zu geben. Ihre Dokumentation beschränkt sich zwar auf eine knappe Vorstellung der Gruppen, die Kenawi mit Dokumenten anreichert.11Kenawi nimmt aber auch eine Typologisierung der von ihr vorgestellten Gruppen vor. Sie unterscheidet zwischen drei Strömungen. Erstens fasst sie die GruppenFrauen für den Friedensowie nichtkirchliche Frauengruppen innerhalb und außerhalb der Kirche zusammen. Die zweite Strömung stellen die kirchlichen Frauengruppen dar. Als dritte Form identifiziert Kenawi Lesbengruppen.12Abgesehen von diesem und anderen einzelnen Ansätzen13der Untersuchung und Typologisierung fehlt nach wie vor eine
10Sänger, Teilhabe, S. 12.
11Vgl. Kenawi, Samirah: Frauengruppen in der DDR der 80er Jahre. Eine Dokumentation, Berlin 1995. Kenawi ist zudem mit einigen Aufsätzen zum Thema in Erscheinung getreten. Vgl. Kenawi, Samirah: Caféhaustratsch und Flüsterpropaganda. Informationsstrukturen der Frauenbewegung in der DDR, in: Beuth, Kirsten / Plötz, Kirsten (Hg.): Was soll ich euch denn noch erzählen? Ein Austausch über Frauengeschichte(n) in zwei deutschen Staaten, Gelnhausen 1998, S. 190-197. Vgl. Kenawi, Samirah: Zwischenzeiten. Frauengruppen in der DDR zwischen östlicher Bürger- und westlicher Frauenbewegung, in: Gehrke, Bernd / Rüddenklau, Wolfgang (Hg.): Auf der Suche nach einem dritten Weg. Das politische Selbstverständnis der DDR-Opposition in den 80er Jahren, Berlin 1999, S. 154-167. Vgl. Kenawi, Samirah: Frauengruppen in der DDR der 80er Jahre. Thesen für eine nichtstaatliche Frauenbewegung, in: Timmermann, Heiner (Hg.): Die DDR in Deutschland. Ein Rückblick auf 50 Jahre, Berlin 2001, S. 495-512. Diese Aufsätze wie auch der Dokumentationsband weisen allerdings, wie im Verlauf dieser Arbeit noch zu zeigen sein wird, Ungenauigkeiten und Fehler auf. Diese Feststellung soll aber die Leistung Kenawis, die mit der Dokumentation einen umfangreichen Überblick gibt, nicht schmälern. Ihre Vorarbeit kann der Ausgangspunkt für eine detaillierte und quellengesättigte Aufarbeitung weiblichen Engagements in der DDR der 1980er Jahre sein.
12Vgl. Kenawi, Frauengruppen, S. 21.
13Karin Zimmermanns Typologie für Berlin umfasst die Frauen für den Frieden, Frauengruppen mit frauenspezifischen Themen im engeren Sinne, Lesbengruppen und Frauenforscherinnen - vgl. Zimmermann, Karin: Die neue Frauenbewegung in der DDR: zur Analyse von Chancen und Möglichkeiten einer sozialen Bewegung (Diplomarbeit), Berlin: FU, FB Pol. Wiss. 1991, S. 27. Daphne Hornig unterscheidet Lesbengruppen, Frauen für den Frieden, feministische Theologinnen und aus kirchlichen Gemeindefrauen entstandene Gruppen sowie aus privater Bekanntschaft entstandene kleine Freundinnennetzwerke - vgl. Hornig, Daphne: Der Organisations- und Formierungsprozeß von Frauen in der DDR: die Institutionalisierung und weitere Gestaltung des frauenpolitischen Spektrums im Verlauf des gesellschaftlichen Transformationsprozesses; eine Analyse unter dem Aspekt sozia-
Page 6
Gesamtdarstellung der autonomen Frauengruppen in der DDR der 1980er Jahre, die zugleich die Einbindung in den historischen Kontext berücksichtigt.
1.1 DDR-Frauengruppen als soziale Bewegung? - Forschungsansätze
In den vorhandenen Untersuchungen zu unabhängigen Frauengruppen in der DDR galt das zentrale Erkenntnisinteresse der Beantwortung der Frage, ob es in der DDR eine Frauenbewegung gegeben hat.14In allgemeinen Darstellungen zur DDR-Geschichte oder zur Geschichte der Opposition in der DDR taucht diese Frage kaum auf.15Die Dominanz männlicher Wissenschaftler und die Tatsache, dass verhältnismäßig mehr Männer als Frauen zu Zeitzeugen- und Zeitzeuginnengesprächen herangezogen werden, mögen eine Ursache hierfür sein.16Aber auch sofern die Frage nach einer DDR-Frauenbewegung gestellt wird, stehen Forscherinnen und Forscher definitorischen Unsicherheiten und unzureichend hinterfragten Vorannahmen gegenüber, die den Blick auf eine Spezifik der DDR-Frauengruppen zu verstellen scheinen. Ein Perspektivenwechsel ist erforderlich und inzwischen auch mehrfach angeregt worden.
Ingrid Miethe weist ausdrücklich darauf hin, dass bei der Klärung der Frage, ob es in der DDR eine Frauenbewegung gegeben habe, differenziert werden müsse. Es könne nicht unter Verweis auf die große Zahl der Frauen, die die offizielle Gleichstellungspolitik nicht in Frage stellten, darauf geschlossen werden, dass es in der DDR keine Frauenbewegung gegeben hätte. Vielmehr müsse sich der Blick auf diejenigen
ler Bewegungen (Diplomarbeit), Berlin: HU, FB Sozialwiss. 1993, S. 59. Inzwischen ist auch Jeannette Madarász mit Untersuchungen zu DDR-Frauengruppen in Erscheinung getreten - vgl. Madarász, Jeannette: Andersdenkende Frauen in der Ära Honecker, in: Barker, Peter / Ohse, Marc-Dietrich / Tate, Dennis (Hg.): Views from Abroad. Die DDR aus britischer Perspektive, Bielefeld 2007.
14Vgl. Kenawi, Thesen, S. 496.
15Vgl. Neubert, Opposition; vgl. Urich, Bürgerbewegung; vgl. Schroeder, Klaus: Der SED-Staat. Geschichte und Strukturen der DDR, München 1998.
16Vgl. Miethe, Frauen, S. 38f.
Page 7
Frauen richten, die sich selbst als „frauenbewegt“ verstanden hätten.17Somit kann das Sample, das es auch in dieser Arbeit einzugrenzen gilt, deutlicher festgelegt werden.
Inwieweit es gerechtfertigt ist, beim vorliegenden Untersuchungsge-genstand von einer Bewegung zu sprechen, das heißt die sozialwissenschaftlichen Kriterien einer sozialen Bewegung anzuwenden, muss laut Miethe bei der definitorischen Klärung ebenfalls Berücksichtigung finden.18Eine soziale Bewegung kann verstanden werden als „ein mobilisierende[r] kollektive[r] Akteur, der mit einer gewissen Kontinuität auf der Grundlage hoher symbolischer Integration und geringer Rollenspezifikation mittels variabler Organisations- und Aktionsformen das Ziel verfolgt, grundlegenden sozialen Wandel herbeizuführen, zu verhindern oder rückgängig zu machen.“19Angesichts dieser Definition und der Entwicklungsphasen, die eine soziale Bewegung durchläuft - Konstituierung, Mobilisierung und Auflösung, Transformation oder Institutionalisierung - kann Miethe zufolge der Begriff soziale Bewegung auch für die Frauenbewegung der DDR gelten.20Die Mobilisierungsphase wird hier in der Entstehung und Existenz von Frauengruppen besonders unter dem Dach der evangelischen Kirche verstanden. Auf dieser Basis
17Vgl. Miethe, Ingrid: Eine Frage der Perspektive. Ostdeutsche Frauenbewegung in den Theorien sozialer Bewegungen, in: Weckwert, Anja / Wischermann, Ulla (Hg.): Das Jahrhundert des Feminismus. Streifzüge durch nationale und internationale Bewegungen und Theorien. Königsstein 2006, S. 62. Miethe verweist in ihrem Aufsatz darauf, dass die Existenz einer Frauenbewegung in DDR nach wie vor auch bestritten oder dieselbe als defizitär dargestellt werde. Als Beleg hierfür verweist Miete auf Rosemarie Nave-Herz, vgl. ebd., S. 61. Nave-Herz stellt zwar für die Anfangszeit der DDR fest, dass es dort keine „Neue Frauenbewegung“ gegeben habe, sie greift aber die Frauengruppen der 1980er Jahre (auf die Miethe ja ausdrücklich Bezug nimmt) auf und überschreibt dieses Kapitel mit „Die Anfänge einer Neuen Frauenbewegung in der DDR“. Nave-Herz bezieht sich dabei auf Untersuchungen zum Thema. Zwar fasst sie sich angesichts der Kompaktheit ihrer überblicksartigen Darstellung recht kurz. Sie stellt eine ostdeutsche Frauenbewegung in den 1980er Jahren aber weder in Frage, noch lässt sie sie defizitär erscheinenvgl. Nave-Herz, Rosemarie: Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland, Bonn 1997, S. 88ff.
18Vgl. Miethe, Perspektive, S. 63.
19Raschke, Joachim: Zum Begriff der sozialen Bewegung, in: Roth, Roland / Rucht, Dieter (Hg.): Neue Soziale Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1991, S. 32.
20Vgl. Miethe, Perpektive, S. 63f. Vgl. auch Ferree, Myra Marx: „The Time of Chaos was the Best“. Feminist Mobilization and Demobilization in East Germany, in: Gender and Society, 8 (1994) 4, S. 597-623. Vgl. Baldez, Lisa: Women’s Movements and Democratic Transition in Chile, Brazil, East Germany, and Poland, in: Comparative Politics, 35 (2003) 3, S. 253-273.
Page 8
sei dann im Herbst 1989 die massenhafte Mobilisierung von Frauen unter dem Dach des UFV erfolgt. Zunächst habe die Herbeiführung sozialen Wandels das Ziel der Bewegung gebildet. Angesichts der Dynamik der Zeitereignisse und des drohenden Verlusts von frauenpolitischen Vorteilen sei aber schnell der Wunsch aufgekommen, sozialen Wandel aufzuhalten beziehungsweise rückgängig zu machen.21Die Auflösung und Transformation der Frauenbewegung der DDR habe sodann im Verlauf des Jahres 1990 begonnen.22
1.2 Soziale Bewegung in der Diktatur? - Übertragungsprobleme
Den Fokus auf „frauenbewegte“ Frauen - Frauen also, die nicht auf der Welle der staatlichen Frauenpolitik mitschwammen - zu legen, erscheint angesichts der oben dargestellten Argumente sinnvoll. Auch die Verortung der DDR-Frauengruppen als Teil einer sozialen Bewegungeiner Frauenbewegung - scheint auf der Basis der von Miethe angeführten Gesichtspunkte schlüssig. Freilich bleiben zwei Probleme virulent. Zunächst fehlen bisher quellengestützte Untersuchungen zu DDR-Frauengruppen, die Inhalte, Methoden, regionale Unterschiede und besondere regionale Bedingungen entschlüsseln. Erst damit kann die Einbindung der Frauengruppen in theoretische Zusammenhänge gelingen.
Dies gilt insbesondere für den zweiten Problemkreis, vor dem die Untersuchung steht. Inwieweit können westlich geprägte Forschungsprämissen einem Gegenstand gerecht werden, der sich unter völlig anderen Bedingungen, als sie diesen Prämissen zugrunde liegen, entwickelt hat? Insbesondere der Anwendung der Theorien Neuer Sozialer Bewegungen (NSB) auf gesellschaftliche Phänomene in der DDR, die Huber-21Vgl.Miethe, Perspektive, S. 64.
22Vgl. ebd., S. 64. Zum Marginalisierungs- und Auflösungsprozess des UFV vgl. Hampele Ulrich, Frauenverband, S. 282ff und 291ff.
Page 9
tus Knabe bereits Ende der 1980er Jahre angeregt hat23, ist nicht ohne Weiteres zuzustimmen.24Mehrfach ist darauf verwiesen worden, dass die Grundannahmen und Definitionen solcher Konzepte vor dem Hin-tergrund westlicher pluralistischer Demokratien entstanden sind. Die Existenz einer Zivilgesellschaft sowie die Absicherung demokratischer Grundrechte hätten dort immer als Voraussetzung für die Entstehung und Existenz sozialer Bewegungen gegolten.25Diese Basis musste „in staatssozialistischen Gesellschaften erst geschaffen werden […] und die sozialen Bewegungen der DDR klagten in erster Linie gerade die Schaffung dieser Grundrechte ein.“26Insofern erscheint es wenig hilfreich, das Erreichen breiter öffentlicher Resonanz und das Ziel der zahlenmäßigen Vergrößerung der Bewegung als Maßstab für die Bewertung von Bewegungen in Osteuropa anzusetzen, waren diese doch darauf bedacht, so zu agieren, dass sie von staatlicher Kontrolle und Repression nicht erfasst werden konnten. Deshalb stellt die Einbeziehung staatlicher Verfolgung von sozialen Bewegungen und deren Umgang damit ein zentrales Kriterium für deren Untersuchung dar.27
Auch gilt es zu beachten, dass Begriffe mit ihren spezifischen Vorprägungen, ihrer Definitionsmacht und ihren impliziten Maßstäben nicht ohne Weiteres auf Gesellschaften übertragen werden können, „für die diese Begriffe nicht in dem unterstellten Maße oder mit einer anderen inhaltlichen Besetzung von Relevanz sind.“28Der Feminismus-Begriff im Westen ist mit Themen und Inhalten besetzt, die bei „bewegten“