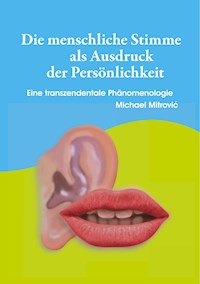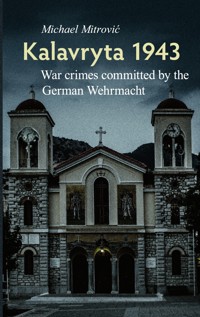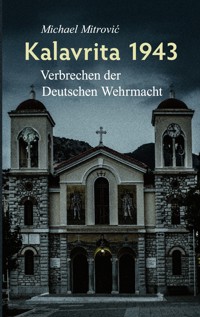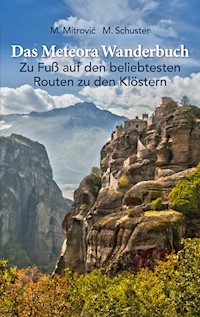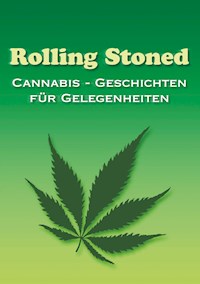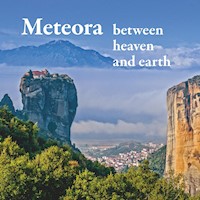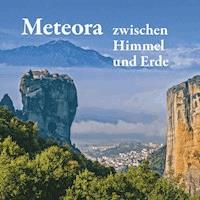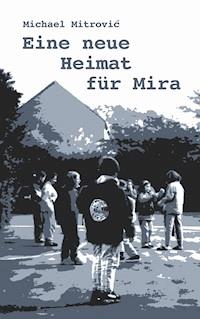Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ausgehend vom Stand vor der Auflösung Jugoslawiens in einzelne Staaten wird eine Klassifizierung der Dialekte des Serbokroatischen diskutiert. Dabei wird die Aufmerksamkeit auf die stokavischen Mundarten und den Ersatz des urslavischen jat gelenkt. Anhand der Mundart von Uzice wird die alte Grenze von Ekavismus und Jekavismus dargestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Gedenken an meine serbischen Vorväter
Neđeljko Mitrović
(1864 – 1909)
Božidar Mitrović
(1880 – 1954)
Vitomir Mitrović
(1910 – 1984)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Eine strukturelle Klassifikation der Dialekte des Serbokroatischen
Zum Stand der serbokroatischen Dialektologie: Die Erforschung der štokavischen Mundarten
Die Bedeutung des urslavischen Vokals ‚jat‘ für die serbokroatische Dialektologie in synchroner und diachroner Hinsicht
Karakteristične osobine užičke govorne zone
Vorwort
Bei den vorliegenden Arbeiten handelt es sich um drei Aufsätze sowie die Arbeit zur Erlangung des Magister Artium an der Universität Hamburg. Letztere wurde 1982 eingereicht, die Aufsätze entstanden in der ersten Hälfte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Zwei von ihnen fielen mehr oder weniger den Wirren um die Auflösung des Staates Jugoslawien zum Opfer. Der Aufsatz über die Mundart der Heimatregion meines Vaters, Užice in Westserbien, war bereits vom Užički Zbornik angenommen worden. Im 24. Band 1995 wird auf Seite 4 unter „Saradnici u ovom broju“ notiert: “Mihajlo Mitrović, profesor iz Bremena“, der Aufsatz jedoch nicht abgedruckt, vermutlich aus technischen Gründen. Der Aufsatz über die serbokroatischen Dialekte wurde dem Wiener Slawistischen Almanach eingereicht, der sich zwar sehr interessiert zeigte, dann wohl aber wegen der Kriegswirren einen Rückzieher machte.
Ist es gerechtfertigt, diese Abhandlungen nach so langer Zeit das Licht der wissenschaftlichen Welt erblicken zu lassen? Diese Frage meint der Verfasser aus mehreren Gründen bejahen zu können. Einmal zeigen sie den Stand der Dinge vor Ausbruch der kriegerischen Handlungen 1991, die letztlich zur Auflösung des jugoslawischen Staates führten. Dieser Stand wird noch heute zum Maßstab genommen, auch um die Dinge nicht über Gebühr zu komplizieren. Des Weiteren hat sich gezeigt, dass die serbokroatische Dialektologie jahrzehntelang mit nicht genügend aufgeklärten und diskutierten Missverständnissen lebte, die nach dem Beginn des Ausbaus der kroatischen Schriftsprache mit Gewalt aufbrachen. Dadurch geriet schließlich die serbische Dialektologie in einen Strudel von halbverdauten Wahrheiten und Fakten, vermischt mit politischen Ansprüchen, die ihrer großen Geschichte und ihrer Bedeutung innerhalb der Slawistik zuwider laufen. Häufige Umbenennungen der Hauptdialekte, unterschiedliche Gewichtung der Klassifikationskriterien sowie zweifelhafte Definitionen von „Serben“ und „serbischen Dialekten“ zeigen, wie stark dieser Zweig der Serbistik in Fluss geraten und wie groß die Gefahr ist, dass er seine Reputation verliert.
Nach wie vor gilt Pavle Ivić als wichtigste Instanz, wenngleich seine Rolle im Rahmen des Memorandums der SANU alles andere als wissenschaftlich neutral angesehen werden kann1. In seinen letzten, teils noch zu Lebzeiten veröffentlichten Ausführungen zur nun „serbischen Dialektologie“ bemüht er sich verkrampft und forciert, die Dinge auf einen neuen Fuß zu stellen2. Dabei kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass alle seine linguistischen Bemühungen zum Ziel haben, ein möglichst großes Areal als „serbisch“ zu deklarieren, und zwar als „rein serbisch“ oder wenigstens „ursprünglich serbisch“. Im Einzelnen geht es um folgende Punkte:
Zugehörigkeit zur übergeordneten Schriftsprache: Streng genommen darf die Dialektologie darauf keine Rücksicht nehmen. Jedoch verlangt die Politik und Diplomatie ein anderes Vorgehen. Welchen Dialekt sprechen katholische oder atheistische Serben, die auf kroatischem Staatsgebiet leben? Kroatischen, weil sie staatsrechtlich Kroaten sind? Oder serbischen, weil sie serbischer Abstammung sind und ihre Vorfahren orthodox waren? Oder darf es solche SprecherInnen per definitionem nicht geben, weil nicht sein kann, was nicht sein darf? Linguistisch betrachtet kommt ausschließlich das Sprachsystem in Betracht, nicht die vermeintlich ethnische Zugehörigkeit.
Kajkavisch und Čakavisch: Selbstverständlich spielen beide Dialektuntergruppen für die Serbistik keine Rolle, das war allerdings schon immer so. Im serbokroatischen bzw. südslawischen Dialektkontinuum müssen sie dagegen berücksichtigt werden, um z. B. Begrenzungen der metanastasischen Bewegungen südlicher Dialekte erklären zu können.
Štokavisch: Ivić erklärt den Begriff für die Serbistik für obsolet. Alle serbischen Dialekte seien ja štokavisch. Das waren sie in der Tat schon immer. Nur gehören die serbischen Dialekte eben gemeinsam mit einem Teil der kroatischen Dialekte der štokavischen Dialektgruppe an, was automatisch die Differenzierung zu den kroatischen Mundarten aufzuklären verlangt. Der Begriff „štokavisch“ bleibt somit weiterhin ein zentrales Kriterium. Ihn auszumerzen deutet auf ein verkrampftes Bemühen hin, die serbischen Dialekte neu zu erfinden.
Die štokavischen serbischen Dialekte: Nach Ivić gehören zu den serbischen Dialekten alle štokavischen, außer den ikavski, stari slavonski sowie istočnobosanski govori. Dies entspricht seiner serbozentrierten Sichtweise. Nun handelt es sich freilich bei den Mundarten außerhalb des serbischen Staatsgebietes um Aussiedlermundarten. Innerhalb Serbiens befinden sich die ekavischen Dialekte sowie in West- und Südwestserbien Relikte ijekavischer Mundarten. Aus kroatozentrierter Sichtweise haben sich (i)jekavische Mundarten serbischer Provenienz nach Nordwesten vorgeschoben. Will Ivić auf der einen Seite das Areal der „typisch serbischen“ Mundarten möglichst groß erscheinen lassen, muss er andererseits selbstverständlich erwähnen, dass sich ein großer Teil dieser Mundarten außerhalb des faktischen serbischen Staatsgebietes befindet und sich unter je anderen Bedingungen weiterentwickelt. Es leuchtet auch keineswegs ein, dass er zwar Mundarten wie diejenigen von Rekaš, Karaševo in Rumänien oder Pehčevo in Nordmazedonien als Aussiedlermundarten („iseljenički govori“) bezeichnet, die gleiche Prozedur jedoch den Varietäten der Krajina und Lika sowie Slawoniens verwehrt.
In diesen Rahmen passt der unheilvolle Versuch, auch im 21. Jahrhundert den „typischen Serben“ als orthodox, den Kroaten als katholisch sowie den Bosnier als „islamisierten Serben“ zu betrachten. Das hat nämlich den großen Vorteil, die moslemischen Mundarten im Sandžak, in Bosnien und der Hercegovina, im zetsko-sjenički dijalekat sowie in Đakovica und Prizren weiterhin als serbisch deklarieren zu können. Und ebenso werden die torlakischen Mundarten leichtfertig in die Reihe der (typischen?) serbischen Dialekte eingereiht, was arealtypologisch keinesfalls einleuchtet. Natürlich beantwortet Ivić nicht die Frage, welche Mundart ein Atheist oder sich als Jugoslawe bezeichnender Mensch spricht!
Wenn eine Staatsgrenze ein Dialektkontinuum durchschneidet, wie das auf dem Balkan häufig der Fall ist, entsteht die Frage, wie wir die jeweilige Varietät diesseits und jenseits der Grenze benennen. Aus chauvinistischen Gründen ist kein Staat bereit, zu konzedieren, dass auf seinem Territorium ein Dialekt oder gar eine Sprache des Nachbarlandes gesprochen wird, wie es z. B. Österreich und die Schweiz in Bezug auf die deutsche Sprache kein Bedenken haben zu tun. Torlakische Mundarten in Bulgarien haben bulgarisch zu sein, solche in Serbien serbisch. Darüber hinaus wurden in der Vergangenheit gerne ostserbische Mundarten als westbulgarische Dialekte oder gar das Nordmazedonische gleich ganz als bulgarisch deklariert.
Die Autonomiebestrebungen der ehemaligen jugoslawischen Republiken scheinen nun dahin zu führen, dass Serbien die Kontrolle über „seine“ Aussiedlermundarten, denn so muss man sie heute politisch korrekt bezeichnen, in den früheren Republiken Kroatien, Bosnien und Hercegovina, Montenegro sowie der autonomen Provinz Kosovo und Nordmazedonien nach und nach verliert. Plötzlich gib es bosniakische Mundarten, nordmazedonische Übergangsmundarten, ja, bald auch wohl nordmontenegrinische Mundarten.
8. Umso mehr versucht Ivić mit aller Gewalt, die auf dem Territorium Serbiens befindlichen Dialekte in eine idealtypische serbische Schablone zu pressen. Mit immer neuen Begriffen wie staroštokavski, srednjoštokavski und novoštokavski dijalekti versucht er zu kaschieren, dass die torlakische Dialektgruppe keineswegs logisch zur serbischen štokavischen Dialektgruppe gehört. Offenbar darf heute nicht mehr sein, was jahrhundertelang eine Tatsache war: die östlichsten serbischen Mundarten unterscheiden sich fundamental von der übrigen Masse West- und Zentralserbiens sowie von der Schriftsprache. Sie haben mehr gemeinsam mit den sog. westbulgarischen und nordmazedonischen Mundarten. Nur sind es dann eben keineswegs „typische“ serbische Mundarten mehr, womöglich gar Übergangsmundarten, die mit gleichem Recht von jenseits der Grenze beansprucht werden können. Dialektologie ist eben weitaus politischer, als es Linguisten wahrhaben wollen. Nicht zufällig werden Steitthemen eingekapselt: serbische Dialektologen befinden über „ihre“ Dialekte und solche, die sie dafür halten. Die Meinung neutraler, nichtserbischer Wissenschaftler wird nicht gern gesehen, kritisch verworfen. Es gibt auf dem Balkan keine objektive Dialektologie! In diesem Zusammenhang ist interessant, dass die Bunjevcen im Raum Subotica – Sombor in Ivić letzter Übersicht nicht mehr auftauchen, obwohl er vom Vorkriegsstand ausgehen will. Bei den Bunjevcen handelt es sich überwiegend um katholische ikavische SprecherInnen.
Die serbische Dialektologie kommt nicht zur Ruhe. Durch die Abspaltung vom serbokroatischen bzw. südslawischen Dialektkontinuum hat sie bisher nur verloren. Eingebürgerte Begriffe werden geändert, wobei politische Absichten nicht auszuschließen sind. So plädiert Ivić für eine Umbenennung des Osthercegovina-Dialekts, in dem sich die Heimatmundart des Vuk Karadžić befindet, in hercegovačko-krajiški dijalekat. Nur befinden sich beide Regionen, sowohl die Hercegovina als auch die Krajina außerhalb des serbischen Staatsgebietes. Das südöstliche Areal der Hercegovina gehört zum Kontinuum mit Südwestserbien und dem nördlichen Teil der Crna Gora. Das nordwestliche Areal der Krajina stellt Aussiedlermundarten dar. Von allen sechs von Ivić postulierten Dialekten bzw. Dialektzonen (hercegovačko-krajiški d., šumadijsko-vojvođanski d., zetsko-raški / -sjenički d., kosovsko-resavski d., smederevsko-vršački d., prizrensko-timočka dijalekatska oblast) führt nur der hercegovačko-krajiški zwei geografische Bezeichnungen im Namen, die sich außerhalb Serbiens befinden. Wie darf man das auffassen?
Gehässiger als P. Milosavljević kann man einem Volk (Staat, Republik) kaum politische Absichten durch Sprachplanung unterstellen: “Pitanje: zašto su Hrvati i pored sopstvenih narečja prihvatili štokavsko za književni jezik, koje će ih čvršće povezati sa Srbima, političke je prirode. Tačan odgovor na to pitanje je: da bi proširili svoj jezički i etnički prostor.“ 3
Solange die Diskussion innerhalb der serbokroatischen (serbischen) Dialektologie auf solcher Ebene geführt wird, fällt sie schnell ins Bodenlose und kann auf internationaler Ebene nicht ernst genommen werden.
In diesem Sinne gebe ich meine Arbeiten nach so langer Zeit an die Öffentlichkeit.
Bremen, im März 2025
Anmerkungen:
1 Siehe hierzu den Aufsatz von Olivera Milosavljević: Der Missbrauch der Autorität der Wissenschaft, in: Th. Bremer, N. Popov, H.-G. Stobbe (Hrsg.): Serbiens Weg in den Krieg, S. 159-182, Berlin 1998
2 P. Ivić: Srpski dijalekti i njihova klasifikacija (I –III), ZbFL XLI / 2, S. 113132; ZbFL XLII, S. 303-354; ZbFL XLIV / 1-2, S. 175-209; Srpski dijalekti i njihova klasifikacija, Sremski Karlovci i Novi Sad, 2009
3 P. Milosavljević: Dijalektološke karte srpskohrvatskog, hrvatskog i srpskog jezika, in: Srbistika br. 2-3, S. 51-70, Priština. Wiederabdruck in: B. Tošović, A. Wonisch (ur.): Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika, knj. I/4: 1990-2004, S.209-222, Graz, Beograd. Zitat S. 216.
Eine strukturelle Klassifikation der Dialekte des Serbokroatischen
1. Die strukturelle Methode in der Dialektologie
Die Dialekte einer Sprache lassen sich auf zweierlei Weise klassifizieren:
Die genealogische Klassifikation basiert auf den Isoglossen der älteren dialekt-differenzierenden Züge und geht von einem gemeinsamen – meist rekonstruierten – sprachlichen Ursprung aller Dialekte der betreffenden Sprache aus. Die Auswahl der Klassifikationskriterien ist genealogisch motiviert, d. h. es werden verwandte, sich jeweils entsprechende Spracheinheiten verglichen. In der Vergangenheit wurde diese Methode meist mehr intuitiv als systematisch angewandt, vor allem, wenn auf der Grundlage genealogischer Kriterien eine Dialektklassifizierung auf synchroner Ebene angestrebt wurde.
Die typologische Klassifikation entgeht diesen Schwierigkeiten, indem sie die verschiedenen sprachlichen Systeme und Subsysteme als Ganzheiten betrachtet und keine Vorauswahl (z.B. genealogisch determiniert) unter den zu untersuchenden Einheiten trifft. Besondere Aufmerksamkeit kommt der Erforschung der inneren Struktur der einzelnen Systeme zu, d. h. den Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen untereinander. Diese Methode basiert auf den Isoglossen der heutigen dialektdifferenzierenden Züge. Gemeinsame sprachliche Ursprünge drücken sich als (diachron bedingte) Ähnlichkeiten der grammatischen Struktur aus.
Während die genealogische Methode implizit diachron ausgerichtet ist, kann die strukturelle Methode sowohl synchron als auch diachron angewandt werden1.
Nach Ivić kann die Dialektologie „auf dreierlei Weise strukturell sein:
wenn sie die sprachlichen Systeme in den Dialekten als linguistische Strukturen betrachtet;
wenn sie die soziale und stilistische Struktur der Differenzierung innerhalb der einzelnen Lokalmundarten behandelt;
wenn sie die Struktur der territorialen sprachlichen Differenzierung erforscht.“
2
Während unter 3) die territoriale Aufgliederung der Dialekte anhand von Isoglossenkoeffizienten ermittelt wird, geht es bei 1) und 2) um die linguistische bzw. soziolinguistisch- stilistische Struktur einer gegebenen Dialekteinheit. Um nun die Dialektklassifikation auf eine objektiv überprüfbare Basis zu stellen, muss „das wahre Kriterium für die Klassifizierung statistisch sein“.3
Die intuitive Auswahl und Hierarchie der Kriterien muss ersetzt werden durch die Operationalisierung aller verfügbarer Daten sowie durch die Bestimmung ihres jeweiligen Stellenwertes im System. Dann nämlich ermöglichen es „die Zahlenindizes, definitive Lösungen in Streitfällen der Dialektklassifizierung zu geben. Die Hierarchie der Dialektgruppen und -untergruppen kann durch Zahlen ausgedrückt werden.“ 4
Die Erforschung der territorialen sprachlichen Differenzierung ist die exakteste Methode, die areale Struktur der Dialekte anhand aller möglichen Isoglossen festzustellen. Sie wird am ehesten dem Dialektkontinuum gerecht, d. h. dem allmählichen Übergang zweier benachbarter Dialekte. Freilich ist sie auch die aufwendigste und wird erst in Zukunft ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen können. Andererseits hat es sich in der Dialektologie als nützlich erwiesen, größere abstrakte Dialekteinheiten anzunehmen, denen notwendigerweise nur einige wichtige Isoglossen zugeordnet werden, nach unserer Meinung eben die strukturell wichtigsten. Auf diese Weise ergänzen sich für Ivić die drei Möglichkeiten der strukturellen Dialektologie.
2. Genetisch-strukturelle Klassifikationsversuche in der serbokroatischen Dialektologie
2.1. Terminologie Der Beginn der Forschungstätigkeit von Milan Rešetar und Aleksandar Belić am Anfang unseres Jahrhunderts kann als eine neue Epoche in der Entwicklung der skr. Dialektologie bezeichnet werden. Durch eine Reihe wegweisender Untersuchungen5 konnte die Grundlage für eine Klassifikation der skr. Dialekte gelegt werden, die in groben Zügen bis heute gilt. Unbestritten ist seitdem die Einteilung in eine štokavische, eine čakavische und eine kajkavische Gruppe, jedoch hat sich bis heute keine befriedigende Terminologie für die Phänomene auf den einzelnen dialektologischen Ebenen durchgesetzt.
Rešetar und Belić noch benutzen unkritisch den Begriff „Dialekt“, wie folgendes Zitat zeigt: “Belić lässt nämlich die kajkavischen Dialekte in Kroatien und Istrien nicht als serbokroatisch gelten... Nach Belić ist nämlich der kajkavische Dialekt ‚ein gemischter slovenisch-serbischer Dialekt, dem der slovenische Dialekt als Grundlage dient‘ “.6 Hier wird „Dialekt“ für drei verschiedene dialektologische Dimensionen verwendet, die wir heute mit „Sprache“ (Slovenisch), „Dialektgruppe“ (Kajkavisch) und „Dialekt“ (Kajkavische Dialekte) bezeichnen würden. An anderer Stelle spricht auch Rešetar von der „štokavischen Dialektgruppe“, die er in „drei Mundarten – die ekavische, jekavische und ikavische“ bzw. in „Mundarten mit älterer Betonung“ und „Mundarten mit neuerer Betonung“ unterteilt. Die Kombination beider Kriterien führt zu einiger Verwirrung, wenn bei der Klassifikation der štokavischen Dialekte Bezeichnungen auftauchen wie: „ekavische Dialektgruppe“, „šumadijaner-syrmischer Mundarten“, „Banater Dialekt“, „Kosovo-Resavaer Gruppe“.7
Belić (1927) spricht vom „štokavski dijalekat“ im Unterschied zum „čakavski“ bzw. „kajkavski dijalekat“, aber auch vom „najarhaičniji štokavski dijalekat ... u Slavoniji“, „staroštokavski dijalekat“, „staroštokavska grupa govora“, „staroštokavski govor“, „govorni tip“.8 Hier werden laufend identische Termini für unterschiedliche Phänomene bzw. unterschiedliche Termini für identische Phänomene gebraucht.
Stevanović (1960) verwendet lediglich zwei Begriffe: dijalekat/govor: „štokavski dijalekat“, „stariji štokavski govori“, „Prizrensko-timočki govori“;9 desgleichen Popović (1960): „Dialektgruppe“ und „Dialekt“.10 Wenn auch die verwendeten Termini konsequent durchgehalten werden, so fehlt beiden doch die Möglichkeit einer exakten terminologischen Subkategorisierung.
Erst Pavle Ivić (1956/58) führte ein brauchbares Begriffssystem in die skr. Dialektologie ein. Er unterteilte die štokavische Dialektgruppe in Dialekte (z.B. Osthercegovina-Dialekt), die Dialekte in Mundartengruppen (an anderer Stelle als Unterdialekte bezeichnet; z. B. die Osthercegovina-Mundartengruppe), diese wiederum gegebenenfalls in Mundartenuntergruppen (z.B. die südöstliche Mundartenuntergruppe der Osthercegovina-Mundartengruppe) und in Mundarten. Eine Schwierigkeit bilden die „Mundarten mit nichtersetztem ĕ“, denen er den Status eines Dialektes zubilligt.11
Brozović (1960) führt eine Terminologie ein, die, sollte sie allgemein akzeptiert werden, eine gute Grundlage für die Lösung der meisten Schwierigkeiten wäre. Seine dialektologischen Kategorien sehen folgendermaßen aus:
„I grupa dijalekata; Ia. podgrupa dijalekata; II dijalekt; IIa. poddijalekt; III grupa govorâ; IIIa. podgrupa govorâ; IV govor; IVa. podgovor.“ 12
Diese Terminologie deckt sich im Wesentlichen mit derjenigen Ivić‘; die Unterkategorien Ia. – IVa. werden nur bei Bedarf ausgenutzt.
Moguš (1977) ersetzt den Begriff „grupa dijalekata“ durch „narječje“:
„1. Mjesni govor 2. grupa govora 3. dijalekti 4. narječje“ 13,
was den Vorteil hat, unterschiedliche Phänomene auch durch unterschiedliche Termini zu bezeichnen.
Ist in der Vergangenheit der Begriff „Dialekt“ meist übermäßig strapaziert worden für verschiedene Dimensionen, so muss bei Peco (1978) gleiches für den Begriff „govor“ beklagt werden. Sein „Gružanski govorni tip“ z. B. gehört, hierarchisch angeordnet, zu: „Šumadijski govori“, „Šumadijski-Vojvođanski govori“, „ekavski govori“ bzw. „ekavsko narječje“ und „štokavski dijalekat“.14
Wir werden im Folgenden die Terminologie Brozović‘ bzw. mit Einschränkung diejenige Ivić‘ 1958 benutzen. Am Beispiel einer westserbischen ijekavischen Lokalmundart soll kurz die Funktionsweise der Begriffssysteme Brozović/Ivić in Bezug auf die realen Phänomene gezeigt werden:
Brozović
Ivić
Beispiel
grupa dijalekata
Dialektgruppe
štokavisch
podgrupa dijalekata
ijekav. Dial.gruppe
ijekavisch
dijalekt
Dialekt
Osthercegovina-Dialekt
poddijalekt
Mda.gr/Unterdialekt
Osthercegovina (vs. Ostbosnien)
grupa govora
Mda.untergruppe
südöstl. Osthercegovina
podgrupa govora
-
Westserbien
govor
Mundart
Dörfer X,Y,Z...
podgovor
-
Dorf X
Auf der Ebene des „poddijalekt“ ist bei Ivić unbedingt der Begriff „Unterdialekt“ der „Mundartengruppe“ vorzuziehen, während jener für „grupa govora“ stehen sollte, „Mundartenuntergruppe“ für „podgrupa govora“, so dass auf diese Weise die wichtigste Lücke in Ivić‘ System geschlossen werden kann. Was die konkreten Bezeichnungen der einzelnen Dialekte/Unterdialekte sowie die Mundarten betrifft, so sind auch sie von Autor zu Autor verschieden. Wir werden in einem späteren Kapitel darauf zurückkommen.
2.2 Genealogie versus Strukturalismus
In die skr. Dialektologie ist die strukturelle Methode erst in Ansätzen eingeführt worden. Die noch immer gültige Lehrmeinung wird durch ein Zitat Brozović‘ veranschaulicht: „svaki je genetski kriterij bio jednom samo strukturalan i svaki zadržava bar minimalno strukturalno značenje. Isto tako: svaki strukturalni kriterij ima šansu da se pod uvjetom normalnog i kontinuiranog razvitka pretvori u genetski…U praksi svi dijalektolozi doziraju genetske i strukturalne klasifikacione kriterije – problem je samo u tome kako ih doziraju.“15
Genetische und strukturelle Kriterien sind demnach also gleichberechtigt, die konkrete Auswahl bleibt dem Forscher überlassen. Besonders warnt Brozović vor der Anwendung ausschließlich eines der beiden Kriterien, was seiner Meinung nach zu falschen Ergebnissen führt. Wählt man ausschließlich strukturelle Kriterien, so müsse man das skr. Sprachgebiet in lediglich zwei Untergruppen einteilen: 1) die torlakische Zone; 2) das gesamte übrige Gebiet mit der što, ča- und kajkavischen Gruppe. Unter ausschließlich genetischen Gesichtspunkten müsse man das skr. Sprachgebiet in eine östliche (Torlak und größerer Teil der štokavischen Gruppe) und eine westliche Zone (čakavisch, kajkavisch, ein kleinerer Teil der štokavischen Gruppe) einteilen.
Dieser Auffassung lassen sich einige Argumente entgegenhalten:
Strukturell betrachtet ist die skr. Zone im äußersten Westen (ča-, kajkavisch) wohl ebenso exzentrisch in Bezug auf die Standardsprache wie die torlakische Zone. Hat die torlakische Zone in der Tat einige Besonderheiten, die nur ihr zukommen (Verlust der Quantität und des Tonverlaufs, Zerfall des Kasussystems, postpositiver Artikel, pleonastische Verwendung der Personalpronomina), so gilt dies in gleichem Maße auch für die westliche Zone (metatonischer Akut, keine verschobenen Akzente, alte Deklination, Schwund des Imperfekts, oft auch des Aorist).
Sollte die strukturelle Zweiteilung in Torlak und übrige Zone wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen werden, so müsste die alte Frage neu gestellt werden, ob der Torlak überhaupt zum skr. Sprachgebiet gehört und nicht etwa zum bulgarischen. Genau dieses Problem sieht auch Brozović, aber: die Exzentrizität einer Dialektzone muss nicht notwendigerweise die Opposition zu allen übrigen Dialekten bedeuten. Dass der Torlak eben doch nicht so stark in Opposition zu den anderen Dialektgruppen treten kann, zeigen die strukturellen (und auch genetischen) Übereinstimmungen mit der štokavischen Gruppe.
16
Ausschlaggebend für die Unterteilung in Untergruppen ist – strukturell gesehen – nicht nur die Anwesenheit bzw. Abwesenheit bestimmter Merkmale in der einen Zone (hier: Torlak), sondern der Vergleich aller konkreten und abstrakten Subsysteme untereinander. Dann nämlich ist es offensichtlich, dass neben der torlakischen Zone gleichwertig stehen eine štokavische, eine čakavische und eine kajkavische, jede mit bestimmten Merkmalen, die keiner anderen Zone zukommen.
Unter genetischen Gesichtspunkten betrachtet ist keineswegs logisch, dass wir eine östliche und eine westliche Gruppe erhalten. Da wir bei der Beurteilung dieser Frage von einem meist konstruierten sprachlichen Ursprung ausgehen, bleibt an der Auswahl der Kriterien immer eine Unsicherheit haften.
17
Nehmen wir die Isoglossen der sog. urslavischen Jotierung oder die Akzentuierung zum Maßstab, haben wir es in der Tat mit einer östlichen und einer westlichen Gruppe zu tun. Anders dagegen ist das Ergebnis beim Reflex der Halbvokale: hier bilden štokavisch und čakavisch eine Gruppe, kajkavisch eine zweite sowie torlakisch eine dritte. Völlig unübersichtlich gestaltet sich das Problem beim Ersatz des ‚jat‘: štokavisch und čakavisch sind in sich jeweils differenziert, torlakisch lässt sich in die ekavische Gruppe des Štokavischen einordnen, aber kajkavisch geht wieder einen besonderen Weg.
18
Wir gehen deshalb so ausführlich auf Brozović‘ Aufsatz ein, weil es der einzige größere Beitrag ist, der die Frage der Methodik der skr. Dialektologie in einer modernen erkenntnistheoretischen Weise behandelt. Denn in der Tat handelt es sich hier um das fundamentale Problem in der Dialektklassifizierung, von dessen Lösung nicht nur die Auswahl der Kriterien, sondern auch deren Hierarchie sowie terminologische Fragen abhängen. Ivić (1958) z. B. lässt bei der Klassifizierung der Hauptdialektzonen Kaj – Ča – Što strukturelle Charakteristika außer Acht „und berücksichtigt mehr die Gesamtheit der Eigenschaften (…) Die strukturellen Kriterien, obwohl im Prinzip sehr bedeutsam, sind in vielen Fällen doch für eine Charakterisierung geeigneter als für eine Klassifizierung der Dialekte.“19
Was aber ist die „Gesamtheit der Eigenschaften“ im Verhältnis zur Struktur aller Eigenschaften?
Wir meinen, dass vor jeder Klassifizierung eine Charakterisierung der Dialekte erfolgen muss, und zwar auf rein synchroner/deskriptiver Basis. Dabei sollen möglichst alle wichtigen Subsysteme berücksichtigt werden: Phonologie, Morphonologie, Morphologie, Syntax, Semantik. Das ist bis jetzt noch kaum in Ansätzen realisiert worden. Wenn die Anzahl der skr. Dialekte und Mundarten unter streng strukturellen Gesichtspunkten beschrieben sein wird, wird man die für die dialektologische Klassifikation wichtigsten Strukturmerkmale leicht erkennen. Denn wenn sich genetische und strukturelle Kriterien wirklich wechselseitig auseinander ergeben – und daran ist unserer Meinung nach nicht zu zweifeln, sollte man sich auf synchroner Ebene eindeutig für die strukturelle Methode entscheiden. Es bleibt dann noch das Problem der Gewichtung der einzelnen Kriterien.
2.3 Die traditionelle Klassifikation der serbokroatischen Dialekte
2.3.1. Auswahl und Hierarchie der Klassifizierungskriterien
Prinzipiell und auch genetisch betrachtet hat die äußere Form des Fragepronomens „was“ (što, ča, kaj) als einzelnes Kriterium geringe Aussagekraft. Strukturell gesehen ist es eines unter vielen Kriterien, bei weitem nicht das wichtigste, eher wohl das auffälligste. Auch der Reflex des ‚jat‘ hat für sich genommen nur beschränkte Aussagekraft, handelt es sich doch in den meisten Fällen lediglich um die Distribution einzelner Laute (e, i) in identischen Lautsystemen.20 Auf der anderen Seite ist nicht leicht einzusehen, weshalb gerade dem Akzentsystem eine so hervorragende Wichtigkeit eingeräumt wird, denn geht man vom Kriterium der interdialektalen Verständigungsmöglichkeit aus,21 so ist das Akzentsystem sicher eines der weniger wichtigen Subsysteme, zumindest in den weitaus meisten Fällen.
In der skr. Dialektologie ist es üblich, jeder Dialekteinheit eine bestimmte Anzahl typischer Charakteristika zuzuordnen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass dies nur auf einer abstrakten Ebene möglich ist. Je größer der Abstraktionsgrad ist, desto allgemeiner werden die Kriterien formuliert werden müssen, desto geringer ihre Anzahl und desto übersichtlicher ihre Hierarchie. Aber: Desto geringer die Aussagekraft für die einzelnen Lokalmundarten.22 Wir wollen dies an einigen konkreten Beispielen demonstrieren.
Ivić führt für die štokavische Dialektgruppe insgesamt 36 Eigentümlichkeiten an, davon 22, die in „fast allen“, nämlich über 95% der štok. Mundarten vertreten sind; die übrigen 14 kommen in 60-95% vor.23 Es hat seinen guten Grund, dass er keine Kriterien nennt, die alle (100%) štok. Mundarten kennen, denn diese Vollständigkeit müsste erkauft werden mit der Reduzierung und Fragwürdigkeit der Kriterien. Die wichtigsten Kriterien, die die štokavische Dialektgruppe von der kajkavischen und čakavischen unterscheidet, betreffen einige diachrone Lautumwandlungen (ǫ zu u; ъ,ь zu a; ḷ zu u; -l zu –o; v(ъ)-, v(ь)- zu u-; *d‘ zu đ; v(ь)s- zu sv-; čr- zu cr-; -jt- zu –ć-; neue Jotierung; ursl. Jotierung; -jd- zu -đ; h zu Ø; ć,đ), Akzentbesonderheiten (Schwund des metat. Akut; neuštokavische Akzentverschiebung) sowie morphologische Markierungen (Pronomen „što“; Deklinationsendungen; Aorist). In den meisten Fällen handelt es sich um sehr allgemeine Sprachentwicklungen, deren Verbreitungsgebiete sich obendrein oft auf torlakischem bzw. čakavisch-kajkavischem Gebiete fortsetzen, nämlich allein 20 von Ivić‘ 22 wichtigsten Eigentümlichkeiten. Er betont denn auch ausdrücklich, „dass sich keine einzige dieser Isoglossen vollkommen mit den Grenzen der Hauptdialektzonen deckt“ 24, und weiterhin, „dass in der angeführten Einteilung des skr. Sprachraums /gemeint ist die Dreiteilung in čak., štok. und kajk.; d.V./ die Rolle des grundsätzlichen Kriteriums nicht den einzelnen typischen Merkmalen zukommt, sondern den scharfen Grenzen auf dem Terrain.“24a Scharfe Grenzen auf dem Terrain müssen sich jedoch auch sprachlich formulieren lassen. Wenn wir von der „štok. Dialektgruppe“ im Gegensatz zu einer čakavischen, kajkavischen und torlakischen reden, ist es notwendig, sie linguistisch einwandfrei zu definieren, was nach unserer Meinung die strukturelle Beschreibung der Dialektgruppen leistet.25
Peco führt 14 Isoglossen für die štok. Dialektgruppe an, darunter keine von Ivić verschiedenen, jedoch fehlt unter anderem die neuštokavische Akzentverschiebung.26 Acht Merkmale betreffen historische Lautwandlungen, fünf sind morphologischer, eines akzentologischer Art.
Auch von den für die čakavische bzw. kajkavische Dialektgruppe angegebenen Merkmalen lässt sich sagen, dass auch sie in den Nachbarmundarten der angrenzenden Dialektgruppen anzutreffen sind und daher kaum als Charakterisierungs-, geschweige denn als Klassifizierungskriterien zu gebrauchen sind.27
Es ist auch versucht worden, eine Klassifizierung auf der Grundlage der Reflexe der urslavischen Jotierung vorzunehmen, die ganz offensichtlich keinen Schritt weiter führte.28 Brozović glaubt, in der Akzentuierung, dem ‚jat‘-Reflex und ebenfalls den Reflexen der urslavischen Jotierung die maßgebenden Kriterien zu sehen.29 Ebenso verfahren schon Rešetar30 und Belić31 und neuerdings wieder Peco.32
Es ist nun aber schlichtweg unmöglich, zwei oder drei Kriterien anzuführen, eben „die wichtigsten“, die in der Lage wären, einer Drei- oder Vierteilung des skr. Sprachraumes zu rechtfertigen; dies beweisen wohl alle vorgenommenen Klassifikationsversuche.33 Wenn die Aufzählung von „typischen Merkmalen“ auch zu keinem befriedigenden Ergebnis führt, so liegt das daran, dass nicht einzelne Sprachzüge aneinander gereiht, sondern einzelne sprachliche Subsysteme, wenn nicht sogar das Gesamtsystem die Dialektgruppen scheiden. Wir werden darauf in einem späteren Kapitel zurückkommen. Hier ist festzuhalten, dass es bis jetzt noch keine befriedigende Charakterisierung bzw. Klassifizierung der skr. Hauptdialektzonen (Dialektgruppen) auf synchron-struktureller Basis gibt. So schwierig sich dieses Problem auch gestalten mag, so wichtig ist seine Lösung bei der Bestimmung der Zugehörigkeit der sog. Mischdialekte oder Übergangsmundarten.34 Ist eine čakavische Mundart mit ‚što‘ oder ‚kaj‘ für „was“ (aber mit dem metatonischen Akut; -l; Konditionalformen ‚bim, biš…; usw.) štokavisch bzw. kajkavisch zu nennen?35 Ist der slavonische Dialekt, oder wenigstens ein Teil davon mit dem metat. Akut und šć, žđ für št, žd, aber mit ‚što‘ für „was“ kajkavisch oder štokavisch?36
Besondere Beachtung findet seit jeher die Klassifikation der štokavischen Dialekte. Seit den Zeiten Rešetars und Belić‘ ist es üblich, zunächst in die ijekavische, ekavische und ikavische Gruppe zu unterteilen, diese wiederum in Mundarten mit älterer und solche mit neuerer Akzentuierung. Auf diese Weise ergeben sich sechs Untergruppen: 1) Ijekavisch: a)ältere, b)neuere Akzentuierung; 2) Ekavisch: a)ältere, b) neuere Akzentuierung; 3) Ikavisch: a)ältere, b)neuere Akzentuierung. So kommt Ivić auf sieben štokavische Dialekte; allerdings führt er die Kategorie „älteste Akzentuierung“ speziell für den slavonischen Dialekt ein, wobei er die Meinung vertritt, „dass die Akzentunterschiede zwischen den štok. Mundarten eine weit größere strukturelle Bedeutung haben als jene hinsichtlich der Vertretung des ĕ“.37
Nun gibt es aber auch noch eine Reihe anderer wichtiger struktureller Merkmale, z. B. die An- oder Abwesenheit morphologischer Kategorien (etwa Aorist, Imperfekt, Deklinationsmuster), Besonderheiten des Phonemsystems (zwei oder drei Vokalklassen; drei oder vier Öffnungsgrade; Abwesenheit bestimmter Affrikaten; usw.) oder lexikalische Unterschiede. Für eine vorläufige Klassifizierung mag es genügen, die Akzentuierung, den ‚jat‘-Reflex und noch das eine oder andere Merkmal in Betracht zu ziehen. Nur allzu leicht läuft man jedoch Gefahr, demjenigen Merkmal in der Hierarchie den höchsten Rang zuzuordnen, das auf dem Terrain des betreffenden Dialekts die größte Variation zeigt, in der skr. Dialektklassifikation traditionell der Akzentuierung. Es ist offensichtlich, dass das štok. Sprachgebiet bezüglich des Vokalismus, Konsonantismus, Morphologie und Syntax eine erstaunliche Einheitlichkeit zeigt,38 auf dem Gebiet der Prosodie aber wohl an die 200 verschiedene Akzentsysteme bekannt sind.39 Muss nicht aber eine Abweichung vom Standard in einem der anderen Subsysteme mindestens ebenso so hoch bewertet werden wie die akzentologische Differenzierung?
Um bei einem konkreten Beispiel zu bleiben: Der Zeta-Lovćen-Dialekt und der Kosovo-Resava-Dialekt40 gehören zum gleichen strukturellen Akzentsystemtyp, freilich unterscheiden sie sich durch kleinere Nuancen (im Kosovo-Resava-Dialekt etwa wird der kurzfallende Akzent von offener Endsilbe verschoben, im Zeta-Lovćen-Dialekt meist erhalten).41 In der Mehrzahl der Mundarten des Zeta-Lovćen-Dialektes (und damit auf der abstrakten Dialekt-Ebene überhaupt) haben wir es aber mit einem viereckigen Vokalsystem zu tun (/a/, /ä/, bzw. /ɛ/), und zwar in diesem Falle im Gegensatz zu allen übrigen štokavischen Dialekten, die nur einen tiefen Vokal /a/ kennen.42 Nach dem Vokalismus zu urteilen kommt dem Zeta-Lovćen-Dialekt im gesamten štokavischen Raum eine Sonderstellung zu. Andererseits beinhaltet die Verschiebung des kurzfallenden Akzentes von offener Endsilbe im Kosovo-Resava-Gebiet das Auftreten – wenn auch begrenzt – des neuštokavischen langsteigenden Akzentes. Dieser tritt jedoch nur in der vorletzten Silbe auf und nur in den Positionen 1a und 2a.43 Richten wir uns nur nach akzentologischen Gesichtspunkten, so müsste dieser minimale strukturelle Unterschied für die Klassifizierung prinzipiell ausreichen, jedoch durch die Einbeziehung auch der übrigen sprachlichen Systeme gewinnen wir eine bedeutend festere Grundlage dafür.44
Dass die akzentologischen Merkmale – trotz der Bedeutung, die sie innehaben – für sich alleine genommen keineswegs immer den höchsten Rang in der Hierachie der Klassifikationskriterien einnehmen, bezeugen die oft sehr starken Abweichungen vom Akzentsystemtyp, die wir in fast jedem Dialekt antreffen; mit anderen Worten: kaum ein Dialekt ist in sich so homogen, dass das Material es zuließe, einen Idealtyp zu abstrahieren, der für alle Lokalmundarten zuträfe. Wir greifen nur ein Beispiel zur Demonstration heraus: Der Osthercegovina-Dialekt ist unter anderem durch die vollständig vollzogene neuštokavische Akzentverschiebung definiert.45 Das Akzentsystem von Kreševo in Ostbosnien jedoch zeichnet sich dadurch aus, dass nur der kurzfallende Akzent von allen Positionen verschoben wurde, der langfallende hat in allen Fällen seine alte Stelle behalten.46 Noch komplizierter wird die Situation, wenn wir feststellen, dass ein ähnliches oder gar identisches Akzentsystem wie in Kreševo auch in der Mundart der Vasojevići (Zeta-Lovćen-Dialekt), in vielen Mundarten des Kosovo-Resava-Dialektes, in Rovinj (istrisch ikavischer Dialekt) usw. besteht,47 kurz gesagt: in jedem Dialekt finden wir mindestens eine Mundart, oft ganze Mundartgruppen bei beträchtlicher arealer Ausdehnung, die das gleiche Akzentsystem wie Kreševo aufweisen. Um nun die Mundart von Kreševo dennoch als zum Osthercegovina-Dialekt zugehörig zu erkennen, genügt es, einen Blick auf die übrigen strukturellen Merkmale zu werfen.48 Selbstverständlich ist die geografische Lage mit in Betracht zu ziehen: gerade auf skr. Sprachgebiet haben wir es häufig mit Sprachinseln (Oasen) zu tun.
Aus allen bisher genannten Gründen lehnen wir auch die akzentologische Klassifikation von Moguš ab, der entsprechend den Entwicklungsphasen vom urserbokroatischen Akzentsystem bis zum neuštokavischen Vierakzentsystem bzw. torlakischen Einakzentsystem vier Unterkategorien einführt: “smatrat ćemo
starom akcentuacijom onu koja se po mjestu, broju i vrsti akcenata slaže s prasistemom,
starijom onu u kojoj je došlo do bilo kojih akcenatskih promjena na tim istim mjestima,
novijom onu u kojoj je došlo do djelomičnog pomicanja akcenatskog mjesta i
novom onu s potpuno pomaknutim akcenatskim mjestom.“
49
Sie ist genealogisch ausgerichtet und gibt anderen sprachlichen Systemen nicht genügend Geltung.
In neuerer Zeit wird auch die Morphologie bei der Klassifizierung der skr. Dialekte stärker berücksichtigt. Auf die Schwächen und Unzulänglichkeiten der Dialektologie im gesamten südslavischen Raum weist Panzer hin.50