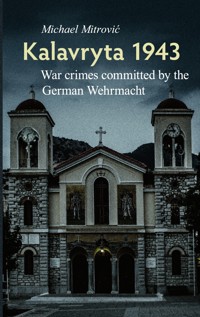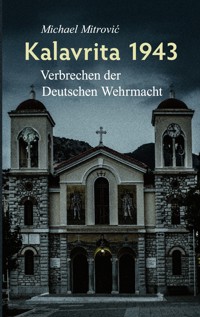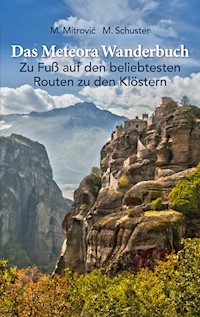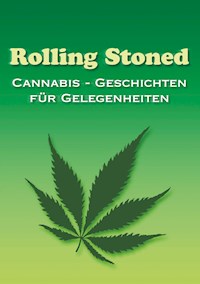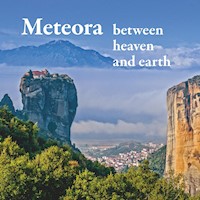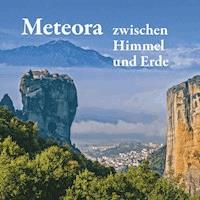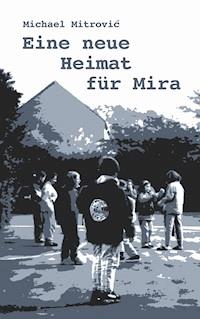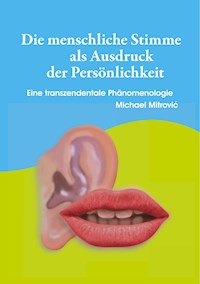
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die menschliche Stimme ist das erste und ursprüngliche Instrument der Kommunikation zwischen den Artgenossen des Homo sapiens. Während der Menschwerdung hat sie sich zu einer Leistungsstimme auf höchstem Niveau entwickelt. Auf der einen Seite gilt sie als Spiegel der Seele, als Abbild der inneren Welt. Durch ihre physische Präsenz ist sie Teil der materiellen Welt, durch ihre schillernde psychoemotionale Präsenz steht sie in enger Verbindung zur esoterischen Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Information is not knowledge
knowledge is not truth
truth is not wisdom
wisdom is not beauty
beauty is not love
love is not music
music is the best!”
Frank Zappa
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einstimmung
Kapitel 1 Die Stimme als technisches Phänomen
Kapitel 2 Die Stimme als Gender-Phänomen
Kapitel 3 Die Stimme als Phänomen der Persönlichkeit
Kapitel 4 Die Stimme als empathisches Phänomen
Kapitel 5 Die Stimme als kommunikatives Phänomen
Kapitel 6 Die Stimme als religiöses Phänomen
Kapitel 7 Die Stimme als göttliches Phänomen
Vorwort
Das vorliegende Büchlein über die menschliche Stimme ist kein Lehrbuch, davon gibt es bereits genügend. Es versucht zwar, die Stimme sowohl als physikalisches als auch kommunikationstechnisches Phänomen einzuordnen, geht aber weit über diese Ebenen hinaus.
Zum einen gehört die Stimmbildung neben der Anatomie, Physik und Linguistik auch in die Sphäre der Kunst und Magie, damit sozusagen zu den zweckfreien Tätigkeiten. Zum anderen lässt sich jede andere banale Aktivität des Menschen transzendental weiterverfolgen auf höhere Bewusstheitsstufen, denen sie phänomenologisch zu Grunde liegen.
Wenn sich der Mensch nicht lediglich als instinktgesteuertes Lebewesen begreifen will, muss er seinen Intellekt benutzen, über sich und die Welt nachzudenken und sich immer weiter vervollkommnen im Sinne einer kosmischen Ordnung. Und eben nicht im Sinne einer materiellen Ausbeutung und Technologisierung.
Die Stimme ist genau so faszinierend wie der Bewegungsapparat. Aus beiden Systemen haben sich die ältesten Kunstformen des Tanzes und des Gesangs entwickelt. Eine technische Beschreibung der Stimme lässt so viel offen an Wirkmächtigkeit wie die Beschreibung des anatomischen Bewegungsapparates nichts über die Ausdrucksmöglichkeit des Tanzes aussagt.
Dies ist ein Versuch, die Stimme in den Rhythmus des gesamten Lebens einzupassen, sie in Verbindung zu anatomischen, mythischen und esoterischen Ebenen zu bringen. Es soll unsere Sinne öffnen für einen bewussteren Umgang mit unserer eigenen Stimme sowie der Wahrnehmung anderer Stimmen.
Man kann die Stimme gar nicht geheimnisvoll genug betrachten. Denn sie war schon lange vor der Schrift das einzige geistige Medium. Alfred Döblin lässt seine Kalypso, die auf Homer zurückgehende αυδηεσσα „die mit Sprache Begabte“, sagen:
„Und der Sprung gelang, denn die Sprechkunst, sich so an die Spitze, fast außerhalb der anderen Künste stellend, vermag nun fast alles – wenn nur der Mensch, der sie hört, fast alles vermag.“
Am Anfang war das Wort – am Anfang war die Stimme!
Einstimmung
Eine welch große Rolle die Stimme in unserem Leben schon immer gespielt hat, erkennt man aus dem überaus vielfältigen semantischen Wortfeld, vor allem dem Überfluss an Präfixverben, in denen der Stamm STIMM vorkommt. Dagegen verwundert es wahrhaftig, wie wenig wir uns im Alltag mit all diesen Aspekten der Stimme beschäftigen. Denn in fast jedem Lebensbereich treffen wir auf gängige Formulierungen und Metaphern, in denen unser Stimm- und Sprechorgan die Hauptrolle spielt. Hier folgt eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
die Stimme des Herzens
jemandem eine Stimme geben (synchronisieren)
nicht bei Stimme sein
jemandem seine Stimme geben (Wahl)
Stimmen hören
Stimmengewirr
mit belegter Stimme sprechen
Stimmen einfangen, auf Stimmenfang gehen (Wahl)
jemanden an der Stimme erkennen
seine Stimme abgeben (Wahl)
die Stimme Gottes
die innere Stimme, seiner inneren Stimme folgen
seine Stimme verlieren
seine Stimme erheben
die Stimme verstellen
Stimmhygiene
eine Stimme imitieren
Stimmgabel
die Stimme der Nachtigall
Stimmen gewinnen, verlieren (Wahl)
mit beredter Stimme sprechen
Stimmgebung
die zweite Stimme singen
eine verbrauchte Stimme
eine Stimme wie ein Reibeisen
etwas schlägt auf die Stimme
eine Nikotinstimme
die Wählerstimme
Stimmvieh
Stimmrecht
Unstimmigkeit
die Stimmung, Hochstimmung
die Feinabstimmung
stimmhaft, stimmlos
die Bestimmung
die Verstimmung
etwas stimmt, stimmt nicht
bei dem stimmt etwas nicht
übereinstimmen
abstimmen
zustimmen
verstimmt sein
jemanden umstimmen
sich abstimmen
sich einstimmen
ein Lied anstimmen
etwas ist stimmig
überstimmt werden
ein Instrument stimmen
bestimmen
jemandem beistimmen
Die Stimme steht offenbar aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung als Metapher für das Funktionieren des ganzen Menschen. Gleichzeitig ist sie sowohl ein soziales Werkzeug als auch ein künstlerisches Instrument. Kein anderer Funktionskreis des menschlichen Körpers ist wirkmächtiger! Wenn „etwas“ mit jemandem „nicht stimmt“, dann ist uns der ganze Mensch suspekt, nicht etwa nur seine Stimme. Wenn sich zwei oder mehr Menschen „abstimmen“ wollen, dann muss die „Chemie zwischen ihnen stimmen“, damit das Ergebnis optimal sein kann. Mit der Wählerstimme ist das Gesamtverhalten des Wählers innerhalb der Legislaturperiode gemeint, nicht nur das Ankreuzen eines Namens!
Wahrlich, die Stimme stellt für sich selbst einen Mikrokosmos dar, der sich aus allen Lebensbereichen bedient und der umgekehrt alle Lebensbereiche beeinflusst. Diese Zusammenhänge wollen wir im Folgenden sichtbar machen.
Die erste Ebene
Die Stimme als technisches Phänomen
Das Phänomen Stimme
Um es gleich vorweg zu sagen: auf der ganzen weiten Welt finden wir keine zwei identischen Stimmen, die zu allen Zeiten und in allen Lebenslagen gleich klängen. Wohl klingen sie ähnlich und führen auch schon einmal zu Verwechslungen, besonders dann, wenn Störungen im Übertragungskanal vorliegen (z.B. auf elektronischem Wege), der Sprecher erkrankt ist oder die auditive Hörspanne des Hörers beeinträchtigt ist. Aber selbst noch so ähnliche Stimmen werden gewisse, vom durchschnittlichen Hörer wahrnehmbare Unterschiede aufweisen. Und wenn wir die Stimme gar mit technischen Mitteln analysieren, werden diese Unterschiede noch weit besser fassbar.
Es ist tatsächlich wie mit dem Fingerabdruck: die Stimme macht den Menschen einmalig auf dieser Welt. Und doch gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen dem Fingerabdruck und der Stimme: während der Fingerabdruck statisch vom Relief der sich nur über größere Zeiträume verändernden Haut genommen wird, deren Rillenstruktur durch den genetischen Code vorgegeben und unveränderbar ist, gibt es von der Stimme keinen vergleichbaren Moment-”Abdruck”. Jede Tonhöhen- und Lautstärkeregelung verlangt eine andere Muskelaktivierung und nur professionell ausgebildete Stimmen sind überhaupt in der Lage, einen Ton eine Zeit lang relativ konstant zu halten.
Die Unschärferelation der Stimme
So werden wir also gleich zu Beginn unserer Betrachtung über die Stimme mit einem verblüffenden Phänomen konfrontiert, das ich - in Anlehnung an die Atomphysik - gerne mit dem Begriff “Unschärferelation” bezeichne: jeder von uns ist in der Lage, Stimmen zu differenzieren sowie zu identifizieren und in der Phonetik können wir eine Unmenge von Daten messen - aber bis heute ist es niemandem gelungen, jeder einzelnen Stimme ein “Etikett” zu verpassen, auf dem unverwechselbar vermerkt wäre, wie wir sie erkennen und warum es nur diese eine bestimmte Stimme sein kann. So wie man in der Teilchenphysik immer nur entweder den topographischen Ort oder die Geschwindigkeit des Teilchens, niemals aber beides simultan bestimmen kann, ist es für die Stimme unmöglich, restlos alle gemessenen Parameter fein säuberlich zu ordnen bzw. sie zu erklären und sie in Verbindung zu bringen mit außerstimmlichen Realitäten wie Sprechabsicht, Sprechwirkung oder die Beziehung zwischen Gesprächspartnern.
Die Stimme ist untrennbar mit dem Sprecher/der Sprecherin verbunden, sie gehört nur diesem einen Menschen. Was sie alles bewirken kann, wollen wir in der Folge sehen.
Ein jeder von uns wird den lieben langen Tag von Stimmen begleitet (und manch einer hört sie sogar des Nachts oder wenn er sich sonst einmal Stille gönnen möchte). Es beginnt mit der Stimme des Nachrichtensprechers im Radio, dem Gespräch am Frühstückstisch, im Büro - bis zum “Gute Nacht”- Gruß am Abend. Ständig hören wir Stimmen und antworten darauf mit unserem eigenen Stimmorgan. Wer aber könnte spontan auf die Frage antworten: Was ist eigentlich die Stimme? Wie wird sie erzeugt? Was vermag sie zu leisten?
Obwohl wir in unserem gesamten Leben im wahrsten Sinne des Wortes von Stimmen umgeben sind, bleibt sie für die meisten von uns zeitlebens ein Geheimnis.
Was also ist das: die Stimme?
Stimme und Hören
Rein phänomenologisch betrachtet haben wir es mit Geräuschen und Klängen zu tun, die unser Stimmorgan produziert und unser Ohr aufnimmt. Damit ist schon eine ganze Menge ausgesagt: die Stimme existiert nicht für sich allein, vielmehr ist sie nur sinnvoll denkbar in Kombination mit dem dazugehörigen Hörorgan. Welche Bedeutung sollte denn den Geräuschen und Klängen zukommen, wenn sie gar nicht gehört werden könnten? Andererseits ist das Gehör wichtiger als die Stimme, weil es alle Geräusche wahrnimmt, nicht nur stimmliche. In der Entwicklungsgeschichte der Tiere ist das Ohr vor dem Stimmorgan entwickelt, denn es stellt neben dem Gleichgewichtsorgan das akustische Perzeptionsorgan dar, welches neben dem Gesichtssinn, dem taktilen Sinn sowie dem Geruchssinn sowohl Gefahr als auch Nahrungsquelle und Artgenossen signalisiert. Auf dieser niedrigen Entwicklungsstufe findet zwar keine Stimmgebung statt, dennoch kommt es zu Verständigung zwischen den Artgenossen.
Austausch von Botschaften
Damit haben wir das zentrale Thema angesprochen: am Anfang steht die Intention oder Notwendigkeit zwischen Individuen, sich einander bemerkbar zu machen, Botschaften auszutauschen und Gefühle auszusenden. Dafür hat sich die Evolution die seltsamsten Möglichkeiten einfallen lassen. Die Bienen führen wahre Tänze auf, deren “Choreographie” ganz exakte Angaben über Menge, Ort und Art des Blütennektars enthalten. Balztänze bzw. -rituale sind von vielen Tierarten bekannt. Und es gibt eben eine Reihe von Möglichkeiten, Geräusche zu erzeugen. Alle beruhen auf dem Prinzip der mehr oder weniger rhythmischen Bewegung von Körperteilen gegeneinander oder isoliert: Flügelflattern, Rasseln der Schlangen, Schlagen von Schwanz oder Leib/Pfote. Manche dieser Bewegungen geschehen reflektorisch oder spielerisch. Daher spielt es zunächst keine Rolle, ob sie der Artgenosse wahrnimmt oder nicht. Andere jedoch sind für die Verständigung zwischen den Individuen mit Sinn behaftet. Nicht jeder einzelne Flügelschlag der Biene, so dürfen wir vermuten, enthält eine Information über entdeckte Futterplätze. Die Bewegung der Flügel dient ja in erster Linie der eigenen Fortbewegung. Gewisse Kreise und Achten in verschiedene Richtungen zurückgelegt hingegen enthalten die gewünschte Information für die anderen Arbeitsbienen.
Funktionen tierischer Lautäußerungen
Offensichtlich besitzen viele Tierarten ein “Vokabular” von im genetischen Code festgelegten Verhaltensstereotypen, über das verfügen muss, wer an der Kommunikation teilnehmen möchte. Außerdem muss jedes Individuum in der Lage sein, relevante / bedeutungstragende von irrelevanten Einheiten zu unterscheiden.
Außer bestimmten Bewegungen wird Information auch auf anderen Kanälen übertragen. Ebenfalls visuell werden ganzheitliche Eindrücke des äußeren Aussehens vermittelt, etwa wenn ein Vogel sich aufplustert oder eine Wildkatze eine Drohgebärde gegen einen Rivalen zeigt. Olfaktorisch werden Gerüche mitgeteilt, die Informationen über dasjenige Individuum verraten, das sie abgesondert hat. In der unmittelbaren Berührung nehmen die Rezeptoren der Haut Fühlung und geben diese haptischen Daten weiter an das Gehirn. Ein Lebewesen stellt sozusagen ein Signale aussendendes und verarbeitendes Gesamtsystem dar.
Nun erzeugt eine jede Bewegung per definitionem die Anregung der überall vorhandenen Luftmoleküle und damit Geräusche. Ein Hörorgan hat sich wohl vor allem deshalb in der Phylogenese entwickelt, weil es sehr nützlich, um nicht zu sagen überlebensnotwendig ist, Geräusche wahrzunehmen, die auf eine unmittelbare Gefahr hinweisen. Es dient aber ebenso dazu, Art- und Sippengenossen zu erkennen. Allerdings setzt dies die Fähigkeit voraus, Geräusche willkürlich produzieren und differenzieren zu können. Denn wenn der Artgenosse sich nicht im Gesichtskreis aufhält, sieht er die Bewegungen nicht, die ihm Information bedeuten könnte.
Zusammenfassend können wir die folgenden Funktionen auflisten, die das Hörorgan eines tierischen Organismus aufweist: Kontakt zu potenziellen Paarungspartnern aufnehmen, Kontakt zu abhängigem Nachwuchs herstellen, Feinde und Konkurrenten auf Abstand halten, Anzeigen des physiologischen Zustands, Signal der Empfängnisbereitschaft, Anfachen der Konkurrenz unter männlichen Tieren sowie Aufschluss über die Kampfkraft.
Das Hörorgan
Einen großen Fortschritt in der Evolution stellt daher das Hörorgan dar. Nun werden auch Ereignisse wahrgenommen, die nicht in Sichtweite oder etwa verdeckt sind. Mit einem solchen Organ ausgestattete Lebewesen hören selbstverständlich sich selbst ebenso gut wie fremde Artgenossen.
Eigenversuch
Mache einmal den Versuch und beobachte bzw. lausche für fünf Minuten den Geräuschen, die dein Körper produziert: Verdauungsgeräusche, Atemgeräusche, Husten, Niesen. Vielleicht gehörst du sogar zu den ganz hellhörigen Menschen, die das Eigengeräusch ihrer Ohren vernehmen, einen feinen hochfrequenten, sehr leisen Ton!
Atmung und Atemgeräusch
Besonders das Atemgeräusch begleitet uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Leben lang, eben bis zum buchstäblich letzten Atemzug. Freilich hören wir beim Fernsehen oder in der Straßenbahn nichts davon. Die Außengeräusche verdecken völlig unser Eigengeräusch. Aber auch, wenn es ganz still ist und wir unserem Atem lauschen und keinerlei Bewegungen ausführen, kann es sein, dass wir tatsächlich nichts hören. Das aber ist ja nicht die Regel.
Eigenversuch
Mach einmal zehn Kniebeugen und lausche anschließend auf deinen Atem!
Jede körperliche Anstrengung verbraucht Energie, die außer der Nahrung durch die Atemluft zugeführt werden muss. Je größer die körperliche Arbeit ausfällt, desto mehr und in kürzeren Abständen muss Sauerstoff zugeführt werden. Während eines Dauerlaufes oder nach dem Treppensteigen kommt manch einer ganz schön ins Keuchen, macht also laute Atemgeräusche.
Beobachte einmal im Laufe eines Tages dein Atemverhalten und lausche den unterschiedlichen Geräuschen, die je nach der Tätigkeit, die du gerade verrichtest, produziert werden.
Der Weg des Atems
Wir werden noch häufiger auf die Atmung zurückkommen, die ja die Grundlage sämtlicher vitaler Vorgänge darstellt. An dieser Stelle wollen wir weiter der Frage nachgehen, wie sich die Stimmfunktion in der Evolution entwickelt haben könnte. Schauen wir uns den Weg an, den die Atemluft bei den Säugetieren und den Menschen zurücklegt: durch Mund oder Nase gelangt die Luft über den Rachenraum in die Luftröhre und weiter über die Bronchien in die Lunge, wo der Gasaustausch stattfindet. Die verbrauchte Luft nimmt den umgekehrten Weg zurück. Dieses Schlauchsystem, das man als eine mit Schleimhaut ausgekleidete Röhre betrachten kann, ist natürlich sehr anfällig für Fremdkörper, die einmal in die Luftröhre gelangt, verheerende Folgen haben können, nämlich schlimmstenfalls den Tod durch Ersticken. Aus diesem Grunde hat sich in der Entwicklungsgeschichte ein mehrfacher Sicherheitsring gebildet, der die Hauptaufgabe besitzt, die Luftröhre von Fremdkörpern freizuhalten und damit die ungehinderte Energieaufnahme in Form von Sauerstoff zu gewährleisten.
Die Stimme als Abfallprodukt der Menschheitsgeschichte
Für das Verständnis der menschlichen Stimme sind diese Zusammenhänge von großer Wichtigkeit. Sie demonstrieren nämlich sehr anschaulich, dass der anatomische Apparat, der in einem späteren Stadium der Stimmerzeugung dient, ursprünglich viel wichtigere Aufgaben besaß, dass mithin die Stimme sozusagen ein Abfallprodukt darstellt. Der Schutz der Atemfunktion stellt sich nämlich einmal als ein Deckel dar, der bei Gefahr die Luftröhre verschließt, der Kehldeckel. Dieser Fall tritt bei einzelnen Fremdkörpern auf, die sich verirrt haben, wobei es zum Hustenreflex und zum Verschluss der Luftröhre kommt. Der Husten selbst ist eine kurzzeitige starke Druckerhöhung, die den Fremdkörper herausschleudern und somit die Gefahr beseitigen soll. Regelmäßig besteht diese Gefahr natürlich bei der Nahrungsaufnahme, denn bis zum Kehldeckel sind ja Nahrungs- und Luftweg größtenteils identisch.
Der Schluckvorgang
Während des Schluckens, welches ab einer bestimmten Phase automatisch (reflektorisch) vor sich geht, schließt nun wieder der Kehldeckel die Luftröhre und gewährleistet dadurch, dass der Nahrungsbrei in die Speiseröhre befördert wird.
Aber damit nicht genug. Unterhalb des Kehldeckels, also schon in dem Bereich, in dem sich normalerweise kein Speisebrei befindet, haben sich zwei feine Muskelpartien gebildet, die im Falle einer Gefahr kontrahieren und den Luftweg zusätzlich abschließen: im oberen Bereich sind das die Taschenfalten, ein etwas gröberer paariger Muskel, der in der Regel nicht völlig abschließt und schließlich die Stimmbänder, die die Luftröhre völlig verschließen können. Diese drei Schutzmechanismen hatten ursprünglich die Aufgabe, die Atemwege zu schützen sowohl bei der Atmung als auch bei der Nahrungsaufnahme.
Wir kehren jetzt zurück zu der Tatsache, dass wir unsere eigene Atmung hören können. Für den zivilisationsgeschädigten Menschen des 21.Jahrhunderts ist es offenbar eine Neuentdeckung, sich mit der eigenen Atmung, den Gefühlen und eben auch der Stimme zu beschäftigen. Dabei stellt die Atmung die kleinste rhythmische Einheit dar, auf der sich alle höheren Ordnungen aufbauen! Wir haben hier das binäre Prinzip in Reinform vor uns: ein - aus oder 1 – 0 bzw. Einatmen - Ausatmen.
Atemgeräusche
Was hören wir nun beim Atmen? Woraus besteht das Atemgeräusch? Immer wenn Luft über Ecken, Kanten oder Flächen streicht, werden Luftmoleküle angestoßen und geben diese Bewegungen über eine kurze Strecke an die Nachbarmoleküle weiter, bevor sie elastisch in ihre Ausgangslage zurückfedern. Das Ergebnis sind Verwirbelungen, ein Rauschen. Gerade so, wie der Sturm in einer Winternacht um die Hausecke oder über das verschneite Feld saust, hören wir die Turbulenzen des Luftstroms, der im Mund- und Rachenraum entsteht. Aber auch in der Luftröhre kann es bereits zu unbeabsichtigten Geräuschen durch Schleimablagerungen oder Entzündungen kommen. Wir hören dann ein gurgelndes Röcheln, der Mediziner spricht vom Stridor. Auch kann die Nasenatmung so sehr behindert sein, dass die Luftmenge nicht einmal mehr für die Ruhe ausreicht und wir durch den Mund Luft aufnehmen müssen.
Die Geräusche, die vorwiegend beim Ausatmen entstehen, können freilich auch gezielt eingesetzt werden, indem der sowieso schon schmale Schleimhautschlauch an verschiedenen Stellen willkürlich verengt wird. Es entsteht dann ein Fauchen, Zischen oder Blasen, was in der Regel auf Abwehr oder Aufmerksamkeitserregung zielt.
Eigenversuch
Wenn wir z.B. um Ruhe bitten, bilden wir ein stimmloses /s/ oder /sch /, /pst/, /pscht/.
Je mehr Atemluft wir zur Verfügung haben, desto länger können wir diese Geräusche halten. Die Lautstärke wiederum wird vom Luftdruck bestimmt, der aus der Lunge herausgepressten Luft also.
Versuche, eine Kerze mit wenig Luft und geringem Druck auszublasen!
Die Stimmproduktion
An dieser Stelle kommt es zu dem erstaunlichen Phänomen der Stimmproduktion. Bis jetzt haben wir uns ausschließlich mit Geräuschen beschäftigt. Wenn der Druck der aus der Lunge gelangenden Luft eine bestimmte Stärke erreicht, kann er die relativ eng anliegenden Haut- bzw. Muskelfalten zum rhythmischen Sich-aneinander-Legen und “Auseinander-Sprengen” bringen. In der Physik ist dieses Verhalten als die Bernoullische Strömungsgleichung bekannt, benannt nach dem Schweizer Naturwissenschaftler Daniel Bernoulli (1700 - 1782). Sie besagt, dass in einer engen Düse bei einer bestimmten Strömungsgeschwindigkeit ein Unterdruck entsteht, was zu einer Verengung führt.
Eigenversuch
Nimm zwei Blatt dünnes Papier Din A6 oder A7 so in die Hand, dass ein schmaler Spalt zwischen ihnen bleibt. Blase in diesen Spalt hinein. Die Blättchen werden sich immer wieder mehr oder weniger rhythmisch berühren.
Voraussetzung für das Erreichen der benötigten Strömungsgeschwindigkeit ist ein bestimmter Luftdruck, der höher sein muss als oberhalb der Engstelle. Diesen Luftdruck liefert die aus der Lunge gepresste Ausatemluft.
Geniale Ausnutzung vorhandener Ressourcen
Es ist faszinierend, wie die menschliche Stimme als Zufalls- und Abfallprodukt der Evolution entstand: die Atemluft, die dem lebensnotwendigen Gasaustausch dient, wird sekundär als Mittel benutzt, einen Betriebsdruck aufzubauen. Dieser Druck bewirkt seinerseits ein sekundäres Zusammentreten von Muskelfalten, die ursprünglich den Schutz des Atemapparates gewährleisten sollten. So stellt sich denn die entwicklungsgeschichtliche Ausbildung der menschlichen Stimmleistung als geniale Ausnutzung vorhandener Ressourcen dar, als vermutlich optimale Lösung auf der Suche nach einem leistungsfähigen Kommunikationssystem. Denn mit der zunehmenden Komplexität des menschlichen Zusammenlebens wurde es notwendig, immer kompaktere, mächtigere Zeichensysteme zu entwickeln. Die ursprünglichen kommunikativen Mittel - Mimik, Gestik, Geruchsmarken, körperliche Berührungen - haben nicht mehr ausgereicht, um den nächsten Evolutionsschritt vom Hominiden zum Homo erectus zu tun. In der Tat sind uns keine Völker oder Stämme auf der Welt bekannt, die sich nicht in einer gesprochenen Sprache verständigen. Sprache und Sprechen scheinen einen Quantensprung in der biologischen Entwicklung zu markieren, der die Grenze vom Menschen zum Tier bezeichnet und eine im geistig-kulturellen Sinne unüberbrückbare Kluft schafft.
Klänge des Kehlkopfes
Im Gegensatz zu Geräuschen, die an jeder beliebigen Stelle gebildet werden können, entstehen im Kehlkopf Klänge. Gebildet werden sie durch das rhythmische Öffnen und Schließen der Stimmbänder (Musculus vocalis), wobei diese erstaunliche Regelmäßigkeit auf einer selbstregulierenden Eigendynamik des Systems beruht.
Die ersten Stimmprodukte in der Evolution mögen sich aus zwei Quellen gespeist haben: einerseits wird es sich um Nebenprodukte großer emotionaler Erregtheit gehandelt haben, bei denen entweder der Atemtrakt stark verengt oder aber der Ausatemstrom verstärkt austritt. Beides sind gute Voraussetzungen, einen Klang zu produzieren, wenn auch keinen “schönen”, reinen!
Eigenversuch
Stell dir einmal vor, du wärest bedroht und willst den Feind knurrend abwehren! Jedenfalls kannst oder willst du deine Stimme dabei nicht einsetzen! Fauchende, zischende Geräusche klingen bedrohlicher als vokale!
Der Spiel- und Experimentiertrieb führt zur Vokalstimme
Andererseits wird der angeborene Spiel- und Experimentiertrieb zum Improvisieren mit der hörbaren Atmung eingeladen haben. Sehr imposante und eigenwillige Ergebnisse solcher Experimente können wir noch heute im Sprechgesang der Inuitfrauen sowie im improvisierten Gruppensingen der Roma und Sinti hören. Sehr früh, noch vor der Versprachlichung, muss auch bereits die Vokalstimme als Distanzüberbrückung entdeckt worden sein. Die Zivilisationsgesellschaft mit ihren Handys und dem Chat im Internet kann sich kaum noch vorstellen, wie sich die Landbevölkerung vor hundert Jahren ohne Telefon verständigt hat. Bei fast allen Tätigkeiten und Verrichtungen des Alltags wurden bestimmte charakteristische Rufe, Kommandos oder Erkennungslaute produziert. Angefangen beim Bauern, der sein Pferd lenkt (hü, brrr), über den Schiffer, der einen Kollegen grüßt (ahoi) bis zum Krieger, der sich durch Schreie Mut macht und den Gegner ängstigt (urra). Man denke nur an die Kelten, vor deren Kriegsgeschrei, unterstützt durch Blechblasinstrumente, selbst die Römer Angst bekamen.
Als das Prinzip der Klangerzeugung erst einmal durchschaut war, wurde es natürlich, wie bei allen Innovationen, auf seine Verwendbarkeit hin untersucht. Was konnte dieses Stimminstrument für die Verbesserung der zwischenmenschlichen Kommunikation leisten? Oder würde es nur eine Episode in der Evolution bleiben, recht eindrucksvoll zwar, aber nicht ausbaufähig?
Die Stimme im Alltag
Zunächst einmal war es möglich, alle Verrichtungen des täglichen Lebens zu kommentieren, während gleichzeitig beide Hände für körperliche Tätigkeiten frei blieben. Auch konnte man alle Gefühlszustände stimmlich begleiten. Da die Atmung und die gesamte Muskulatur mit dem vegetativen Nervensystem verkoppelt sind, werden je nach Gefühlslage und Ausatemdruck unterschiedliche Bedingungen für die Produktion von Klängen geschaffen.
Eigenversuch
Mach dir einmal bewusst, wie deine eigene Stimme klingt, wenn du
Geräusche und Klänge des Kleinkindes
Einen recht guten Eindruck davon, wie das vorsprachliche stimmliche Begleiten von Handlungen und Gefühlen klingt, bekommen wir, wenn wir Kleinkindern zuhören und zusehen. Aufmerksame Eltern unterscheiden verschiedene Arten des Schreiens, Gurrens, Lallens und Weinens bzw. Lachens, die alle ihre eigene Bedeutung haben. Natürlich setzt ein Kleinkind seine Stimme nicht bewusst ein, um sie auszuformen, damit es später sprechen kann. Vielmehr werden die Geräusche und Klänge ganz automatisch und zweckfrei durch die Respirationsluft gebildet, sozusagen als physikalische Notwendigkeit. Da aber bestimmte Gefühlszustände ähnliche oder gleiche Stimmproduktionen hervorrufen, z.B. das nicht gestillte Hungergefühl ein lautes plärrendes Weinen, werden sich diese Klänge/Geräusche im Bewusstsein des Kindes verankern und führen so zu ersten Rückkopplungserfahrungen. Bald darauf wird es Gehörtes nachahmen und mit Eigenproduktionen experimentieren.
Der stimmliche Ausdruck von Gefühlszuständen, den der zivilisierte (“gut erzogene”) Mensch gewöhnlich in Sportstadien und Wirtshäuser verbannt hat, diente ursprünglich nicht nur der Selbststimulierung durch Bewusstmachung, sondern auch der Kontaktaufnahme zu anderen Individuen. Genau genommen gibt es einen Teil in der Stimme, der selbstvergessen, introvertiert kultiviert werden will, etwa wenn das Kleinkind lange Lallmonologe führt und sich sichtlich wohl dabei fühlt. Hier dürfen wir den Ursprung der Sprech- und Gesangskunst suchen. Der andere Teil verkörpert dagegen die eher technisch orientierte Kommunikation, die aufgrund von konventionell festgelegten Lautstrukturen gesprochene Sprache ermöglicht.
Das lautliche Zeichensystem
Betrachten wir einmal näher diese technische Seite der Stimmverwendung. Wenn es möglich ist, eine gewisse Anzahl zu unterscheidender Klänge und Geräusche zu produzieren, die man miteinander kombinieren kann, so steht damit ein Zeichensystem zur Verfügung, welches in der Lage ist, eine sehr große Anzahl von höheren Einheiten zu generieren. Anders ausgedrückt: wenn sich einzelne Laute innerhalb einer gewissen Variationsbreite als wiederholbare Konstanten (im Sinne des modernen Phonembegriffes) herausarbeiten lassen, können mit ihnen größere Einheiten, nämlich Wörter, gewonnen werden.
Im Verlauf der Menschheitsgeschichte entstand aufgrund der immer weiter fortschreitenden Arbeitsteilung und Komplexität des Lebens die Notwendigkeit, Informationen festzuhalten, wofür Schrift- und Zeichensysteme als auch architektonische Anordnungen (Stonehenge) entwickelt wurden. Auch war die Gestik und Mimik als Gebärdensprache sehr nützlich und manchmal, im Jagd- und Kriegswesen, die einzig mögliche Form der Verständigung, ohne den Erfolg der Handlung zu gefährden. Es bildete sich gleichfalls ein Repertoire an “lautlich/stimmlichen” Ganzheiten heraus, welches, wie wir gesehen haben, in hervorragender Weise geeignet war, zunächst komplexe Gefühlszustände auszudrücken, dann aber auch Handlungsanweisungen zu produzieren wie Warnungen, Aufforderungen oder Abgrenzungen.
Tierlaute nachahmen
Als der Vormensch erst einmal begonnen hatte, mit seiner Stimme zu experimentieren, war es - ganz wie beim Kleinkind auch - nur noch ein kleiner Schritt, die Geräusche seiner Umwelt, und in ganz besonderer Weise die Laute der Tiere nachzuahmen. Der Jäger machte sich diese zu höchster Perfektion gelangte Fähigkeit bei der Pirsch zunutze, um das zu jagende Wild zu täuschen.
Eigenversuch
Leider droht diese so faszinierende und zugleich beglückende Fähigkeit des Nachahmens von Tierstimmen völlig in Vergessenheit zu geraten. Unsere Kinder erleben kaum noch Tiere aus der Nähe, schon gar keine wilden. In der Kultur der Erwachsenen gilt das Imitieren eines Pferdewieherns oder Hundebellens als albern, wenn nicht gar verrückt! Wenn du dich schon nicht traust, dein Wohnzimmer oder Badezimmer zur Farm zu machen, so rate ich dir, wann immer du mit kleinen Kindern Kontakt hast, die Gelegenheit nicht zu verpassen, die Tierlaute nachzuahmen. Kinder jedenfalls lieben dieses Schauspiel!
Aus vielen bäuerlichen Kulturen ist bekannt, wie komplex die “Sprache” von Bäuerin und Bauer mit ihren Tieren ist bzw. war. Für jedes Haustier gab es einen speziellen Lockruf, ebenso einen Distanzruf und natürlich den nachgeahmten Laut, der die Tierstimme imitiert.
Imitieren von Geräuschen
Aber nicht nur Tiere kann die menschliche Stimme mehr oder weniger echt imitieren. Eigentlich lassen sich alle natürlichen Geräusche nachahmen: Meeresrauschen ebenso wie Gewitterdonner, heulender Wind wie krachendes Eis. Es kommt ja nicht darauf an, dass es völlig identisch klingt, sondern nur so genau wie eben möglich und vor allem wiedererkennbar. Auch hier bieten sich uns Kinder als wunderbares Anschauungsobjekt an.
Eigenversuch
Beobachte einmal, wie etwa 10jährige Jungen einen Indianerfilm kommentieren. In dem unbezähmbaren Wunsch, sich gegenseitig die fesselndsten Szenen in Erinnerung zu rufen, “reden” sie nicht nur mit Händen und Füßen, sondern setzen auch ein wahres Feuerwerk an Geräuschen und Lauten ein: Zischen, Fauchen, “Zack” und “Fusch”, “takataka” und “bong” usw.
Die menschliche Stimme ist also in der Lage, ganze Geschichten zu erzählen, ohne auch nur ein einziges “Wort” im herkömmlichen Sinne zu verwenden. Dies demonstrieren uns Lautkünstler wie etwa David Moss oder Ernst Jandl in höchstem Maße. Nicht Wörter sind das eigentliche Material für unsere Sinne, sondern Tonhöhe, Lautstärke, Dehnung oder Kürzung, Klangfarbe: die prosodischen Elemente!
Eigenversuch
Stell dir vor, du sollst auf die vorwurfsvolle Frage “Wann bringst du endlich mal die leeren Flaschen zum Container?” mit “Morgen!” antworten. Je nach deiner psychischen Verfassung, der Beziehung zum Sprecher / zur Sprecherin hast du unendlich viele Nuancen zur Verfügung, dieses kleine Wörtchen zu be-”tonen”, es mit Ton/ Leben zu füllen. Vom skandierenden, beide Silben betonende “mor-gen” über das lieblich süße, in der ersten Silbe ansteigende “morgen” bis zum tonlosen hingehauchten reduzierten “mogn”.
All diese Möglichkeiten, die Stimme je nach Gefühlslage zu modulieren, werden in den meisten Fällen mehr oder weniger unbewusst realisiert. Bisweilen gelingt es uns recht gut, uns zu verstellen oder “eine Rolle zu spielen”. Wenn wir das mit diesem Verhalten angestrebte Ziel erreichen, was immer es auch sei, hat unsere Stimme ihre Wirkung getan. Meistens gelingt uns so etwas im Alltagsleben, wenn der oder die Gesprächspartner selbst so erregt sind, dass ihnen unser Betrug gar nicht auffällt. Von Schauspielern erwarten wir geradezu, dass sie uns mit ihrer Vortragskunst einige Stunden der Illusion schenken.
Die Stimme als sprachliches Instrument
Bis jetzt haben wir uns sehr ausführlich mit vielen Nuancen befasst, die im stimmlichen Ausdruck mitschwingen und das Gefühlsleben quasi abbilden. Ein ebensolch wichtiger Bereich stellt die Verwendung der Stimme als sprachliches Element dar. Am Anfang der Entwicklungsgeschichte der menschlichen Sprache stehen die stimmlichen Produktionen, die wir bisher schon beschrieben haben. Die Intention, etwas auszudrücken, sich dem Mitmenschen mitzuteilen, wird immer Wege dazu finden.
Eigenversuch
Vielleicht erinnerst du dich, wie du einmal im Urlaub mit Einheimischen ins Gespräch kommen wolltest. Weil aber keiner von euch des anderen und auch keine dritte gemeinsame Sprache beherrschte, musstet ihr “mit Händen und Füßen” kommunizieren.
Die ersten “Wortgebilde” könnten lautmalerische Ausdrücke gewesen sein, also Nachahmungen von Natur- und Tiergeräuschen. Dabei spielt es keine so große Rolle, wie exakt die Artikulationswerkzeuge ihre Positionen einnehmen und halten. Die Hauptsache ist, dass das entstandene Geräusch von allen wiedererkannt wird.
Tiergeräusche als Sprachzeichen
Interessant sind die unterschiedlichen Lautwerte, die einzelne Sprachen etwa für den Hahnenschrei verzeichnen: deutsch “kikeriki” (letzte Silbe betont), englisch “cockadoodledoo” (letzte Silbe betont), serbisch “kukuriku” (3.Silbe betont).
Zum einen kommt hier die große Schwierigkeit zum Ausdruck, mit den Mitteln der menschlichen Sprache - nicht der Stimme! - den Tierlaut abzubilden. Ebenso wird jedoch die große Freiheit einer jeden Sprache sichtbar, die ihrem eigenen Rhythmus gemäßen Lautstrukturen zu schaffen.
Je größer das Repertoire der Ausdrücke, Naturlaute, Sinneinheiten und vielleicht auch Namenetiketten wurde, desto schwieriger war es, diese Items auseinanderzuhalten. Die Notwendigkeit zu dieser immer genaueren Bezeichnung führte freilich zu der Entdeckung, dass man mithilfe der Hohlräume und der Atem-, Kau- und Schluckorgane eine erstaunliche Vielfalt an unterschiedlichen Klängen und Geräuschen produzieren kann. Es kam schließlich zu kleinen willkürlichen Veränderungen von lautmalerischen Gebilden bzw. Bezeichnungen und auf diese Weise zu den ersten “abstrakten” Wörtern.
Erste Wörter
Die Bezeichnung (der Name / das Etikett) des gezähmten Wolfes mag als hypothetisches Beispiel dienen. Nehmen wir einmal an, diese Tiergattung wurde wegen des charakteristischen nächtlichen Heulens nach diesem Geräusch benannt, dann konnte dabei etwas herauskommen wie [wou] oder [ou] mit steigender Intonation. Sollte sich erwiesen haben, dass das Geheul sich besonders realistisch anhörte, wenn man die Zunge rückverlagert bzw. retroflex platziert, ist es nur noch ein kurzer Schritt zum [wo:l] bzw. [volf]. Das [f] mag aus irgendeinem Suffix entstanden sein, welches zur genaueren Kennzeichnung der Gattung wichtig war, vielleicht [volf] “Wolf” vs. [vo:l] “gezähmter Wolf”. (Vgl. auch im Slavischen „vuk, vlk“ u.ä.). So könnte es im Indoeuropäischen gewesen sein, andere Kulturen und Sprachräume könnten andere Aspekte für die Lautgebung zum Vorwand genommen haben.
Lautliche Einheiten
Dies ist, wie gesagt, nur ein hypothetisches Beispiel, das den möglichen Verlauf der Ausbildung menschlicher Sprache andeuten soll. Der entscheidende Fortschritt bei dieser sukzessiven Ausdifferenzierung von lautlichen Nuancen ist die Erkenntnis, dass es lautliche Einheiten gibt, die innerhalb einer gewissen Variationsbreite von allen Sprachteilnehmern wiedererkannt werden. Diese Einheiten bzw. Laute können unterscheidend dienen und obendrein miteinander kombiniert werden zu neuen übergeordneten Einheiten, unseren Wörtern entsprechend.
Die Art und Weise der genutzten Laute ist für ihre Funktion völlig unerheblich. Je nachdem, welche phonetischen Merkmale sich einer bestimmten Population als vordergründig oder strukturbildend aufprägen, zeigt das Lautinventar, welches sie für die Bezeichnung ihrer realen Umwelt benutzt, charakteristische Strukturen, Korrelationen und Bildungsweisen. Die Sprachen der Welt zeigen eine erstaunliche Vielfalt an Bildungsmöglichkeiten menschlicher Sprachlaute. Zwar kann man selbst innerhalb Europas bereits einige seltenere Phänomene studieren. Dennoch muss der alte Kontinent für den Erforscher von versprachlichten Stimmmodulationen eher als langweilig gelten. Keine einzige ihrer Sprachen macht im eigentlichen Sinne Gebrauch vom Prinzip der Tonverlaufskorrelation, welches etwa zwei Dritteln der uns bekannten Sprachen zu Eigen ist (z.B. dem Chinesischen).
Emotion vs. Intention
Als nächstes wollen wir uns anschauen, wie die Laute und Geräusche gebildet werden, die wir entweder rein emotional-subjektiv oder sprachlich-objektiv einsetzen. Ihre Bildungsweise ist in beiden Fällen grundsätzlich gleich, nur dass für emotional-vegetative Laute die Eigenkontrolle aufgehoben ist, während beim Sprechen die latent vorhandenen Emotionen sozusagen für die Zwecke der Sprache gezähmt werden müssen. Das geschieht, indem die sprachlichen Sinneinheiten von den Intentionen / Emotionen zwar initiiert werden, nicht aber so von ihnen deformiert werden dürfen, dass die Emotionen die sachlichen Inhalte überformen. Trotz großer Emotionen muss also der sprachliche Inhalt noch verständlich sein, wenn eine Kommunikation erfolgreich sein soll. Andererseits sind im Alltag häufig auch reine Emotionen völlig verständlich, weil sie aus dem Kontext erschlossen werden können.
Der Kehlkopf
Kommen wir jetzt zum eigentlichen Stimmorgan, dem Kehlkopf. Ohne einige Grundkenntnisse der Physik werden wir im Folgenden nicht auskommen. Das fertige Produkt, die Stimme, ist streng physikalisch betrachtet, ein Gemisch akustisch messbarer Schwingungen. Damit etwas in Schwingung versetzt wird, brauchen wir eine Energie liefernde mechanische Kraft sowie schwingungsfähige, also elastische Objekte. Den mechanischen Druck, der nach dem Gesetz von Bernoulli notwendig ist, um das System in Schwingungen zu versetzen, liefert der Ausatemstrom der Lunge.
Aus- und Einatemluft
Vom mechanischen Standpunkt aus betrachtet gibt es keinen Unterschied zwischen der sauerstoffreichen eingeatmeten und der sauerstoffärmeren ausgeatmeten Luft. Auch lassen sich Klänge und Geräusche nicht nur beim Ausatmen, sondern auch beim Einatmen produzieren, wie das gelegentlich beim seufzenden Sprechen (“ja ja”) oder als gestörte Stimmgebung vorkommt. Allerdings lässt sich der Atemstrom bedeutend genauer und ökonomischer führen, wenn er von einer gewissen Höchstmenge dosiert wird, als wenn die Stimmgebung während des lebensnotwendigen Einatmens und damit in ständiger Konkurrenz zur primären Funktion erfolgt.
Uns interessiert jetzt nur die Möglichkeit, mithilfe der Kehlkopfstrukturen Klänge zu erzeugen. Dass ein großer Teil der Laute einer Sprache ohne Beteiligung der Stimme gebildet wird und dass beim Flüstern die Stimmgebung völlig unbeteiligt ist, tut zunächst nichts zur Sache.
Sphinktersystem
Auf seinem Weg von der Lunge über die Bronchien und die Luftröhre passiert der Luftstrom im Kehlkopfbereich von unten nach oben drei Engen: die echten Stimmlippen, die “falschen” Stimmlippen oder Taschenfalten und den Kehldeckel, bevor er durch Rachen, Mund und Nase entweicht. Alle drei Engebereiche haben sowohl phylogenetisch als auch ontogenetisch die Primärfunktion, die Lunge vor eintretenden Fremdkörpern zu schützen. Dabei hat das unterste Abschluss- oder Sphinktersystem, die Stimmlippen, die dem Bronchial- und Pulmonaltrakt am nächsten sind, die größte Flexibilität und Leistungskraft entwickelt. Nicht nur, weil es die letzte Möglichkeit des Verschlusses darstellt. Was durch die Stimmlippen rutscht, gerät unweigerlich in die Trachea und kann ungünstigenfalls zum Bolustod durch Ersticken führen. Aber auch für die Ausführung von kraftvollen Bewegungen zum Körper hin ist der Glottisschluss ein wichtiger Hilfsmechanismus, z.B. beim Klimmzug.
Die Kehlkopfmuskulatur
Im Verein mit diesen Primärfunktionen hat die beginnende Vokalisation bzw. Stimmgebung seit der frühen Menschheitsgeschichte durch Ausbildung eines spezifischen muskulären Apparates zu einer hohen Leistungsfähigkeit auf dem sekundären Gebiet der stimmlichen Produktion geführt. Das betrifft sowohl die innere Kehlkopfmuskulatur, die für die Feinabstimmung von Lautstärke und Tonhöhe verantwortlich ist, als auch die äußere Kehlkopfmuskulatur, die der Aufhängung des Sphinkter- / Stimmapparates zwischen Schädelbasis und Brust- / Schlüsselbein dient.
So gibt es neben Stimmlippenöffnungs- und -schließmuskeln auch Stimmlippenspanner unter der inneren Muskulatur, Kehlkopfheber- und Senkermuskeln unter den äußeren Muskeln.
Beim Anregen der Stimmlippen durch die Respirationsluft nähern sich diese einander an, wenn ein bestimmter Luftdruck erreicht und das Bernoulli-Gesetz wirksam wird.
Eigenversuch
Bei unserem kleinen Experiment mit den beiden parallel gehaltenen Blättern konnte man das gut beobachten. Blasen wir mit zu geringem Druck auf den Spalt zwischen ihnen, machen sie keinerlei Bewegung aufeinander zu. Bei zu starkem Anblasedruck entstehen durch Turbulenzen Unregelmäßigkeiten. Ist der Druck optimal, d.h. der zu bewegenden Masse adäquat, schwingen unsere Blätter relativ regelmäßig.
Schwingungsverhalten der Stimmlippen
Genauso funktioniert der Schwingungsvorgang unserer Stimmlippen, nur dass sie bedeutend flexibler und sehr komplex aufgebaut sind. Der eigentliche Stimmmuskel wird überlagert von einer Deckschicht, dem Stimmband sowie einer höchst beweglichen Schleimhautschicht. Auch ist die aerodynamische Form dieser Stimmlippen dergestalt, dass sie nicht als Ganzes zusammentreten, sondern zunächst im unteren Bereich, um dann nach oben zu weiterzuwandern, während unten bereits der Verschluss der Glottis gesprengt wird. Obendrein macht die locker aufliegende Schleimhautschicht durch ihr geringes Gewicht größtenteils gegenläufige Bewegungen zur Hauptmasse der Stimmlippen. Weil sich diese Epithelschicht am äußersten Rande der Stimmlippen befindet, sprechen wir bei diesen Bewegungen von der Randkantenverschiebung. Ist sie zu stark oder schwach ausgeprägt bzw. ganz aufgehoben, so ist die Ökonomie des gesamten Systems in Dysbalance und es kommt früher oder später zu Stimmstörungen.
Es handelt sich beim Kehlkopf, wie wir sehen, um einen hochentwickelten Apparat, dessen sekundärer Funktionskreis durch zusätzliche Spezialisierung, wie sie in der Entwicklungsgeschichte nur beim Menschen stattfand, in die Lage versetzt wurde, Klänge zu produzieren und zu modulieren.
Atemvolumina
So lange der Anblasedruck der aus der Lunge gepressten Luft ein bestimmtes Maß nicht unterschreitet, können die Stimmlippen in Schwingungen gehalten werden. Wird der Druck aus physiologischen Gründen zu gering, weil die übliche Luftmenge, die eingeatmet wurde, die Lunge wieder verlassen hat, reicht die Energie zum Anregen der Stimmlippen nicht mehr aus: der Klang bricht ab oder schwingt relativ sanft aus. Allerdings besitzen wir neben der üblichen in Ruhe bzw. ohne Anstrengung eingeatmeten Luftmenge, dem Atemzugvolumen, noch Reservemöglichkeiten.
Eigenversuch
Atme ganz normal ein und sage dann mehrmals hintereinander in abwehrendem Ton “nein! nein! nein!” ohne allzu große Emphase. Wenn der normale Impuls zum Luftholen kommt, ignoriere ihn und sprich weiter. Du wirst noch Luft haben, das “nein!” einige weitere Male auszusprechen, auch wenn es zunehmend gepresst klingen wird.
Über unser Atemzugvolumen hinaus besitzen wir zusätzliche Reservevolumina: ein größeres inspiratorisches und ein kleineres expiratorisches. Alle drei Volumina zusammen ergeben die Vitalkapazität, die Menge Luft also, die uns für alle Arten von Aktivitäten zur Verfügung steht, u.a. auch für stimmliche.
Klänge und Geräusche
Als nächstes wollen wir uns anschauen, wie Klänge und Geräusche entstehen. Bei optimalem Anblasedruck wird die geschlossene Glottis von unten aufgesprengt und es kommt kontinuierlich nach oben zu verlaufend zur Öffnung sowie zur bereits erwähnten gegenläufigen Randkantenverschiebung der Schleimhaut. Während diese im obersten Bereich ihre größte Ausdehnung erfährt, wird der untere Bereich der Stimmlippen durch den entstehenden Unterdruck erneut zusammengesaugt, so dass ein Zyklus aus Öffnung und Schließung abgeschlossen ist. Durch den aufrechterhaltenen Anblasedruck, der für den bei Öffnung entstehenden Unterdruck verantwortlich ist, sowie die elastischen Rückstellkräfte (bzw. Rückschnellkräfte) bildet sich eine Eigendynamik des Systems: Zyklus folgt auf Zyklus. Weil ein einzelner Zyklus durch das Aufsprengen der Glottis sowie anschließender abrupter Druckänderung charakterisiert ist, sprechen wir auch vom Prinzip des “Knallgenerators”. Folgen etwa 40-50 Glottissprengungen (“Knallvorgänge”) pro Sekunde aufeinander, wird das entstandene Produkt als tiefster Bass gehört. Zwar kann unser Ohr eventuell noch etwas tiefere Frequenzen wahrnehmen (taktil auf jeden Fall), der Stimmapparat jedoch ist aus mechanischen Gründen nicht in der Lage, diese zu produzieren.
Eigenversuch
Nimm ein langes Lineal und lege es so auf den Tisch, dass ein Ende darüber hinausragt. Bringe es zum Schwingen (Generationen von Schülern dürften auf diese Weise ihre Lehrer geärgert haben!). Je länger der schwebende Teil ist, desto tiefer ist der hörbare Klang, da das Lineal relativ selten pro Sekunde schwingt. Je kürzer er ist, desto höher wird der Klang, weil es nun häufiger pro Sekunde schwingt.
Natürlich hören wir nicht die schwingenden Stimmlippen 50 mal in der Sekunde, sondern die von ihnen angeregte Luft, die wir als Schall wahrnehmen. Allerdings können wir uns kaum vorstellen, wie dieser sogenannte Primärklang sich anhört, weil wir ihn niemals isoliert hören. Ein schwacher Vergleich wäre die Vorstellung, wir zupften eine isolierte Violinen- oder Gitarrensaite, also ohne den hölzernen Klangkörper.
Obertöne
Im Falle der menschlichen Stimmbildung funktionieren die anatomischen Strukturen zwischen Stimmlippen und Lippen als ein solcher Klangkörper/Ansatzrohr, in dem es zur Schalldämpfung sowie zur Resonanzbildung kommt. Zur Grundfrequenz, die einer bestimmten Tonhöhe entspricht, treten dabei quasi ganzheitliche Vielfache dieser Frequenz, die allerdings mit zunehmender Obertonreihe immer stärker gedämpft werden. Die Obertöne entstehen wahrscheinlich durch Luftverwirbelungen an den Stimmlippen