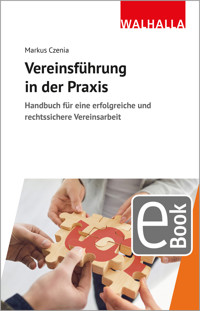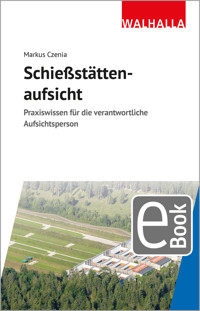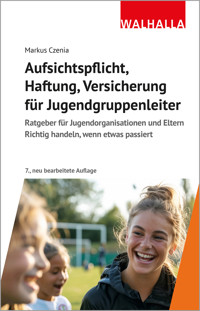
19,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Walhalla Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zeltlager, Sportunfälle, Radtouren, Aufenthalt im In- und Ausland
Jugendgruppenleiter, Jugendpfleger, Vereinsvorstände und -mitarbeiter sowie Eltern, die Verantwortung für andere übernehmen, müssen wissen:
- Welche Risiken birgt die Ausübung dieses Ehrenamts?
- Welche "Rettungsringe" schützen im Schadensfall?
- Wie verhalten sie sich im Schadensfall richtig?
- Wie haften Vorstand und Verein?
- Welche Versicherungen sind notwendig?
- Wann greift die private Haftpflicht?
- Was bedeuten die Klauseln in der Vereinsversicherung?
- Welche Haftungsrisiken gibt es? Wie lassen sie sich vermeiden?
- Welche Datenschutzrichtlinien sind zu beachten?
Das Praxishandbuch Aufsichtspflicht, Haftung, Versicherung für Jugendgruppenleiter enthält ausgewählte Rechtsprechung, hilfreiche Checklisten, Praxisbeispiele und rechtssichere Musterformulierungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
7., neu bearbeitete. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected]
Kurzbeschreibung
Zeltlager, Sportunfälle, Radtouren, Aufenthalt im In- und Ausland
Jugendgruppenleiter, Jugendpfleger, Vereinsvorstände und -mitarbeiter sowie Eltern, die Verantwortung für andere übernehmen, müssen wissen:
Welche Risiken birgt die Ausübung dieses Ehrenamts?Welche "Rettungsringe" schützen im Schadensfall?Wie verhalten sie sich im Schadensfall richtig?Wie haften Vorstand und Verein?Welche Versicherungen sind notwendig?Wann greift die private Haftpflicht?Was bedeuten die Klauseln in der Vereinsversicherung?Welche Haftungsrisiken gibt es? Wie lassen sie sich vermeiden?Welche Datenschutzrichtlinien sind zu beachten?Das Praxishandbuch Aufsichtspflicht, Haftung, Versicherung für Jugendgruppenleiter enthält ausgewählte Rechtsprechung, hilfreiche Checklisten, Praxisbeispiele und rechtssichere Musterformulierungen.
Autor
Markus Czenia , ist Dozent und Autor in den Rechtsgebieten Gemeinnützigkeitsrecht, Sport- und Waffenrecht. Unter anderem lehrt der Autor an der Europäischen Sportakademie Land Brandenburg (ESAB), dem Kommunalen Bildungswerk KBW e.V. und der LSWB – Akademie des Landesverbands der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern e.V.
Zudem ist Czenia für verschiedene Landessportbünde im Rahmen der Aus- und Fortbildung zum DOSB-Vereinsmanager tätig und Gastdozent an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Zu seinen Teilnehmern gehören insbesondere Studierende, Mitarbeitende unterschiedlicher Behörden, Steuerberater und Funktionäre von Non-Profit Organisationen.
Schnellübersicht
Vorwort
1. Aufsichtspflicht
2. Sorgfaltspflicht
3. Haftung
4. Vorschläge zur Haftungsvermeidung
5. Schutz im Schadensfall
6. Versicherung
7. Jugendschutzgesetz
8. Strafrechtliche Risiken
9. Steuern und Sozialversicherung
10. Datenschutz
11. Musterschreiben und Vorlagen
Auszüge aus referenzierten Vorschriften
Vorwort
Rechtssicherheit für Jugendgruppenleiter
Abkürzungen
Rechtssicherheit für Jugendgruppenleiter
Die Arbeit mit einer Kinder- oder Jugendgruppe ist eine anspruchsvolle, aber auch lohnenswerte und spannende Aufgabe. Ein Großteil der heute tätigen Jugendleiter hat in jungen Jahren selbst Erfahrungen als Teilnehmer einer Freizeit gemacht. In einer Welt, die sich ständig verändert und vor neuen Herausforderungen steht, sind die Jugendgruppenleiter die Leuchttürme, die jungen Menschen Orientierung, Unterstützung und Inspiration bieten.
Dieses Buch soll Ihnen als wertvoller Begleiter dienen, gefüllt mit praktischen Ratschlägen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Arbeit rechtssicher zu gestalten.
Viel Erfolg!
Markus Czenia
Abkürzungen
a. a. O. am angegebenen OrtAbs. AbsatzAGAmtsgerichtArt. ArtikelAz.AktenzeichenBBiGBerufsbildungsgesetzBGBBürgerliches GesetzbuchBFHBundesfinanzhofBGHBundesgerichtshofBMFSFJBundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und JugendBRKGBundesreisekostengesetzBSGBundessozialgerichtBT-Drs. BundestagsdrucksacheBZRGBundeszentralregistergesetzDOSBDeutscher Olympischer SportbundDSGVODatenschutz-GrundverordnungEGBGBEinführungsgesetz zum Bürgerlichen GesetzbuchEHICEuropäische KrankenversicherungskarteEStGEinkommensteuergesetze. V.eingetragener VereinFeVFahrererlaubnis-VerordnungFGFinanzgerichtFISFédération Internationale de Skii. V. m.in Verbindung mitJuSchGJugendschutzgesetzKunstUrhGKunsturheberrechtsgesetzLDOLehrdienstordnungLGLandgerichtLuftVOLuftverkehrsordnungNJWNeue Juristische WochenschriftNr.NummerOLGOberlandesgerichtOWiGOrdnungswidrigkeitengesetzPBefGPersonenbeförderungsgesetzRn.RandnummerS.SeiteSGB VIISozialgesetzbuch Siebtes Buch – Gesetzliche UnfallversicherungSGB VIIISozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und JugendhilfeSGB XSozialgesetzbuch Zehntes Buch – Sozialverwaltungsverfahren und SozialdatenschutzStGBStrafgesetzbuchStVOStraßenverkehrsordnungStVZOStraßenverkehrs-Zulassungs-OrdnungVBGVerwaltungsberufsgenossenschaftVersRVersicherungsrecht (Zeitschrift)VomVOVerfahrensordnung des Versicherungsombudsmann e. V.VVGVersicherungsvertragsgesetzZPOZivilprozessordnung1. Aufsichtspflicht
1. Grundsätze
2. Aufsichtspflichtige Personen im Verein
3. Freizeiten
4. Bedeutung
5. Umfang der Aufsichtspflicht
6. Personalauswahl
7. Minderjährige Aufsichtspersonen
8. Anwesenheit der Eltern
9. Polizeiliches Führungszeugnis
1. Grundsätze
Die Kinder- und Jugendarbeit sichert durch verschiedene Angebote den Fortbestand der Vereine. Zu den relevanten Aktivitäten zählen insbesondere die sportliche Betätigung im Verein und die Teilnahme an Freizeiten. Zur Jugendarbeit gehören immer auch Jugendleiter, Trainer und Betreuer, die sich um den Nachwuchs kümmern, Übungsstunden leiten oder während einer Freizeit auf das Wohlergehen der Teilnehmer achten.
Obwohl sich viele Vereinsmitglieder eine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen grundsätzlich vorstellen könnten, werden potenzielle Betreuer oftmals aufgrund falscher Informationen von der Aufgabe abgeschreckt. Vorschnell wird behauptet, dass man in der Nachwuchsarbeit bereits mit einem Bein im Gefängnis stünde und immer auch das Privatvermögen in Gefahr sei, sollte es zu einem Schaden kommen.
Im Folgenden räumen wir mit diesen falschen Annahmen auf und betrachten die rechtlichen Grundlagen insbesondere zur Aufsichtspflicht.
2. Aufsichtspflichtige Personen im Verein
Vereine und Jugendorganisationen setzen sich in der Regel aus verschiedenen Gruppen von Funktionsträgern zusammen, denen unterschiedliche Aufgaben zukommen. Neben dem Vorstand, der den Verein im Innen- und Außenverhältnis rechtsgeschäftlich vertritt, sind insbesondere für die internen Aufgaben im Zusammenhang mit der Nachwuchsarbeit folgende Personen mit verantwortlich:
Trainer
Übungsleiter
Jugendleiter
Helfer für das Training
Jugendgruppenleiter
Regelmäßig wird in diesem Zusammenhang von einem Betreuer gesprochen. Nachfolgend betrachten wir zunächst die Bedeutung des Begriffs nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).
Betreuer gemäß BGB
Die zentrale Norm zur Bestellung eines Betreuers findet sich in § 1816 BGB. Demnach wird ein Betreuer vom Betreuungsgericht bestellt, der geeignet ist, in dem gerichtlich angeordneten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten nach Maßgabe des § 1821 BGB rechtlich zu besorgen. Hierzu gehört insbesondere, im erforderlichen Umfang den persönlichen Kontakt mit dem Betreuten zu halten.
Bei den Betreuten im Sinne der Vorschrift handelt es sich um Volljährige, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen und daher einer Betreuung bedürfen.
Der Umfang der Betreuung wird gemäß § 1815 BGB vom Betreuungsgericht definiert. Entscheidendes Kriterium ist, inwieweit ein bestimmter Lebensbereich vom Betreuten nicht mehr selbst erledigt werden kann. Regelmäßig übernimmt ein Betreuer die Wahrnehmung der finanziellen Interessen des Betreuten.
Abgrenzung zum Verein
Die im Alltag gebräuchliche Bezeichnung „Betreuer“, mit der in der Regel die in der Jugendarbeit tätigen Vereinsmitglieder bezeichnet werden, hat mit der zuvor beschriebenen Definition im Sinne des BGB nur wenig gemeinsam.
Zur Beauftragung ist insbesondere der Vorstand und keine öffentliche Stelle zuständig. Die Satzung des Vereins kann diese Aufgabe auch einem anderen Organ (Geschäftsführer, Mitgliederversammlung) zuweisen. Es besteht somit im Unterschied zum gesetzlich geregelten Betreuer keine Vorschrift über die Übertragung einer Aufgabe innerhalb des Vereins.
Unterschiedliche Aufgaben
Betrachtet man die zuvor genannten Personen mit Blick auf ihre jeweilige Aufgabe, sind hier markante Unterschiede festzustellen.
Übungsleiter und Trainer haben in Abgrenzung zu einem Betreuer (auch Leiter genannt) die Aufgabe, den Kindern und Jugendlichen sportliche Fähigkeiten zu vermitteln. Es wird in der Regel nach einem festgelegtem Trainingsplan gearbeitet.
Die Aufgabe eines Betreuers liegt primär in der Überwachung der Gruppe, die sich teilweise auch mit sich selbst beschäftigt. Es werden zwar Rahmenvorgaben gemacht, die aber nicht mit einem strikten Trainingskonzept vergleichbar sind.
So gibt der Betreuer beispielsweise das Spielen mit Bällen frei, ohne dabei das konkrete Spiel anzuleiten und die Kinder und Jugendlichen in der jeweiligen Ballsportart zu trainieren.
3. Freizeiten
Unter Freizeiten sind Gruppenaktivitäten zu verstehen, die nicht am Wohnort der Teilnehmer stattfinden. Eine Freizeit erstreckt sich regelmäßig über mehrere Tage, wird in unterschiedlichen Formen durchgeführt und ist Teil der Jugendarbeit. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören gemäß § 11 Abs. 3 SGB VIII:
außerschulische Bildung
Jugendarbeit in Sport, Spiel und Gesundheit
arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
internationale Jugendarbeit
Kinder- und Jugenderholung
Jugendberatung
Neben der Erholung leisten Kinder- und Jugendfreizeiten einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und zum praxisorientierten Erwerb von Wissen und Sozialkompetenz im Umgang miteinander.1 Insbesondere bietet sich den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, die sich vom Alltag abgrenzen.
Freizeiten werden heutzutage von unterschiedlichen Organisationen angeboten. Neben den kirchlichen Organisationen und Jugendverbänden werden die Maßnahmen insbesondere von gemeinnützigen Vereinen, aber auch durch kommerzielle Anbieter durchgeführt.
Deutscher Bundesjugendring e. V., November 2008, Position 62
4. Bedeutung
Die Aufsichtspflicht leitet sich aus dem Erziehungsauftrag ab und ist der Personensorge zuzuordnen. Das BGB führt hierzu aus:
Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.
Die Aufsichtspflicht besteht demnach in erster Linie gegenüber Minderjährigen. Gegenüber volljährigen Personen kommt eine Aufsichtspflicht bei Vorliegen besonderer Umstände (Krankheit, geistige Behinderung) in Betracht. Adressat dieser Pflicht sind zunächst die Eltern. Die Aufsichtspflicht kann sich weiterhin auf andere Beziehungsverhältnisse erstrecken. Das BGB nennt hierzu insbesondere folgende Personen:
Adoptiveltern
Pfleger
Vormundschaften
Die Aufsichtspflicht erstreckt sich auch auf Lehrer an öffentlichen Schulen und leitet sich aus den jeweiligen Schulgesetzen der Länder ab (z. B. § 5 Abs. 1 LDO Bayern).
Ausbilder in Betrieben haben in der Regel die Aufsichtspflicht gegenüber den Auszubildenden. Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) regelt alle Parameter bezüglich der gegenseitigen Rechte und Pflichten.
Sinn und Zweck der Aufsichtspflicht sind zum einen der Schutz der Minderjährigen vor Schäden und Gefahren, zum anderen sollen auch Dritte und deren Eigentum vor einer Schädigung durch minderjährige Personen geschützt werden.2
Gemäß § 1 Abs. 1 SGB VIII hat jeder junge Mensch das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person. In der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern muss einerseits die Vermeidung von Schäden im Blick behalten werden. Andererseits sollen die Anvertrauten selbst Erfahrungen sammeln und sich entfalten und entwickeln können.
Aufsichtspflicht nach § 22 SGB VIII
Das bestehende Spannungsverhältnis zwischen der Förderung der Kinder einerseits und der Abwehr von Gefahren andererseits wird auch in § 22 Abs. 2 SGB VIII deutlich. Die Vorschrift beschreibt die Grundsätze zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Zu den Hauptaufgaben der genannten Einrichtungen gehören neben den Vorgaben des § 1 Abs. 1 SGB VIII (Recht auf Förderung und Entwicklung) die Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder.
An diesen Parametern ausgerichtet, muss den Kindern ermöglicht werden, durch eigene Erfahrungen ein Gefahrenbewusstsein spielerisch zu erlernen. Ein Übermaß an Vorsicht würde die Kinder eventuell zu stark einschränken. So bedarf es hier auch einer kompetenten Abwägung zwischen Gefahrenabwehr und Entwicklung der Kinder.
Aufsichtspflicht in der offenen Jugendarbeit
Für die offene Jugendarbeit im Sinne des § 11 SGB VIII gelten besondere Bedingungen bezüglich der Aufsichtspflicht.
Die offene Jugendarbeit ist dadurch gekennzeichnet, dass während der Öffnungszeiten ein ständiges Kommen und Gehen ohne vorherige Anmeldung stattfindet. Im Unterschied zur Übergabe der Minderjährigen durch die Sorgeberechtigten an einen Verein findet die hiermit einhergehende Übertragung der Aufsichtspflicht in der offenen Einrichtung gerade nicht statt.
Somit besteht bei einem offenen Treff oder in gleichartigen offenen Betrieben keine Aufsichtspflicht. Bereits die Tatsache, dass die anwesenden Betreuer nicht genau wissen, welche Jugendlichen sich momentan im Haus aufhalten, lässt keinen anderen Schluss zu.
Ein völlig unregulierter Raum entsteht aber nicht. Es gelten die Vorgaben zur Verkehrssicherungspflicht. Hierzu detailliert Kapitel 4.6.
Übertragung der Aufsichtspflicht
Dem Grundgedanken des § 1631 BGB folgend kann die Aufsichtspflicht von den Personensorgeberechtigten auf Dritte übertragen werden. Ein schriftlicher Vertrag ist hierzu nicht zwingend, eine mündliche Vereinbarung reicht aus. Wird die Aufsichtspflicht auf einen Erziehungsbeauftragten delegiert, darf dieser die Aufsichtspflicht nicht an eine weitere Person übertragen.
Anders stellt sich die Situation bei Übertragung der Aufsichtspflicht an einen Verein oder eine andere Institution dar. In diesem Fall darf der Verein die Pflicht beispielsweise an einen Jugendleiter oder Betreuer delegieren.
In Sportvereinen bringen die Eltern ihre Kinder zur Trainingsstätte des Vereins und holen diese nach Trainingsende wieder dort ab. Mit der „Abgabe“ des Kindes an den Verein wird die Aufsichtspflicht übertragen. Entgegen der Annahme mancher Erziehungsberechtigter besteht keine Aufsichtspflicht auf dem Hin- und Rückweg. Werden die Kinder und Jugendlichen von vereinseigenem Personal zu einem Wettkampf gefahren, gilt auch währenddessen die Aufsichtspflicht. Um eventuellen Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, ob die Aufsichtspflicht tatsächlich übertragen wurde, ist in jedem Fall eine schriftliche Vereinbarung zu empfehlen. Übungsleiter und Betreuer sollten auch immer eine Liste der zum Training angemeldeten Kindern verfügbar haben. So ist ausgeschlossen, dass ein Kind (vielleicht der Freund eines anderen Kindes) ohne vorherige Absprache mit den Eltern am Training teilnimmt.
Unbedingt erforderlich ist eine Vereinbarung mit den Eltern, dass die Kinder pünktlich zum eigentlichen Trainingsbeginn abgegeben werden. Hierdurch wird eine unübersichtliche Situation aus Kindern, die gerade die Sportstätte verlassen, und anderen Kindern, die sich auf dem Weg zum Training befinden, vermieden. Werden die Kinder beispielsweise 30 Minuten vor Trainingsbeginn abgegeben, ist regelmäßig noch kein Betreuer vor Ort, der sich der Kinder annehmen kann.
Die Grundsätze zur Übertragung der Aufsichtspflicht gelten gleichsam für Aktivitäten wie Jugendfreizeiten, Zeltlager usw. Mit der Übergabe der Minderjährigen an die jeweilige Institution oder deren Bevollmächtigten wird die Aufsichtspflicht wirksam übertragen.
Zeitliche Verschiebung
Die bei der Übertragung der Aufsichtspflicht zwischen Verein und Personensorgeberechtigten getroffenen Vereinbarungen sind für beide Seiten verbindlich. Insofern sind insbesondere festgelegte Trainingszeiten bindend. Verspätet sich das eingesetzte Personal, beginnt die Aufsichtspflicht gleichwohl zum vereinbarten Zeitpunkt. Bei einer zu erwartenden Verspätung muss der Verein demnach dafür Sorge tragen, dass eine andere Person rechtzeitig die Aufsicht übernimmt. Der Übungsleiter muss also den Verein über die Verspätung informieren. Gleiches gilt bei Ausfall des Trainings. Idealerweise informiert der Übungsleiter gleichzeitig auch die Eltern.
Festgelegte Abfahrtszeiten sind ebenso einzuhalten und verbindlich. Eltern müssen demnach nicht damit rechnen, dass bei einer zuvor vereinbarten Abfahrtszeit um 9.00 Uhr die Fahrt tatsächlich erst um 9.30 Uhr startet und während der halben Stunde keine Betreuung vor Ort ist.
Ende der Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht endet in der Regel mit dem Verlassen des Vereinsgeländes und der Übergabe der Kinder an die Personensorgeberechtigten. Besondere Problematiken entstehen dann, wenn ein Kind nicht zum vereinbarten Zeitpunkt abgeholt wird. Zunächst muss die Aufsichtsperson versuchen, die Eltern telefonisch zu kontaktieren. Eine Telefonliste mit den aktuellen Kontaktdaten der Eltern gehört wie die Teilnehmerliste unbedingt zum Rüstzeug der Übungsleiter.
Sind die Eltern nicht erreichbar, darf das Kind nicht einfach sich selbst überlassen werden. Sofern es die Zeitplanung zulässt, wartet die Betreuungsperson bis zum Eintreffen der Eltern. Ist dies nicht möglich und kann auch keine andere Aufsicht organisiert werden, muss das Kind in die Obhut der Polizei oder des Jugendamts übergeben werden. Die Eltern sind hierüber entsprechend zu informieren.
Wird das eingesetzte Aufsichtspersonal so eingeplant, dass vor und auch nach dem Training noch 10 Minuten zusätzlich zur Verfügung stehen, lassen sich derartige Probleme größtenteils vermeiden.
Einwilligung der Eltern
Im Zusammenhang mit der Einwilligung der Eltern ist darauf zu achten, dass keine Aktivitäten mit den Kindern unternommen werden, die von dieser Einwilligung nicht umfasst sind. Hier ein Beispiel:
Die Kindergruppe trifft sich am Vereinsheim, um zum geplanten Ausflug zu einer Burgruine aufzubrechen. Wie jeden Donnerstag kommt auch die kleine Jolina dazu und erzählt dem Übungsleiter, dass ihre Eltern ihr die Teilnahme am Ausflug untersagt haben und sie deshalb ziemlich traurig wäre. Dem Übungsleiter tut die kleine Jolina so leid, dass er sie mit auf den Ausflug nimmt. An der Burgruine angekommen, stolpert Jolina über einen Stein und fällt so unglücklich, dass sie sich den linken Arm bricht. Ihre Hose wird beim Sturz auch eingerissen.
Im geschilderten Fall ist der Übungsleiter vollumfänglich haftbar, da er Jolina gar nicht erst hätte mitnehmen dürfen. Liegen Anhaltspunkte für eine fehlende Einwilligung vor, ist der Leiter zur Nachfrage bei den Eltern verpflichtet. Keinesfalls darf das Kind im guten Glauben über ein Einverständnis mitgenommen werden.
Gleiches gilt für die Durchführung von alternativen Angeboten.
Die Sporthalle hat sich aufgrund sommerlicher Hitze stark aufgeheizt. Daher beschließt der Übungsleiter, statt Sport in der Halle zu treiben mit den Kindern in die Innenstadt zur Eisdiele zu gehen. Kommt es hierbei zu einem Schadensfall, haftet der Übungsleiter regelmäßig persönlich. Etwas anderes ergibt sich, wenn bereits bei der Anmeldung zum Training diese Alternative vereinbart wurde.
Es ist somit im Vorfeld wichtig, die Eltern ausführlich über das geplante Angebot zu informieren und vor allem auch die Alternativen darzustellen, falls ein Angebot ausfällt oder nicht verfügbar sein sollte.
Erfolgt keine Information, spricht man von einer Gefahrenerhöhung gegen den Willen der Eltern. Demnach ist beispielsweise Hockey ein Spiel, mit dem die Eltern im Rahmen einer Ferienfreizeit nicht rechnen müssen. Kommt es hierbei zu einem Schaden, haftet der Veranstalter auch ohne Verschulden.
Je genauer die Information an die Eltern gestaltet wird, umso geringer ist das Risiko, in eine Haftungsfalle zu tappen. Die Elterninformation sollte regelmäßig auf Vollständigkeit und Aktualität geprüft werden.
OLG Hamm, Urteil vom 21.12.1995, Az. 6 U 78/95
5. Umfang der Aufsichtspflicht
Eine gesetzliche Regelung zum Umfang der Aufsichtspflicht besteht nicht. Daraus folgt, dass sich im Gesetz auch keine Aufzählung oder Definition findet, aus der sich detailliert die Verletzung der Aufsichtspflicht ableiten ließe. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) bestimmt sich das Maß der gebotenen Aufsicht nach Alter, Eigenart und Charakter des Kindes sowie danach, was den Aufsichtspflichtigen in ihren jeweiligen Verhältnissen zugemutet werden kann.3
Das Maß der geschuldeten Aufsicht erhöht sich mit der Gefahrenträchtigkeit der jeweiligen Situation.4Hierbei ist entscheidend, was verständige Aufsichtspflichtige nach vernünftigen Anforderungen unternehmen müssen, um die Schädigung Dritter durch ein Kind zu verhindern.5
Wird einer aufsichtspflichtigen Person der Vorwurf einer Verletzung der Aufsichtspflicht gemacht, entscheiden erst die Gerichte, ob die Aufsichtspflicht tatsächlich verletzt wurde.
Es geht also im Kern darum, dass es insbesondere bei kleineren Kindern und steigender Gefahr einer höheren Intensität an Aufsicht bedarf, als es bei einer Gruppe im Alter zwischen 12 und 15 Jahren während einer Aktivität auf dem Vereinsgelände der Fall wäre. Zudem muss eine Beurteilung des Angebots auf die Gefahrenträchtigkeit erfolgen, um bestehende Risiken bewerten und entsprechende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen zu können.
Im Folgenden betrachten wir die aus der Rechtsprechung entwickelten Kernaufgaben zur Aufsichtspflicht.
Persönliche Merkmale
Für den Verein und das eingesetzte Aufsichtspersonal ist es unerlässlich, die persönlichen Merkmale der Teilnehmer zu kennen. Um sich ein möglichst detailliertes Bild von den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen zu verschaffen, können die gewünschten Informationen über einen Fragebogen erfasst werden. Auch hier empfiehlt es sich aus Gründen der Beweiskraft, die Informationen schriftlich anzufordern.
Im Fragebogen sollten körperliche Einschränkungen aufgrund von Krankheiten oder Behinderungen abgefragt werden. Die regelmäßige Einnahme von Medikamenten gehört ebenso zu den wichtigen Informationen wie bestehende Allergien.
Je nach Art des Angebots sind weitere Informationen erforderlich. Wird beispielsweise ein Schwimmtraining angeboten, muss im Vorfeld durch eine Abfrage geklärt werden, ob alle Teilnehmer bereits schwimmen können.
Örtliche Gegebenheiten
Ebenso wichtig wie die persönlichen Merkmale der Teilnehmer sind Kenntnisse über die örtlichen Gegebenheiten, um mögliche Gefahren erkennen zu können. Ein Waldlauf durch unwegsames Gelände erfordert andere Verhaltensweisen als ein Training in einer gut ausgebauten Sporthalle.
Grundsätzlich gilt: Je gefahrenträchtiger die Umstände, desto größere Anforderungen sind an die Fähigkeiten und Eigenschaften des Aufsichtsbedürftigen, insbesondere eines Kindes, zu stellen.6
Im Vorfeld eines jeden Angebots ist es somit erforderlich zu prüfen, ob die geplante Aktivität auch zu der angedachten Altersgruppe passt.
Klare Anweisungen
Zur Sicherstellung eines ordentlichen und sicheren Ablaufs bedarf es klarer Anweisung der Aufsichtspersonen. Hierzu gehören insbesondere der Hinweis auf eventuelle Gefahren und die Belehrung über die gewünschten Verhaltensweisen. Das eingesetzte Personal muss außerdem deutlich machen, welche Konsequenzen mit einer Übertretung der Anweisungen verbunden sind.
In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist besonders auf eine altersgerechte Ansprache zu achten. Werden Verbote ausgesprochen, sollten hierzu auch immer entsprechende Erläuterungen mitgeliefert werden, damit die Kinder und Jugendlichen die Sinnhaftigkeit des Verbots verstehen.
Beobachten
Die Aufsichtsperson muss das Verhalten der Gruppe aufmerksam beobachten. Unter Kindern und Jugendlichen können schnell Raufereien und Konflikte entstehen, die durch aufmerksames Personal frühzeitig aufgelöst werden können. Das Beobachten der Gruppe beinhaltet auch eine Einschätzung, ob die Gruppengröße den örtlichen Verhältnissen angemessen ist. Steht beispielsweise für ein Training ein kleinerer Raum als üblich zur Verfügung, muss die Gruppengröße entsprechend angepasst werden.
Einen gesetzlich festgelegten Betreuungsschlüssel gibt es nicht. Vielmehr ist der Vorstand in der Pflicht, für eine ausreichende, der Gruppenstärke und der jeweiligen Aktivität angepasste Betreuung zu sorgen.
Zudem muss auch das eingesetzte Personal realistisch einschätzen, wie viele Minderjährige sicher betreut werden können. Die Anzahl ist insbesondere abhängig vom Alter, den Fähigkeiten der Minderjährigen, den örtlichen Umständen und der Erfahrung des Personals.
Überwachen
Die Überwachung der Aufsichtsbedürftigen ist eine zentrale Aufgabe der Aufsichtspflicht. Entgegen der landläufigen Meinung ist keine ständige Anwesenheit der Aufsichtsperson erforderlich. So hat beispielsweise der BGH festgestellt, dass Kinder im Alter von fast 5 ½ Jahren eine gewisse Zeit ohne unmittelbare Einwirkungsmöglichkeit und Aufsicht gelassen werden können.7 Der den Kindern zugestandene Freiraum entbindet jedoch in dieser Altersgruppe nicht von einer regelmäßigen Kontrolle in kurzen Zeitabständen.
Je nach Altersstufe ist eine unterschiedliche Intensität zur Beaufsichtigung erforderlich. Besteht die Gruppe aus älteren Kindern oder Jugendlichen, ist eine permanente Beaufsichtigung nicht erforderlich. Grundsätzlich sind bereits bei Kindern im Alter ab sieben Jahren weder eine Überwachung „auf Schritt und Tritt“ noch eine regelmäßige Kontrolle in kurzen Zeitabständen erforderlich. Demnach muss Kindern in diesem Alter, wenn sie normal entwickelt sind, das Spielen im Freien auch ohne Aufsicht in einem räumlichen Bereich gestattet sein, der den Eltern oder analog der Aufsichtsperson kein sofortiges Eingreifen ermöglicht. Zum Spiel der Kinder gehört es, Neuland zu entdecken und zu „erobern“.8
Verhalten bei Regelverstößen
In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen kommt es regelmäßig vor, dass sich ein Kind auch nach mehrmaliger Ermahnung nicht an die vereinbarten Regeln hält.
Übungsleiter und Betreuer müssen jederzeit in der Lage sein, bei Fehlverhalten einzugreifen und die Regeln durchzusetzen. Auch hierbei gilt als oberste Prämisse, dass die Ansprache dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder Jugendlichen angemessen erfolgt. Ebenso wichtig ist, dass der Verein bzw. seine Betreuer mit einer Stimme sprechen und gleiche Verstöße mit gleichen Sanktionen belegt werden, unabhängig davon, welcher Betreuer gerade die Gruppe leitet.
Als Sanktionen kommen verschiedene Maßnahmen in Betracht. Eine Ermahnung stellt die erste Stufe dar. Als nächste Stufe kann ein Einzelgespräch mit dem betreffenden Kind hilfreich sein. Sind diese Maßnahmen nicht von Erfolg gekrönt, kann das Kind von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden. Auch ein Elterngespräch kann eine sinnvolle Maßnahme sein. Hierbei gilt es zu bedenken, dass hierdurch leicht ein Vertrauensverhältnis zum Trainer oder Betreuer gestört werden kann. In letzter Konsequenz kann der dauerhafte Ausschluss des Kindes vom Training beschlossen werden.
Keinesfalls dürfen Sanktionen ausgesprochen werden, die nicht mit dem Gedanken der gewaltfreien Erziehung im Sinne des § 1631 Abs. 2 BGB vereinbar sind. Demnach darf ein Kind nicht vor der Gruppe durch schamhaftes „In-die-EckeStellen“ vorgeführt werden. Eine Sanktion muss immer auch einen erzieherischen Aspekt beinhalten.
Sanktionen auszusprechen und hierbei das richtige Maß zu finden, bedarf einer gewissen Erfahrung, und auch Fingerspitzengefühl ist gefragt. Einerseits sollen Strafen nicht inflationär verhängt werden, andererseits ist die Einhaltung vereinbarter Regeln wichtig.
BGH in NJW 1984, S. 2574
4BGH, Urteil vom 19.01.2021, Az. VI ZR 194/18
5Ebd.
6OLG Hamm, Urteil vom 09.06.2000, Az. 9 U 226/99
7BGH, Urteil vom 19.03.1957, Az. VI ZR 29/56
8BGH, Urteil vom 20.03.2012, Az. VI ZR 3/11
6. Personalauswahl
Für den Verein besteht im Zusammenhang mit der Aufsichtspflicht ein Haftungsrisiko nach §§ 31, 831 BGB, wenn das eingesetzte Personal nicht sorgfältig ausgesucht wurde. Der Vorstand ist verpflichtet, die Geschäfte des Vereins dergestalt zu führen, dass hierdurch keine Schäden und somit Schadensersatzansprüche entstehen. Die Auswahl muss im Hinblick auf die fachliche sowie menschliche Eignung erfolgen. Auswahlkriterien sind hierbei insbesondere die geistige und charakterliche Eignung, Erfahrungen als Leitung und das Verantwortungsbewusstsein.
Die direkte Ansprache von Mitgliedern bringt erfahrungsgemäß den größten Erfolg, im Unterschied zu einer Rundmail, in der abgefragt wird, wer sich denn gerne in der Jugendarbeit engagieren möchte.
Im Gespräch können Aufgaben detailliert erläutert und alle Fragen direkt beantwortet werden. In vielen Fällen schlummert erhebliches Potenzial im Verein, das durch gezielte Kommunikation entfaltet werden kann.
Personen, die bereits durch Unpünktlichkeit, unbeherrschtes Auftreten oder in anderer Art und Weise negativ aufgefallen sind, sollten nicht mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen beauftragt werden.
Umgang mit Lebensmitteln
Regelmäßig geht mit der Betreuung einer Jugendgruppe auch die Verpflegung der Minderjährigen in den Verantwortungsbereich des Betreuers über. So werden in einem Zeltlager die Mahlzeiten überwiegend von den Aufsichtspflichtigen zubereitet.
Das gemeinsame Kochen vermittelt den Kindern und Jugendlichen unter anderem ein Bewusstsein für den sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln und Ressourcen.
Die gemeinsam von der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V., dem Deutschen Caritasverband e. V. und der Diakonie Deutschland – Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. herausgegebene Leitlinie „Wenn in sozialen Einrichtungen und Diensten gekocht wird“ beschreibt im Kapitel G die unterschiedlichen Szenarien für ein gemeinschaftliches Kochen.9
Betreuer, die während einer Veranstaltung mit dem Kochen befasst sind, sollten demnach an einer Hygienebelehrung teilnehmen. In einigen Bundesländern ist diese Belehrung verpflichtend.
Personenbeförderung
Mit einer Jugendfreizeit, einem Trainingslager oder sonstigen auswärtigen Veranstaltungen ist immer auch die Beförderung von Personen verbunden. Der Vorstand ist verpflichtet, das eingesetzte Personal zur Personenbeförderung sorgfältig auszuwählen. Wird an dieser Stelle nachlässig gehandelt, droht im schlimmsten Fall eine Haftung aus § 831 BGB.
Die Personenbeförderung ist eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe. Insofern sollten nur als besonders zuverlässig anzusehende Mitglieder damit betraut werden. Bei der Auswahl empfiehlt es sich, die Regelungen zur gewerblichen Personenbeförderung nach § 48 FeV zu beachten:
gültige Fahrerlaubnis
über 21 Jahre alt
mindestens zwei Jahre im Besitz der Fahrerlaubnis
körperliche und geistige Eignung
Zu beachten sind immer die jeweiligen Bedingungen zur Kfz-Versicherung. Im Antragsverlauf ist in der Regel der jüngste Fahrer anzugeben. Wurde hier beispielsweise 21 Jahre angegeben und es fährt ein 20-Jähriger, erlischt im schlimmsten Fall der Versicherungsschutz.
Nach § 1 PBefG unterliegt die entgeltliche oder geschäftsmäßige Beförderung von Personen der Genehmigung. Die Vorschrift enthält jedoch eine für Vereine wichtige Ausnahme: Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 PBefG werden keine Genehmigung und kein Personenbeförderungsschein benötigt, wenn
die Beförderung unentgeltlich erfolgt oder
das Gesamtentgelt je Kilometer zurückgelegter Strecke den in § 5 Abs. 2 Satz 1 BRKG genannten Betrag nicht übersteigt.
Somit ist darauf zu achten, dass die anfallenden Fahrtkosten umgelegt nicht mehr als 30 Cent/Kilometer (bestehendes dienstliches Interesse, sonst 20 Cent), höchstens jedoch 130 Euro betragen und entsprechend kein wirtschaftlicher Vorteil mit der Personenbeförderung erzielt wird. Werden die Beträge überschritten, unterliegt die Beförderung der Genehmigung und die Fahrer benötigen einen Personenbeförderungsschein.
Stehen keine eigenen Fahrzeuge zur Verfügung und wird die Durchführung der Fahrt an ein Unternehmen vergeben, benötigt der Verein keinerlei Genehmigungen. Um Unklarheiten zu vermeiden, sollte in den Anmeldeunterlagen kenntlich gemacht werden, dass die Beförderung nicht durch den Verein, sondern zum Beispiel durch ein Busunternehmen durchgeführt wird.
Möglichkeiten zur Qualifizierung
Die Sportbünde und -verbände bieten speziell auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen abgestimmte Qualifikationen an (z. B. Jugendleitercard, Jugendbasislizenz). Verpflichtend sind diese Qualifikationen nicht. Mit Blick auf eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit sind diese Lehrgänge aber durchaus sinnvoll und zu empfehlen. Insbesondere die Übungsleiter-C-Ausbildung ist für den Verein interessant. Diese Qualifikation nach DOSB-Richtlinie berechtigt den Verein zur Beantragung von Zuschüssen zu den ausgezahlten Honoraren der Übungsleiter. In der Regel richtet sich die Zuschusshöhe nach der Anzahl der im Verein vorhandenen Lizenzen pro 100 Mitglieder und der Jugendquote. Detaillierte Auskunft hierzu erteilen die jeweiligen Landessportbünde.
Die DOSB-Lizenzen gelten regelmäßig vier Jahre. Eine Verlängerung erfolgt durch den Nachweis von Fortbildungen. So wird sichergestellt, dass die Lizenzinhaber ihr Wissen immer aktuell halten.
Um Mitglieder für die Ausbildung zu begeistern, kann der Verein die Kosten für die Lehrgänge im Rahmen der Aus- und Fortbildung übernehmen. Letztendlich trägt gut geschultes Personal zur positiven Außendarstellung des Vereins bei, und das Geld ist somit eine gute Investition in die Zukunft des Vereins.
Ausbildung zum Ersthelfer
Die eingesetzten Übungsleiter und Betreuer sollten über einen Nachweis der Ausbildung in Erster Hilfe verfügen, der nicht älter als zwei Jahre ist. Regelmäßiges Auffrischen der Kenntnisse stellt sicher, dass bei einem Unfall die richtigen Maßnahmen ergriffen werden können. Für die Qualifikationslehrgänge des DOSB ist ein gültiger Erste-Hilfe-Nachweis eine der Zulassungsvoraussetzungen.
Grundsätzlich ist zu empfehlen, auch andere im Verein tätige Personen in Erste Hilfe schulen zu lassen. Denn Unfälle passieren nicht nur während des Trainings, sondern auch in anderen Bereichen des Vereins (Arbeitseinsatz, Grünpflege etc.).
Wenn in sozialen Einrichtungen gekocht wird. Lambertus Verlag 2022
7. Minderjährige Aufsichtspersonen
Im Verein können auch Minderjährige als Aufsichtspersonen eingesetzt werden. Der Vorstand hat dafür Sorge zu tragen, dass die ausgewählten Jugendlichen in der Lage sind, die ihnen übertragene Aufgabe verantwortungsbewusst und gewissenhaft auszuführen. Bevor ein Minderjähriger als Betreuer eingesetzt wird, bedarf es der Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Aus Gründen der Beweissicherung ist hierzu eine schriftliche Einverständniserklärung zu empfehlen.
Die neu mit der Aufgabe betrauten jungen Betreuer sollten nicht sofort allein eine Gruppe übertragen bekommen. Vielmehr empfiehlt es sich, die Jugendlichen zunächst als Helfer zu erproben. So können die Probanden langsam an die Aufgabe herangeführt werden und wertvolle Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern sammeln. Nach dieser Probezeit kann zum Beispiel zwei Jugendlichen als Team die eigenverantwortliche Gruppenleitung übertragen werden. Die Arbeit zu zweit bietet gegenseitige Sicherheit und erleichtert den Einstieg in die Vereinsarbeit.
8. Anwesenheit der Eltern
Sind die Eltern während eines Trainings anwesend, stellt sich in der Praxis immer wieder die Frage, ob die Personensorgeberechtigten in dem Fall selbst die Aufsichtspflicht über ihre Kinder haben.
Die Lösung richtet sich danach, wo sich die Eltern während des Trainings befinden und welchen Einfluss sie auf ihr Kind nehmen können.
Demnach besteht keine eigene Aufsichtspflicht beim Aufenthalt im Zuschauerbereich. Gleiches gilt, wenn ein Elternteil als Helfer für die gastronomische Verpflegung eingesetzt wird.
In jedem Fall ist aber eine klare Absprache mit den Eltern empfehlenswert, um insbesondere „übereifrigen“ Eltern rechtzeitig den Wind aus den Segeln zu nehmen, um so einen störungsfreien Trainingsbetrieb sicherzustellen.
9. Polizeiliches Führungszeugnis
Mit Beschluss vom 22.12.2011 hat der Bundestag das Bundeskinderschutzgesetz als Erweiterung des bestehenden Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) beschlossen. Der neu eingeführte § 72a SGB VIII regelt nunmehr den Tätigkeitsausschluss von einschlägig vorbestraften Personen durch Einsichtnahme in das Führungszeugnis. Er richtet sich an den öffentlichen Träger der Jugendhilfe. Für einen Verein ergibt sich hieraus zunächst keine Pflicht, sich ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen zu lassen.
Je nach Bundesland bestehen jedoch Vereinbarungen zwischen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe und Trägern der freien Jugendhilfe (Sportjugenden der Sportbünde, Jugendorganisationen der Landesfachverbände usw.). Nach diesen Vereinbarungen stellt der Träger der freien Jugendhilfe sicher, dass er keine Personen zur Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt, die rechtskräftig wegen einer in § 72a Abs. 1 SGB VIII genannten Straftat verurteilt worden sind. Hieraus besteht für den Verein die Pflicht, Einsichtnahme in ein erweitertes Führungszeugnis zu verlangen. Entscheidend ist, ob eine pädagogische Tätigkeit vorliegt. Zudem kommt es auf Art, Intensität und Dauer der Tätigkeit an.
Zur Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses benötigt der zukünftige Übungsleiter eine Bestätigung des Vereins. Hierzu kann das nachfolgende Formulierungsbeispiel verwendet werden:
Hiermit wird bestätigt, dass der Verein ……….. entsprechend § 72a SGB VIII die persönliche Eignung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Zwecke der Betreuung von Minderjährigen anhand eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG überprüft. Herr/Frau ……….., geboren am ………. , ist hiermit aufgefordert, ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a Abs. 1 Nr. 2a BZRG vorzulegen.
Hauptamtlich in der Jugendarbeit tätige Mitarbeiter sind nach § 72a SGB VII verpflichtet, ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a BZRG vorzulegen.
2. Sorgfaltspflicht
1. Rahmenbedingungen
2. Inhalt der Sorgfaltspflicht
3. Unfallverhütung beim Sport
1. Rahmenbedingungen
Aufsichtspflicht und Sorgfaltspflicht sind untrennbar mit der Aufgabe eines Übungsleiters verbunden. Die Sorgfaltspflichten sind insbesondere bei der sportlichen Betätigung von Bedeutung und bestimmen sich auch danach, ob der Übungsleiter ehrenamtlich eine dem Gemeinwohl dienende Tätigkeit entfaltet. Bei einem hauptberuflich tätigen Trainer wird aufgrund seiner Fachkenntnisse daher ein anderer Maßstab anzulegen sein. Denn wo es um die Erkennbarkeit von Gefahren geht, muss jedermann auch sein etwaiges Sonderwissen gegen sich gelten lassen.10
Die zu berücksichtigenden Kriterien sind weiterhin:
Verhaltensregeln der Sportverbände
geistig-sittlicher Reifegrad der Jugendlichen
zeitliche sowie örtliche Gegebenheiten
Insbesondere die Vorgaben durch die Verhaltensregeln der Sportverbände bieten wichtige Anhaltspunkte, welche sichernden Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen nach der allgemeinen Lebenserfahrung notwendig erscheinen.11
Art und Maß der anzuwendenden Sorgfalt bestimmen sich gemäß BGH nach den Anforderungen, die bei objektiver Betrachtung der Gefahrenlage im Voraus an einen besonnenen und gewissenhaften Menschen in der konkreten Lage und sozialen Rolle des Handelnden zu stellen sind.12
Im Zusammenhang mit der geistig-sittlichen Reife der Kinder und Jugendlichen ist darauf abzustellen, wie deren bisheriges Verhalten im Training war. Haben sich die Teilnehmer bisher immer regelkonform verhalten und die Anweisungen des Übungsleiters befolgt? Hieraus ergibt sich ein Gesamteindruck, der dem Übungsleiter eine Einschätzung über das Verantwortungsbewusstsein seiner Gruppe ermöglicht.
Um eine mögliche Verletzung der Sorgfaltspflichten beurteilen zu können, müssen alle rechtlich relevanten Belange unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls abgewogen werden. Wie bereits bei der Aufsichtspflicht besteht auch für die Sorgfaltspflicht keine gesetzliche Definition. Der konkrete Umfang lässt sich demnach nur aus den von der Rechtsprechung und aus der Praxis abgeleiteten Grundsätzen bestimmen.
Wessels/Beulke/Satzger (2017): Strafrecht Allgemeiner Teil, C. F. Müller, Rn. 944
11OLG Hamburg, Urteil vom 28.04.2015, Az. 1 Rev 13/15
12BGH, Urteil vom 19.04.2000, Az. 3 StR 442/99
2. Inhalt der Sorgfaltspflicht
Zentrale Aufgabe der Sorgfaltspflicht ist die Vermeidung von voraussehbaren Schäden im Trainingsbetrieb. Die Elemente der Sorgfaltspflicht (Vorhersehbarkeit und Vermeidbarkeit) hängen vielfach voneinander ab. Die Sorgfaltspflicht, fremde Rechtsgüter nicht zu beeinträchtigen, kann beispielsweise nur aus der Erkennbarkeit eines Risikos entstehen.13
Konkret lässt sich die Sorgfaltspflicht folgendermaßen skizzieren:
dafür Sorge tragen, dass sich Räume und Geräte in gebrauchsfähigem und sicherem Zustand befinden
sicherer Auf- und Abbau von Sportgeräten
Einhaltung der Hallenordnung
Hinweis auf Gefahrenquellen
Erteilen klarer Anweisungen
Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten
Hilfestellung und Sicherung im Training
Wie wichtig die Einhaltung der Sorgfaltspflicht durch den Übungsleiter ist, zeigt sich an einem Fall, den das AG Bonn zu verhandeln hatte.
Während eines Trainings am Barren stürzte ein Mädchen aus der Gruppe der 7- bis 8-Jährigen und verletzte sich hierbei erheblich. Das Mädchen brach sich den rechten Arm an Elle, Speiche und Oberarmknochen und der rechte Oberarm sprang aus der Gelenkpfanne.
Nach Auffassung des Gerichts ereignete sich der Unfall deshalb, weil die Übungsleiterin die Kinder ohne Sicherung turnen ließ und somit ihre Sorgfaltspflicht verletzte. Die Übungsleiterin hat schuldhaft und fahrlässig gehandelt, da sie die Gefahren hätte erkennen müssen. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Unfall sich bei ordnungsgemäßer Sicherung des Mädchens während der Turnübung nicht ereignet hätte.14
OLG Hamburg, Urteil vom 28.04.2015, Az. 1 Rev 13/15
14AG Bonn, Urteil vom 08.03.2006, Az. 11 C 478/05
3. Unfallverhütung beim Sport
Mit gezielten Maßnahmen können Vorstand und Personal dafür sorgen, dass ein Unfall gar nicht erst passiert und somit auch kein Anspruch auf Schadensersatz entsteht. Welche Maßnahmen im Einzelnen zu treffen sind, richtet sich nach dem jeweiligen Angebot des Vereins. Ein Sportverein trägt andere Risiken als beispielsweise ein Schachverein.
Die folgenden Maßnahmen können sportartübergreifend zur Unfallverhütung und zur Vermeidung von Verletzungen beitragen:
Muskeln, Gelenke und auch der Kreislauf sollten vor einer sportlichen Anstrengung durch ein entsprechendes Aufwärmprogramm auf die bevorstehende Belastung vorbereitet werden.
Vor Beginn der Übung wird mit einem Blick auf die Schuhe der Kinder geprüft, ob diese intakt sind. Bei der Gelegenheit kann auch überprüft werden, ob die Schuhe entsprechend geschnürt sind, um das Stolpern über einen losen Schnürsenkel zu verhindern.
Manche Sportarten benötigen spezielle Ausrüstungsgegenstände (Football, Hockey etc.). Vor Trainingsbeginn ist auf das korrekte Anlegen der Schutzausrüstung und Protektoren zu achten.
Schmuck, lange Ketten und Uhren sollten abgelegt werden. Besonders Uhren bergen bei plötzlichen Armbewegungen ein hohes Verletzungsrisiko für andere Teilnehmer.
Lange Haare werden idealerweise mit einem Haarband fixiert.
Hat sich ein Unfall ereignet, ist oberstes Gebot, Ruhe zu bewahren. Nach der Erstversorgung ist der Notruf nach dem Prinzip der zwei „W“ abzusetzen.
Wo ist das Ereignis?
2.Warten auf Rückfragen
Die ursprüngliche Regelung der 5-W-Fragen wurde im Zuge der Vereinfachung für den Anrufer durch die 2-W-Methode ersetzt.
Die Art und die Reihenfolge der vorzunehmenden Maßnahmen zur Erstversorgung richten sich immer nach der konkreten Situation und dem Grad der Verletzungen. Grundsätzlich muss sich der Übungsleiter einen Überblick über das Unfallgeschehen verschaffen und die Unfallstelle absichern. Die Eigensicherung ist hierbei unbedingt zu beachten.
3. Haftung
1. Definition
2. Haftung des Aufsichtspflichtigen
3. Beispiel aus der Rechtsprechung
4. Besondere Sachverhalte
5. Keine Verletzung der Aufsichtspflicht
6. Verkehrssicherungspflicht
7. Haftung für Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen
8. Haftung von Sportlern untereinander
9. Haftung aus Vertrag
10. Einzelfälle zu Haftungsfragen
11. Haftung von Vereinsmitgliedern
12. Haftung der Organe
13. Haftung gegenüber der GEMA
1. Definition
Unter dem Begriff „Haftung“ ist die Verpflichtung zu verstehen, für einen verursachten Schaden einzustehen. Die Grundlage der Haftung bildet ein Dualismus aus dem Recht der Vertragsverletzung und dem Recht der unerlaubten Handlung (Delikt).
Wird das Rechtsgut eines anderen schuldhaft verletzt und entsteht dem Dritten hierdurch ein Schaden, resultiert daraus ein Anspruch auf Schadensersatz. In § 194 Abs. 1