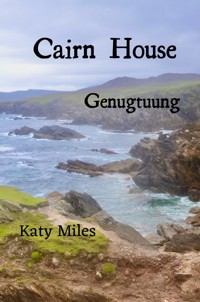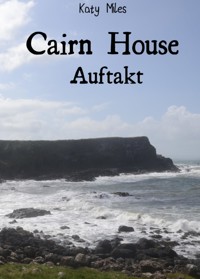
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
England 1815: Charlotte Bentley ist die Lachnummer der Saison: Gewandet in alte Kleider und riesige Hauben ihrer Großmutter hat sich in London ihr Ruf als Vogelscheuche und alte Jungfer manifestiert. Zudem hält sie mit ihrer Meinung zu Politik und Wissenschaft nicht hinterm Berg, was die feine Gesellschaft an jungen Damen so gar nicht sehen will. Nur in Cairn House, dem Landsitz der Familie in Cornwall, fühlt Charlie sich wohl. Hier, am äußersten Rand der Zivilisation, mag jeder sie so, wie sie ist! Und - sie kann ungestört ihren beiden Lieblingsbeschäftigungen nachgehen: dem Klavierspielen und dem Reiten. Doch leider bleibt der Sommer nicht so geruhsam, wie Charlie und ihr kleiner Bruder Grenny sich das ausgemalt haben: Ihr älterer Bruder George versucht, sich das Leben zu nehmen. Verwalter Langston veruntreut Gelder. Charlie wird gebeten, als Solistin in London aufzutreten. Und zu allem Überfluss organisiert George seinen Kameraden Henry Campbell, der Charlie bei der Verwaltung von Cairn House unterstützen soll. Das Chaos ist vorprogrammiert, doch gleichzeitig entdeckt Charlie, dass sie es gar nicht nötig hat, sich hinter ihrer Verkleidung zu verstecken. Ein Buch über eine starke Frau.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 705
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katy Miles
Cairn House - Auftakt
Cairn House 1
Katy Miles
Cairn House
Auftakt
Roman
Prolog, September 1799
Barfuß und in einem weißen Nachthemd tapste die Kleine zur Tür, bedacht darauf, keinen Lärm zu machen. Lange blonde Haare fielen ihr über den Rücken und sie wirkte in dem bauschigen, weißen Nachthemdchen dürr und verloren. Ihr Ziel war klar, als sie sich streckte, um die Türklinke zu erreichen. Auf dem Korridor wandte das Mädchen sich nach rechts, um geräuschlos über den mit dicken Teppichen belegten Boden zu huschen, auf den die ersten Sonnenstrahlen des Tages durch das Fenster am Ende des Ganges kleine Kringel malten. Der Bodenbelag verschluckte jegliches Geräusch, sodass der kleine Ausreißer schließlich ungesehen das Treppenhaus erreichte, das seinem Ziel am nächsten lag. Leise schlich die Vierjährige die Stufen hinunter, bis zu dem ersehnten Zimmer. Mist, bestimmt kam sie nicht rein! Konzentriert biss sie sich auf die Lippen und streckte sich, so gut sie konnte nach oben. Auf Zehenspitzen erwischte sie die Klinke, die an diesem Raum noch weiter oben angebracht war als an den Schlafräumen, stemmte den Doppelflügel der schweren Holztüre mit all ihrer Kraft auf und ließ ihn hinter sich schnell wieder ins Schloss fallen.
Als sie sich nun umdrehte, strahlten ihre Augen auf! Allein! Allein und endlich dort, wo sie normalerweise nur geduldete Zuschauerin war und mit einer Puppe in die Ecke gesetzt wurde, damit sie sich ruhig verhielt. Dabei war sie auf jede Erklärung der Lehrerin begierig und konnte nicht verstehen, weshalb ihre Schwestern sich gegen jede Stunde sträubten.
Langsam ging sie hinüber. Vor dem Instrument blieb sie schließlich stehen. Sacht strich ihr kleiner Zeigefinger über das Holz, während sie die Tasten betrachtete. Vorsichtig, fast ehrfürchtig, schlug sie einen Ton an. Sie wusste, dass es das C war, denn die Lehrerin hatte es oft genug erklärt. Louisa und Rose hatten nur einfach keine Lust zuzuhören, geschweige denn das Klavierspiel zu erlernen.
Das Mädchen schob den Klavierhocker ein Stück näher an das ersehnte Instrument heran, um hinaufzuklettern. Zart schlug sie die Tasten an. Himmlisch, sonst hatte sie stets nur zusehen dürfen! Sie verstand nicht, dass Rose sich die Reihenfolge und das Muster der Tasten nicht merken konnte. Nur in dieser Abfolge ergaben die Töne doch die Melodie, die sie spielen wollte! Es war einfach nur logisch!
Aber schon nach kurzer Zeit verwandelte sich ihre Freude in Ärger und schließlich in Wut. Ihre Finger waren zu kurz! Sie konnte das nicht so spielen, wie es klingen sollte, denn sie musste die Finger hüpfen lassen. Es musste anders klingen, gebunden und weich…
Erste Tränen rannen über ihre Wangen, sodass sie fürchterlich erschrak, als eine Hand sich auf ihre Schulter legte. Ertappt nahm sie die Finger von der Tastatur und drehte sich um. Hinter ihr stand ihre Mutter und musterte das Mädchen eindringlich. Sobald sie die Tränenspuren auf den Wangen ihrer Jüngsten entdeckte, nahm sie sie hoch, glitt selbst auf den Klavierhocker und schloss ihre Tochter in eine tröstende Umarmung.
„Es klappt nicht, Mama!“, weinte das Mädchen an die Schulter der Mutter. „Die Finger sind zu kurz! Ich muss sie hüpfen lassen und kann die Töne nicht binden, wie es Mrs. Carpenter immer von Louisa hören will.“ Enttäuscht von sich selbst zog sie die Nase schniefend hoch. Mutters Hand strich liebevoll über ihren Kopf.
„Das kann dir mit deinen kleinen Händen noch gar nicht gelingen, Charlie! Aber du hast die Melodie fehlerfrei gespielt, die Notenwerte richtig ausgehalten und deshalb war das ganz erstaunlich gut.“ Sie drehte sich so, dass sie ihrer Tochter ins Gesicht sehen konnte. „Soll ich Mrs. Carpenter bitten, dir auch Unterricht zu geben, Charlotte? Du bist zwar noch sehr jung, aber wenn dich das glücklich machen würde…“ Die Tränen versiegten auf der Stelle, als das Mädchen der Mutter ernsthaft zunickte. Da war ein unsichtbares Band zwischen ihr und den Tönen, eine Freundschaft und Sehnsucht - und Mama hatte das gesehen!
Die Mutter lächelte, stand mit der Kleinen auf dem Arm auf und meinte: „Dann wollen wir mal nach oben gehen, dich anziehen und dieses Vogelnest auf deinem Kopf durchbürsten. Nächstes Mal musst du dich nicht mehr in aller Frühe in den Musikraum schleichen! Du bekommst hier deine festen Übungszeiten wie die anderen auch.“
Und sie hatte Wort gehalten! Nach zwei Jahren hatte Mrs. Carpenter zerknirscht erklärt, diesem Kind nicht genug beibringen zu können, sodass Lady Emilia gezwungen war, sich nach einem geeigneten Klavierlehrer umzusehen. Dieser kam in Gestalt des alten Mr. Pottingfield nach Cairn House, der sich mit ganzem Herzen Charlies technischer Ausbildung am Instrument widmete. Sie übte Tonleitern, bis ihre Finger wund waren und transponierte kleine Übungen in jegliche Tonart – am Ende hatte sie das Gefühl, diese schlafend im Kopfstand noch spielen zu können. Drei Jahre blieb der Lehrer bei der Familie, begleitete sie auch nach London, nach Chichester oder Elming Park auf die anderen Anwesen. Als Charlie neun Jahre alt war, stellte er sie in London Maestro Lorenzo Manzini vor, einem italienischen Pianisten, der nach England übersiedelt war. Zunächst weigerte sich dieser, sie überhaupt vorspielen zu lassen, da er keine neuen Schüler mehr aufnehmen wollte. Doch der alte Mr. Pottingfield bearbeitete den begnadeten Musiker so lange, bis er bereit war die Neunjährige anzuhören.
Von diesem Tag an begleitete Maestro Lorenzo ihre musikalische Ausbildung: Charlie erhielt ihren Unterricht, sobald sie sich in London aufhielt. Dann wurde kritisiert, verbessert und geübt, – bis der Maestro wieder zufrieden war und Charlie mit neuen Musikstücken versorgte.
Und glücklich war Charlie nur, wenn sie Klavier spielte.
Oder auf einem Pferderücken saß, aber dafür zeigte der Maestro kein Verständnis.
Quatre-Bras, Belgien, 16. Juni 1815
Ihm brach der Schweiß aus. Gefühlt aus jeder verdammten Pore. Am Morgen hatten sie Wellingtons Befehl erhalten, die Truppen der niederländisch-nassauischen Division unter Bijleveld im Wald bei Quatre-Bras zu verstärken. Augenblicklich war ihnen klar gewesen, dass es heute einen entscheidenden Vorstoß Napoleons geben würde. George Bentley blickte nach rechts zu seinem Kameraden Henry Campbell hinüber. Dieser saß auf seinem Rappen, die Pistole und sein Nothardt-Gewehr geladen in der Satteltasche, den Säbel gezückt. Neben ihm sein Reitknecht Sam in selber Manier. Nervös tastete er nach seiner eigenen Brown-Bess und vergewisserte sich, dass sie geladen und griffbereit war. Über dem gesamten Waldstück hing die Nervosität dick und zäh. Wie Nebelschwaden waberten Angst und Hoffnung, Konzentration und Anspannung zwischen den Stämmen der Bäume hindurch und wanden sich um die wartenden Reiter. Hüllten sie ein und drohten, sie zu verschlucken! Der erste Schweißtropfen lief dem jungen Kavalleristen entlang des Rückgrats hinunter, der ihm gleichzeitig eine Gänsehaut verursachte. Er wollte nicht noch einmal töten! Wollte nicht noch einmal in tote Augen starren und weitere Schuldgefühle anhäufen.
Doch als Somerset den Befehl zum Vorrücken gab, sah er keine Alternative: Er musste im Truppenverband mit vorwärts. Zunächst hörte er nur, dass sie sich dem Kampfgeschehen näherten. Schreie, Schüsse, das Klirren der Zaumzeuge, das Aufeinandertreffen von Stahl…. Die Geräusche explodierten in seinem Kopf, hallten, wurden immer lauter und verdrängten alles andere. Und dann – waren sie mittendrin.
Neben ihm knallten die Schüsse, sein Sichtfeld wegen des Rauchs eingeschränkt… George agierte und reagierte, kämpfte erbittert gegen die immer nachdrücklicher vordrängenden Franzosen, die sich zu Fuß Meter um Meter näherkämpften. Sekunden wurden zu Minuten, Minuten zu Stunden. Wie lange sie die Säbel geschwungen, die Waffen geladen und nachgeladen hatten, konnte er nicht sagen, aber irgendwann begannen sie, an Boden zu verlieren. Das Haar klebte an seiner Stirn, Blutspritzer fremder Soldaten zierten seine Stiefel, sein Arm fühlte sich lahm an. Aber er wusste, er durfte nicht nachlassen! Nicht nachlassen, weiterkämpfen! Er fühlte Henrys beruhigende Gegenwart neben sich: gelassen, überlegt, zuverlässig!
Oh Gott, wieviele Franzosen hatte er nun auf dem Gewissen? Wieviele Frauen zu Witwen gemacht? Seine Stute Tulip folgte jedem Schenkeldruck, ging rückwärts, hielt stoisch aus, auch wenn er selbst am liebsten die Flucht ergriffen hätte. Ihr blindes Vertrauen rührte ihn und gab ihm selbst wieder Mut zum Durchhalten. Ununterbrochen ratterte sein Hirn, unablässig verfluchte er seine Entscheidung, sich für diesen Feldzug freiwillig gemeldet zu haben … immer und immer wieder – wie ein Mantra.
Nicht nachlassen! Fielding links neben ihm wurde von seinem Pferd geschleudert und als George einen Seitenblick riskierte, sah er das Loch in seinem Schädel, riesig, faustgroß und gähnend an Stelle der Augenhöhle. Ihn fröstelte, während er eilig den Blick nach vorn wandte, verbissen weiterkämpfte und nicht noch mehr zurückweichen wollte. Lauthals hörte er Henry neben sich fluchen, dann… Tumult von links. Oh Gott, war die Flanke dort ungesichert? Er vernahm den Lärm rasch näherkommender Truppen … Franzosen? Belgier? Und als er den Kopf in diese Richtung drehte, explodierte die Welt. Im ersten Moment konnte er nicht nachvollziehen, was geschehen war – bis er den Halt verlor und von Tulips zuverlässigem Rücken rutschte. Aufgeregt stürmte die Stute davon. Dann brach der Schmerz in ihm aus, wühlte sich wie ein wildes Tier in seine Eingeweide und hinderte ihn am Atmen. Henrys Stimme:
„Verdammt, George! Sam, hilf mir! Bentley hat es erwischt!“ Atmen, George, atmen! Rasender Schmerz, aber Henrys aufmunternde Worte an seinem Ohr: „George, durchhalten! Wach bleiben! Wir schaffen das schon!“ Ein Ruck an seinem Oberkörper. Henrys Schrei…. Dann Dunkelheit und wohltuende Schwärze…
London, Freitag, 23. Juni 1815
Sie hörte das Weinen hinter der Tür. Dann nichts mehr. Die tiefe, beruhigende Stimme ihres Vaters. Und wieder das jämmerliche Schniefen ihrer Mutter. Charlotte Bentley, von allen nur Charlie genannt, drückte sich kummervoll vor den Gemächern ihres Vaters herum.
Die Depesche war vor weniger als einer Stunde eingetroffen und für das Mädchen gab es keinen Zweifel über den Inhalt des Schreibens: Ihr Bruder musste in dieser letzten, schrecklichen Schlacht auf dem Kontinent, von der alle Zeitungen berichtet hatten und in der Napoleon angeblich besiegt worden war, sein Leben gelassen oder sich eine schreckliche Verwundung zugezogen haben! Ihre Augen waren rot verweint, gleichzeitig dröhnte ein schrecklicher, klagender Schrei, der ihrer verletzten Seele, ständig in ihren Ohren. Als würde ihr Schmerz von innen heraus alles übertönen wollen.
George! Ihr fröhlicher und unberechenbarer großer Bruder! Immer hatte er seine Schwestern geärgert und nach seiner Pfeife tanzen lassen! Louisa und Rose, die beide älter waren als sie selbst, hatten ihn besser in Schach halten können, Charlie dagegen war ihm gefolgt wie ein Hündchen, hatte ihn schon immer glühend verehrt. Als er sechzehn Jahre alt gewesen war, war sie gerade mal sechs.
Dieser große, mutige Bruder hatte sie zum Reiten animiert, sie das Kartenspielen mit allerlei Tricks gelehrt und ihr Fechtlektionen erteilt.
Er hatte ihr an dem kleinen Strand in der Nähe ihres Hauses in Cornwall das Schwimmen beigebracht, sich stundenlang auf dem Rücken mit ihr im Salzwasser treiben lassen und die Wolken beobachtet.
Er hatte sie huckepack den Klippenweg hochgetragen, wenn sie abends zu müde zum Laufen gewesen war.
Er hatte sich nachts mit in ihr Baumhaus gesetzt, wo er ihr die Sternbilder erklärt hatte…
Charlies Herz brach mit jeder Erinnerung ein Stück mehr auseinander, bis sie sich auf die Knöchel ihrer linken Hand beißen musste, um nicht laut aufzuschluchzen.
Als sie hinter sich Schritte hörte, drehte sie sich nicht um. Es musste ja niemand sehen, wie sehr sie geweint hatte. Erst als sich zwei Arme um sie schlangen, reagierte sie und drückte ihren neunjährigen Bruder Grenville fest an sich.
„Es ist wegen George, oder?“, flüsterte er, die Stimme brüchig und heiser. Charlie konnte zunächst nur nicken, einige Zeit standen sie so still. „Wird er nie wiederkommen?“
„Ich weiß es nicht, Grenny. Mutter hat die Depesche geöffnet, ist in Tränen ausgebrochen und in Vaters Zimmer geeilt. Ich weiß nicht genau, was in dem Schreiben steht, aber es waren auf jeden Fall schlechte Nachrichten.“ Sie brach resigniert ab.
„Ich habe Angst!“, wisperte Grenny an ihrem Arm. Und Charlie küsste ihn auf den akkuraten Scheitel und murmelte:
„Ich auch, kleiner Bruder, ich doch auch!“
Dover, Dienstag, 11. Juli 1815
Er war nur noch müde! Müde und unglaublich alt! Henry Campbell, der Earl of Crowland, tat den letzten Schritt von Bord auf das alte Kopfsteinpflaster. Als er endlich wieder festen englischen Boden unter seinen Füßen spürte, fühlte er sich unendlich dankbar. Dankbar, müde und alt.
Als einer der Letzten hatte er das Schiff verlassen und so herrschte an Land bereits dichtes Gedränge. Eine alte Frau neben ihm schluchzte herzzerreißend, während sie einen jungen Soldaten fast in einer Umarmung erdrückte. Der linke Ärmel baumelte leer an der Seite seiner Uniform herab, aber mit dem rechten Arm umschlang er die Frau – vermutlich seine Mutter – mindestens genauso fest wie sie ihn. Henry seufzte leise und versuchte, den unbarmherzigen Schmerz, der sein Herz auch nach acht Jahren noch immer heimsuchte, zu verdrängen. Seine Mutter konnte ihn nicht mehr in die Arme schließen. Ihm graute etwas vor der Heimkehr zu seiner Familie, die die letzten Jahre in einer Wolke aus Trauer gefangen gewesen war. Jedes Mal, wenn er den Landsitz oder das Londoner Stadthaus besucht hatte, war es ihm dort etwas düsterer vorgekommen. Zum Glück hatte er vor drei Jahren eine eigene kleine Residenz in London bezogen, Verlust und Schmerz waren dort weniger präsent.
Sein Reitknecht Samuel, den er liebevoll Sam nannte, humpelte eben über die Planken, Henrys Rappen hinter sich führend. Auch Apollon würde dankbar sein, wenn die Reise endlich vorbei wäre. Mustergültig folgte er dem älteren Mann über den schwankenden Steg, spielte nur aufmerksam mit den Ohren.
„Ham wer´s geschafft, Mylord! Meine alten Knochen freu‘n sich jetzt schon auf ein richtiges Bett und mein Magen auf Madame Fontaines oder Emmas leckeres Abendessen!“ Henry lächelte. Sam hatte schon immer eine Schwäche für Emma, die Köchin seines Vaters, gehabt.
„Geht mir genauso! Darauf haben wir mehr als ein Vierteljahr verzichten müssen!“ Henry übernahm die Zügel und Sam wollte gerade wieder zurück an Bord gehen, als ein Matrose seinen Wallach heranführte und ihre beiden Satteltaschen anschleppte.
„Müsste alles da sein, Mylord! So wie Ihr gesagt hattet! Unter Deck lag sonst nichts mehr herum!“, meldete er sachlich, bevor er schnell die Finger um das Geldstück schloss, das Henry ihm in die Hand drückte.
„Ich danke Euch für die gute Betreuung, Peter!“, murmelte Henry, der sich dann abgelenkt umdrehte.
Am Pier war Unruhe entstanden, als eine stattliche Kutsche herangerollt war und Platz zwischen den vielen Heimgekehrten beansprucht hatte. Das bekannte Wappen an der Einstiegstüre ließ Henry kurzzeitig die Kehle eng werden. Sam gesellte sich zu ihm.
„Hab ich mir gedacht, dass Euer Vater Euch abholen wird, Mylord!“ Leise kräuselte sich ein Lächeln in Henrys Mundwinkeln, als er seinen Vater beim Aussteigen beobachtete, der sich suchend nach ihm umblickte. Freude erfüllte seine Augen, als er seinen Sohn in der Menge entdeckte.
„Henry!“, rief er erfreut und strebte ihm entgegen. Etwas ungeschickt drückte sein Vater ihn kurz an seine schmale Brust. Ein unfassbarer Beweis seiner Zuneigung für einen sonst so distanzierten Menschen wie den Duke. „Ich bin dem HERRN zu Dank verpflichtet, dass er dich lebend wieder zurückgeschickt hat!“
Henry grinste. „Hätte mir jemand vor fünf Jahren gesagt, dass du auf deine älteren Tage hin fromm wirst…! Ausgelacht hätte ich ihn!“
Sein Vater schenkte ihm zunächst zwar ein schiefes Lächeln, wurde dann aber sofort wieder ernst. „Ich meine das wirklich so! Napoleon hat genug Opfer gefordert. Dass Charles seit letzter Woche unverletzt zurückgekehrt und du nun auch wieder da bist, macht mich demütig.“
Auch Henry verging das Lachen. „Es war die Hölle, Vater! So viele Menschenleben wurden verspielt für den Wahn eines alternden Mannes!“
Der Duke fasste ihn sacht am Arm. „Ich habe mich mein Leben lang in der Politik unseres Landes engagiert…, wenn die Außenpolitik auf Kriege zurückgreifen musste, ist noch nie Gutes dabei herausgekommen.“ Er seufzte tief. „Aber man konnte Napoleon auch nicht einfach marschieren lassen!“ Ein kurzes Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus, als beide an das dachten, was dieser Krieg zerstört und gefordert hatte.
Dann sah Henry sich suchend um. „Hast du James nicht mitgebracht? Wo steckt der kleine Schlingel?“ Wie hatte er seinen vierzehn Jahre jüngeren Bruder vermisst, der tränenüberströmt Abschied von ihm genommen hatte!
„Nun, wir haben uns bei deiner Schwester Maria und Sir William auf ihrem Landsitz in Canterbury einquartiert, wo wir uns auch für heute Abend angemeldet haben, damit Sam und du nicht die lange Strecke auf einmal zurücklegen müsst. James ist heute bei ihnen geblieben.“
Ergeben fügte Henry sich in sein Schicksal und nickte. Eigentlich hatte er so schnell wie möglich in sein Stadthaus in London reisen wollen, um sich wieder in seinen gewohnten Lebensrhythmus zu fügen. Er hatte das Gefühl, die Sicherheit eines geregelten Tagesablaufs zu benötigen, um den Kopf von den bedrückenden Bildern des Krieges zu befreien. Aber sein Vater hatte es gut gemeint.
„Danke, Vater! Wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich die Strecke lieber zu Pferd zurücklegen. Nach der Überfahrt sehne ich mich nach etwas Bewegung.“
Der Duke klopfte ihm auf die Schulter, drehte dabei aber bereits wieder Richtung Kutsche ab. „Wir sehen uns beim Dinner!“, rief er über eine Schulter zurück, während er grüßend den Arm hob. Diesmal war Tony, der Kutscher, rechtzeitig bereit, um die Tür aufzuhalten und seinem Herrn beim Einsteigen behilflich zu sein. Nachdem er die Tür hinter ihm geschlossen hatte, winkte er Henry fröhlich zu.
„Herzlich willkommen zu Hause, Sir. Ihr werdet uns bald eingeholt haben!“ Dann hievte er sich gekonnt auf den Kutschbock, um sein Gefährt zügig wieder in Gang zu setzen.
Henry drehte sich nach Sam um, der in der Zwischenzeit die Pferde gesattelt und die geräumigen Reise-Satteltaschen befestigt hatte. Apollon scharrte bereits etwas ungeduldig mit dem Huf. „Bereit, Sam, für einen Umweg nach Canterbury?“
Der Knecht zuckte gleichmütig die Achseln. „Auf den Tag mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an! Bin nur froh, dass das vermaledeite Geschaukel auf dem Schiff überstanden ist! Reiten könnte ich noch wochenlang! Aber für die See bin ich nicht gemacht!“
Einträchtig zogen sie die Sattelgurte nochmal nach, schwangen sich nebeneinander auf die Pferde, lenkten dann die Tiere vorsichtig über das Pier, das sich in der Zwischenzeit merklich geleert hatte, und ließen Dover zügig hinter sich.
Cairn House – zur selben Zeit
„Seid bitte leise!“, tadelte Lady Emilia ihre beiden auf Zehenspitzen den Korridor durchquerenden Kinder, während sie mit dem Teetablett-beladenen Dienstmädchen im Gefolge in Georges Zimmer eilte.
Die Nachrichten in der Depesche, die Admiral Sir Francis Bentley und seine Gattin Lady Emilia erhalten hatten, waren doch etwas weniger dramatisch gewesen, als Charlie und ihr Bruder Grenny befürchtet hatten. Ihr Bruder George war schwer verletzt worden, schien aber langsam zu genesen. Der Säbelhieb eines Franzosen hatte George am Oberschenkel die Schlagader durchtrennt, sodass er fast verblutet wäre. Nur das schnelle und beherzte Eingreifen eines Kriegskameraden hatte seinen sicheren Tod verhindert. Nach einer geglückten Not-Operation im Feldlazarett hatte sich am Kontinent zunächst eine Entzündung entwickelt, die inzwischen jedoch wieder abgeklungen war, ohne wirklich Schaden anzurichten. Ihr Londoner Arzt Dr. Trent war eher um die mentale Genesung seines Patienten besorgt gewesen, sodass die Eltern sich entschieden hatten, London früher als geplant den Rücken zu kehren, um auf ihren Landsitz in der Nähe von St. Yves zu ziehen.
Nun waren sie also in Cornwall, was Charlie ohnehin am liebsten war. Ihre Saison war unspektakulär, ja enttäuschend verlaufen, ohnehin zog sie die Weite und Freiheit des Landlebens der Enge und Falschheit Londons vor. Die gute Meinung der anderen war ihr nie wichtig gewesen, im Gegenteil, sie hatte alles darangesetzt, möglichst unnahbar und uninteressant zu erscheinen. Ihre Schwestern waren beide gut verheiratet und hatten brav getan, was die Gesellschaft von ihnen erwartete. Charlie hingegen hatte sich mit zwölf Jahren geschworen, niemals zu heiraten oder einem Mann zu Gefallen zu sein.
Die Geschwister waren durchaus daran gewöhnt, sich leise im Haus bewegen zu müssen. Schließlich verlangte der angeschlagene Gesundheitszustand ihres Vaters, der seit drei Jahren phasenweise das Bett hüten musste und immer kränklicher wurde, permanente Rücksichtnahme. Aber dass man nun nicht einmal mehr auf Zehenspitzen über die Korridore gehen durfte…! Sie grinsten sich verschwörerisch zu, rannten die letzten Meter die Dienstbotentreppe hinauf bis zu Grens Zimmertüre und warfen diese dann schwungvoll hinter sich zu, bevor sie in lautes Lachen ausbrachen.
„Wie zwei Einbrecher…!“
„Demnächst müssen wir auf Socken laufen oder dürfen die Zimmer nicht mehr verlassen, Charlie!“, klagte Gren. „Wir dürfen nicht mehr zum Frühstückszimmer gehen und müssen elend verhungern.“
„Oder Abby muss uns die Speisen in einen Korb legen, den wir vom Balkon aus an einem Seil nach unten lassen und gefüllt wieder nach oben ziehen“, spann Charlie den Gedanken weiter.
Während das Mädchen sich in einen Sessel am Fenster plumpsen ließ, streckte sich Gren der Länge nach auf dem Teppich aus. „Hast du Bodes astronomisches Jahrbuch bekommen, Charlie?“
Seine Schwester lächelte. „Aber sicher! Ich hab es schon fast durchgelesen. In zwei Tagen oder so kannst du es haben.“
Gren seufzte. „Noch zwei Tage warten!“ Er zog ein langes Gesicht. „Können wir dann wenigstens an den Strand gehen und baden? Ich langweile mich zu Tode!“
Charlie strahlte! „Perfekt, Gren! Ich lasse die Köchin einen Picknickkorb zusammenstellen, dann können wir gleich los!“ Die junge Frau sprang auf, froh, endlich etwas zu tun zu haben.
„Lass dich von Mutter auf dem Korridor nicht erwischen!“, witzelte Gren, worauf seine Schwester nur leise lachte, bevor sie sich auf den Weg zur Küche machte.
Verstohlen hastete sie die Dienstbotentreppe, die direkt bis zur Küche führte, hinunter bis ins Erdgeschoss. Hier war das Reich von Abby, deren rotes Gesicht über einem kochend heißen Trog hervorlugte und deren wache Augen Charlie fröhlich musterten.
„Heute auch mal zu Mittag hier, Lady Charlotte? Damit hatte ich schon gar nicht mehr gerechnet.“
Charlie lachte fröhlich. „Kannst du uns einen deiner legendären Picknickkörbe packen? Gren und ich würden gern an den Strand zum Baden gehen. Und Mutter hat sowieso keine Zeit für uns, solange es George nicht besser geht.“ Abby schüttelte tadelnd den Kopf und schnalzte missbilligend mit der Zunge. Sie kannte die Kinder der Familie schon von Geburt an.
„Das hat schon seine Richtigkeit, Mylady. Solange Master George gepflegt werden muss, braucht er jegliche Unterstützung durch Eure Ladyschaft.“ Sie rührte konzentriert weiter und blickte dann entschlossen auf. „Es wird gut sein, wenn Ihr Eurer Mutter ab und an zur Hand geht mit Eurem älteren Bruder. Aber heute soll es also ein Picknickkorb für Euch und Gren sein?! Ich lasse Betty gleich alles vorbereiten und Thomas kann ihn Euch nachher zum Stall bringen.“ Charlie nickte, kam um den Herd in der Mitte der großen Küche herum und legte der Köchin den Kopf an die Schulter.
„Ich danke dir, Abby! Heute lassen Gren und ich uns Wellen und Wind um die Nase wehen, doch morgen werde ich Mutter bei George ablösen. Aber… Er starrt bisher nur apathisch an die Decke und spricht kein Wort! Ich habe es ja schon versucht…!“ Sie schluckte den Kloß hinunter, der sich in ihrem Hals gebildet hatte. „Er muss Schreckliches erlebt haben, wenn es ihn so entsetzlich verzweifeln lässt.“ Sie drückte die Köchin nochmals liebevoll am Arm, bevor sie sich beeilte, in ihr Zimmer zu gelangen, um sich auf den Ausflug vorzubereiten und sich umzuziehen.
Sorge zeichnete sich auf Lady Emilias Zügen ab, während sie ihren Ältesten betrachtete. Wie eingefallen sein Gesicht wirkte! Wie wenig Leben in seinem jungen Körper noch zu stecken schien. George hatte bereits als kleiner Junge, später auch als junger Mann durch seine Lebhaftigkeit und Fröhlichkeit jedes Herz im Sturm erobert. Und nun dies!
Die Beinwunde verheilte wirklich gut. In der Zwischenzeit konnten sie die Wunde teilweise schon mehrere Stunden offenlassen, da sich alles verschorft und geschlossen hatte. Trotzdem seufzte Lady Emilia leise und Georges Augenlider flatterten.
„Du bist da, Mutter!“
Schnell eilte sie an seine Seite, um seine Hand zu drücken. „Ich bin nie weit! Das solltest du inzwischen wissen. Wenn du etwas brauchst, lass es mich wissen.“ Sie machte eine kleine Pause. „Dein Vater würde dich auch gerne besuchen, derzeit fühlt er sich aber sehr schlecht und seine Gicht verursacht schreckliche Schmerzen.“
George nickte nur müde. „Ich habe keine Kraft für Besuch, Mutter. Nicht von dir, nicht von Vater, von niemandem! Vielleicht könnt ihr mich einfach alleine lassen?!“
Resigniert wandte Lady Emilia sich ab. „Wie du wünschst, George! Milton wird in der Nähe bleiben.“ Unauffällig gab sie Milton ein Zeichen, näher an Georges Bett zu rücken und drückte leise die Türe hinter sich ins Schloss. Von außen lehnte sie sich dagegen, schloss müde die Augen und ließ sich von der Ausweglosigkeit der Situation übermannen. Ihr Gatte war nicht mehr einsatzfähig, ja, er wurde immer gebrechlicher - und nun fühlte auch George sich außerstande das Anwesen zu verwalten. Sie überlegte schon mehrere Tage, wie es weitergehen sollte.
„Ich muss mit Charlie darüber sprechen. Bestimmt fällt ihr etwas ein. Gleich heute beim Abendessen“, sprach sie sich selbst Mut zu. Dann gab sie sich innerlich einen Ruck und konzentrierte sich auf die nächste Aufgabe. Sie würde Tee ins andere Krankenzimmer bestellen - einen Kräutertee für den Admiral, einen gute Tasse Assam für sich selbst. Irgendwie würden sie auch durch diese dunkle Phase kommen. Eine gestohlene Stunde am Bett ihres Mannes würde keinem schaden. Sie musste es genießen, was sie noch miteinander teilen konnten. Ein kleiner Plausch über die Politik, ein wenig die Sorgen um George abladen. Es tat gut, mit einem Mann verheiratet zu sein, dessen Unterstützung man sicher sein und den man auch nach vielen Jahren noch respektieren und lieben konnte. Als sie in die Halle kam, sah sie Charlie in einem strengen, hochgeschlossenen Reitkleid sowie Grenville in seinen kurzen Reithosen ihre Stiefel anziehen. Sie lachten, was Lady Emilias Herz sich leichter und freier fühlen ließ. Wenn sie auch keinerlei Anstalten machte, sich auf eine Ehe einzulassen oder einem Mann auch nur eine Chance zu geben, so war ihre Tochter fürsorglich und liebevoll im Umgang mit ihrem kleinen Bruder. Sie wartete an der Treppe oben, damit die beiden ungestört das Haus verlassen konnten.
„Meinst du, das Wasser ist sehr kalt, Charlie?“, wollte Gren aufgeregt wissen.
„Sicher, es ist ja noch früh im Jahr, Grenny. Aber das macht nichts. Wir werden trotzdem unseren Spaß haben.“ Charlie drehte sich nach Thomas um, der in gebührendem Abstand gewartet hatte, bis die Geschwister sich fertig angezogen hatten. Gren hob schnuppernd die Nase in Richtung des Korbes in Thomas‘ Armen, der unschwer als Picknickkorb zu erkennen war.
„Ich glaube, ich rieche Abbys gebratenes Hühnchen. Ach, freu ich mich. Beeil dich, Charlie!“ Diese hatte nun auch endlich ihre Haare unter den Reithut gestopft, die Hutnadeln fest am Kopf befestigt und die staubigen Stiefel unter dem Kleid versteckt.
„Bin so weit! Nächstes Mal nehmen wir aber Mutter mit an den Strand! Sie braucht auch mal eine Auszeit! Und wir müssen noch kurz bei Kasseiopeia an der Box vorbeischauen. Das Fohlen kann nun jeden Tag kommen. Ach, bin ich aufgeregt!“ Und schon wirbelten sie aus dem geöffneten Türflügel, liefen lachend in Richtung der Ställe und baten Thomas, sich zu beeilen.
Als es wieder ruhig geworden war, spielte ein Lächeln um Lady Emilias Lippen, denn sie hoffte, Abby ebenfalls einen Picknickkorb abluchsen zu können. Ein Picknick im Krankenzimmer würde dem Admiral bestimmt auch gefallen! Und plötzlich fühlten sich ihre Schritte deutlich leichtfüßiger an als noch vor einigen Minuten.
„Können wir noch einen Abstecher zu Sheep‘s Head machen, Grenny?“ Charlie schwang sich mühelos auch ohne Hilfe des Stallmeisters Sebastian Oakley in den Sattel, wo sie ungeduldig darauf wartete, dass Gren den Picknickkorb hinter dem Sattel seines Dartmoor-Ponys befestigt hatte. Ihr Bruder grunzte nur, so vertieft war er in seine Aufgabe. Nun trat Oakley hinzu, prüfte kurz, ob alles gut vertäut war, klopfte Grenville zufrieden auf die Schulter und lobte ihn.
„Gut aufgepasst, Mylord. Bald könnt Ihr schon auf längere Reisen gehen, wenn Ihr Euer Pferd so gut vorbereitet.“
Grens kleine Brust schwoll vor lauter Stolz auf doppelte Größe an. „Nun denn, dann können wir los, Charlie!“ Der Neunjährige sprang im Nu in den Sattel seines Ponys, das er Sunshine getauft hatte, und jagte aus dem Hof, dass zwei Hühner gackernd davonstoben. Charlotte hob zum Abschied noch grüßend ihre Gerte, bevor sie nicht weniger eilig auf ihrer Stute Gipsy hinterhertrabte. Oakley war ein kleinerer Mann, mit strohblonden Haaren und Sommersprossen, vielleicht Anfang vierzig und Charlie kannte ihn ihr Leben lang. Nun grinste er, während er ein Stück Kautabak aus einer Zahnlücke auf den Hof zischen ließ. „Nicht zu sehen, dass der Vater kein Reiter ist…. Seine Kinder sitzen alle bombenfest im Sattel!“
Gren und Charlie trabten schon bald gemächlich am Küstenweg oberhalb der Klippen Richtung Sheep‘s Head entlang. Der Pfad war breit genug, dass sie nebeneinander bleiben konnten, und in unausgesprochenem Einverständnis ließen sie die Pferde nach den ersten hundert Metern laufen. „Yeeeeesss!“, schrie Grenny übermütig. Sofort schlug Sunshine erschrocken nach hinten aus, was den Jungen jedoch nur zum Lachen brachte. Auch Charlie hatte das Gefühl, am liebsten davonfliegen zu wollen! Endlich wieder frei, kein Korsett, keine falschen Schlangen der feinen Gesellschaft, die sich das Maul über andere zerrissen und kein heuchlerisches und herablassendes Getue der feinen Lords, die alle dachten, Frauen hätten keinen Kopf, um zu denken. Und keine Verkleidung!
Charlie gab es nicht gerne zu, aber seit einem furchteinflößenden Zwischenfall, als sie gerade zwölf Jahre alt gewesen war, hatte sie Angst vor Männern und deren körperlicher Überlegenheit. Also hatte sie beschlossen, sich so unsichtbar und unattraktiv wie möglich zu machen. George war es damals gewesen, der sie gerettet hatte, als ein Geschäftspartner ihres Vaters sich abends betrunken hinter ihr hergeschlichen und sie überall gegen ihren Willen angefasst und ihr Kleid zerrissen hatte. George war es gewesen, der den Mann am Kragen gepackt, von ihr weggerissen und aus dem Haus getreten hatte, sodass er ohne Mantel in den Stall gewankt und sich auf den Heimweg gemacht hatte. George war es gewesen, der anschließend in ihr Zimmer gekommen und sie die Nacht lang in einem Ohrensessel in den Armen gewiegt, bis sie sich beruhigt hatte. Und George war es gewesen, der seinen Eltern gegenüber durchgesetzt hatte, dass Charlie eine Brille bekommen sollte und die Kleidung anziehen durfte, die sie für richtig hielt. Waren sie im Kreis der Familie, so verzichtete Charlie meist auf ihre Verkleidung, doch sobald sie Besuch erwarteten, setzte sie ihre unförmige Brille mit Fensterglas auf, bürstete ihre Haare streng zurück, steckte sie unvorteilhaft streng fest und trug oft sogar im Haus eine schlichte Haube, die die Fülle ihres langen Haares verbarg. So verschwand ihr Angesicht hinter belanglosen Accessoires und ihren Körper versteckte sie in hochgeschlossenen, sackartigen Kleidern. Hatten ihre Eltern anfangs verwundert den Kopf geschüttelt, so schienen sie jetzt aufgegeben zu haben, Charlie je wieder in die feine Gesellschaft integrieren zu wollen. Die inständigen Bitten ihrer Mutter, sich für die erste Saison in luftige, helle Farben zu hüllen, waren ungehört verhallt. Ihre Tochter hatte sich bei größeren gesellschaftlichen Anlässen stets im Hintergrund gehalten und versucht, möglichst mit den Tapeten der jeweiligen Einrichtung zu verschmelzen. Charlie wusste nicht, was George ihren Eltern erzählt hatte – der Geschäftspartner war jedenfalls nie wieder aufgetaucht und Charlies seltsame Verschrobenheiten bezüglich ihrer Aufmachung wurden stillschweigend toleriert. Tja - es war eben durchaus von Vorteil, liebende Eltern zu haben, die sich kümmerten und ihren Kindern nur das Beste wünschten.
Von einer Verkleidung war an Charlie heute nichts zu sehen. Zwar trug sie ein dunkles, hochgeschlossenes und nicht besonders elegantes Reitkleid, hatte ihr Hütchen aber durchaus keck auf den Kopf gesetzt und auf die Brille verzichtet. Ein paar Sommersprossen würden niemanden stören, sie selbst am wenigsten, und wenn sie am Ende des Sommers etwas gebräunt sein sollte – Vornehmheit war ihr nicht wichtig! Sie fühlte sich frei und leicht und glücklich! Wenn es George nur besser ginge!
Gren schloss auf seinem Pony wieder zu ihr auf und sie hatten schon bald Sheep‘s Head erreicht. Von diesem Punkt aus hatte man das Gefühl, bis nach Amerika schauen zu können. Gren seufzte kellertief neben ihr. „Ich will gar nicht weg von hier, Charlie! Ich habe so Angst vor dem Internat!“
Charlie sah ihn von der Seite an. Gren war klein für sein Alter. Er hatte dasselbe dunkelblonde Haar mit helleren Strähnen darin wie sie selbst und noch seine typische Bentley-Kinderstupsnase. Bei den Frauen der Familie blieb sie klein und keck, bei den Männern wuchs sie sich zu einer geraden schmalen Nase aus. Ihr kleiner Bruder war eher von schmaler Statur, aber sie wusste, dass auch George erst spät gewachsen war und nun breitere Schultern bekommen hatte als viele seiner Freunde. Bei Grenville würde das bestimmt ähnlich sein. Sie drehte ihren Oberkörper in seine Richtung, während er weiter über das Wasser in die dunstige Ferne hinausblickte. „Grenny, ich kann das so gut verstehen! Wenn irgendwo ein Neuanfang bevorsteht, ist das immer schrecklich beängstigend. Aber du musst dich vor nichts fürchten. Du hattest das Glück, bis jetzt von wunderbaren, fähigen Hauslehrern unterrichtet zu werden und zu Hause bleiben zu können. Du bist klug und wach, sportlich und fröhlich. Du wirst keinerlei Probleme haben, dich in einer Internatsschule zurechtzufinden. Und…. Du wirst die beste Ausbildung bekommen, die sich ein Junge nur wünschen kann!“ Ihr Bruder schluckte. „Weiß ich ja alles. Aber...“, er sah sie furchtsam an, „es kursieren schreckliche Gerüchte, was sie mit den Neuen in den Häusern anstellen! Und ich kenne noch keinen einzigen anderen, der mit mir dort hingehen wird.“
„Mach dir erst Gedanken, wenn die Abfahrt kurz bevorsteht, Grenny, bitte. Genieß den Sommer hier jetzt noch einmal. Wenn du möchtest, kannst du morgens auch mit mir zum Unterricht für die Kinder der Pächter kommen. Ich habe versprochen, ihnen das Zeichnen, das Schwimmen, aber auch Lesen und Schreiben beizubringen. Ich könnte bei diesen Dingen auch deine Hilfe brauchen.“ Anscheinend ließ ihr kleiner Bruder sich ihren Vorschlag durch den Kopf gehen. „Abgemacht! Besser, als oben im Manor zu sitzen und darauf zu warten, dass du wieder heimkommst.“ Er grinste schief und der Wind wehte ihm die Haare wild um den Kopf. „Dann lass uns versuchen, ob wir es uns noch zutrauen, den felsigen Pfad in die Bucht runterzureiten oder ob wir lieber absteigen.“ Doch Grenny ließ nur ein abfälliges Schnauben hören, während er sein Pony wendete, um bis zum Klippenpfad zurückzukehren.
Charlie folgte ihrem Bruder. Vorsichtig lenkte sie Gipsy über die Steine, sie wollte keine Verletzung ihrer geliebten Stute riskieren und war froh, dass Grenny sein Pony auch sicher bis in die Bucht manövrierte. Am Strand nahmen sie den Pferden Sättel und Zaumzeuge ab und ließen sie laufen. Die Bucht war klein, nur etwa fünfzig bis siebzig Meter lang und bei Flut, so wie im Moment, nur fünfzehn bis zwanzig Meter breit. Aber man war alleine hier, sodass man ungestört baden, lesen und essen konnte, man hatte wunderbaren Sand und wenn man sich zwischen die kleineren Felsen legte, war man etwas geschützt vor dem doch kräftigen Wind.
Hier hatten Sie als Kinder oft die Nachmittage verbracht mit ihrer Mutter, während ihr Vater auf See gewesen oder der Verwaltung seiner verschiedenen Besitztümer nachgegangen war. Wenn er allerdings in Cairn House zugegen gewesen war, war er abends auch dazugekommen und sie hatten am Strand ein Feuer entzündet aus dem angeschwemmten Holz. Dann hatte er Geschichten aus den fernen Ländern erzählt, die er bereist hatte – Neufundland, Amerika, Mexiko, Frankreich, Dänemark, Spanien und Portugal. Sie hatten einen von Abbys Körben geplündert und Seemannslieder gesungen, die normalerweise eher in den Hafentavernen rund um den Globus zu hören waren. Charlie hatte diese Abende geliebt!
„Wer zuerst im Wasser ist!“, brüllte Gren gegen das Rollen der Wellen an, warf Stiefel und Klamotten wahllos auf einen Haufen, bis er nur noch seine Unterhosen trug und rannte dann schnellstens davon. „Das ist mehr als unfair, kleiner Bruder! Du hast nicht halb so viele Schichten Kleidung an wie ich!“ Doch auch Charlie bemühte sich, schnell nur noch im Unterkleid dazustehen und dann ins Wasser rennen zu können. Grenny hatte mehrere keuchende Japser ausgestoßen, während er bereits bis zur Hüfte im Wasser stand. „Kaaaalt!“, schrien beide wie auf Kommando und mussten lachen. Sie spielten im Wasser, ließen sich mit den Wellen in Richtung Strand tragen, tauchten durch die großen Brecher hindurch und legten sich schließlich zum Trocknen auf den Sand. Begeistert erzählten sie sich Geschichten aus den Büchern, die sie eben gelesen hatten – Grenny schwärmte für die Odyssee – und plünderten den Picknickkorb. Am späten Nachmittag wurde es schließlich kälter, sodass sie zusammenpackten, um nicht zu spät zum Abendessen zu kommen. Müde, aber erfrischt und erholt kehrten sie zurück.
Als Oakley ihre Pferde am Stall in Empfang nahm, schmunzelte er über ihre strahlenden Gesichter und klopfte seinen beiden Vierbeinern kräftig den Hals. „Weiß nicht, wer da zufriedener aussieht, die Tiere oder die Reiter.“ Glücklich lächelte Charlie ihn an. „Es war wundervoll, Oakley. Aber nächstes Mal machen wir einen richtigen Ausritt, damit die Faulpelze auch was zum Laufen haben.“ Belebt und glücklich strebten die Geschwister dem Haus zu.
Zur selben Zeit, zwischen Dover und Canterbury
Henry und Sam holten die Kutsche tatsächlich schneller ein, als sie gedacht hatten. Das Gefährt hatte noch nicht einmal die volle Höhe der Klippen erreicht, als sie von hinten angesprengt kamen. Eine Weile trabten sie gemächlich neben dem Wagen her und unterhielten sich mit Tony, bevor sie ihre Pferde zu einem schnelleren Tempo bewegten. Die Straßen waren trocken, sodass sie bereits zur Teezeit das Anwesen der Russells erreichten.
Alles sah gepflegt und sauber aus. Die Flügeltüren des Herrenhauses öffneten sich bereits, als Henry darauf zuschritt, und seine Schwester kam ihm auf der Treppe entgegengeeilt. „Oh, Henry! Ich bin so froh, dass du zurück bist. Heil und fast unversehrt! Wir hatten so schreckliche Nachrichten vom Kontinent erhalten, dass wir vor Sorge außer uns waren!“ Sie schloss ihn in eine feste Umarmung und zog ihn hinter sich her in Richtung des Hauses. In der Türe stand sein vierjähriges Patenkind, das ebenfalls Henry hieß und seiner hellblonden Mutter immer ähnlich wurde. Der Junge grinste ihn an. „Onkel Henry!“ „Hey, kleiner Henry!“, rief der Große und wirbelte den kurzen Kerl auf seine Schultern. Dahinter tauchte James auf. Henry strahlte noch mehr, als sein elfjähriger Bruder sich kurz an ihn drückte. Er war ein ruhiger, zurückhaltender Junge, der nicht viele Worte machte, aber die liebevolle Geste wärmte Henrys Herz. Sanft strubbelte er ihm durch den dunkelbraunen Haarschopf, während er ihm ins Haus folgte. „Nächste Woche starten wir nach Bury, James, dann können unsere Ferien endlich beginnen!“ Da drehte sein Bruder drehte sich und belohnte ihn mit einem schüchternen Lächeln. Inzwischen war auch der Hausherr aufgetaucht. „Henry! Wie gut, dich zu sehen!“, meinte Sir Russell freundlich, als er ihm die Hand drückte. Unterdessen wirbelte Maria an ihm vorbei, um dem Butler Anweisungen zu geben, dass er Henry zeigen solle, wo er untergebracht war. „Alle jungen Männer gehen bitte nochmals auf ihre Zimmer und schrubben ihre Finger vor dem Tee – ihr riecht nach Stall. Und Henry...“ „Ich rieche auch nach Stall und würde mich sehr gerne frisch machen vor dem Tee, keine Sorge!“ Maria kicherte. „Jules bringt dich nach oben, um dir dein Zimmer zu zeigen, Henry. Bitte - sobald ihr fertig seid, alle im Salon erscheinen!“ Maria blickte den beiden Jungs kopfschüttelnd nach. „Seit James hier ist, verfolgt der kleine Henry ihn wie ein Schatten. Es scheint ihn aber gar nicht zu stören, unseren Bruder.“ „Ach was, der ist froh, mal jemanden zu haben, der zu ihm aufblickt. Ein Nachzügler zu sein hat seine Nachteile, er muss sich immer ziemlich alleine gefühlt haben! Bis gleich!“
Henry folgte Jules zu seinem Raum im ersten Stock. „Perfekt! Danke!“ Der Butler verbeugte sich steif, während er auf die Waschschüssel deutete. „Hier müsstet Ihr alles finden, was Ihr für eine kurze Wäsche benötigt, Mylord.“ Er machte eine kurze Pause. „Ich werde Euch den jungen Frederick als Kammerdiener zur Verfügung stellen. Er sollte so weit sein, dass er diese besondere Aufgabe erfüllen kann.“ Jules glitt fast geräuschlos aus dem Raum.
Endlich kurze Zeit alleine! Henry seufzte. Langsam knöpfte er die Uniformjacke auf, die er achtlos auf einen der Sessel am Fenster feuerte. Unbewusst rieb er sich seine Wunde am Arm, bevor er das bodentiefe Fenster öffnete und auf den kleinen Balkon heraustrat. Tief sog er den Anblick der englischen Landschaft in sich auf. Es hatte etwas Beruhigendes, die von Hecken und Mäuerchen durchzogenen Ländereien hinter dem Park zu betrachten. Seufzend trat er dann ins Zimmer zurück, krempelte die Ärmel hoch und beugte sich über die Waschschüssel, um den Staub der Straße abzuwaschen und sich auf den Tee vorzubereiten. Seine Schwester würde nicht lange warten wollen.
Nach dem Abendessen, bei dem es recht zwanglos zugegangen war und an dem die Kinder zur Feier des Tages hatten teilnehmen dürfen, verschwand Maria mit den Jungs in den oberen Räumen, während sich der Duke, der kurz vor der Dunkelheit das Anwesen erreicht hatte, Sir William und Henry in die Bibliothek zurückzogen. An einem mit Intarsien verzierten Kartentischchen setzten sie sich zusammen und genehmigten sich einen Schluck Cognac.
„Wenn ich derzeit auch wenig Positives mit Frankreich verbinde, so habe ich an französischem Alkohol nichts auszusetzen!“, frohlockte Henry, als er genüsslich die Aromen des Weinbrands seine Geruchsnerven kitzeln ließ und begeistert am Rand seines Cognacschwenkers schnüffelte. Er hatte die staubige, verschwitzte Uniform gegen einen dunkelblauen Anzug seines Gastgebers getauscht, der nicht so ganz passte und zog ächzend sein Jackett aus.
Der Duke kostete einen kleinen Schluck aus seinem Glas. „Hätte man mir vergangenen Sommer, als wir in derselben Runde zusammensaßen, weismachen wollen, dass wir nochmals in einen Feldzug gegen Napoleon investieren müssen, hätte ich denjenigen ausgelacht!“ Sir William neigte zustimmend den Kopf. „Es war erschreckend zu sehen, dass ein abgesetzter Monarch mit nur tausend Mann Armee so viele Männer dazu motivieren konnte, zu ihm überzulaufen. Hunderttausend Soldaten standen ihm am Ende zur Verfügung...! Meine Güte, dass ihm das nochmals geglückt ist, hundert Tage die Regierung an sich zu reißen und die alliierten Truppen in Schach zu halten!“ Er schickte Henry einen neugierigen Blick. „In welche Schlachten warst du involviert, Henry? Kannst du schon darüber reden oder sind die Ereignisse noch zu frisch?“ Henry drehte nachdenklich das Cognacglas in seiner Hand. „Nun, anfangs waren wir an kleinen, unbedeutenden Scharmützeln am Rande des Kriegsgeschehens beteiligt. Basislager war in der Nähe von Quatre-Bras in Belgien.“ Müde rieb er über die Stoppeln an seinem Kinn. „Unsere wirklich relevante Schlacht, in die wir verwickelt waren, folgte erst spät: Wellington befahl uns am 16. Juni, uns den niederländisch-belgischen Truppen Bijlevelds anzuschließen. Eigentlich sollten wir weiter nach Osten in Richtung Ligny, um die Preußische Armee zu unterstützen, aber Napoleon hatte uns kurzzeitig sehr geschickt von deren Verbänden abgeschnitten. Also wurden wir zur Verteidigung der strategisch wichtigen Straßenkreuzung in Quatre-Bras eingeteilt. Ehrlich gesagt waren wir uns nicht sicher, ob wir tatsächlich die Kreuzung würden halten können. Es waren noch zu wenige Truppenverbände vor Ort.“ Er nahm einen tiefen Atemzug. „Also stießen wir als Vorhut unseres Bataillons mit nur zwanzig Mann zu Maitland und den niederländischen Truppen dazu. Sam wich mir nicht mehr von der Seite. Uns war klar, dass in den kommenden Tagen die entscheidenden Gefechte stattfinden würden und über den gesamten Truppen lag eine extreme Anspannung.“ Ihn fröstelte.
„Unser Bataillon war während des gesamten Feldzugs Lieutenant-Colonel Somerset unterstellt, einem Hochkaräter, was Militärtaktik betrifft.“ Henry verstummte gedankenverloren. „Ich habe eine tiefe Verbundenheit gespürt zu einem Kameraden namens George Bentley. Sagt dir der Name was?“ Sir William zog eine Augenbraue hoch. „Der Sohn von Admiral Bentley, dem Earl?“ Henry nickte. „Ist der alte Haudegen noch für die Krone unterwegs?“ Henry schüttelte den Kopf. „Er musste sich vor drei Jahren zur Ruhe setzen – die Gicht! Der Admiral ist an manchen Tagen ans Bett gefesselt.“ Der Duke sah seinen Sohn fragend an. „Was hatte es mit dem Sohn auf sich?“ „Nun, wir waren zwei oder drei Mal, gleich zu Beginn des Kriegseinsatzes, zusammen losgeschickt worden - nichts Weltbewegendes. Aber gleich beim ersten Erkundungsritt gerieten wir in einen Hinterhalt, der uns fast das Leben kostete. Bentley erschoss dabei einen Franzosen – fast noch ein Kind! Das musste er, hätte er nicht abgedrückt, dann hätte der Junge es getan.“ Schweigen legte sich über den Kartentisch und der Cognac in den Gläsern ging zur Neige. „Bentley wurde von da an von riesigen Zweifeln geplagt. Er zweifelte an der Legitimation des Krieges, an seinem persönlichen Einsatz, an seinem Vater, der schon so viele Schlachten auf See geschlagen hatte. Aber er begann auch, an der Menschheit an sich zu zweifeln und schließlich an sich selbst und seiner Existenz. Er wurde melancholisch.“ Henry nippte den letzten Schluck Cognac. „Jedenfalls kämpften wir in Quatre-Bras Seite an Seite – Sam, George und ich. Die Franzosen hatten uns fast umzingelt und wir waren dabei, uns um eine Ordnung für einen vorübergehenden Rückzug zu bemühen, als zwei Bataillons Verstärkung eintrafen. George war bei ihrer Ankunft kurzzeitig verwirrt, ob Freund oder Feind zu uns stieß, und gab für einen Moment seine Deckung auf. Dabei wurde er durch einen Säbelhieb schwer am Bein verwundet, stürzte vom Pferd und blieb zunächst liegen. Sam wartete mit Apollon ein Stück weiter entfernt. Ich packte George unter den Achseln und versuchte, ihn hinter den vordersten Frontreihen in Sicherheit zu bringen, während das Blut fontänenartig mit jedem Herzschlag aus seiner Wunde am Oberschenkel schoss. Dabei hat mich selbst auch eine Kugel am Oberarm erwischt und zwei Geschosse zischten so dicht an meinem Kopf vorbei – ich habe den Luftzug gespürt…! Als einige der nachrückenden Männer meine Not erkannten, beeilten sie sich mit der Neuformation, sodass ich bald hinter ihnen in Sicherheit war. Dann ging auch alles sehr schnell. Die zusätzlichen Männer konnten Napoleons Truppen an diesem Tag standhalten bei Quatre-Bras und die Kreuzung für die alliierten Truppen sichern. Und eben dieses Gegenhalten bildete die Basis für den endgültigen Schlag zwei Tage darauf in Waterloo.“ Ein Diener kam herein, goss Cognac nach und schloss die Flügeltüren zur Terrasse, wo die kühle Abendluft ungemütlich ins Zimmer gedrungen war. Sir William lehnte sich vor. „Was geschah mit Bentley und dir?“ „Sam brachte Apollon zu mir, dann fing er das verängstigte Reittier des Kameraden ein. Wir banden George das Bein ab, um die Blutung zu stoppen. Danach legten wir den Verwundeten über den Sattel und banden ihn mit zwei Seilen fest – er wäre sonst nach den ersten Schritten aus dem Sattel gerutscht. Anschließend fragten wir uns zum nächsten Feldlazarett durch! Mein Gott! Was sich dort an Leid und Schmerzen, Tod und Geschrei drängte, das werde ich nie vergessen. Allein während der Wartezeit bis zur Versorgung meines Durchschusses haben wir das Geschrei von zwei Beinamputationen mit angehört. Wir haben die Schwestern gesehen, die die abgetrennten Gliedmaßen hinter dem Zelt in eine Grube geworfen haben, wo sie abends dann verbrannt wurden. Noch nie war ich so froh gewesen um Sams eisernen Brandyvorrat in der Satteltasche. Ich konnte meinen Schmerz betäuben, meine Wunde säubern, aber wir konnten auch Bentley davon einflößen.“ Henry blickte die beiden anderen Männer eindringlich an. „Bentley verlor immer wieder das Bewusstsein. Wir wussten nicht, wie schlimm es um ihn stand. Und während ich ihm einmal von dem Alkohol einflößte, krallte er sich in meinen Arm und bat mich, ihn anzuhören. „Campbell! Wenn ich sterbe, kümmere dich um meine Familie. Bitte! Mein Vater kann wegen seiner Schmerzen nicht mehr viel arbeiten und mein Bruder ist noch zu klein. Ich bitte dich! Ich weiß um dein Geschick beim Führen deiner Ländereien und wenn du auch jünger bist als ich, vertraue ich dir das Schicksal meiner Familie an. Ich bitte dich inständig, nimm dich ihrer an!“ Dann kam auch schon der Arzt - zunächst wurde George versorgt, dann ich! Der Kampf war für uns beide zu Ende. Sam wurde für den 18. noch einmal einberufen, aber er war nicht mehr in vorderster Front. Ich wurde beim Lager zurückgelassen und habe noch zweimal im Lazarett nach Bentley gesehen, aber er war nicht ansprechbar. Danach wurden Sam und ich abgezogen. Wir haben Gefangene in verschiedenste Lager überstellt und die Truppenbehausungen mit abgebaut. Zudem haben wir den Rücktransport vieler Verletzter organisiert. Von Bentley haben wir nichts mehr gehört.“ Alle drei Männer waren tief in Gedanken versunken. Sir William hatte sich als Erster wieder gefasst. „Du solltest dich bei seiner Familie nach seinem Befinden erkundigen! Du weißt ja nicht mal, ob er überlebt hat!“ Auch der Duke stimmte dem zu. „Vielleicht braucht die Familie dich wirklich!“ Widerwillig kapitulierte Henry: „Ich kenne durchaus meine Pflicht.“ Mühsam hievte er sich dann aus den Tiefen seines Sessels empor, trank das Glas in einem Zug leer und stellte es auf das Kartentischchen. „Aber das wird Zeit haben bis morgen, ich brauche ein weiches Bett und ein paar Stunden erholsamen Schlaf. Ich denke, ihr entschuldigt mich!“ Sir William erhob sich ebenfalls. „Gute Nacht, Henry! Wir sind sehr froh, dass du alles überstanden hast. Vor allem auch Maria – sie war die letzten Monate in steter Sorge um ihre beiden Brüder, die so tapfer gekämpft haben.“ Müde hob Henry die Hand zum Gruß und drehte sich wortlos um. Es war ein langer Tag gewesen – und eine noch längere Reise. Zeit für eine Pause.
Cairn House, Mittwoch, 12. Juli 1815, 2.30 Uhr
Unruhig wälzte George sich in seinem Bett. Die Decke schien ihn zu erdrücken und seine Füße kribbelten ruhelos, fast schmerzend, unerträglich. Bewegen! Er musste sie in ständiger Bewegung halten! Nicht nachlassen! Bewegen! Aber wenn er sich darauf konzentrierte….
George schnappte nach Luft! Atmen! Hilfe, nun musste er auch noch ans Atmen denken. Nicht vergessen! Vor Aufregung begann er zu schwitzen. Ekel überflutete ihn. Er konnte den Schweiß aus jeder Pore drücken spüren. Überall drückte die Flüssigkeit heraus, vergrößerte die Poren, überdehnte sie! An der Stirn öffneten sie sich so weit, dass man seine Hirnmasse unter der Schädeldecke glitzern sehen konnte. Feucht, rosa… dann bewegte sie sich auf ihn zu, durch ein gähnendes gezacktes Loch in der Stirn, quoll hervor wie ein Tier und breitete sich aus, troff über die Stirn nach unten. Aber nicht seine Stirn… eine kindliche Nase, zwei Augen, die ihn aus ihren Höhlen tot anstarrten, und die glatte Haut eines Jungen vor der Pubertät……. Schreiend fuhr er auf und fühlte sich von zwei schlanken Armen umschlungen. „Schhhhttt! George, ganz ruhig! Du hast nur geträumt. Du bist zu Hause!“ George keuchte. „Oh Gott, Charlie!“ Er versuchte, zu Atem zu kommen. „Ich seh ihn jede Nacht. Jede Nacht dieses kleine Gesicht, diese klagenden, toten Augen.“ Charlie drückte ihn sacht an der Schulter, damit ihr Bruder zu Seite rutschte und kroch zu ihm unter die Decke. „Himmel, bist du heiß! Hast du Fieber?“ Zielstrebig wanderte ihre kleine Hand zu seiner Stirn und tastete nach der Temperatur! „Du hast mir einen Schrecken eingejagt! Aber an der Stirn bist du eher kalt!“ „Ich hab kein Fieber, Charlie, beruhig dich!“ Er holte tief Luft. „Ich sehe nur die Bilder dieses verfluchten Krieges jede Nacht wieder vor meinem inneren Auge! Und sie verändern sich in meinem Traum. Die Gesichter deformieren sich, verfließen, platzen auf und überall drängen ekelerregende Säfte heraus. Als würden die Geschwüre des Hasses und der Feindschaft aufplatzen und die Welt verpesten und überfluten. Als würden die Getöteten, die sich für ihren Herrscher geopfert haben, zurückkehren und die Überlebenden mit ihrem Tod und ihrem Schmerz einholen und ersticken wollen. Ich halte das nicht aus! Es verfolgt mich tagsüber in meinen Gedanken – lässt keinen Raum für anderes – und nachts sucht mich das Grauen dieses Krieges in den Träumen heim!“ Charlotte hatte ihre Stirn an Georges Schulter gelehnt und bei diesem Ausbruch erschrocken aufgekeucht. Ein paar Tränen rannen ihr über die Wangen, von denen sie hoffte, dass George sie nicht bemerken würde. „Ich habe jeden Tag gebetet, den du unterwegs warst! Habe Gott angefleht, dich wieder zurückzubringen, dir beizustehen, dich zu beschützen! Ich habe nur an deinen Körper gedacht, dein Leben und deine Unversehrtheit durch die Waffen der Franzosen. Aber ich habe keinen Gedanken daran verschwendet, womit du konfrontiert wirst, welche Situationen du durchleben musst. Ich schäme mich so sehr, dass ich daran nicht gedacht habe.“ George schüttelte in der Dunkelheit den Kopf. „Meinst du etwa, ich hätte mir darüber vorher Gedanken gemacht? Begeistert habe ich mich anfangs unentbehrlich gemacht und mit den Niederländern enge Kooperationscorps gegründet. Pah! Wirklich keiner hatte mir von seinen persönlichen Monstern erzählt. Erst als es mich dann verfolgte, nach dem Tod dieses kleinen Kerls nicht mehr losließ, dann haben einige rausgelassen, was ihnen zu schaffen macht, immer noch, immer wieder und noch Jahre nach dem jeweiligen Ereignis. Dass sie jede Nacht träumen, diese Schuld nie loswerden. Aber erst dann!“ Er stöhnte. „Wir wurden hier in England rekrutiert, gelobt, in Listen eingetragen. Dir wurde auf die Schulter geklopft und ich dachte, das wird ein besonderes Erlebnis, dieser Krieg. Mein Gott, wie naiv ich doch war! Und ich dachte, wenn Vater so ein genialer Admiral war, dann müsste ich diese strategische Ader für planvolle Kriegstaktik quasi in die Wiege gelegt bekommen haben! So war es ja auch! Jeder lobte, wie brillant meine Gedanken und meine Überlegungen bezüglich der Kriegsstrategien seien, und ich habe mich innerlich verflucht dafür, weil deshalb Menschen starben. Und dieses Sterben, wenn du es miterlebst… Charlie – es ist die Hölle!“ Er atmete schwer, schien kaum Luft zu bekommen. Charlie drückte sich noch enger an ihn, wollte ihm von ihrer Wärme abgeben.
„So viele Menschen…, die sterben mussten, weil ein Einzelner nicht genug bekommen konnte von seiner Macht! Es macht mich ganz krank, wenn ich daran denke, was dieser Krieg nun nach sich zieht!“ Charlie seufzte leise. „Ärzte, Schwestern, Soldaten, sie alle werden mit den Bildern ihrer Erinnerungen zu kämpfen haben. Da bist du nicht allein, George!“
Georges Hand suchte nach ihrer und drückte sie fest. „Du hast ein großes Herz, Charlie!“ „Das haben wir beide! Vermutlich macht uns all das Elend um uns herum deshalb auch so viel Kummer!“ Jetzt schniefte sie doch hörbar. „Ich habe meine Saison gehasst, George! Du unterwegs fürs Vaterland, dann all dieser Reichtum, all diese Falschheit und dieses grotesk-materielle Gebaren in London, während am Kontinent die Söhne, Väter und Ärzte sterben! George, nicht einer spricht mal aus, was er denkt. Mein Gott, welch Affront es war, als ich beim Dinner bei Lord Eldridge gewagt habe, mich über gesellschaftliche Reformen zu unterhalten!“ George entwich ein leises Lachen, während Charlie nur mit Mühe ein Gähnen unterdrückte.
„Du bist müde! Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Charlie! Geh lieber schnell in dein Bett zurück!“ Doch Charlie war schon eingeschlafen, was ihr gleichmäßiger Atem ihm bestätigte. Er musste wider Willen in der Dunkelheit lächeln.
Seine kleine Lieblingsschwester war nicht gemacht für die Londoner Salons. Sie war gemacht für ein offenes Wort, Ehrlichkeit und Mut. Das alles wollte die feine, englische Gesellschaft nicht und Charlie musste darunter bestimmt leiden. Aber ein beschädigter Kerl wie er, konnte sich keine bessere Schwester wünschen als eben diese!
Als Lady Emilia mit einem Hausmädchen zusammen am nächsten Morgen gegen sieben Uhr das Zimmer ihres Sohnes betrat, staunte sie nicht schlecht, Charlie in ihrem Morgenrock neben George vorzufinden. Beide schliefen noch tief und fest, sodass sie als Mutter nicht umhinkonnte, die Geschwister lächelnd zu betrachten. Sacht berührte sie ihre Tochter an der schmalen Schulter. „Charlotte!“ Das Mädchen öffnete fast sofort die Augen, blickte sich verwundert um und hielt dann einen Finger an seine Lippen. Es kletterte vorsichtig aus dem Bett, um dann auf Zehenspitzen zur Tür zu huschen, dicht gefolgt von Lady Emilia. Auf dem Korridor hielt Charlie inne. „Ich bin gestern Nacht noch kurz in der Küche hinuntergegangen, weil ich so Durst bekommen hatte und in meinem Zimmer der Wasserkrug leer war. Auf dem Rückweg habe ich George schreien hören. Also bin ich zu ihm reingegangen, Mutter. Er hatte schlecht geträumt und irgendwie erschien es mir wichtig, mit ihm über seinen Traum zu reden. Irgendwann muss ich eingeschlafen sein.“ Ihre Mutter nickte verständnisvoll. Sie schien immer noch sehr besorgt. „Mir ist bewusst, dass George nachts schlecht schläft und von schrecklichen Alpträumen geplagt wird. Die ersten Nächte habe ja ich neben seinem Bett gewacht und ihn beruhigt, sobald er aufgeschreckt ist. Aber die letzten drei Tage war auch dein Vater von immensen Schmerzen geplagt, sodass ich beschlossen hatte, in dessen Zimmer zu nächtigen.“ Beunruhigt sah sie ihrer Tochter in die hellblauen Augen, die von der Iris ausgehend von ungewöhnlichen dunkelgrauen Strahlen durchzogen waren. „Ach, Mama, gib mir doch nächstes Mal Bescheid, wenn du das Gefühl hast, dich nicht aufteilen zu können. Ich kann doch ohne Probleme ein Nachtlager auf Georges Boden einrichten oder es mir auf seinem Sofa gemütlich machen! Du kannst doch die ganzen Kranken nicht alleine versorgen! Und ich habe mal wieder nur an mich gedacht und kein Stück weiter. Entschuldige!“ Lady Emilia lächelte ihre Tochter dankbar an. „Es ist schon alles in Ordnung so, Charlie. Aber ich brauche deine Hilfe bei der Verwaltung der Ländereien. In diesem Zustand kann George doch nicht nach den Pächtern und den Ländereien sehen oder sich um die Investitionen kümmern. Und ich habe von diesen Dingen so gar keine Ahnung!“ Sie schüttelte verzweifelt den Kopf. „Und ehrlich gesagt traue ich diesem Verwalter - war nicht Langston sein Name? – überhaupt nicht über den Weg! Wir müssen uns nach einer Möglichkeit umsehen, hier Unterstützung zu bekommen.“ Während Charlie wie mechanisch nickte, rubbelte sie sich frierend die Arme. „Ich ziehe mir nur kurz was an, Mutter. Treffen wir uns gleich im Frühstücksraum.“