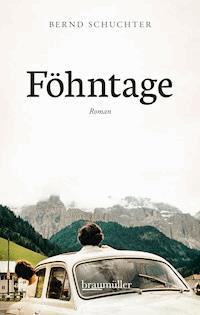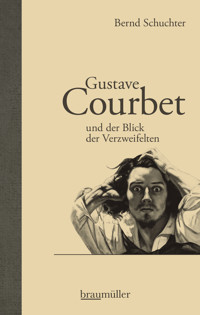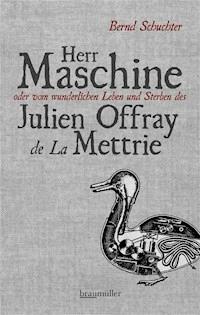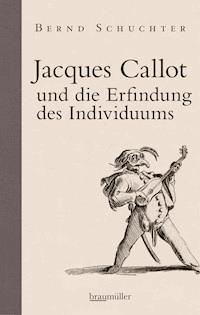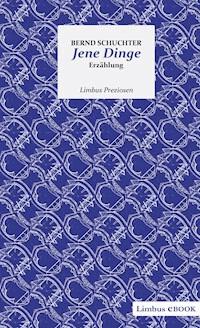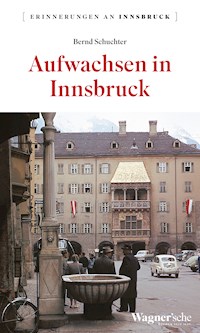
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universitätsverlag Wagner
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Erinnerungen an Innsbruck
- Sprache: Deutsch
Eine Reise in die Vergangenheit Innsbrucks - lebendig in persönlichen Erinnerungen!"Langsam durch belebte Straßen zu gehen, ist ein besonderes Vergnügen. Man wird überspült von der Eile der andern, es ist ein Bad in der Brandung." (Franz Hessel)Franz Hessel mit Spazieren in Berlin steht ebenso Pate wie Walter Benjamin mit Stadt des Flaneurs, wenn Bernd Schuchter über sein Aufwachsen in Innsbruck nachdenkt. Wie kaum eine andere Stadt ist Innsbruck ein Refugium des Spaziergängers, dem Flanieren zur Kunst wird. So sehr sich Innsbruck in den letzten Jahrzehnten auch gewandelt hat, die Altstadt mit ihren Gassen, Läden und versteckten Orten hat sich wenig verändert - vor allem nehmen alle Innsbrucker an ihr Anteil, kommen sie auch ursprünglich aus Hötting, Wilten, dem Saggen oder Pradl. Das Herz der Stadt gehört all jenen, die es flanierend erkunden. Bernd Schuchter unternimmt in Aufwachsen in Innsbruck auch einen Gang in die Vergangenheit, in ein altes Innsbruck mit seinen verschwundenen Geschäften und Plätzen, erinnert an berühmte Jugendhäuser oder Sozialprojekte, erzählt von Hausbesetzungen und dem naiven Zugang zur Welt in vordigitalen Zeiten - und besucht Orte, die sich erhalten haben und ihren Teil zum Gedächtnis der Stadt beitragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ERINNERUNGEN AN INNSBRUCK
Band 6:
Bernd Schuchter
Aufwachsen in Innsbruck
Für Hubert, den letzten Stadt-Cowboy Innsbrucks, der wie kein anderer die unendliche Prärie der Fantasie durchreitet
Den Flanierenden leitet die Straße in eine
entschwundene Zeit. Ihm ist eine jede abschüssig.
Sie führt hinab, wenn nicht zu den Müttern,
so doch in eine Vergangenheit, die um so bannender
sein kannals sie nicht seine eigene, private ist.
Dennoch bleibt sie immer Zeit einer Kindheit.
Walter Benjamin
Vorrede
Es gab einmal eine Zeit, da war Innsbruck noch nicht Weltstadt. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, und den Jüngeren und Unerfahrenen kommen die Geschichten von früher wie Mythen aus längst vergangenen Zeiten vor, wie Erzählungen über eine im Nebel des Vergessens abgelegte, längst untergegangene Zivilisation, deren karge Reste man heute noch im Museum bestaunen kann. Dabei ist das zwanzigste Jahrhundert noch gar nicht so lange her …
Als das Buch Spazieren in Berlin von Franz Hessel 1929 erschien, war das die Geburtsstunde einer neuen Gattung Mensch, des Vorgängers des heutigen Stadtbenutzers, eines Wesens, das nicht mehr willenlos durch die Häuserfluchten hastete, sondern sich gewandt und gut gekleidet auf den Straßen bewegte, um zu sehen, mehr noch aber, um gesehen zu werden. Er war ein Bruder des Dandys und ein Schwager des Snobs, und mit beiden gemeinsam hatte er die Verachtung für die gehetzte Eile des modernen Großstädters. Seine Attitüde war zugleich Verweigerung und Ausdruck eines Stils, den man auch heute wieder pflegen sollte. Die Rede ist vom Flaneur und von seiner Art, sich eine Stadt zu ergehen. Nicht anders als flanierend sollte man einen Raum erkunden, und Innsbruck, die Stadt der kurzen Wege, eignet sich bestens dazu.
Innsbruck ist – seiner Weltstadt-Attitüde zum Trotz – keine Metropole, aber zumindest die Altstadt ist zu touristischen Hochzeiten ein Gewusel aus Menschen, das keinen Vergleich zu scheuen braucht. Ob man unter den vielen Menschen aber auch nur einen einzigen Innsbrucker treffen kann, ist mehr als ungewiss. Ein Spaziergang ist mit den Worten von Franz Hessel aber vielleicht lohnenswert: „Langsam durch belebte Straßen zu gehen, ist ein besonderes Vergnügen. Man wird überspült von der Eile der andern, es ist ein Bad in der Brandung.“
Annäherung
Jede Stadt ist voller Erinnerungsorte für die Menschen, die in ihr leben. So auch für mich. Über die Jahre habe ich mir mein Innsbruck nicht nur ergangen, sondern vor allem auch erfahren; insbesondere die Straßenbahnlinien 1 und 3 durchziehen mit ihren verästelten Gleiswegen wie Adern die Stadt. Innsbruck ist aber nicht nur eine Stadt der kurzen Wege, sondern auch der Baustellen: Seit Jahrzehnten werden vorzugsweise in den Sommermonaten mit beharrlicher Leidenschaft die Straßen aufgerissen. Dazu kommen die nicht enden wollenden Renovierungen der Hausfassaden bis hin zu den großen Bauvorhaben wie dem Kaufhaus Tyrol, den Rathausgalerien oder dem Haus der Musik.
Auch die Straßenbahnen fahren nicht immer auf denselben Gleisen, sondern wechseln teils schneller ihre Routen, als die Innsbrucker Verkehrsbetriebe die neuen Netzpläne drucken können. Ob die Dreier nun über die Museum- oder die Anichstraße geführt wird, scheint manchmal von den Jahreszeiten abzuhängen, und die Route des Sightseer, mit dem man als Tourist die Stadt erkunden kann, orientiert sich oft nur entfernt an den Vorgaben des Audioguides, der die monatlich wechselnden Baustellen natürlich nicht berücksichtigen kann. Im Zweifelsfall untermalt die Hintergrundmusik die fehlende Aussicht auf der geänderten Route. Es ist fraglich, ob die Regionalbahn, so sie irgendwann fertiggestellt wird, die für sie vorhergesehenen Trassen befahren wird, und für wie lange.
Als ich ein Kind war (und bis weit in meine Jugend hinein), wurde jedenfalls die Straßenbahnlinie 3, die damals nur die Stadtteile Pradl und Amras mit der Innenstadt verband, über den Hauptbahnhof bis in die Maria-Theresien-Straße geführt. Dort, wo heute die Flaneure nur auf die sie überholenden Radfahrer achten müssen, herrschte seinerzeit noch Verkehr bis zum Eingang zur Altstadt. Anstelle der Fußgängerzone samt Straßencafés, Pflastersteinen und goldenen Laternen war der Boulevard auch für den Straßenverkehr offen, der sich um die Insel der Straßenbahnhaltestelle auf Höhe der alten Spitalskirche schob. Danach bog die Tram in die Museumstraße ein und fuhr in Richtung der alten Dörfer Pradl und Amras.
Auf Innsbrucks Prachtboulevard herrschte immer schon mächtig viel Verkehr, per Bus, Bahn und zu Fuß. (Foto: Stadtarchiv)
Und eine Tram war die Dreier in meiner Kindheit tatsächlich noch: altbacken und ein wenig verstaubt, und dabei gibt es noch ältere Garnituren, die an manchen Tagen als Reminiszenz an früher heute noch fahren, mit ihrem Aufstiegspodest im Freien und den antiquierten Sitzen. Die Garnituren meiner Kindheit hatten den Charme der Wirtschaftswunderjahre und rochen nach parfümierten älteren Damen mit beigen Strümpfen oder wahlweise nach Tapeten, die die Achtzigerjahre-Kinderzimmer meiner Generation noch zierten, nach Tapetenkleister vielmehr, der auf die langen Bahnen aufgetragen wurde, die in Heimwerkermanier – lange vor der Ansiedlung der großen Baumärkte am Stadtrand – mehr oder weniger fachmännisch auf die Wände der meist viel zu kleinen, aber immerhin gemeinnützigen Stadtwohnungen irgendwo in Pradl aufgezogen wurden. Das Fluchen des Vaters, wenn sich wieder einmal eine Bahn heillos verknotete und dadurch unbrauchbar wurde. Ein Geduldsspiel mit ungewissem Ausgang, bei dem man – je länger diese langen Nachmittage dauerten – immer nachsichtiger mit etwaigen Blasen und Wellen unter den Tapetenbahnen mit ihrem Ornament- oder Blumenmuster wurde.
Aber wann fuhren wir schon in die Altstadt, als ich Kind war? In meinen ersten paar Lebensjahren wohl nicht so regelmäßig, außer im Advent einmal zum Christkindlmarkt. Wir nutzten die Straßenbahn natürlich für die vielen Ausflüge und Wanderungen, die ich unter der Woche mit meiner Mutter und ihren Freundinnen unternehmen musste, um in der Innenstadt aber nur umzusteigen, etwa in die Einser-Straßenbahn, dann weiter zum Stift Wilten, wo man die „Igler“ erwischen konnte, die Straßenbahnlinie 6 nach Aldrans und weiter über den Lanser See bis nach Igls. Aber bis ins Dorf fuhren wir nie. Oder wir fuhren zum alten Hauptbahnhof mit seiner weithin sichtbaren Uhr, um in die Stubaitalbahn zu wechseln und nach Natters zu fahren. Durch den Wald spazierten wir hinauf zum Gasthaus Natterer Boden, der damals noch nicht diesen leicht schäbigen Streichelzoo zur Schau stellte. Retour ging es dann zu Fuß über schmale Wurzelwege ins Tal, vorbei an der alten Sprungschanze, die man durch den Wald aufragen sah. Oder wir fuhren mit der Dreier in die Maria-Theresien-Straße, um in irgendeinen Bus umzusteigen (was weiß ein Kind schon von Buchstaben und Zahlen), der bis zum Großen Gott fuhr. Leichtes Schaudern beim Ausstieg, aber eine Kindheit lang nie einen großen Gott gesehen oder getroffen, lieber im Laufschritt weiter und vorbei an den letzten Wohnblöcken, um hinauf zum Planötzenhof zu wandern, um zum ersten Mal im Gasthaus eine saure Wurst zu essen (für Nichttiroler ebenso wie ein marinierter Graukas eher eine lukullische Perversion als eine Gaumenfreude). Eine Prägung fürs Leben und eine lebenslange Vorliebe für saure Speisen. Vielleicht auch weiter durch die Wälder und hinunter bis zum Gasthaus Schießstand, weiter, hinab nach Hötting, wo – kurz bevor man die ersten Häuser erreicht – ein Hohlweg links nach oben zu einem weiteren Gasthaus führte. Auch dort Saft und Kuchen und als Kind der erste Zug an der Zigarette einer Freundin meiner Mutter, da man doch ausprobieren will, womit sich die Erwachsenen so intensiv beschäftigen.
Ansonsten waren die Wege in Pradl, in Stadtnähe, überschaubar: zu Fuß nach Amras zum Rodelhügel nahe der Autobahn, zu Fuß in den nahen Rapoldipark auf den Spielplatz. Den Sillpark gab es noch nicht. Das Privileg, den wohl kürzesten Schulweg aller Volksschulkinder zu haben, vielleicht dreißig Meter von Tür zur Tür. Dennoch kam ich oft zu spät, wofür ich nach dem Unterricht nachsitzen musste, vielleicht auch wegen anderer Vergehen. Auch hier eine lebenslange Prägung, ein entschiedenes Misstrauen den Morgenstunden gegenüber.
Später dann mit dem Fahrrad zum Reithmanngymnasium, vielleicht fünf Minuten Fahrt, höchstens zehn, und auch hier das Talent, ständig zu spät zu kommen. Das Versteckspiel mit dem Direktor, der alle Kinder noch nach Jahrzehnten beim vollen Namen kannte, als lernte er in seiner Freizeit die Listen seiner Schülerinnen und Schüler als Vorbereitung für Wetten, dass …? wieder und wieder auswendig. In der Schule auch der heimliche Neid auf die Schlüsselkinder, die schon einen eigenen Haus- und Wohnungsschlüssel hatten, so viel größer und reifer wirkten. Seltsam, denn die Schlüsselkinder selbst bedauerten sich eher, genau wie jene, die nachmittags in einen Hort gehen mussten, weil die Eltern in der Arbeit waren, aber man bewundert oft jene Dinge, die man selbst nicht hat, deren Fehlen aber eigentlich kein Mangel ist. Auf mich wartete mittags zu Hause ein warmes Essen auf dem Tisch, an manchen Tagen aber nur der Restmüll-Sack vor der Wohnungstür und der nervige Gang zu den Müllhäuseln, noch ehe ich die Wohnung betreten hatte.
Die Schwierigkeit, sich am Heimweg zu vertrödeln, da die Wege ja so kurz waren. Plaudereien an der Ecke zur Schutzengelkirche, viele Schulkollegen wohnten in der Gumppstraße. Ansonsten langweiliges Radeln durch Wohngebiet, keine Abwechslung, keine Läden, an deren Schaufenster man sich die Nase platt drücken konnte wie die Kinder in der Folge von Pippi Langstrumpf, die damals im Fernsehen lief, als das „stärkste Mädchen der Welt“ mit ein paar Goldmünzen den Süßigkeitenladen leerkauft und dann die Bonbons, Gummistangen und die vielen anderen Leckereien mit allen Kindern der Stadt teilt. Auf meinem Heimweg gab es nur die kleine Bäckerei in der Türingstraße oder vielleicht die Gärtnerei am Roß-Sprung in der Egerdachstraße – mäßig spektakulär. Als Kind wusste ich nichts von der Sage, die sich um den Roß-Sprung und die zwei markanten Grenzsteine rankt. Nach der soll an dieser Stelle ein Edelknabe bei dem Versuch verunglückt sein, mit seinem Pferd einen Kanal, der das Wasser des Amraser Sees ausleitete, zu überspringen. Nach der Geburt eines Sohnes durch die ebenso schöne wie bei den Tirolern beliebte Philippine Welser, die mit ihrem Gemahl Erzherzog Ferdinand II. auf Schloss Ambras residierte, sollten zwei Boten in die Stadt reiten, um die frohe Kunde der Geburt eines Erben anzuzeigen. Jeder der beiden wollte Erster sein, und der besagte Edelknabe versuchte sich durch den Sprung über den Kanal einen Vorsprung zu verschaffen, was ihm auch gelungen wäre, doch sowohl Reiter als auch Pferd brachen nach dem Sprung tot zusammen. Der Reiter, so die Sage, ist heute vergessen, das Pferd aber wurde unsterblich, indem es ausgestopft in der Wunderkammer von Schloss Ambras zum Gedenken aufbewahrt wurde und bis heute zu bestaunen ist.
Wie sehr bewunderte ich meine Schulkollegen, die über die Stadt verstreut wohnten und wie selbstverständlich nach der Schule den Weg zur Bushaltestelle in der Reichenauer Straße nahmen, um in Grüppchen auf die auch damals schon überfüllten Busse der Linie O zu warten, die in meiner Jugend eine Zeitlang tatsächlich als Oberleitungsbusse mit Strom betrieben wurden, was ihrem Namen weit mehr entsprochen hätte: „Oberleitungs-Bus“ anstatt „Bus Richtung Olympisches Dorf“, kurz O-Dorf. Die Neunzigerjahre des vorigen Jahrhunderts waren ja einer der Höhepunkte einer Utopie des korrekten Lebens, Vorläufer der Political Correctness, als die Grünen-Bewegung in der Mitte der Gesellschaft angekommen war und die Kinder und Jugendlichen auf Antifaschismus und Gendergerechtigkeit geeicht wurden, auch wenn man Letzteres damals noch nicht so nannte. Der Softie als zeitaktuelles Klischeebild des wahren Mannes war Vorbild in einer Zeit, in der die Frauen mit ihren Schulterpolstern selbst die breiten Schultern hatten, die die Frauen früherer Generationen so bereitwillig beim anderen Geschlecht gesucht hatten. 1992 jährte sich auch die Eroberung Amerikas zum fünfhundertsten Mal, und keine Schule zwischen Innsbruck und Landeck, die dieses Ereignisses nicht in kritischer Weise gedacht hätte, nämlich als Diskurs einer kolonialen Selbstgerechtigkeit, in dessen Verlauf es nur natürlich ist, heute – in der damaligen Moderne – auf Seiten der Entrechteten und Verfolgten zu stehen. Der Genozid an den amerikanischen Ureinwohnern vermengte sich stilvoll mit der antinazistischen Gesinnungstheologie einer Generation von Junglehrern, die als Erben der 68er-Generation im Alltag dem Dünkel der Altnazis, die ebenfalls noch unterrichteten, entgegentreten mussten. Mit Schaudern erinnere ich mich an einen Sport- und Geografielehrer, der nie anders als im braun-beigen Zweiteiler zum Unterricht erschien, ein Zwitter zwischen Turnanzug und Alltagshose samt Oberteil, und der aus seiner Gesinnung keinen Hehl machte. Wie naiv das gutgemeinte Multikulti-Gedöns der einen Seite eines Tages wirken sollte, konnte man damals erst erahnen; dass aber der innen wie außen braungewandete Lehrkörper von gestern war, war uns Schülern immer bewusst. Legendär waren seine geografischen Ausführungen anhand der Landkarten, die man zu Stundenbeginn aus der Requisite nahe dem Konferenzzimmer holen musste; mit einem ausziehbaren Teleskopstab verlieh der beige Ewiggestrige seinen Ausführungen Nachdruck, und wehe, wenn ein vor die Klasse zitierter Prüfling eine Antwort nicht wusste – dann rauschte die zur Gerte mutierte Teleskopstange wahlweise auf Hände, Bauch oder Kopf nieder.
Wie dankbar wir waren, wenn wir nach dem Unterricht aus der Schule branden durften und die Gischt uns in die Stadt spülte. Mich führte der Weg meist nur in den dunklen Radlkeller, wo ich über die Jahre mit unterschiedlichen Schlössern diverse Kämpfe ausfocht, nicht nur im Winter, wenn die Temperaturen sie einfrieren ließen. Einmal aber, ich erinnere mich noch genau, begleitete ich – ins Gespräch vertieft, worüber, weiß ich nicht mehr – einen Schulkameraden zur R-Bus-Haltestelle in der Reichenauer Straße und stieg schließlich mit ihm in den Bus. In die Innenstadt, allein der Klang war wie ein Versprechen.
Vordergründig war uns daran gelegen, unser Gespräch fortzuführen – weiterreden, weiterquatschen. Worüber wir uns wohl unterhalten haben? Über die beginnende Snowboarderszene auf der Nordkette vielleicht, die damals noch ein Minderheitenprogramm war? Wohl kaum. Eher zeigten wir uns, kaum dreizehnjährig, irritiert darüber, dass es bei den Mädchen chic war, riesengroße Plastikschnuller um den Hals zu tragen. Damals, man kann es nicht anders sagen, war die jeweilige Mode noch nicht in der Postmoderne abgelegt, sondern wurde ernst genommen. Wie etwa der Trend, der durch einen Song von zwei Minderjährigen aus Atlanta, Georgia, ausgelöst wurde: Das Markenzeichen von Kris Kross war, ihre Klamotten verkehrt herum zu tragen, wobei es schwierig war, das mit unserer Kleidung nachzuahmen. Immerhin versuchten wir es in diesen politisch harmlosen Zeiten tief in den Neunzigerjahren in einer Schule in Innsbruck. Die Welt, die große weite, ahnten wir damals, war sehr weit weg.
Für ein Vorstadtkind konnte selbst eine Fahrt mit den Oberleitungs-Bussen in die Innenstadt ein Abenteuer bedeuten. (Foto: Stadtarchiv)
Bereitwillig jedenfalls begleitete ich meinen Klassenkameraden und fuhr in die Innenstadt; aufregend war es, weil es verboten war – ich hätte ja gleich heimgehen sollen. Dennoch stand ich wie die anderen Schüler verschwitzt und mit zu schwerer Schultasche im Gelenk des R-Busses, bis wir irgendwann ankamen in der Anichstraße, am Rand der Inneren Stadt gegenüber der Klink, im Eckhaus, in dessen Erdgeschoß eine Konditorei war, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, was sehr wahrscheinlich ist.
Für einen Moment konnte ich eine andere Welt erleben, als ich mit meinem Freund in seine Wohnung ging; eine Bürgerwohnung mit langen Gängen und großen Zimmern, Altbau, hohe Räume; nie zuvor hatte ich erlebt, dass man auch so leben konnte, kannte ich doch nur die beengten Gemeindebauten der Vorstadt. Beschämt verabschiedete ich mich, da ich mich jetzt doch fragte, wie ich heimkommen sollte. Bereits zuvor im Bus war mir eingefallen, dass ich nicht wie meine Klassenkameraden ein Freifahrtticket besaß, sondern schwarzgefahren war. Ich war nicht nur kein Schlüsselkind, sondern ich war auch nicht berechtigt, kostenlos in die Innenstadt zu fahren. Das sollte sich in den nächsten Jahren grundlegend ändern.
Und die Fahrten mit der Dreier in die Innenstadt? Dienten, wenn nicht zum Umsteigen, in erster Linie dazu, einen gewissen Zahnarzt am Sparkassenplatz zu besuchen, dessen Künste vage beschrieben bleiben müssen, denn damals schickte man Patienten noch mit Lachgas in ein Reich der Freude. Wie ein Traum waren für mich die Sitzungen bei jenem Arzt, der anderen wohl ein Trauma fürs Leben beschert hat. Ich habe jedenfalls nur eine vage Erinnerung an Farben und Töne und an den anschließenden Besuch mit meiner Mutter im Kaufhaus Tyrol, wo ich zur Belohnung ein kleines Spielzeug bekam; aber das ist eine andere Geschichte.