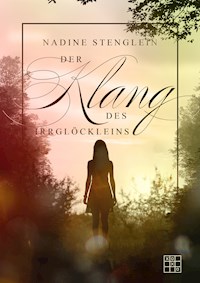6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Einführungspreis: 6,99€ statt 8,99€ Gesamtausgabe der Aurora-Sea-Reihe! Aurora Sea - Das Geheimnis des Meeres Das Raunen des Meeres: Romantisch, fantastisch und spannungsgeladen! Vor Jahren verschwand das Flugzeug, in dem Emmas Eltern saßen, spurlos über dem Meer. Eine Weile später wiederholt sich ein solches Ereignis. Emma wohnt seit dem Verlust ihrer Eltern bei ihrer Tante Mathilda auf Sylt und erhält plötzlich SMS-Nachrichten von einem gewissen Jamie, der behauptet Passagier der letzten Unglücksmaschine gewesen zu sein. Als sie Jamie später auf einer geheimnisvollen Insel trifft, die wie aus dem Nichts mitten im Meer auftaucht, erfährt sie, dass in den Tiefen des Meeres Gefahren lauern, die nicht nur ihr zum Verhängnis werden sollen. Zudem hat es sich der junge Evenfall, ein Meereswesen, in den Kopf gesetzt, Emma um jeden Preis zu seiner Gefährtin zu machen... Aurora Sea - Die Legende der Avarthos Emma ist glücklich mit Jamie. So oft sie können, treffen sie sich auf ihrer Koralleninsel. Doch der Friede trügt. Evenfall bekommt unerwartete Unterstützung, und erneut bedrohen die Avarthos die Menschen von Sylt. Zur selben Zeit freundet sich Emma mit Tim an, der seinen Vater ebenfalls bei einem der Flugzeugabstürze verloren hat. Als sie ihn in ihre Geheimnisse einweihen muss, bringt das nicht nur sein Leben in Gefahr. Können die Freunde – die lebenden und die toten – die Gefahr gemeinsam abwenden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Kurzbeschreibung: Aurora Sea - Das Geheimnis des Meeres: Das Raunen des Meeres: Romantisch, fantastisch und spannungsgeladen! Vor Jahren verschwand das Flugzeug, in dem Emmas Eltern saßen, spurlos über dem Meer. Eine Weile später wiederholt sich ein solches Ereignis. Emma wohnt seit dem Verlust ihrer Eltern bei ihrer Tante Mathilda auf Sylt und erhält plötzlich SMS-Nachrichten von einem gewissen Jamie, der behauptet Passagier der letzten Unglücksmaschine gewesen zu sein. Als sie Jamie später auf einer geheimnisvollen Insel trifft, die wie aus dem Nichts mitten im Meer auftaucht, erfährt sie, dass in den Tiefen des Meeres Gefahren lauern, die nicht nur ihr zum Verhängnis werden sollen. Zudem hat es sich der junge Evenfall, ein Meereswesen, in den Kopf gesetzt, Emma um jeden Preis zu seiner Gefährtin zu machen...
Kurzbeschreibung: Aurora Sea - Die Legende der Avarthos: Emma ist glücklich mit Jamie. So oft sie können, treffen sie sich auf ihrer Koralleninsel. Doch der Friede trügt. Evenfall bekommt unerwartete Unterstützung, und erneut bedrohen die Avarthos die Menschen von Sylt. Zur selben Zeit freundet sich Emma mit Tim an, der seinen Vater ebenfalls bei einem der Flugzeugabstürze verloren hat. Als sie ihn in ihre Geheimnisse einweihen muss, bringt das nicht nur sein Leben in Gefahr. Können die Freunde – die lebenden und die toten – die Gefahr gemeinsam abwenden?
Nadine Stenglein
Aurora Sea - Gesamtausgabe
Roman
Edel Elements
Edel Elements
- ein Verlag der Edel Verlagsgruppe GmbH
© 2022 Edel Verlagsgruppe GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2022 by Nadine Stenglein
Covergestaltung: Edel Elements
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-432-5
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
Kurzbeschreibung
Das Raunen des Meeres: Romantisch, fantastisch und spannungsgeladen! Vor Jahren verschwand das Flugzeug, in dem Emmas Eltern saßen, spurlos über dem Meer. Eine Weile später wiederholt sich ein solches Ereignis. Emma wohnt seit dem Verlust ihrer Eltern bei ihrer Tante Mathilda auf Sylt und erhält plötzlich SMS-Nachrichten von einem gewissen Jamie, der behauptet Passagier der letzten Unglücksmaschine gewesen zu sein. Als sie Jamie später auf einer geheimnisvollen Insel trifft, die wie aus dem Nichts mitten im Meer auftaucht, erfährt sie, dass in den Tiefen des Meeres Gefahren lauern, die nicht nur ihr zum Verhängnis werden sollen. Zudem hat es sich der junge Evenfall, ein Meereswesen, in den Kopf gesetzt, Emma um jeden Preis zu seiner Gefährtin zu machen...
Nadine Stenglein
Aurora Sea
Das Geheimnis des Meeres
Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2021 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2021 by Nadine Stenglein
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Ashera
Covergestaltung: Designomicon, München
Lektorat: Tatjana Weichel
Korrektorat: Jennifer Eilitz
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-375-5
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
Spurlos
Mit einem Wort: Hör nie auf mit diesen drei Dingen: Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wisse, dass das Größte dieser drei Dinge immer die Liebe sein wird.
– Apostel Paulus –
Seit das Flugzeug meiner Eltern vor ein paar Jahren über dem Atlantik auf mysteriöse Weise verschwunden war, hegte ich ein großes Unbehagen dem Meer gegenüber. Nun ließ ich zum ersten Mal seit langer Zeit seine Wellen so nahe an mich herankommen, dass die auslaufende Gischt meine Füße überspülte. Ein Frösteln überlief meinen Körper, schien ihn mit Eiskristallen zu übersäen.
Nichts hatte sich geändert. Im Grunde wusste ich, dass ich dem Meer keine Schuld geben konnte, dennoch waren mir sein Schweigen, seine Unergründlichkeit und seine Weite, die ich früher geliebt hatte, unheimlich geworden.
Denn ich war mir sicher, dass Mom und Dad zusammen mit den anderen Passagieren zu Gefangenen seiner Tiefe geworden waren. Schon oft hatte ich davon geträumt. Nachtfantasien, in denen ich ihre aufgerissenen Münder sah, aus denen anstatt verzweifelter Schreie Wasserblasen stiegen, die mit mir zurück zur Oberfläche trieben. Jedes Mal versuchte ich, bei Mom und Dad zu bleiben, nach ihnen zu greifen und sie mit mir zu nehmen, doch ich schaffte es nie. Der Meeresboden, in dem das Flugzeug feststeckte, hielt sie fest, als wären sie mit ihm wie durch unsichtbare Seile verbunden.
Ich zog den Reißverschluss meiner Jacke bis zum Kinn und blickte über das Meer hinweg in das Abendrot, das sich über dem Sylter Wattenmeer ausdehnte.
Früher hatte ich Tante Mathilda oft mit meinen Eltern besucht. Nun wohnte ich bereits seit fünf Jahren bei ihr. Sie war die einzige Verwandte, die ich noch hatte, und ich war ihr mehr als dankbar, dass sie mich nicht in ein Heim gesteckt hatte, als meine Eltern verschwanden. Ich biss mir auf die Zunge, um die Tränen zu unterdrücken.
Heute war Moms Geburtstag, den wir mit Sicherheit groß gefeiert hätten. Es war ein runder, ihr vierzigster. Ich warf eine Kusshand Richtung Himmel, da hörte ich die Stimme meiner Tante hinter mir.
»Der Sand ist doch viel zu kalt, Emma!«
Sie hatte recht, also wischte ich mir die Sandkörner von den Füßen und schlüpfte in meine Turnschuhe, ging ein paar Schritte zurück und drehte mich zu ihr um. Sie stand, bepackt mit einem Korb voller Wäsche, auf der Holzveranda ihres kleinen, blau gestrichenen Hauses mit den weißen Fensterläden, und blickte nachdenklich in meine Richtung.
Der Wind wirbelte ihre kurzen blonden Locken durcheinander und umtanzte ihren zierlichen Körper. Mein Herz schlug schneller. Sie sah meiner Mutter ähnlich, die beiden hätten Zwillinge sein können. Ich liebte sie von ganzem Herzen. Sie war eine sanftmütige Person. Auch das hatte sie mit Mom gemein, wenngleich sie nach außen hin manchmal ein bisschen schroffer wirkte.
»Alles okay?«
Ich nickte und setzte ein Lächeln auf, damit sie sich keine Sorgen machte. »Ich helfe dir mit der Wäsche«, entgegnete ich.
»Brauchst du nicht, Emma. Ist nicht viel. Das schaff ich schon. Geh du lieber mal wieder nach Tinnum zu deinen Freunden. Das wird dir guttun. Mel hat vorhin angerufen, sie vermisst dich schon«, gab sie zurück und verschwand dann nach drinnen.
Der Gedanke, mal wieder mit meiner Freundin zu quatschen, war nicht schlecht, doch heute blieb ich lieber allein und schickte den Wellen noch einen Geburtstagsgruß für Mom hinterher, den sie vielleicht sogar zu ihr tragen würden. Danach lauschte ich dem Tosen der See, während der Wind noch einen Tick kühler wurde und über mein Haar strich, als wolle er mich aufheitern.
Mein Blick verlor sich in den wogenden Wellen, und dann glaubte ich, ihn wieder zu hören, diesen melancholischen und zugleich wunderschönen Gesang, der von der Gischt zu mir getragen wurde.
Ich atmete so leise wie nur möglich, aus Angst, ihn wieder zu vertreiben, und hielt ganz still. Dieses Mal war er intensiver als sonst, und mir war, als wolle er mich anlocken. Ich war mir sicher, sicherer denn je, dass dieser Gesang real war. Ich bildete mir das nicht ein. Schnell machte ich kehrt und rannte auf das Haus zu.
»Tante Tilli?«
Ich eilte durch die liebevoll im Landhausstil eingerichteten Zimmer, in denen mir jeder Winkel vertraut war. Schließlich fand ich Tante Tilli, wie ihre Freunde und ich sie gerne nannten, in ihrem kleinen Bügelzimmer zwischen roséfarbenen Bettlaken. Das Zimmer hatte früher mal als Vorratskammer gedient.
Tilli blies sich eine ihrer Locken aus der Stirn und hob den Blick. In ihren wasserblauen Augen lag ein besorgter Ausdruck. »Ist was passiert? Du bist ja ganz bleich.«
Ich ergriff ihre Hände. »Der Gesang. Er ist wieder da. Komm schnell!«
»Und ich dachte schon sonst was.« Tante Mathilda stellte das Bügeleisen ab und folgte mir mit einem Seufzen.
»Er ist lauter als sonst. Dieses Mal wirst du es auch hören, bestimmt. Ich bilde es mir nicht ein«, flüsterte ich. Meine Stimme überschlug sich vor Aufregung.
Zurück am Strand musste ich feststellen, dass der Gesang nicht mehr zu hören war. Trotzdem hielt ich gespannt die Luft an, während wir zusammen lauschten. Und tatsächlich kehrte der mystische Gesang zurück. Nirgends zuvor hatte ich derart klare, helle und gleichzeitig traurige Stimmen gehört.
Gespannt beobachtete ich meine Tante. Ihre Mimik wirkte angestrengt. Dann schüttelte sie den Kopf und lockerte sich. »Tut mir leid, Emma. Ich höre nichts außer dem gewohnten Rauschen des Meeres.«
Das konnte sie doch unmöglich überhören. Enttäuscht starrte ich sie an, aber ihr Blick war eindeutig. Sie vernahm nicht einen Ton.
Meine Tante sah mich mitfühlend an. »Das Meer hat dieses Lied, das du zu hören glaubst, wohl allein für dich geschrieben, Emma. Aber manchmal spielen uns auch die Sinne einen Streich.«
»Ich bilde es mir nicht ein!«, wiederholte ich eindringlich, während meine Tante mir sanft über den Rücken strich.
»Wir sollten Doktor Morton anrufen. Ich meine, vielleicht sind auch die Tabletten dran schuld. Er hat ja gesagt, dass sie leichte Wahnvorstellungen hervorrufen können.«
Vehement schüttelte ich den Kopf, bückte mich, hob ein wenig Sand auf und ließ ihn durch meine Finger rieseln. »Ehrlich gesagt hab ich noch keine einzige von diesen komischen Pillen geschluckt. Ich brauch sie nicht. Sie können mir Mom und Dad auch nicht wiederbringen.«
Tilli verzog einen Mundwinkel. »Aber sie können dir ein wenig innere Ruhe verschaffen«, räumte sie ein.
Daran glaubte ich nicht. Minutenlang lag Stille zwischen uns und allmählich verebbte der Gesang wieder.
»Jetzt haben sie aufgehört zu singen«, sagte ich.
Tilli presste kurz die Lippen aufeinander. »Ich glaub dir ja, dass du sie wirklich hörst. Ich weiß nur nicht, was ich dazu sagen soll. Ich halte dich nicht für verrückt oder dergleichen. Aber es macht mir Sorgen.«
Mein Blick schweifte erneut aufs Meer hinaus. »Das will ich nicht, Tante Tilli. Dass du dir Sorgen machst.«
Sie legte einen Arm um mich und drückte mich an sich. Ihr entwich ein leises Seufzen. »Ach, Emma. Ich wünschte, ich könnte sie dir zurückbringen. Ich vermisse sie auch, sehr sogar.«
Ich atmete tief durch. »Es ist halt diese Ungewissheit, die so schlimm ist.«
»Ja, ich weiß, Emma.«
Es tat immer noch so weh, als wäre es erst gestern gewesen. Bis heute waren alle Suchaktionen im Sand verlaufen. Keine Spur. Nichts. Das Flugzeug war nie gefunden worden.
Ich schmiegte mich an meine Tante, die die gleiche Wärme ausstrahlte, wie meine Mutter es immer getan hatte. Das machte es etwas leichter für mich. Beide besaßen ein großes Herz. Tilli hatte ihres, anders als Mom, die sich in meinen Vater auf den ersten Blick verliebt hatte, noch nie an einen Mann verschenkt. Sie liebte ihr Single-Dasein. Das behauptete sie zumindest.
Was mich anging – ich war meinem Traumprinzen noch nicht begegnet. Ehrlich gesagt interessierten Jungs mich auch nicht so brennend, was vielleicht auch daran lag, dass ich bisher nur Kumpeltypen oder Machos über den Weg gelaufen war. Zurzeit konzentrierte ich mich lieber auf meine Ausbildung zur Floristin, was mir viel Spaß machte. Damit trat ich in Moms Fußstapfen. Sicher würde ihr das gefallen. Sie hatte sich damals mit einem eigenen kleinen Blumenladen einen Traum erfüllt. Dad hatte sie immer dabei unterstützt. Beide waren kreativ. Mom entwarf und bastelte gern schöne Dinge, Dad war Schriftsteller. Seine Geschichten steckten voller mystischer Geheimnisse, die mich und viele andere begeisterten. Er hätte wohl nie gedacht, dass er selbst einmal Teil einer mysteriösen Geschichte werden würde. Ich vermisste ihn schrecklich.
»Na, ihr zwei!«, rief jemand in unmittelbarer Nähe, dessen Stimme mir gut bekannt war. Sie gehörte dem alten Seebären Georg, einem Fischer aus dem Ort. Tante Mathilda errötete leicht und straffte die Schultern. Georg war einer ihrer glühendsten und hartnäckigsten Verehrer, den sie schon seit einigen Jahren zappeln ließ. Er kam, wie ich fand, genau zur richtigen Zeit. Sein Besuch holte uns aus unserem Gedankenloch.
»Hallo, Georg«, begrüßte ihn meine Tante, und ich schloss mich ihr an.
Er lächelte. »Hallo, die Damen. Die Jungs und ich waren vorhin draußen. Hab frische Krabben dabei für euch«, sagte er.
»Oh, das ist nett«, meinte ich.
Tilli nickte und bat ihn ins Haus. Dann hakte sie sich bei mir unter. »Kommst du mit rein, Emma? Ich mach uns meinen Schokoladentee. Der ist gut für die Seele.«
»Ich glaub, das ist Georg auch«, flüsterte ich und zwinkerte ihr zu. Mathilda tat so, als hätte sie es nicht gehört. Georg setzte den Sack, den er über dem Rücken trug, ab und streckte seinen muskulösen Körper, der Tante Mathildas um mindestens zwei Köpfe überragte.
»Alter Angeber.« Tilli lachte.
Georg hob die buschigen, grauen Brauen. „Was, ich?“
Ich hakte mich bei meiner Tante aus, denn ich wollte noch etwas erledigen. »Geht schon mal rein, ich komm gleich nach«, sagte ich.
Tilli hauchte mir einen Kuss auf den Scheitel. „Bis gleich.“ Sie ging zu Georg hinüber und mit ihm ins Haus.
Als sie weg waren, drehte ich mich zum Meer und schickte zwei Fragen hinaus: »Wo sind sie? Ist der Gesang ein Zeichen? Wenn ja, dann brauche ich mehr davon.«
Ich klammerte mich an viele Kleinigkeiten, egal, wie dünn die Seile, an denen sie hingen, auch waren. Die Hoffnung war pure Überlebensstrategie. Doch die Wellen schwiegen.
Georg und Tante Mathilda saßen bereits an dem viereckigen Holztisch in der Küche bei Tee und Gebäck, als ich zu ihnen stieß. Im Hintergrund lief das Radio. Kaum hatte ich mich auf meinem Platz niedergelassen, schob mir Tilli eine Tasse mit dem versprochenen Schokoladentee zu, dessen Duft mich an Weihnachten erinnerte – Zimt, Vanille und Nelken. Am Ende des Sommers einen Weihnachtstee zu trinken war zwar unpassend, konnte jedoch, wie ich nach ein paar Schlucken feststellte, wahre Wunder bewirken. Ich fühlte mich wie in eine warme Decke gehüllt.
»Du solltest auch was essen, Schatz. Du wirst ja immer dünner«, bemerkte Tilli.
»Das täuscht«, erwiderte ich schnell, was meine Tante kurz aufseufzen ließ.
»Dein Tee ist wirklich der beste der Insel, Tilli«, schwärmte Georg und schnäuzte sich in ein grünes Stofftaschentuch.
„Hast du dich etwa erkältet?“, fragte Tilli ihn.
Eine tiefe Falte bildete sich zwischen seinen Brauen. „Ich erkälte mich doch nie. Mich hat da nur was gekitzelt. So, und jetzt noch eine Tasse von deinem köstlichen Gebräu bitte.“ Er hielt meiner Tante die leere Tasse hin.
»Na, übertreib mal nicht«, winkte sie ab, doch Georg hörte nicht auf, sie mit Komplimenten zu überschütten, die ihre Wangen noch mehr erhitzten. Ich war mir sicher, dass es daran lag. Sie stand auf, entschuldigte sich kurz bei uns, und ging auf die Veranda hinaus. Angeblich, um dort nach ihren neuen Teepflanzen zu schauen, ich glaubte aber eher aus Verlegenheit.
Ich schmunzelte und beugte mich ein wenig zu dem Seebären hinüber, als sie weg war. »Mal ehrlich, Georg. Du findest Tillis Lungenwurztee tatsächlich köstlich?«, fragte ich, woraufhin der Seebär mir zuzwinkerte.
»Schlecht ist er nicht.«
Ich verzog einen Mundwinkel. »Nett untertrieben. Aber du bringst sie zum Schmelzen mit deinen Komplimenten, Georg.« Ich stupste den Fischer an.
Er seufzte leise. »Sie ist ein harter Brocken, aber ich geb nicht auf. Jeder Eisberg schmilzt einmal«, erwiderte er und hob dabei die Brauen.
In dem Moment kam Tilli zurück. »Was gibt’s denn zu tuscheln?«, fragte sie, da verfinsterte sich Georgs Mimik.
Er zeigte auf Tillis Radio. »Psssst!«
Stirnrunzelnd lauschten wir den Worten des Nachrichtensprechers, die mir einen Schauer nach dem anderen über den Rücken jagten.
»Kein Funkspruch und kein Notsignal von automatisch auslösenden Crashsendern. Experten gehen von keiner Entführung, sondern von einem Absturz der Passagiermaschine über dem Atlantik aus. Die Suchaktionen sind in vollem Gange. Bislang allerdings ohne Erfolg.«
In meinen Ohren begann es zu rauschen, als stünde ich wieder am Strand. Ich verstand kein einziges Wort mehr von dem, was der Mann im Radio sagte. In meinem Kopf tobte ein Orkan, der meine Gedanken durcheinanderwirbelte, bis mir schwindelig wurde. Es war wieder passiert! Aus dem Augenwinkel sah ich, dass Georg auf Tante Mathildas Anweisung hin das Radio abschaltete. Sie setzte sich und rutschte mit ihrem Stuhl nahe an mich heran. Ihre Hände legte sie auf meine. Meine Handinnenflächen schwitzten vor innerlichem Aufruhr.
Ich sah meine Eltern direkt vor mir, wie sie mich zum Abschied geküsst hatten und mir versprachen, etwas Schönes aus Atlanta mitzubringen.
»Hätte ich sie nur zurückgehalten oder wäre doch mitgeflogen«, stotterte ich und spürte, wie mir eine Träne über die Wange rollte und in meiner Kehle ein Kloß anschwoll.
Tante Mathilda umschloss meine Hände mit ihren. »Sei mir nicht böse; aber du weißt, wie ich denke«, entgegnete sie, bemüht, ein Zittern in ihrer Stimme zu unterdrücken.
»Es kommt alles so, wie es kommen muss und soll, ich weiß. Aber ich hab das Gefühl, als wäre ich schuld«, brach es aus mir heraus.
Georg sah betreten drein, wagte es aber nicht, etwas zu dem Thema zu sagen. Er wusste wohl, dass er mit seiner oft rauen Art vielleicht am Ende sogar ins Fettnäpfchen getreten wäre. Harte Schale, weicher Kern. In seinem Fall traf das Klischee absolut zu und seine Zurückhaltung war zudem mehr wert als tausend Worte.
Er stand auf und legte uns seine breiten, mit Schrunden übersäten Hände auf die Schultern, um zu zeigen, dass er da war, um uns zu stützen. Jederzeit.
Nachricht
Zwei Wochen später
Ich setzte mich auf mein Bett und blätterte in einem Fotoalbum mit violettem Stoffeinband und weißem kleinen Blütendruck, das Mom einst zusammengestellt hatte.
Inmitten des Albums entdeckte ich ein großes Familienfoto, auf dem meine Eltern so natürlich wirkten, wie sie auch in Wirklichkeit immer gewesen waren. Ich vermisste so viel, tausend Kleinigkeiten. Paps’ Lachen, seinen Humor, mit dem er meine Mutter nicht selten in den Wahnsinn getrieben hatte, und seine spontanen Ideen.
Mir fehlten Moms warme Stimme, die kleinen Ausflüge, die wir oft unternahmen, und wie wir über Gott und die Welt diskutierten. Wir waren immer füreinander da gewesen, wie eine Bilderbuchfamilie. Zu schön, um wahr zu sein, hatte ich manchmal gedacht.
Langsam blätterte ich weiter. Wenn ich meine Eltern mit einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich das Wort Wiege wählen. Denn genau das waren sie immer für mich gewesen. Eine Wiege, in die ich mich betten konnte und die mich aus allem herausschaukelte. Genauso aber wollte ich auch für sie da sein. Nun konnte ich nichts tun und es machte mich wahnsinnig.
»Willst du mit Georg und mir Krabben essen, Emma?«, rief Tante Mathilda nach oben.
»Danke, aber ich hab keinen Hunger«, erwiderte ich und ließ mich rücklings aufs Bett fallen. Noch immer waren die Suchaktionen nach der Boeing ergebnislos geblieben.
Jeden Tag hatte ich positiven Neuigkeiten entgegengefiebert und mit den Angehörigen gefühlt. Ich schüttelte den Kopf und dachte wieder einmal an die letzten Stunden, die ich mit meinen Eltern verbracht hatte. Sie hatten nicht fliegen wollen, als mich am Vortag der Abreise eine Sommergrippe überraschte. Ich war es, die sie davon abbrachte, den Flug zu stornieren, wusste ich doch, wie lange sie sich schon auf diese Reise nach Atlanta gefreut hatten.
Zudem hatte sich Tante Tilli bereit erklärt auf mich aufzupassen und sich sogleich auf den Weg gemacht. Paps hatte mir am Abend doch noch seine neueste Idee für sein nächstes Buch verraten und Mom mir gesagt, dass sie mich vermissen würde. Danach hatten wir gemeinsam Mensch ärgere Dich nicht gespielt und waren zusammen eingeschlafen.
Ich wünschte, sie hätten am nächsten Morgen den Wecker nicht gehört oder sich nicht von mir überzeugen lassen, doch zu fliegen.
Denn wenige Stunden nach ihrem Abflug war die Passagiermaschine vom Radar der Luftüberwachung verschwunden. Kein Hilferuf des Piloten, nichts. Nur Stille. Alles, was blieb, waren Fragen, die niemand beantworten konnte, und Vermutungen, die sicher nicht nur bei mir Albträume auslösten. Die Ungewissheit zeichnete immer schrecklichere Bilder.
Nach dem neuesten Ereignis nun lief ich Gefahr, wieder zu sehr in ein Tief hineinzuschlittern. Ich ahnte, dass mein Jahresurlaub düster enden würde.
Ablenkung musste her. Also beschloss ich nach Tinnum zu gehen, in mein Lieblingscafé, um dort eine Tasse mit heißer weißer Schokolade und extra viel Sahne zu trinken.
»Wann kommst du zurück?«, wollte Tanta Mathilda wissen und lächelte mir vom Küchentisch aus zu, an dem sie mit Georg bei einem Glas Wein, frischen Krabben und Weißbrot saß.
Ich zuckte mit den Schultern. »Weiß noch nicht. Ich geh mal ins Roxy. Bestimmt sind Mel und Björn auch dort.«
»Na dann, viel Spaß, Deern!«, wünschte mir Georg, bevor ich das Haus verließ.
»Und Jacke nicht vergessen«, rief Tante Mathilda mir nach. Sie sah in mir immer noch das kleine Mädchen, aber ich nahm es ihr nicht übel, meistens jedenfalls nicht.
Artig schnappte ich mir meinen blauen Parka, der im Flur an der Garderobe hing, und machte mich auf den Weg. Der Wind war rau und schnitt mir ins Gesicht, als ich durch die Dünen lief. Von Tante Tillis Anwesen aus war es ungefähr ein halber Kilometer, bis man auf das erste Haus der Ortschaft traf.
Die Kieselsteine des schmalen, schlangenförmigen Weges, der nach Tinnum führte, knirschten unter meinen Schuhen. Ich atmete tief ein und langsam wieder aus und schickte Melanie eine SMS.
Mel und Björn waren seit meiner Ankunft hier auf Sylt an meiner Seite und die besten Freunde, die ich mir vorstellen konnte. Schon bevor ich hierhergezogen war, kannte ich die beiden von Kurzurlauben – wenn auch nur flüchtig.
Bin auf dem Weg ins Roxy. Sehen wir uns da?
Wie gedacht, kam die Antwort prompt.
Björn ist krank, aber ich komme – klar. Bis gleich. Freu mich!
Ich schickte ihr einen Smiley. Als ich Tinnum erreichte, piepste erneut mein Handy. Hoffentlich, dachte ich, war es nicht Mel, die doch noch absagen wollte, weil ihr vielleicht etwas dazwischengekommen war.
Ich zog das Handy aus der Tasche und warf einen Blick aufs Display. Die SMS kam von einer unbekannten Nummer. Seltsam. Dennoch öffnete ich sie, um sie zu lesen.
Hier ist Jamie. Ich bin ein junger Mann, der Passagier in der Maschine gewesen ist, die vor ein paar Tagen über dem Atlantik abgestürzt ist. Brauche deine Hilfe. Bitte! Dies ist KEIN SCHERZ. Ich kann jetzt nicht mehr schreiben, sie kommen.
Im ersten Moment war ich so entsetzt, dass mir das Handy beinahe aus der Hand gerutscht wäre. Erst nach ein paar Sekunden setzte mein Verstand wieder ein. Das konnte doch nur ein schlechter, absolut niveauloser Scherz sein. Von wegen Hilfe! Ich steckte das Handy wieder ein und marschierte mit einer Portion Wut im Bauch weiter. Wie konnte man nur so dreist sein?
Mel kam zeitgleich mit mir am Roxy an und begrüßte mich wie üblich mit Wangenküsschen. Sie sah klasse aus in ihren marineblauen Boots und der Jeans-Latzhose, unter der sie eine lässige weiße Bluse trug. Der Wind wirbelte ihr rotes, kurzes Haar durcheinander und trieb ihr Tränen in die Augen.
»Schnell rein«, sagte sie, nahm mich an der Hand und zog mich in das Café, das im 50er-Jahre-Stil eingerichtet war. Das Ambiente war hell und größtenteils pastellfarben. Sogar die Kellnerinnen sahen aus, als wären sie gerade aus einer Zeitkapsel gestiegen. Sie trugen rot-weiß gestreifte, fast knielange Kleider mit ausgestelltem Rockteil, dazu weiße Schiffchenmützen und rote Pumps.
Wir setzten uns auf eine der Bänke, die mit cremefarbenem Kunstleder bezogen waren, und bestellten zwei Tassen weiße Schokolade. Mel saß mir gegenüber und beugte sich ein wenig vor.
»Stillhalten, du hast da eine Wimper«, sagte sie und griff vorsichtig danach. Sie hatte sich unter meinem rechten Auge verfangen. Mel hielt mir den Finger, auf dessen Kuppe sie die Wimper balancierte, vor die Nase, und bemerkte: »Puste sie weg und wünsch dir dabei was!«
Ich lachte ein wenig, woraufhin sie mich fixierte und erwiderte: »He, ich mein es ernst. Das letzte Mal, als ich es gemacht habe, hat es funktioniert.«
»Sei mir nicht böse. Aber das kann ich nicht glauben. Wäre ja zu schön. Was hast du dir denn gewünscht?«
Auf meine Frage hin errötete Mel ein wenig. Ohne mich anzusehen, antwortete sie leise: »Einen erfolgreichen Flirt mit Tim Jacobs.«
»Wusste ich doch, dass du auf den Fischerburschen stehst. Erzähl mal genauer.«
Sie blickte auf und wurde rot. »Stell dir vor, wir sind uns in Tinnum über den Weg gelaufen. Ja, ist noch nichts Sensationelles. Aber zum ersten Mal hat er mich bemerkt, ist ein paar Meter vor mir stehen geblieben und schielte immer wieder rüber. Am Ende hat er mir sogar zugezwinkert.«
Ich spitzte kurz die Lippen. »Wow. Schicksalshaft!«
»Du machst dich über mich lustig.« Sie wollte gerade ihren Finger wegziehen, als ich es mir anders überlegte. Vielleicht war am Ende wirklich was dran. Schaden konnte es jedenfalls nicht.
Die Kellnerin brachte unsere Schokolade, die herrlich süß duftete.
»Warte! Ich mache es.«
Mel lächelte über ihren kleinen Triumph. Ich schloss die Augen und wünschte mir, dass ich endlich eine Nachricht über Moms und Dads Verbleib erhielt. Dann blies ich die Wimper von Mels Finger.
»Ich weiß, dass man seinen Wunsch nicht verraten darf. Aber gibst du mir wenigstens einen kleinen Hinweis?«, fragte Mel. In ihren braunen Augen lag ein neugieriges Leuchten.
»Meine Eltern«, erwiderte ich leise.
Augenblicklich verschwand das Lächeln aus Mels Gesicht. »Verstehe«, sagte sie nur und sah mich mitfühlend an.
Ich wich ihrem Blick aus und versuchte die Tränen zu unterdrücken, da piepste mein Handy erneut. Ein Stich durchfuhr mich. Die Nachricht von vorhin wühlte immer noch in mir. Mit einem lauten Seufzen griff ich in meine Tasche und holte das Handy hervor.
»Wenn das dieser seltsame Typ ist, flipp ich aus.«
»Welcher Typ?«, wollte Melanie wissen und reckte den Hals, um einen Blick auf das Display zu werfen.
Er war es nicht. Tante Mathilda bat mich, ihr frischen Salat mitzubringen. Ich atmete auf und zeigte Mel die Message, die ich von dem angeblichen Passagier bekommen hatte. Sie nahm sie kopfschüttelnd zur Kenntnis.
»Also das ist wirklich abgedreht. Würde ich auch nicht für voll nehmen«, sagte sie.
»Ich frag mich, wer wohl dahintersteckt. Muss doch einer sein, der von dem Schicksal meiner Eltern weiß und sich genau deshalb diesen geschmacklosen Joke überlegt hat!«
Mel trank von ihrer Schokolade, nickte langsam und beobachtete mich, wie ich auf Antworten klickte.
»Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Emma. Falls du nun zurückschreiben willst, dann besser keine Beleidigungen. Wer weiß, was für ein krankes Hirn dahintersteckt«, gab Mel mir zu bedenken.
Aber ich musste es tun, um meiner Wut ein wenig Luft zu machen. Also tippte ich folgende Message:
Lass die dummen Scherze. Das ist nicht witzig!
Nachdem ich den letzten Buchstaben eingegeben hatte, drückte ich, ohne noch einmal zu überlegen, auf Senden. Es dauerte nur ein paar Sekunden, da erhielt ich von selbigem Absender eine weitere Nachricht.
»Der spinnt doch!«, schimpfte ich und tippte auf Annehmen.
Mel rutschte schnell auf meine Seite. Gemeinsam lasen wir.
Bitte melde dich! Brauch dich, Emma. Ich weiß deinen Namen von deiner Mutter Helena, hab von ihr auch deine Handynummer. Sie sagte, du bist in etwa in meinem Alter. Dein Vater nennt deine Mom oft Leni.«
Verdutzt sahen Mel und ich uns an.
»Ist doch sehr seltsam. Glaube, der spielt wirklich nur ein dummes Spiel. Aber er scheint dich und deine Familie gut zu kennen und es für seine Zwecke zu nutzen. Schrecklich!«, bemerkte Mel.
»Du denkst also, es ist einer von hier?«
Mel hob die Brauen. »Na ja. Ich denke da an einen ganz Bestimmten. Piet. Jeder weiß, dass er ein Auge auf dich geworfen hat. Vielleicht ist er sauer, weil du ihn links liegen lässt. Ich meine, denk mal an Dani. Als die ihm eine Abfuhr gegeben hat, stalkte er sie beinahe den ganzen Sommer hindurch, bis ihr Vater ihm eine Lektion erteilte.«
Möglicherweise hatte sie recht. Piet war in meinem Alter und hielt sich für unwiderstehlich. Daraus machte er keinen Hehl. Zwar mochte er gut aussehen, doch seine Oberflächlichkeit und das übertriebene Getue machten ihn geradezu hässlich.
Er war der Sohn eines erfolgreichen Immobilienmaklers aus Tinnum. Seine Avancen waren mir natürlich nicht entgangen. Aber Piet war der Letzte, den ich mir als Freund vorstellen konnte.
Mein Handy ließ mich wissen, dass meine SMS an diesen Typen fehlgeschlagen war. Also sendete ich sie erneut, allerdings wieder ohne Erfolg.
»Am besten, du ignorierst weitere Nachrichten einfach«, schlug Melanie vor.
Ich nickte und schaltete das Handy kurzerhand aus.
»Hast du von dem Flugzeug gehört, das über dem Atlantik verschwunden ist?«, fragte ich.
Mel schlug die Augen nieder. »Ich wollte es nur nicht ansprechen, um nicht … na, du weißt schon, alte Wunden wieder aufzureißen.«
»Ich verstehe das alles nicht. Wie können gleich zwei Maschinen einfach so im Nichts verschwinden? So, als hätte es sie nie gegeben?«
»Ich wünschte, ich könnte dir das beantworten. Es tut mir so leid, Emma.«
Ich atmete tief durch und trank von meinem Seelentröster. Er schmeckte gut, aber den Kummer konnte er heute nicht mal ansatzweise vertreiben. Dennoch bereute ich nicht, hierhergekommen zu sein. Ich war froh, dass ich Mel hatte.
Nach unserer Schokolade schleppte sie mich durch die kleinen Geschäfte der Stadt, die manchmal richtig ausgefallene Schätze und Geheimnisse bargen. Es dauerte nicht lange und ich wurde fündig. Auf einem verstaubten Regal eines Antiquitätengeschäfts entdeckten wir ein altes Buch mit teilweise verwischten Zeichnungen eines Unbekannten. Die Seiten waren wellig, als wäre das Buch direkt aus dem Wasser gefischt worden. Frau Ischl, der der Laden gehörte, beobachtete uns neugierig aus ein paar Metern Entfernung.
Der Maler musste aus Sylt gewesen sein oder zumindest ein Liebhaber der Insel, denn seine Zeichnungen galten allesamt dem Meer und seiner unmittelbaren Umgebung.
»Mein Großvater hat das Buch zufällig vor ein paar Jahren gefunden. Es lag in Strandnähe, in einer kleinen Felsenhöhle versteckt«, erzählte uns Frau Ischl und kam näher, während ich es durchblätterte.
Obwohl die Welt, die der Maler auf dem Papier geschaffen hatte, nur schwarz-weiß war, enthielt sie eine lebendige Intensität, die mich faszinierte. Ich musste es einfach haben.
»Mein Großvater hat es mir geschenkt, aber wenn ihr es kaufen wollt, mach ich euch einen guten Preis. Es verstaubt hier nur.«
Wie konnte sie diesen Schatz einfach so hergeben, dachte ich, nahm ihr Angebot aber ohne zu zögern an.
»Ich dachte, du hasst das Meer«, bemerkte Mel im Hinausgehen.
»Hassen ist nicht das richtige Wort. Ich finde es eher … unheimlich. Aber hier auf den Zeichnungen, da sieht es so friedlich aus. Findest du nicht?«
Ich hielt ihr das Buch hin, woraufhin sie mit den Schultern zuckte. Mit Kunst hatte Mel nicht wirklich viel am Hut. Schade eigentlich!
Todeskampf
Auf dem Nachhauseweg musste ich dennoch wieder an die Kurznachrichten denken, die ich von dem Unbekannten erhalten hatte. Was, wenn doch etwas dran war? Wenn es stimmte und er wirklich …?
Ich seufzte und musste den Kopf über mich selbst schütteln. Nein, wahrscheinlich hatte Mel recht. Ich ging ein wenig schneller, weil ich fror und ich mich nach Tante Tillis Gesellschaft sehnte. Ihre Gegenwart war für mich gleich einer wohlig warmen Decke, die mir Schutz bot vor den Widrigkeiten des Schicksals; weil sie die Einzige war, die meine innere Traurigkeit am besten auffangen konnte.
Wenig später konnte ich bereits das Reetdach unseres Hauses hinter den Dünenhügeln aufblitzen sehen.
In meiner Anfangszeit auf Sylt hatte ich den lauten Atem meiner alten Heimatstadt Bedfords vermisst, der hektisch durch die Straßen pulsierte und nie verebbte. Mit der Zeit jedoch hatte ich den Ort meiner Kindheit beinahe vergessen und die Freiheit lieben gelernt, die mir die Insel bot.
Plötzlich hörte ich den Klingelton meines Handys – ein James-Blunt-Song. Hatte ich es nicht abgeschaltet? Mein Herz begann wild zu pochen, als ich danach griff, es herauszog und einen Blick auf das Display warf. Mr. Unbekannt hatte mir geschrieben.
Langsam wurde das Ganze mehr als unheimlich. Für einen Augenblick überlegte ich die Nachricht zu ignorieren, entschied mich letztendlich aber dagegen und las sie.
Keine Antwort von dir. Ich kann es dir nicht verdenken. Doch geh an den Strand und lausche den Wellen. Deine Mutter hat sie gebeten, dir das Lied zu schicken, das sie dir oft vor dem Schlafengehen vorgesungen hat. Hin und wieder habt ihr es auch gemeinsam gesungen. Und die Stimmen hast du sicher schon gehört. Ich bat sie zu singen, wenn sie dich am Strand wahrnehmen. Bitte, Emma! Vertrau mir. Wir sind noch da! Gib uns nicht auf! Ich weiß, dass das alles schwer zu glauben ist. Ich kann nicht mehr schreiben. Wenn sie es entdecken – nicht auszudenken. J.
Meine Schläfen schienen einen Wettkampf mit meinem Herzschlag auszufechten. Ein weiteres Mal las ich die Nachricht. Konnte Piet sich so etwas wirklich ausdenken? Und woher sollte er wissen, dass ich manchmal einen Gesang zwischen den Meereswellen hörte? Und wer um alles in der Welt waren »sie«, wem gehörten diese Stimmen? Oder hatte dieser Jamie das mit den Stimmen am Ende gar selbst inszeniert?
Mit einem Mal war die Kälte, die mich bis dahin eingehüllt hatte, verschwunden, und ich begann zu rennen. Auf dem Weg zum Strand flogen meine Füße beinahe über den Kiesweg.
Irrsinn oder nicht, ich musste wissen, ob es stimmte. Lebten Mom und Paps etwa noch? Waren sie Gefangene – irgendwo? Neue Hoffnung tat sich auf, und ich schwor, würde sich doch ein Scherz hinter allem verbergen, würde ich denjenigen finden und ihm eine gehörige Lektion erteilen.
Luft holend hielt ich dicht am Strand inne und starrte aufs Meer hinaus. Sanfte Wellen rollten heran, es war fast windstill. Himmel und Wasser verschmolzen miteinander, sie hatten an diesem Tag die gleiche zartblaue Farbe.
Ich schloss die Lider und lauschte. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Nichts Ungewöhnliches war zu hören. Dennoch harrte ich voller Hoffnung weiter aus.
»Da bist du ja wieder, Schatz.«
Ich drehte mich um und entdeckte meine Tante auf der Veranda.
»Ich komme gleich«, antwortete ich. Tilli nickte und ging ins Haus. Auch ich wollte gerade den Rückzug antreten, da erklang es. Erst leise, dann immer lauter. Ein helles Summen, so schön, dass mir Tränen in die Augen stiegen.
Ich kannte die Melodie. Sie gehörte tatsächlich zu dem Lied, das meine Mutter und ich meistens beim Zubettgehen zusammen gesungen hatten, als ich noch ein kleines Mädchen war. Mom liebte meine Stimme, wenngleich ich sie wenig besonders fand. Aber es machte mir immer Spaß, mit ihr im Duett zu singen. Manchmal sang ich auch allein vor mich hin, am liebsten, wenn ich am Strand entlangspazierte.
Bilder aus längst vergangener Zeit stiegen in mir auf. Ich sah Mom direkt vor mir, ihre glänzenden, großen Augen, mit denen sie mich ansah. Ich glaubte sogar ihr Parfum zu riechen. Sie duftete immer nach Veilchen und Vanille.
Der Gesang nahm mich gefangen, und ich begann das Lied von damals leise vor mich hin zu singen.
Am Himmel so klar, siehst du leuchtende Sterne.
Die Nacht ist da, legt sich wie ein Flügelschlag über die Meere.
Und wenn du öffnest die Lider dein,
dann sieh nur hin, in ihr glänzendes Sein.
Vertreiben die Schatten, weisen dir eine Tür.
Geh getrost hindurch, ich bin bei dir.
Immer nah, immer hier.
Getragen auf Wolken in ein Land voller Träume,
beschützt von den Dächern wilder Bäume.
Keine Angst, geh weiter Schritt für Schritt,
hier gibt es keine Grenzen, keine Zäune, nur Licht.
Mein Herzschlag führt dich, ist wie ein Stern.
Er leuchtet für dich, egal, ob wir uns nah oder fern.
Ich kann dich immer sehn, glaub an dich,
dann wird die Hoffnung nie vergehn, niemals vergehn.
Jetzt träume süß und morgen früh im Morgenglanz weck ich dich wieder hier.
Dann schau übers Meer, siehst glitzernd die Sonne stehn.
Und die Schatten der Nacht im Meer untergehn,
während die letzten Ängste mit der Gischt verwehn.
Danach hatte sie mir immer einen Kuss aufs Haar gehaucht, das Licht gelöscht und mir noch einmal gesagt, wie lieb sie und Paps mich hatten. Dieses Lied kannte keiner außerhalb unserer Familie. Da war ich mir absolut sicher. Meistens, bevor Mom die Tür meines Zimmers geschlossen hatte, warf auch mein Vater noch einen Blick zu mir herein und wünschte mir eine gute Nacht und vor allem schöne Träume.
Tiefer und tiefer sank ich in die Vergangenheit, und es war mir, als spürte ich die ganze Liebe und Wärme meiner Eltern auf einmal um mich herum. Die Sehnsucht nach ihnen war größer als das Universum, größer als jede Vorstellung.
Erst das Surren des Handys riss mich aus meiner Gedankenwelt. Mein Herz machte einen Satz. Eine neue Nachricht von Jamie. Meine Hände waren ganz feucht vor Aufregung.
Der Gesang erlosch.
Hast du es gehört? Es ist wahr, was ich dir schreibe. Und bitte – halt dich vom Meer fern, geh nicht hinein, Emma! Ich melde mich bald wieder.
In mir tobte ein Orkan, der meinen Verstand völlig durcheinanderfegte. Das Ganze war real, ich hatte den vorhergesagten Gesang wirklich gehört, und langsam änderte sich meine Meinung. Das alles konnte kein Scherz sein. Vor innerem Aufruhr schaffte ich es kaum, Jamies Nummer für einen Rückruf zu aktivieren.
Verdammt, ich musste mit ihm sprechen. Es war zum Verrücktwerden – die Verbindung schlug abermals fehl.
Wieder und wieder probierte ich eine Verbindung herzustellen – ohne Erfolg. Das durfte doch nicht wahr sein!
Ich ließ das Handy sinken und schrie voller Verzweiflung aufs Meer hinaus: »Dann sagt mir, wo ihr seid. Bitte! Wie kann ich euch helfen, wenn ich euch nicht erreichen kann?«
Ich rief mir jedes Wort, das Jamie mir bisher geschrieben hatte, in Erinnerung. Es waren Worte, in denen ich große Angst und Verzweiflung wahrnahm. Einfach hier zu stehen und nichts tun zu können, außer abzuwarten, machte mich beinahe wahnsinnig.
Aber ich sollte mich vom Meer fernhalten. Warum? Hatte meine innere Stimme recht? Gab es da draußen etwas, das mir meine Eltern gestohlen hatte? Wenn dem wirklich so war, wer oder was verbarg sich dahinter?
Ich steckte das Handy ein, da hörte ich im Hintergrund Tillis Stimme. Sie kam auf die Veranda gelaufen.
»Meine Güte, Georg. Du siehst ja schrecklich aus. Was ist denn passiert?«
Augenblicklich drehte ich mich zu ihr um. Georg stieg in gebeugter Haltung die Treppe zur Veranda hoch, auf der meine Tante weilte. Ich hatte ihn gar nicht kommen sehen, war zu sehr aufs Meer fixiert gewesen. Tilli streckte ihm die Hand entgegen, denn er schien jede Sekunde in sich zusammenzusacken. Ich rannte auf beide zu. Georg sank auf die Knie und presste sich eine Hand gegen den Brustkorb, als ich bei ihnen ankam. Er rang nach Luft. Sein wettergegerbtes Gesicht war aschfahl, und auf seiner Stirn glänzte Schweiß.
Tilli und ich tauschten entsetzte Blicke. Gemeinsam zogen wir ihn hoch und brachten ihn ins Haus. Vielleicht hatte er einen Herzanfall. Das Adrenalin jagte noch schneller als vorhin durch meine Adern. Innerlich betete ich für Georg. Ich mochte ihn, auch wenn seine Art manchmal so rau war wie das Wattenmeer.
»Ich konnte ihnen nicht helfen. Verdammt noch mal«, stammelte Georg, als wir ihn auf Tillis giftgrüne Samtcouch hievten. Noch nie hatte ich ihn so aufgewühlt gesehen.
Er griff nach Mathildas Händen und drückte sie fest. Dabei zitterte er am ganzen Leib.
»Beruhige dich, Georg. Was ist denn passiert?«, fragte sie ihn. Inzwischen glich ihre Gesichtsfarbe der von Georg, der nach Krabben und Seetang roch. Er trug noch immer seine Fischerkluft. Da draußen musste etwas Schreckliches geschehen sein. Ein mehr als ungutes Gefühl durchzog meinen Magen und ließ ihn grummeln.
Georg schnappte nach Luft, als wäre er gerade aus den Tiefen des Meeres getaucht, und riss die Augen auf. In ihnen lag ein Ausdruck, der mich frösteln ließ. Pures Entsetzen! Keuchend setzte er sich auf und wir uns zu ihm.
»Wir waren mit dem Kutter und einem kleineren Boot draußen. Lief erst alles wie immer“, erzählte er ein wenig abgehackt. „Dann plötzlich ein Geschrei von Olles Boot aus, das mir bis ins Knochenmark fuhr. Er, Sören und Benedict waren circa zweihundert Meter von meinem Kutter entfernt. Sie wollten die Netze prüfen, weil sich irgendwas Größeres drin verheddert zu haben schien.«
Er holte abermals Luft, und zum ersten Mal, seit ich ihn kannte, sah ich, wie ihm Tränen in die Augen stiegen.
Für einen Moment ließ er Tillis Hand los und fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen. Dann suchte er erneut eine ihrer Hände. Gebannt hingen wir beide an Georgs bebenden Lippen.
»Das Boot begann zu schaukeln wie bei hohem Wellengang. Die Jungs beugten sich über den Bootsrand. Sie schrien durcheinander. Ich verstand nur, dass sie einander zuriefen, man müsse es töten. Ich machte mich sofort auf den Weg zu ihnen, doch der Kutter sprang erst nach ein paar Versuchen wieder an. Verdammtes Ding!«
Für einen Augenblick biss er die Zähne wütend zusammen und riss die Augen weit auf.
»Ich sag euch, was dann geschah, war so grauenhaft. Sören griff nach einer Harpune. Ich sah, dass erst Benedict und gleich darauf Olle über Bord gingen. Das Wasser um das Boot herum schäumte nur so. Sie kämpften dort mit irgendwas. Ich werde ihre Schreie nie vergessen. Gott, es war, als hätte sich die Hölle unter dem Meer aufgetan.«
Er wischte sich mit einer Hand über das Gesicht. »Sören beugte sich über den Rand des Bootes und stieß mit der Harpune zu.« Er ahmte die Bewegungen ein paar Mal mit einem Arm nach. »Wieder und immer wieder. Wie ein Wahnsinniger.«
Mathilda und ich waren wie erstarrt. Das alles klang wie aus einem Horrorfilm. Georgs Stimme wurde immer undeutlicher. Es fiel ihm schwer, noch Worte über die Lippen zu bekommen.
»Dann wurde das Wasser ums Boot herum rot. Ich hörte ein Quietschen, das mir in den Ohren wehtat. Von Olle und Ben war nichts mehr zu sehen. Etwas schien sie nach unten gezogen zu haben. Sören rief, da sei noch so ein Ding, und stieß mit letzter Kraft die Harpune erneut ins Wasser. Als ich ankam, rettete sich Sören sofort auf den Kutter.«
Georg drehte den Kopf zur Seite. »Mein Gott!«
»Mein Gott!«, wiederholte meine Tante seine Worte wie in Trance.
»Benedict und Olle … Sie tauchten auf einmal wieder auf. Rücklings im Wasser treibend, die Augen weit aufgerissen. Sie lebten noch«, murmelte Georg dann.
»Gott sei Dank«, stieß Tilli aus und presste eine Hand gegen den Brustkorb, doch Georg schüttelte den Kopf und sah sie an. Ich schlug eine Hand vor den Mund.
Ich kannte Olle und Benedict seit Jahren. Sie gehörten zu Tinnum wie die Fische zum Meer. Zwei muskelbepackte, gesunde Männer, Mitte fünfzig, verheiratet und Väter von Jungs. Waren sie nun etwa tot? Ich musste schlucken, doch der Kloß, der in meinem Hals steckte, ließ sich nicht vertreiben.
»Ihre Leiber waren brutal zugerichtet. Ich möchte nicht ins Detail gehen. Ich … werde den Anblick mein Lebtag nicht vergessen können. Meine Freunde, getötet von einer Bestie.« Er ließ Tillis Hand los und hieb sie zur Faust geballt in die Luft. »Ich werde diesen Bastard finden, und dann gnade ihm Gott!«
»Was war es … dieses Ding?«, fragte ich. Georgs glasige Augen richteten sich auf mich.
»Sören sagte, dass es aussah wie ein großer Mensch, nur mit der Haut eines Fisches, schwarzen Augen und vielen kleinen spitzen Zähnen.«
Augenblicklich wich meine Tante ein Stück zurück. »Willst du etwa sagen, da draußen gibt es sie tatsächlich … Meermänner? Das sind doch nur alte Legenden.«
Georg fixierte sie. »Bei allem, was mir heilig ist, Tilli, ich schwöre, da war etwas! Etwas Unmenschliches. Ich selbst hab es nicht gesehen, aber ich glaube Sören.« Georg klang völlig überzeugt von dem, was er da sagte. Gepaart mit Jamies Nachrichten ergab das alles auf einmal einen schrecklichen Sinn. Es schien wahr zu sein.
»Sören ist sich sicher, es sind zwei gewesen. Das zweite Wesen war ein wenig kleiner. Er zog den, der die Jungs angefallen hat, weg und verschwand mit ihm in den Tiefen. Sören glaubt fest, dass er ihn getroffen hat. Aber wohl nicht tödlich.«
Mathilda schwieg. Ich konnte ihre Gedanken beinahe rattern hören und wusste, dass sie nicht an die alten Legenden von Meereswesen glaubte. In dem Moment beschloss ich die Sache mit Jamie vorerst für mich zu behalten.
»Wie dem auch sei. Ich akzeptiere, was du sagst. Ich weiß, dass du kein, na, wie soll ich sagen …«, sagte meine Tante nach einer Minute.
»… Irrer bist. Nein, bin ich nicht«, ergänzte Georg ein wenig beleidigt.
Mathilda strich ihm zur Besänftigung durchs Haar, was ihm sichtlich guttat. Er konnte ihr nie wirklich böse sein.
»Sag doch, was ist mit Ben und Olle?«, wollte sie wissen. Ihre Stimme zitterte leicht. Ich schloss die Augen, weil ich die Antwort ahnte, die dann auch prompt und unveränderbar über Georgs Lippen kam.
»Die Jungs … sie sind tot.«
»Oh Gott, nein!«, flüsterte Mathilda.
Mir wurde eiskalt und übel zugleich.
Georg nickte betreten. »Wir haben sie notdürftig versorgt und sofort an Land gebracht. Kurz vor ihrem Tod haben sie uns gebeten, das Ding zu jagen und zu fangen, um andere zu schützen. Wir haben es ihnen versprochen. Ich werde diese Bastarde finden und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich weiß, dass einige hier uns nicht glauben werden. Schon allein, weil sie wissen, dass Sören, Ben und Olle gerne mal ein Bier getrunken haben, wenn wir draußen waren. Aber sie waren nüchtern. Es stimmt, was meine Jungs sagten.«
Er richtete sich auf, immer noch kreidebleich. Seine Augen glänzten nun wie im Fieber.
»Ich glaub dir«, stotterte ich leise.
»Ich glaub dir auch. Jedenfalls, dass du es glaubst«, bemerkte Tilli.
Georg klopfte mir auf die Schulter.
»Am besten, ihr meidet das Meer in nächster Zeit.«
Mathilda erhob sich und ging ans Fenster. »Es ist so schrecklich. Es waren gute Männer. Wenn ich an ihre Frauen denke … und die Kinder.«
Georg nickte und wirkte plötzlich in sich selbst versunken. Wir alle hingen eine ganze Weile schweigend unseren Gedanken nach, zu unbegreiflich schien das Ganze.
Der Fremde
Ein paar Tage später
Die Welt in und um Tinnum stand Kopf. Erst nach Olles und Benedicts Beerdigung erholten sich die Menschen langsam wieder und kehrten, zumindest äußerlich, zum Alltag zurück.
Das Schicksal der beiden Fischerfreunde hatte auch in der Presse großes Aufsehen erregt. Hier und da hörte man die Leute tuscheln. Den Toten ihre Ehre, aber keiner glaubte so recht an die Geschichte der Ungeheuer aus dem Meer, und Haie, zumindest welche, die Menschen angriffen, gab es hier keine.
Die Behörden tappten im Dunkeln und konnten noch keinen Schuldigen ausmachen, weder Mensch noch Bestie.
Man merkte Sören an, dass ihn die Sache zur Verzweiflung trieb. Er trug einen Sack voller Gerüchte auf seinem Rücken. Eine Last, die er nicht ein Leben lang mit sich herumschleppen wollte, wie er sagte. Auch Georg wurde vonseiten der Leute schief beäugt.
Nicht wenige glaubten, Olle und Benedict wären in einem Kampf gestorben. Ob dieser nur zwischen den beiden oder auch den anderen zwei stattgefunden hatte – darüber gab es unzählige Spekulationen.
Ich für meinen Teil zweifelte nicht an den Aussagen der Männer. Tilli glaubte aber nach wie vor an kein Ungeheuer aus den Tiefen, was ihr nicht zu verdenken war. »Vielleicht waren es tauchende Piraten, denen ihr ein Dorn im Auge wart. Kann doch sein«, sagte sie.
Georg war nun beinahe täglich Mathildas Gast, und man merkte, dass ihr Rat ihm mehr als teuer war.
»Es war, wie Sören es sagte, und wir werden es beweisen.«
Sein Blick ging ins Leere und langsam verengte er wütend die Augen. Tilli beobachtete ihn genau wie ich und wir wussten beide, was er damit meinte. Er würde sobald wie möglich wieder mit Sören hinausfahren und nach den Monstern Ausschau halten.
Ich stand auf, legte ihm kurz eine Hand auf die Schulter und lief dann zu einem der Rundbogenfenster, von wo aus man eine gute Sicht aufs Meer hatte. Die Wellen schäumten und donnerten an den Strand, als wollten sie uns warnen, ihnen nicht zu nahe zu kommen.
In den letzten Tagen hatte ich sie oft besucht, gelauscht und gehofft. Aber da war nichts. Kein Gesang, keine Stimmen. Und keine weitere Nachricht von Jamie, obwohl er versprochen hatte, sich bald wieder zu melden. Auch gab es weiterhin kein Durchkommen zu ihm. War etwas passiert? Was konnte ich tatsächlich glauben? In meiner Verzweiflung dachte ich darüber nach, Tilli und Georg doch von den Nachrichten zu erzählen, verwarf den Gedanken aber wieder. Nein! Es klang einfach zu abwegig. Zudem Tilli eh glaubte, ich bildete mir das mit den Meeresstimmen nur ein. Sicher hatte sie Georg schon sorgenvoll davon erzählt, und er war meist ihrer Meinung.
In meinem Zimmer kam mir das Buch mit den Meereszeichnungen aus dem Laden wieder in den Sinn. Durch die schrecklichen Ereignisse der letzten Tage hatte ich es fast vergessen. Ich kramte es aus meiner Schreibtischschublade und begann die hintere Hälfte zu durchblättern, auf denen weiche Zeichnungen von Muscheln, Korallen und hohen Meereswellen zu sehen waren.
Meine Finger strichen über die Bilder – ganz zart, als wären sie zerbrechlich. Sie waren voll tiefer Liebe für das Meer, und ich wünschte, auch ich könnte je wieder so dafür empfinden.
Die vorletzte Seite war mit der letzten verbunden. Irgendetwas hielt sie zusammen. Bei genauerem Hinsehen erkannte ich, dass es Dreck war, vermischt mit Seetang.
Vorsichtig schälte ich die Seiten auseinander und öffnete sie wie eine Muschel. Ob ich zwischen ihnen eine Perle finden würde? Mein Herz begann schneller zu pochen und ich war dankbar für die Ablenkung, die mir dieses kleine Büchlein schenkte. Die zwei Seiten, die sich mir wenig später offenbarten, überraschten mich wirklich. Rechts saß ein junger Mann auf einem Felsen. In seinen Händen hielt er eine große Muschel, die er sehnsuchtsvoll betrachtete. Auf der linken Seite war das Gesicht des jungen Mannes als Porträt gezeichnet. War es ein Selbstbildnis des Malers?
Die dunklen, mandelförmigen Augen schienen tief in mich hineinzuschauen. Beinahe glaubte ich, er würde mir jeden Moment zublinzeln. Irgendetwas an diesem Gesicht zog mich an und stieß mich gleichermaßen ab. Es wirkte so lebendig wie der Rest der Zeichnungen.
Die vollen Lippen, sein Mund so ernst und nachdenklich. Die dunklen Haare, die sein schmales Gesicht umrahmten, waren im Nacken zu einem langen Zopf mit eingeflochtenen kleinen Muscheln und Bändern zusammengefasst, der sich wie ein Seil um seinen Hals legte.
Auf keiner der leicht vergilbten Seiten fand sich eine Unterschrift oder Widmung, also würde mir der Fremde wohl ewig ein Rätsel bleiben. Nach einer Weile klappte ich das Büchlein zu und verstaute es wieder an seinem alten Platz. Dann nahm ich mein Handy und warf einen Blick darauf.
Für einen Augenblick glaubte ich, mein Herzschlag würde aussetzen. Jamie hatte mir eine neue Nachricht gesendet.
Ich kann verstehen, wenn du mir immer noch nicht glaubst. Melde mich erst jetzt, da ich wieder in Sicherheit bin. Konnte mich davonschleichen. Das Handy trage ich bei mir, geschützt in einer wasserdichten Hülle aus durchsichtiger Fischhaut. Doch Empfang habe ich nur, wenn ich auftauchen kann. Ein Wissenschaftler unter den Passagieren hat eine energetische Quelle entdeckt, die den Akku auflädt, sobald man sich ihr nähert. Davon gibt es einige da unten. Vielleicht können wir sie noch anderweitig für uns nutzen. Das Meer steckt voller magischer Geheimnisse. Aufzutauchen gelingt mir jedoch nur selten und kurz. Außerdem gefährde ich damit auch die anderen. Wie lange ich dich unentdeckt kontaktieren kann, weiß ich nicht. Aber etwas lässt mir keine Ruhe. Ich war auf dem Weg zu meiner kleinen Schwester Haley, die seit einer Weile auf Sylt wohnt. Haley McCann. Sie ist todkrank. Ich habe ihre neue Telefonnummer nicht, aber sie muss wissen, dass ich sie liebe und ihr keine Schuld gebe. Es war dumm, was ich damals zu ihr gesagt habe. Es war nicht so gemeint. Könntest du ihr das sagen? Bitte, Emma. Es ist sozusagen mein letzter Wille, ein Herzenswunsch. Ich wäre dir unendlich dankbar!
Ich konnte die flehende Verzweiflung seiner Worte deutlich spüren. Jamie hatte also eine Schwester. Das Herz schlug mir bis in die Kehle. Auch wenn ich wusste, dass ein weiterer Versuch ihn zu erreichen, fehlschlagen würde, probierte ich es. Es blieb dabei – er war unerreichbar.
Ich musste mehr erfahren und setzte mich an meinen Computer.
»Haley McCann … Sylt«, sagte ich leise vor mich hin, während ich ihren Namen mit zittrigen Fingern in die Google-Suchleiste eingab. Sekunden später vermeldete Google einen Treffer. Ihre Festnetznummer wurde angezeigt.
Kurzerhand schnappte ich mir das Handy und wählte ihre Nummer, drückte diese aber nach dem ersten Rufton weg. Unmöglich konnte ich ihr das ganze Mysterium um ihren Bruder am Telefon erzählen. Höchstwahrscheinlich würde sie mich für irre halten und gleich wieder auflegen.
Nein, ich musste persönlich mit ihr reden. Ihrer Adresse nach wohnte sie nur ein paar Orte weiter.
Sogleich beschloss ich, mich auf den Weg zu machen.
Das Haus, in dem Haley wohnte, lag in der stillen Sackgasse eines kleinen Ortes, zwischen Westdüne und Kiefernwäldchen in der Nähe des Strandes gelegen. Es war ein weißes Mietshaus mit Reetdach.
Die umlaufende Terrasse hatte eine große Fensterfront zu einem mit bunten Blumen und Gräsern übersäten Garten. Langsam näherte ich mich dem Anwesen, wohl überlegend, was ich als Erstes zu Haley sagen sollte, wenn ich ihr begegnete. Mein Verstand hoffte inständig, dass sich nicht alles doch noch als grotesker Scherz herausstellte.
Meine innere Stimme und mein Herz dagegen trieben mich voran und sprachen mir Mut zu. Mom hatte mir beigebracht, immer auf mein Bauchgefühl zu hören. Seit ihr Lied von den Wellen zu mir an den Strand getragen worden war, war ich positiv gegenüber den Entwicklungen und somit Jamie, wenngleich mir das Ganze nach wie vor Angst machte und ein Restzweifel blieb.
Haley
Der Garten war mit einem weißen Holzzaun umgeben, der mir bis zu den Schultern reichte. Mit den Händen umgriff ich die oberste Latte des Zaunes so fest, dass die Knöchel meiner Finger weiß hervortraten. Ein paar Meter entfernt lag jemand auf einem Liegestuhl.
Von hier aus konnte ich nicht erkennen, ob es eine Frau oder ein Mann war. Ich fasste all meinen Mut zusammen und sagte: »Entschuldigen Sie die Störung. Ich suche Haley McCann. Können Sie mir vielleicht weiterhelfen?«
Angespannt und voller Erwartung auf eine Antwort biss ich mir auf die Unterlippe. Zu meiner Erleichterung rührte sich die Person auf der Liege und antwortete: »Dann hat Ihre Suche jetzt ein Ende. Ich bin Haley.«
Erstaunt hielt ich die Luft an, als Haley sich langsam erhob. Sie schlang eine Decke um ihren dünnen Körper und rückte die grüne Wollmütze, die sie auf dem Kopf trug, etwas nach hinten. Daraufhin warf sie mir einen fragenden Blick zu. Ich hatte sie tatsächlich gefunden. Ich hob grüßend eine Hand und setzte zu einem Lächeln an.
»Hallo. Ich … ich hab eine wichtige Nachricht für Sie, Haley McCann.«
Meine Stimme klang, als gehöre sie nicht zu mir, als hätte da gerade jemand anderes gesprochen. Mein Gefühl jedoch sagte weiterhin, dass es richtig war, was ich hier tat. Ich versuchte zu helfen, nichts weiter. Daraus konnte mir niemand einen Vorwurf machen. Viel schlimmer und zudem egoistisch wäre es doch gewesen, wenn ich es nicht versucht hätte.
Die junge Frau war schätzungsweise in meinem Alter. Ihre Wangen waren ein wenig eingefallen, ihre Haut wirkte gelblich. Trotzdem fand ich sie hübsch. Das leuchtende Grün ihrer Augen überstrahlte die Zeichen der Krankheit.
Mich musternd kam sie an den Zaun. Ich atmete langsam aus und sagte dann: »Jamie schickt mich!« Haley kräuselte ihre glänzende Stirn, ihr Blick war auf mich gerichtet. Kurz schnappte sie nach Luft. »Mein Bruder? Ist er zurück?« Ihre Augen blitzten auf und in ihrer Stimme lag ein hoffnungsvoller Unterton. »Ich dachte … ich meine, sein Flugzeug ist verschwunden. Alle, auch ich, dachten, es sei wohl abgestürzt.« Ihre Stimme kippte.
»Ich weiß«, entgegnete ich und musste schwer schlucken.
Ich merkte, dass sie unruhig wurde, und kramte schnell nach meinem Handy. „Ich muss dir was vorlesen. Können wir …“ Auf der Veranda stand eine ältere Dame mit grauem Haar und starrte neugierig zu uns herüber. Ich deutete auf das Haus, und Haley bat mich in den Garten.
»Du hast recht. Lass uns drinnen reden, Fremde ohne Namen. Meinen kennst du ja schon.«
Ihre Worte trafen mich. Wie peinlich und unhöflich von mir. In meiner Aufregung hatte ich mich nicht mal vorgestellt. Ich reichte ihr eine Hand, die sie fest, aber mit einer merklichen Portion Skepsis drückte. »Sorry. Emma Bennet.«
Ohne etwas zu entgegnen, ging sie ins Haus, und ich beeilte mich, ihr zu folgen. Das Tor im Holzzaun war offen. Haley winkte der Frau auf der Veranda zu, woraufhin diese sichtlich verlegen zurückwich. »Bist du von Sylt, Emma?«, wollte Haley wissen.
»Ja, ich wohne bei meiner Tante in der Nähe von Tinnum.«
Haley hustete und presste sich eine Hand auf den Brustkorb. »Entschuldigung«, murmelte sie und steuerte durch einen Flur auf ihre kleine Küche zu, die kunterbunt und sehr modern war. Haley schenkte sich Wasser ein und trank gierig. Danach ging es ihr wohl besser, der Husten beruhigte sich.
Sie bot mir auch etwas zu trinken an, aber ich winkte dankend ab. Mein Herz hämmerte mir so heftig gegen die Rippen, dass ich glaubte, Haley müsste es hören.
Sie setzte sich an den kleinen, pinken Küchentisch und bat mich zu sich. Als ich ihr gegenüber auf einem der neongrünen Stühle Platz genommen hatte, schaltete ich mein Handy an und legte es auf die Mitte des Tisches.
»Also?«, fragte Haley.
Ich räusperte mich. »Ich kenne deinen Bruder nicht wirklich. Ich weiß, das klingt nun verrückt und anfangs dachte ich, jemand wolle mich auf den Arm nehmen, aber nun glaub ich immer mehr, dass es stimmt, was er mir schreibt.«
Die Worte kamen plötzlich haltlos wie ein Wasserfall über meine Lippen. Erst Haleys Blick, mit dem sie mich musterte, ließ mich verstummen.
»Er hat dir nur geschrieben? Was heißt das genau?«, fragte sie.
Ich las ihr die Nachrichten bis auf die letzte vor. Während sie mir zuhörte, entglitten ihr die Gesichtszüge und sie schüttelte den Kopf, sobald ich innehielt.
»Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, das klingt alles so abgedreht. Könnte sehr gut auch nur irgendein Irrer sein.«
Schließlich zeigte ich ihr die Nummer des Handys, von dem aus die Nachrichten verschickt wurden.
»Das da ist nicht seine Nummer«, stellte Haley fest.
»Aber er könnte sie vor der Abreise ja auch geändert haben. Oder?«, gab ich zu bedenken, woraufhin sie die Nummer noch einmal genau betrachtete.
Haley seufzte tief. »Ich wollte eigentlich nie mehr mit Jamie reden. Er … er hat mir mal sehr wehgetan.« Ihre Stimme wurde weicher, ich spürte die Trauer in ihr. »Aber als ich erfahren hab, dass er Passagier in der Maschine war, die über dem gottverdammten Meer verschwunden ist … Ich vermisse ihn. Trotz allem.« Sie nahm mir das Handy ab. »Ich wähle mal die Nummer. Das wird das Einfachste sein, um herauszufinden, ob er wirklich dahintersteckt«, schlug sie vor.
»Das wird nichts bringen«, sagte ich. »Die Verbindung bricht immer wieder sofort ab. Besser gesagt baut sich erst gar keine richtige auf.«
Haley probierte es dennoch. Ich betete, dass es bei ihr klappen würde. Aber das tat es nicht.
»Wenn sich da jemand echt einen Scherz erlaubt, dann sollte der mir besser nie über den Weg laufen«, bemerkte sie. Ich konnte ihr nur zustimmen. »Dem lesen wir dann gemeinsam die Leviten.«
Zum ersten Mal, seit wir uns gesehen hatten, schenkten wir uns ein kleines Lächeln, das eine große Wirkung hatte. Haleys Misstrauen mir gegenüber schmolz merklich mit jedem weiteren Atemzug.
Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. »Komisch ist das Ganze dennoch. Und was ist mit deinen Eltern? Waren sie auch im Flugzeug?«
»Nein. Das Flugzeug, in dem meine Eltern saßen, verschwand vor ein paar Jahren über dem Atlantik. Beinahe an der gleichen Stelle.«
Haley starrte mich entsetzt an. »Mein Gott, Emma. Das tut mir wahnsinnig leid«, flüsterte sie.
»Mir auch«, erwiderte ich leise.
Für ein paar Sekunden schwiegen wir.
»In den Nachrichten«, erzählte Haley dann, »hab ich gehört, dass in Jamies Maschine drei Meeresbiologen saßen, die der Sache von damals auf den Grund gehen wollten.«
Das war mir neu. »Die Nachricht über das Verschwinden der Maschine hat alles von damals wieder hochgespült. Zwar werden die Wunden nie ganz verheilen, egal, wie viel Zeit vergeht, aber wenn es wieder so direkt zur Sprache kommt, dann scheint es so, als wäre alles erst gestern gewesen. Dieses Ohnmachtsgefühl … Nichts tun zu können, nur zu warten. Bis heute wurde das Flugzeug, in dem meine Eltern saßen, nicht gefunden«, flüsterte ich.
»Schrecklich! Ich weiß gar nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Es ist unbegreiflich.«
»Das ist okay, das geht vielen so. Viele haben Angst, sie könnten was Falsches sagen und schweigen daher lieber.«
Haley strich mir kurz über den Arm. Eine kleine Geste, die mir sehr guttat und für die ich ihr dankbar war.
Ihre Augen verengten sich. »Wenn das wirklich ein blöder Jux ist, dann hat der Typ dich und auch mich ganz schön ausspioniert. Das dürfen wir nicht einfach so ignorieren. Vor allem nicht, wenn Jamie wirklich Hilfe braucht.«
»Was schlägst du also vor?«, wollte ich wissen.
»Wir müssen herausfinden, wem diese Nummer gehört.«
Ich atmete auf. »Das machen wir. Haley?«