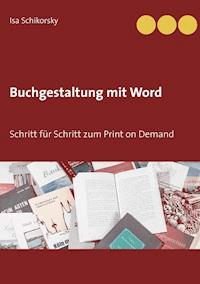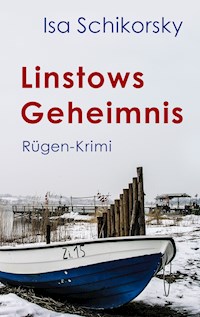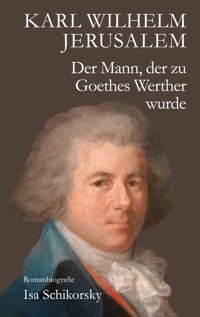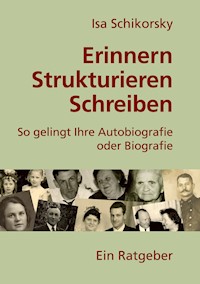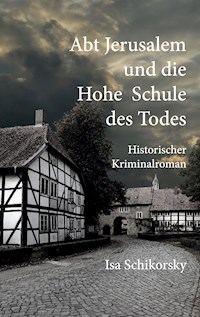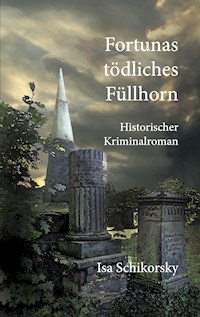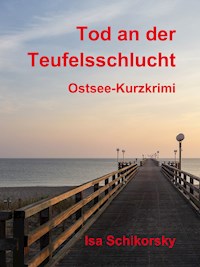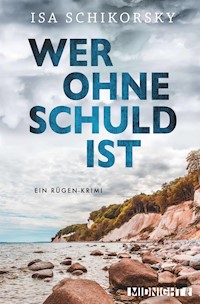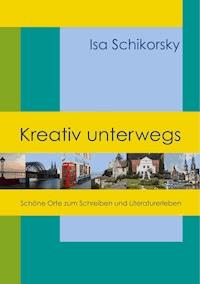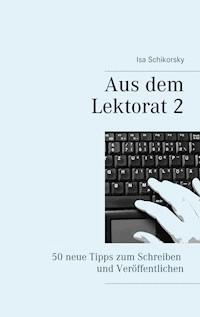
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Was lässt sich aus Bestsellern lernen? Sind Füllwörter wirklich überflüssig? Braucht man einen Literaturagenten? Welche Fachbücher zum Schreiben und Veröffentlichen sind empfehlenswert? Isa Schikorsky ist seit 1995 als freie Lektorin für Verlage, Autorinnen und Autoren sowie als Dozentin für kreatives und literarisches Schreiben tätig. Nach dem ersten Band »Aus dem Lektorat« (2009) hat sie jetzt 50 neue Tipps zusammengestellt. Beantwortet werden weitere wichtige und aktuelle Fragen zum Schreiben, Publizieren und Vermarkten von Romanen und Erzählungen. Das Buch richtet sich insbesondere an Menschen, die erste Schritte auf dem Buchmarkt wagen, sich orientieren und ihr Schreibwissen ergänzen möchten. Den Inhalt beider Bände vereint »Aus dem Lektorat 1 und 2. 100 Tipps zum Schreiben und Veröffentlichen« (2018).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu dieser Ausgabe
Es handelt sich um den zweiten Band zu AUS DEM LEKTORAT. 50 TIPPS ZUM SCHREIBEN UND VERÖFFENTLICHEN (2009).
Beide Teile zusammen sind unter dem Titel AUS DEM LEKTORAT 1 UND 2. 100 TIPPS ZUM SCHREIBEN UND VERÖFFENTLICHEN erschienen (2018).
Die Autorin
Die Sprach- und Literaturwissenschaftlerin Isa Schikorsky ist seit 1995 als Dozentin für kreatives und literarisches Schreiben und freie Lektorin tätig. Sie lebt und arbeitet in Köln und publiziert neben Schreibratgebern auch Sachbücher, Kriminalromane und Erzählungen.
www.stilistico.dewww.schikorsky.de
Inhalt
Schreibtipps für Erzähltexte
1. Lockerungsübung: automatisch schreiben
2. Von Heldenreisen und Schneeflocken
3. Braucht man eine Prämisse?
4. Aus Bestsellern lernen
5. Eine Frage der Zeit: Präsens oder Präteritum?
6. Lassen Sie die Verben »schwitzen«
7. Gefühle lesen und zeigen
8. Fluch und Segen: die Rückblende
9. Vertraute Fremde: Figuren, die berühren
10. Gedanken im Erzähltext
11. Mimik und Gestik nicht vergessen
12. Die Tücken der Allwissenheit
13. Die Zeit als Strukturelement
14. Schauplätze als Mit- und Gegenspieler
15. Sinn und Unsinn der Füllwörter
16. Verzichten Sie auf den »Gott aus der Maschine«
17. Kürzen ist »literarisches Viagra«
18. Mit Bildern erzählen
Aus dem Autorenalltag
19. Nicht nur, wenn die Muse küsst – Schreibplanung
20. Ein Roman in einem Monat: NaNoWriMo
21. Lohnt sich das Schreibprogramm »Papyrus Autor«?
22. Lisa Müller oder Carla Caroli? Über Pseudonyme
23. Reich werden als Autor?
24. Es ist Ihr Geld: Verwertungsgesellschaft Wort
25. So wird Ihre Lesung perfekt
26. Gemeinsam stark: Autoren-Netzwerke
Professionell in Formfragen
27. Groß oder klein? Anredepronomen
28. Die Suche nach dem Apostroph
29. Absätze und Leerzeilen: Pausen im Text
30. Das Drei-Punkte-Problem
31. Buchgestaltung mit Word
Veröffentlichen und vermarkten
32. Brauche ich einen Literaturagenten?
33. Ganz einfach: E-Books selbst veröffentlichen
34. Der Buchmarkt für Kinder und Jugendliche
35. Marketing? Macht das nicht der Verlag?
36. Werbemittel Leseexemplare
37. Hilft Facebook beim Buchverkauf?
38. »Ihr Buch gefällt mir nicht«: Ein-Stern-Urteile
39. Was bietet die »Autorenwelt«?
40. Der dritte Weg: Veröffentlichen im Imprint
Ratgeber zum Schreiben und Publizieren
41. Juli Zeh: »Treideln«
42. James Wood: »Die Kunst des Erzählens«
43. Ulrike Scheuermann: »Die Schreibfitness-Mappe«
44. Liane Dirks: »Sich ins Leben schreiben«
45. Patricia Highsmith: »Suspense«
46. Hanns-Josef Ortheil: »Schreiben auf Reisen«
47. Haruki Murakami: »Von Beruf Schriftsteller«
48. Sylvia Englert: »So lektorieren Sie Ihre Texte«
49. André Hille: »Titel, Pitch und Exposé«
50. Tanja Rörsch: »Praxishandbuch Buchmarketing«
Literaturverzeichnis
Erwähnte Internetseiten
Schreibtipps für Erzähltexte
1. Lockerungsübung: automatisch schreiben
Wer mit dem Schreiben beginnt, leidet zuweilen unter Schreibhemmungen. Oft steckt dahinter ein Streben nach Perfektionismus, dem die Vorstellung zugrunde liegt, jede Formulierung müsse bis in alle Ewigkeit so stehen bleiben. Mit zunehmender Schreibpraxis verliert sich das Gefühl meist, man schreibt unbekümmerter, weil man weiß, dass sich alles immer wieder korrigieren lässt. Wenn es aber bei neuen oder besonders wichtigen Projekten einmal hakt, wenn man keinen Anfang findet und frustriert aufs weiße Blatt oder den blinkenden Cursor des Monitors starrt, kann es sinnvoll sein, auf eine kreative Methode zurückzugreifen, gewissermaßen als Lockerungs- und Entspannungsübung.
Ein Verfahren, das ich persönlich sehr schätze, ist das automatische Schreiben. Es setzt dem rationalen, mit Überlegung und Logik geformten Text das Experiment entgegen, die freie Assoziation, den spontanen und unbewussten Ausdruck. Wenn es funktioniert, geraten Sie in den Fluss der Sprache, aus dem Ideen und Bilder aufsteigen.
Häufig genutzt wurde das automatische Schreiben von den Surrealisten. Ob es tatsächlich so ist, »daß in jedem Augenblick in unserem Bewußtsein ein unbekannter Satz existiert, der nur darauf wartet, ausgesprochen zu werden«, wie André Breton in seinem ERSTEN MANIFEST DES SURREALISMUS (1924) behauptete? Probieren Sie es aus! Breton rät: »Schreiben Sie schnell, ohne vorgefaßtes Thema, schnell genug, um nichts zu behalten, oder um nicht versucht zu sein, zu überlegen.« Ganz wichtig: Nicht den Stift absetzen, nicht die Finger von der Tastatur nehmen, immer weiterschreiben. Denken Sie auf keinen Fall! Sinnen Sie nicht über das nach, was Sie gerade geschrieben haben. Verbieten Sie sich alle Gedanken, insbesondere solche wie: Ist das überhaupt ein richtiger Satz? Wie wird das Wort geschrieben? Das ist doch völliger Blödsinn! – Schreiben Sie, was Ihnen durch den Kopf geht, völlig frei und unzensiert, ohne einen Gedanken an Rechtschreibung, Stil, Struktur, Logik zu verschwenden.
Wer nicht ganz frei schreiben mag, kann ein Wort, einen Satzbeginn oder einen Satz als Impulsgeber nutzen, zum Beispiel: Als ich heute Morgen erwachte ..., Reden ist Silber ... (oder ein anderes Sprichwort).
Sie können sich einen Wecker stellen, zehn Minuten genügen. Alternativ schreiben Sie einfach so lange, bis Sie sich leergeschrieben fühlen. Wenn am Ende eine logisch aufgebaute Geschichte entstanden ist, haben Sie vermutlich etwas falsch gemacht. In der Regel entsteht ein Steinbruch mit mehr oder weniger ausgeprägten Goldadern, in denen ungewöhnliche, originelle Formulierungen und Ideen aufblitzen, die zum Weiterdenken und Weiterschreiben anregen. Viel Spaß dabei!
2. Von Heldenreisen und Schneeflocken
Wie wichtig sind Strukturvorgaben für das Plotten von Romanen? Darüber wird unter Autoren und Autorinnen heftig debattiert und gestritten. Bekannte Muster sind »Heldenreise«, »Schneeflockensystem« und »Drei-Akt-Struktur«, gefachsimpelt wird über Plotpoint, Pinchpoint, Mirror-Moment, Twist usw. So mancher fühlt sich von dem Begriffswirrwarr überfordert und fragt sich, ob er erst Listen von Fachwörtern pauken muss, bevor er endlich schreiben darf. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Absolutheit, mit der die jeweilige Methode zuweilen als einzig wahre verteidigt wird. Die meisten wollen gerade nicht nach Schema F arbeiten, sondern auf ihre eigene Weise erzählen.
Dabei kann es sinnvoll sein, sich das Strukturmodell des Erzählens genauer anzusehen, denn es ist – zumindest in seiner Grundform – erstens sehr einfach und zweitens sehr alt und universell. Es ist das, was in verschiedenen Kulturen und zu allen Zeiten unter einer Geschichte verstanden wurde und wird. Wir haben dieses Modell so weit verinnerlicht, dass uns nur auffällt, wenn es nicht beachtet wird.
Meine Seminare zu diesem Thema leite ich gern mit folgender »Geschichte« ein: Gestern bin ich in die Stadt gegangen, um mir einen Rock zu kaufen. Gleich in der ersten Boutique fand ich genau das, was ich suchte. Ich habe den Rock gekauft und bin wieder nach Hause zurückgekehrt.
Die Zuhörer reagieren mit irritierten bis ungläubigen Blicken: Wie, schon zu Ende? Das soll eine Geschichte sein? An diesem kruden Beispiel leuchtet es unmittelbar ein: Nein, das ist nicht das, was wir von einer Geschichte erwarten. Und jeder weiß, was fehlt: das Außergewöhnliche, Unerwartete, eine Komplikation. Im Alltag kann es ein Missgeschick sein: Ich stelle an der Kasse fest, dass ich mein Portemonnaie vergessen habe (und ich brauche den Rock ganz dringend für einen Termin). Oder: Eine andere Kundin schnappt mir meinen Traumrock vor der Nase weg (und es gibt keinen weiteren davon in meiner Größe). Der Zuhörer will wissen, wie ich das Problem gelöst habe. Ist es mir gelungen, der Rivalin den Rock wieder abzuschwatzen? Mit welchem Trick konnte ich die Verkäuferin dazu bringen, mir den Rock ohne Bezahlung mitzugeben? Sofort wird das Grundmuster erkennbar: In einer Alltagssituation passiert etwas, woraus sich eine Schwierigkeit ergibt, man versucht sie zu meistern, es gelingt oder misslingt.
Alle Strukturmethoden, egal welchen pompösen Namen sie tragen, fußen auf diesem einfachen Modell: Einleitung, Hauptteil, Schluss. Ausgangssituation, Problem, Lösung. Sicher, im Roman sollte alles größer sein als in der Realität, also das Problem existenzieller, die Lösungsversuche intensiver, die Widerstände heftiger und die überraschenden Wendungen zwischendurch weniger berechenbar. Und ganz klar: Die Spannung muss bis kurz vor Ende des Romans bestehen bleiben, sollte sogar noch ansteigen.
Sie möchten es gern genauer wissen? Im Internet finden Sie eine Fülle von Informationen zu den gängigen Strukturmodellen. Sie können sich daran orientieren und sie vollständig oder in Teilen für Ihr Romanprojekt nutzen.
Die »Heldenreise« ist ein mythologisches Modell, das so alt wie das Erzählen selbst ist und sich bereits an Homers ODYSSEE (8. Jh. v. Chr.) eindrucksvoll studieren lässt. Gezeigt wird der Held (Protagonist) auf seiner Reise durch die Welt, bei der er zahllose Gefahren meistern muss. Es lässt sich auf jeden Plot übertragen, wird jedoch am häufigsten für Fantasy genutzt. Einen guten Überblick gibt der Wikipedia-Artikel zum Begriff »Heldenreise«, in dem die Abfolge der Stationen nach den Modellen von Joseph Campbell und Christopher Vogler knapp und verständlich vorgestellt wird. Wer noch mehr erfahren möchte: Christopher Voglers Buch DIE ODYSSEE DER DREHBUCHSCHREIBER, ROMANAUTOREN UND DRAMATIKER (2018) ist gerade neu aufgelegt worden.
Bei der »Schneeflockenmethode« handelt es sich um ein von Randy Ingermanson entwickeltes Verfahren, bei dem der gesamte Roman von einer Idee aus geplottet wird. Vorbild ist die Entstehung einer Schneeflocke: An ein gefrorenes Wassertröpfchen lagern sich immer weitere Kristalle an. Analog dazu wird von einem Satz aus der Roman gebaut. Der erste Schritt ist zugleich der schwierigste, denn der Basissatz soll die Kernaussage der Geschichte enthalten. Ihm werden Schritt für Schritt Informationen hinzugefügt, bis der zehnte schließlich das Schreiben der Geschichte als finale Erweiterung der szenischen Grundstruktur vorsieht. Der Vorteil: Man weiß, wie der Roman enden wird, wenn man mit dem Schreiben beginnt. Vorgestellt wird DIE SCHNEEFLOCKENMETHODE (2015) zum Beispiel von der Schreibtrainerin Anette Huesmann.
Die Drei-Akt-Struktur (1. Exposition, 2. Entwicklung, Zuspitzung, Konfrontation, 3. Auflösung) mit den entsprechenden Wendepunkten erklärt Ron Kellermann sehr fundiert. Sein Buch FIKTIONALES SCHREIBEN (2006) ist leider nur noch antiquarisch (zu überhöhtem Preis) erhältlich. Hilfreiche Informationen finden sich im Blog www.filmschreiben.de
3. Braucht man eine Prämisse?
Welche Prämisse hat die Geschichte, an der Sie gerade arbeiten? Können Sie diese Frage sofort beantworten? Haben Sie noch nie darüber nachgedacht? Oder finden Sie es sogar unsinnig, das zu tun? Viele Autoren und Autorinnen sind der Meinung, ihre Geschichte ist zu vieldeutig und komplex, um sich auf eine Aussage reduzieren zu lassen. Genau das soll die Prämisse aber leisten: Sie gibt Auskunft über die »beherrschende Idee« (Ron Kellermann) oder die Kernaussage eines Textes. James N. Frey behauptet sogar: »Eine Geschichte ohne eine Prämisse zu schreiben ist, als wollte man ein Boot ohne Riemen rudern.« Das trifft es meiner Ansicht nach sehr gut. Sie brauchen die Prämisse, um die Geschichte anzutreiben, um die Richtung zu bestimmen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Nur wenn Sie Ihre Prämisse kennen, können Sie den roten Faden durch den Plot ziehen und bestimmen, was in den Text gehört und was nicht.
Wie findet man die Prämisse? Zugegeben, meist hat man noch keine rechte Ahnung, wohin die Fahrt gehen soll, wenn man anfängt, eine Geschichte zu entwickeln. Doch wenn die Handlung in groben Zügen klar ist, kann die Suche starten. Sie müssen wissen, welcher (emotionale) Wert im Mittelpunkt steht, wohin und zu welchem Ende er den Protagonisten befördert. In der einfachsten Form folgt die Prämisse dem Muster X führt zu Y: Realitätsflucht führt ins Unglück oder Wer den Hass überwindet, wird sein Gleichgewicht finden oder Unerlaubte Liebe führt zum Tod – diese letzte Aussage beweisen beispielsweise Flaubert mit MADAME BOVARY (1857) und Tolstoi mit ANNA KARENINA (1877). Probieren Sie verschiedene Formulierungen aus und feilen Sie an Ihrer Prämisse, bis sie wirklich überzeugend und eingängig ist, dann wird sie Ihnen gute Dienste bei der Weiterarbeit leisten.
Übrigens: In der Geschichte selbst wird die Kernaussage nie explizit erwähnt. Eine Ausnahme bildet die Gattung der Fabel. Da wird traditionell am Schluss die Moral nochmals zusammengefasst: Wer hochmütig ist, wird vernichtet oder Niemand soll seinen Feind verachten, auch wenn er klein erscheint.
Wem die Suche nach einer Prämisse Schwierigkeiten bereitet, kann den umgekehrten Weg gehen: Nehmen Sie zum Beispiel ein Sprichwort oder eine Redensart und verfassen Sie eine Erzählung dazu. Deren Prämisse lautet vielleicht: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein oder Wer alles will, bekommt nichts oder Den Vogel, der am Morgen singt, holt am Abend die Katz.
4. Aus Bestsellern lernen
Sie kennen den Tipp bestimmt: Wer Romane schreiben möchte, sollte Romane lesen. Dadurch lernt man mehr als durch jeden noch so dicken Schreibratgeber. Besonders hilfreich müsste es demnach sein, Bestseller zu lesen. Auch wenn daraus nicht zwangsläufig folgt, dass einem selbst welche gelingen. Erfolg versprechende Strategien lassen sich aber zweifellos erkennen. Ein Musterbeispiel dafür ist EIN GANZES HALBES JAHR (2012) von der Engländerin Jojo Moyes. Der Unterhaltungsroman stand viele Monate auf den deutschen und internationalen Bestsellerlisten ganz vorne und verkaufte sich bis Mitte 2014 allein in Deutschland über 1,2 Millionen Mal.
Was hat dieser Roman, was andere nicht haben? Einen geradezu klassischen Spannungsaufbau und eine wunderbare Protagonistin. Mit der völlig durchschnittlichen Louisa Clark können sich Leserinnen leicht identifizieren: Sie stammt aus kleinen Verhältnissen, fühlt sich wenig selbstbewusst, schlingert ohne Ziel durchs Leben und hat sich in einer lauwarmen Beziehung mehr schlecht als recht eingerichtet. Dann wird sie arbeitslos und muss jeden erdenklichen Job annehmen. So kommt sie zu der Aufgabe, einen Mann zu betreuen, den sie unter anderen Umständen nie kennengelernt hätte. Will Traynor ist das genaue Gegenteil von Louisa: Er ist ehrgeizig, neugierig, reich, gebildet und gut aussehend – aber eben auch gelähmt und rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen. Louisas erstes Problem: Sie muss mit dem sarkastischen und depressiven Mann irgendwie zurechtkommen. Schon daran verzweifelt sie beinahe. Nur weil sie den Verdienst unbedingt braucht, harrt sie aus. Doch bald stellt sich heraus, dass der anfangs so groß erscheinende Konflikt im Vergleich zum folgenden lächerlich gering ist. Lou erfährt, dass Will fest entschlossen ist, sein Leben zu beenden. Seine Familie hat ihm eine Frist von sechs Monaten abgerungen, in der er seine Entscheidung überprüfen soll. Jetzt sieht Lou ein Ziel: Sie will in dem halben Jahr erreichen, dass Will seinen Entschluss aufgibt. Wird ihr das gelingen? Wer bis zu dieser Stelle gelesen hat, kann die Lektüre vermutlich nur noch schwer unterbrechen. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit um Leben und Tod eines geliebten Menschen, denn zumindest der Leser weiß lange vor Lou, wie es um ihre Gefühle steht.
Mehr Spannung geht nicht! Moyes hat einen absolut überzeugenden Plot kreiert, der ein Höchstmaß an emotionaler und existenzieller Dringlichkeit enthält, die durch den Zeitdruck zusätzlich gesteigert wird. Weitere Motivstränge wirken als Ergänzung: Lou entdeckt ihre Stärken, bricht aus der Bequemlichkeit aus und entwickelt Pläne für eine Veränderung ihres eigenen Lebens.
Kennen Sie andere Beispiele für dramaturgisch faszinierende Konflikte? Nehmen Sie Ihren Lieblingsroman zur Hand und prüfen Sie den Spannungsaufbau. Forschen Sie nach, in welchem Moment der Roman Sie gepackt hat. Wann wollten Sie ihn nicht mehr zur Seite legen? Was wollten Sie erfahren? Welche Frage sollte der Roman Ihnen beantworten? Welches Ziel verfolgte die Hauptfigur? Welche Hindernisse musste sie überwinden? Formulieren Sie anschließend ähnliche Fragen für Ihr Schreibprojekt. Finden Sie den Punkt, an dem Sie Ihre Leser ganz in den Bann der Handlung ziehen.
5. Eine Frage der Zeit: Präsens oder Präteritum?
Es ist ein Thema, das in meinen Seminaren häufig und kontrovers besprochen wird: In welchem Tempus, also welcher Zeitform, soll ein Roman oder eine Erzählung geschrieben werden?
Eigentlich muss darüber nicht diskutiert werden. Erst das Erleben, dann das Erzählen. Am Anfang steht immer ein Geschehen, das anschließend zur Geschichte wird, so ist der folgerichtige zeitliche Ablauf. Deshalb ist das Präteritum die klassische Zeitform der Narration und zugleich die logische. Eigentlich.
An diesem Punkt der Diskussion meldet sich regelmäßig jemand zu Wort und sagt, er habe neulich diesen Roman von der oder dem gelesen, der sei im Präsens geschrieben und deshalb spannender als andere Bücher gewesen. Dieses Argument wird oft benutzt: Präsens wirke näher dran, aufregender, dramatischer. Um das zu überprüfen, habe ich drei Thriller aus dem Regal gezogen, die sicher nicht in Verdacht stehen, langweilig zu sein: Dan Browns ILLUMINATI (2003), Melanie Raabes DIE FALLE (2015) und PASSAGIER 23 (2014) von Sebastian Fitzek – alle verwenden das Präteritum. Ob ein Roman spannend ist oder nicht, hängt also offenbar nicht von der verwendeten Zeitform ab. Ein langatmiger Text wird durch das Präsens keineswegs kurzweiliger.
Allerdings gilt: Schriftsteller sind frei in ihren Entscheidungen, nicht gezwungen, sich an grammatische oder orthografische Regeln zu halten.
Und so gibt es eine Reihe von Autoren, die manchmal oder sogar ausschließlich das Präsens benutzen, weil sie überzeugt