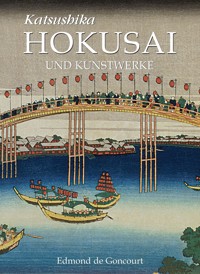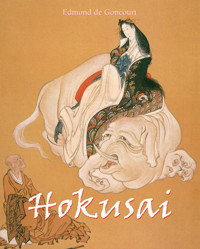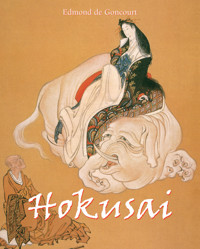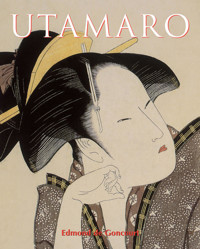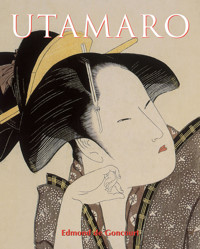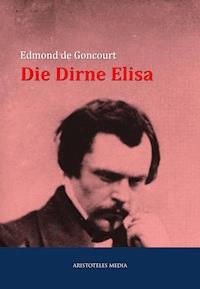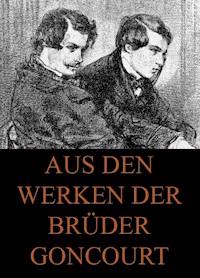
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Edmond de Goncourt und Jules de Goncourt waren französische Schriftsteller. Thomas Mann bezeichnete die Literatur der Brüder Goncourt als entscheidende Inspiration für das Abfassen seines Romans Buddenbrooks. Dieser Band enthält die folgenden Werke: Juliette Faustin Die Dirne Elisa Tagebuch der Brüder Goncourt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus den Werken der Brüder Goncourt
Edmond und Jules de Goncourt
Inhalt:
Edmund und Jules de Goncourt – Biografie und Bibliografie
Juliette Faustin
II
III
IV
Die Dirne Elisa
Erstes Buch
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
Zweites Buch
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.
LI.
LII.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.
LX.
LXI.
LXII.
LXIII.
LXIV.
LXV.
Tagebuch der Brüder Goncourt
Einleitende Notiz
Aus dem Tagebuch für das Jahr 1870
Aus dem Tagebuch des Jahres 1871
Aus dem Tagebuch des Jahres 1872
Aus dem Tagebuch des Jahres 1873
Aus den Werken der Brüder Goncourt, Edmond de Goncourt
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849617257
www.jazzybee-verlag.de
Edmund und Jules de Goncourt – Biografie und Bibliografie
Franz. Schriftstellerpaar, der ältere geb. 26. Mai 1822 in Nancy, gest. 16. Juli 1896 in Champrosay bei Paris, der jüngere geb. 17. Dez. 1830 in Paris, gest. daselbst 20. Juni 1870, waren Söhne eines Schwadronschefs der Kaiserzeit und Enkel von Jean Antoine Huon de G., einem Deputierten der Nationalversammlung von 1789. Sie betraten zuerst 1851 die schriftstellerische Laufbahn, die sie immer vereint verfolgten. Von einem ernsten Streben beseelt und durchaus selbständigen Kunstanschauungen huldigend, waren die Brüder G. auf dem Felde des Romans neben Flaubert die Führer der modernen naturalistischen Schule, in der sie mit diesem gewissermaßen den rechten, aristokratischen Flügel bildeten, während Zola den jüngeren linken und demokratischen befehligte. Ihr Stil ist überaus sorgfältig gepflegt, ihre Sprache reich, aber nicht selten affektiert. Den Grundton ihrer Romane bildet eine melancholische, pessimistisch resignierte Weltansicht. Wir nennen davon: »Les hommes de lettreh« (1860; neue Aufl. u. d. T.: »Charles Demailly«, 1869); »Sœur Philomène« (1861); »Renée Mauperin« (1864); »Germinie Lacerteux« (1865); »Manette Salomon«, eine Erzählung aus dem Pariser Künstlerleben (1867), und »Madame Gervaisais« (antiklerikal, 1869). Daneben haben die Brüder G. auf dem Gebiete der Kunst- und Kulturforschung in den Werken: »Histoire de la société française pendant la Révolution« (1854), »La société française pendant le Directoire« (1855), »Portraits intimes du XVIII. siècle« (neue Aufl. 1878, 2 Bde.), »Sophie Arnould, d'après sa correspondance« (1857, 2. Ausg. 1876), »Histoire de Marie-Antoinette« (1858; deutsch, 3. Aufl., Wien 1867), »Les maîtresses de Louis XV« (1860), »La femme an XVIII. siècle« (1862), »L'art au XVIII. siècle« (3. Aufl. 1883, 2 Bde.), »Gavarni, l'homme et l'artiste« (1873), »L'amour an XVIII. siècle« (1875) u.a. Vorzügliches geleistet und sich namentlich für die Kunst- und Sittengeschichte des 18. Jahrh. als geradezu klassisch erwiesen. Nach dem Tode Jules' de G. veröffentlichte Edmond allein noch die ultrarealistischen Romane: »La fille Élisa« (1878), die Geschichte einer Straßendirne, die unzählige Auflagen erlebte, »La Faustin« (1882) und »Chérie« (1885); ferner »Les frères Zemganno« (1879), ein rührendes Denkmal der Bruderliebe, »L'Italie d'hier. Notes de voyages 1855–1856«, mit Randzeichnungen von Jules de G. (1894), sowie zwei schätzenswerte räsonierende Kataloge: »L'œuvre de Watteau« (1876) und »L'œuvre de Prud'hon« (1877); »La Saint-Huberty, d'après sa correspondance« (1882); »Mlle. Clairon« (1890); »La Guimard« (1893), diese drei unter dem Kollektivtitel: »Les actrices du XVIII. siècle«; Briefe seines Bruders: »Lettres de Jules de G.« (1885); »Préfaces et manifestes littéraires« (1886); »Journal des Goncourt« (1887–96, 9 Bde.), die wichtigste Fundgrube für die Geschichte des Naturalismus in Frankreich; »La maison d'un artiste«, die Beschreibung der Kunstsammlungen, die das Haus der beiden Brüder in Auteuil umschließt (1881), und damit verwandt: »Outamaro« (1891), eine Übersicht des Wirkens des japanischen Malers und Karikaturenzeichners. Das Missgeschick, welches die beiden Brüder 1865 mit ihrem realistischen Drama »Henriette Maréchal« hatten, wurde reichlich ausgeglichen durch den Erfolg, den Edmond de G. allein mit der Bearbeitung von »Germinie Lacerteux« und »La fille Élisa« auf Pariser Bühnen erntete. Vgl. Delzant, Les G. (1889).
Académie des Goncourt nennt sich ein von Edmond de G. durch sein Testament gestifteter Schriftstellerverband von zehn Mitgliedern. Nach Goncourts letztem Willen soll jedes Mitglied einen Jahresgehalt von 6000 Fr. beziehen und jedes Jahr das Prosawerk eines Schriftstellers mit einem Preise von 10,000 Fr. gekrönt werden. Das Testament bezeichnete bloß acht Akademiker, nämlich Alphonse Daudet (gest. 1897), Gustave Geffroy, Léon Hennique, K. J. Huysmans, Paul Margueritte, Octave Mirbeau, Joseph-Henri Rosny und Iustin Rosny. Da der Ertrag der Versteigerung der von G. hinterlassenen Kunstschätze das nötige Kapital für seine Stiftung nicht vollständig ergab, kam die Begründung der Akademie, die im Gegensatze zu der alten Académie Française die neuern Richtungen der Literatur und nur die Prosa begünstigen soll, erst im Frühjahr 1904 zustande. An den Platz des verstorbenen Alphonse Daudet trat dessen Sohn Léon; Lucien Descaves und Elémir Bourges erhielten die zwei offenen Sitze. Den ersten Preis des Jahres 1904 trug der bis dahin ganz unbekannte John-Antoine Nau für den krausen Irrenhausroman »Force Ennemie« davon.
Juliette Faustin
Es war drei Uhr nachmittags. Juliette Faustin,, die am Abend die Phädra in Racines Tragödie zum zweiten Male spielen sollte, trat in ihr Badezimmer.
Dieser Raum – das "porzellanene Zimmer" nannte ihn ihre alte Haushälterin, Frau Guénégaud – war der einzige in Juliettes elegantem kleinem Hause, dessen Ausgestaltung sie nicht dem Architekten überlassen hatte; zu ihrem Vergnügen hatte sie ihn nach eigenem Geschmack ausgestattet und mit einem so verschwenderischen Aufwand an Geld, wie es ihr bei der übrigen Einrichtung nicht in den Sinn gekommen war. Sie, die Frau, die eine Stunde jedes Tages im Wasser zubrachte, pflegte zu sagen, in dem müßigen Nichtstun des Bades verlange das Auge, durch Schönes an den Wänden unterhalten zu werden. Und sie hatte von Bracquemond, dem phantasievollen Raumkünstler, vierundzwanzig große Fayenceplatten herstellen lassen, um damit das Bad an allen vier Seiten völlig in eine Täfelung aus Porzellan einzuschließen.
Von Künstlerhand auf die spiegelglatten Flächen gezaubert, sah man die hochbeinigen Vögel, die über Strömen und Flüssen dahinstreichen, über den Seen inmitten lanzenspitzen Röhrichts an sumpfigen Ufern; und die Flüge dieser Vögel mit dem glasklar farbigen Gefieder schossen wie Blitze durch ein Grün von lichtem Schmelz, das sich heiter von dem weißen schillernden Untergrund abhob. Den Fußboden des Zimmers hatte der Künstler, einen anmutigen Einfall erprobend, unter dem lustigen Blütengestreu verschwinden lassen, mit dem ein starker Wind das Erdreich unter blühenden Bäumen überschüttet, und die kleinen Fliesen des Bodens schienen über und über besät mit den weißen Blütenblättern des Kirschbaumes, den feuerroten der japanischen Quitte.
Als Sitze dienten Schemel aus chinesischem Porzellan. Die Decke war höchst originell: Eine Rose aus geschliffenem Spiegelglas in der Mitte, die verbindenden Leisten unter Schnitzwerk verborgen, ahmte das durchbrochene Dach eines orientalischen Lustzeltes nach, und auf das azurblau belegte Glas – ein Versuch von ganz überraschender Wirkung! – waren Blumen gemalt, wie die italienischen Salons des siebzehnten Jahrhunderts sie liebten. Diese Malereien hatte die Faustin einem einzigartig begabten, doch dem Absinth verfallenen Künstler fast gewaltsam abgezwungen: Um sie von ihm zu erlangen, behielt sie ihn einen vollen Monat als Gefangenen in ihrem Hause. Zur Einfassung diente der Deckenrose ein breiter Rahmen aus mehrfach geschichteten Kristallgewinden, die, in den Ecken tief heruntergezogen, mit ihrem reichen Schliff und den vielfältigen Facetten hüpfende Lichter versprühten.
In der Mitte des Zimmers ragte ein gewaltiges Kupferbecken und blitzte wie Gold; dahinein gepflanzt war weißer Flieder, fast ein kleiner Baum, und die Faustin ließ ihn den ganzen Winter und den ganzen Frühling hindurch jederzeit durch neue Pflanzen ersetzen, sobald die Blüten welkten.
Der Gegenstand jedoch, der das Begehren einer verwöhnten Frau wecken mußte, war eine Badewanne aus makellos weißer Fayence, mit einer Ranke von Myrtenblättern auf ihrem Rand als einzigem Schmuck; nur zwei Wannen dieser Art zu brennen glückte dem Hersteller, denn die Konstruktion eines Brennofens für diese so ungewöhnlich großen Stücke richtete ihn zugrunde; die eine Wanne besaß die Faustin, die andere befindet sich im Museum zu Sèvres. Die Hähne für das heiße und das kalte Wasser, zwei Schwanenhälse aus dunklem Silber, waren nach Wachsmodellen aus dem Nachlaß des früh verstorbenen genialen Goldschmiedes Possot gegossen.
Am Kopfende der Badewanne hing ein mit weißem Flanell gefütterter Morgenrock aus alten Guipure-Spitzen von einem Ruhebett, das mit einer Matte, zart wie das Manilageflecht eines Zigarrenetuis, bedeckt war; zwei kleine Pantöffelchen aus Kolibrifedern verschwanden fast unter einem zu Boden geglittenen Zipfel des Gewandes.
Juliette Faustin war seit drei viertel Stunden im Wasser, sie träumte und sann mit unbestimmten, vom langen Bade wie aufgelösten Gedanken ihrem Morgenbesuch beim Marquis de Fontebise nach. Beifall, Hervorrufe, die Ovationen am Schluß der Tragödie, das alles hatte sie bei der Aufführung am vorvergangenen Tage geerntet, und dennoch war sie nicht ganz mit sich zufrieden, ihr schien, sie habe nicht all das gegeben, was zu geben sie sich versprochen hatte, als sie an die Rolle heranging. Ja, sie hatte aus der ganzen Fülle ihrer Kunst gespielt; aber selbst die größte Kunst – genügte sie wirklich für diese Rolle? ... und ohne daß sie wußte, warum, tönte ihr in diesem Augenblick fast wie zum Hohn ein lang vergessener Schrei ins Ohr: ein Schrei, den sie in einem schlechten Boulevardstück eine sehr mittelmäßige Schauspielerin in der Rolle einer Schwindsüchtigen hatte ausstoßen hören... eine Schauspielerin aber, die selber ein wenig schwindsüchtig war.
Mitten in ihrer Träumerei wurde Juliette durch die Haushälterin unterbrochen, die hereintrat, um ihrer Herrin eine Karte zu reichen und ihr zu melden, der Überbringer der Karte sei unten und bitte um Tag und Stunde, wann sie ihm die Ehre erweisen wolle, ihn zu empfangen.
Die Faustin las den Namen auf der Karte: Lord Annandale.
"Lord Annandale", sagte sie, "mir nicht bekannt... nein, ganz und gar nicht."
"Madame kennen den Herrn nicht? Aber das ist doch Monsieur William Rayne!"
"William Rayne! William Rayne, sagst du... ja, jetzt fällt mir ein... Annandale war der Name seines Vaters... Schnell, lauf und bring ihn zu mir!"
"Madame vergessen gewiß, wo Sie sind?"
"Ich befehle dir, führ ihn herein."
Mit vor Erregung bebender Hand riß die Faustin ein Fläschchen von einem Wandbrett, leerte seinen ganzen Inhalt in das Bad, und als Lord Annandale eintrat, war der Körper der nackten Frau nur ein rosiger, kaum sichtbarer Schimmer inmitten von opalem, milchigem Weiß, das verschleiernd ihre Nacktheit mit einem Nebelduft umhüllte.
Der junge Lord, in tiefe Trauer gekleidet, näherte sich ehrfurchtsvoll der Badenden; dann blieb er neben ihr stehen und beugte ein Knie zum Boden, um die feuchte Hand zu küssen, die ihm die Faustin entgegenstreckte – fast furchtsam, wie vor einer Geistererscheinung.
"Ja, ich bin es! ... oh, vieles hat sich in meinem Leben zugetragen! ... später werde ich Ihnen alles erzählen... aber ich habe Ihre Briefe gelesen und weiß, daß Sie mich noch lieben, Juliette!"
"Sie, William! ist es möglich?" Und die Faustin hielt inne, um ihn mit ganzer Seele anzuschauen, als wollte sie sich seines Daseins, seiner Gegenwart, seiner Wirklichkeit versichern, und fast irre Freude war in ihrem Blick. Und als er reden wollte, legte sie ihm mit unsicherer Bewegung die Hand auf den Mund. "Nein, nein", hauchte sie, "sprechen Sie nicht. Was Sie mir sagen – es macht mich denken; und der Klang Ihrer Stimme – er lenkt mich ab... Und ich will Sie sehen... immer nur Sie sehen!"
Die alte Haushälterin trat abermals ein. "Um Gottes willen, Madame! Monsieur Blancheron ist da und will Sie dringend sprechen. Er läßt sich nicht abweisen."
Über die Züge der jungen Frau flog etwas wie der Unmut eines plötzlichen Erwachens; danach kam es von ihren Lippen: "Sag Blancheron, daß ich ihn nicht empfangen kann... daß ich mit Mylord schlafe!" Und da die Alte zögerte, den Auftrag auszuführen, setzte sie gebieterisch hinzu: "Sag ihm das! Ich befehle es dir."
Als die Dienerin gegangen war, winkte die Badende William durch einen Blick zu sich heran, daß er sich auf einen Porzellanschemel dicht neben der Wanne setze. Und die Arme schamhaft über der Brust gekreuzt, nur die braunen Locken an Williams blondes Haar geschmiegt, den Kopf schmeichlerisch wiegend, sprach sie verwirrte und zärtliche, von jähem Verstummen dann und wann unterbrochene Worte, sprach sie all das aus, was die Liebende selig bewegte, bis sie unvermittelt schwieg und ihr Gesicht von dem Geliebten weg zur Seite kehrte. William beugte sich über Juliettes abgewandtes Antlitz und sah Tränen still über ihre Wangen fließen, glückliche Tränen, die sich in den geschürzten Winkeln ihrer lächelnden Lippen verloren.
"Oh! Das ist ja eine recht sonderbare Art von Glück... es sieht fast aus, als ob ich weinte", sagte die Faustin und fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen. "Schon vier Uhr! William, wir müssen uns trennen... Holen Sie mich heute abend vom Theater ab. Guénégaud wird Ihnen die Karte für die kleine vergitterte Loge geben... Rasch! Gehen Sie jetzt."
Doch ehe William den Raum verließ, sandte ihm die Schauspielerin, mit Brust und Armen aus dem Wasser tauchend, eine Kußhand nach und rief:
"Mylord, für Sie wird die Faustin heut' abend spielen... hören Sie... für Sie allein!"
II
Als die Faustin am Theater anlangte, sah sie, daß sich bereits eine endlose Menschenschlange die Fassade an der Rue de Richelieu entlangwälzte, um die Arkaden bog und sich bis in die kleine Rue de Montpensier hineinwand, eine aufgeregte, gestikulierende Menge, aus der verworren der Lärm leidenschaftlicher Wortwechsel stieg.
Paris war von glühender Neugier auf diese zweite Aufführung ergriffen, denn nach der ersten hatten die Meinungen unversöhnlich gegeneinander gestanden: Die einen erhoben die neue Tragödin über die berühmte Rachel, die anderen meinten, sie besitze nur ein sehr durchschnittliches Verständnis für die Rolle, verfüge jedoch über ungewöhnliche schauspielerische Mittel; sie sei ein wundervolles Instrument, auf dem der alte Marquis de Fontebise spiele – eine Schauspielerin von großem Können also, aber keineswegs eine Schauspielerin aus dem Gefühl. Dies war seit zwei Tagen der Gegenstand der Gespräche und Debatten in den Cafés, den Salons, den Klubs. Zudem war anläßlich des ersten Auftretens der Faustin eine Zeitungsschlacht über die Frage entbrannt, ob es vertretbar und den geheiligten Traditionen gemäß sei, die längst entschlafene große Tragödie durch die Effekte des modernen Dramas zu künstlichem Leben zu erwecken, wie die neue Phädrä es unternahm. Und ganz Paris hatte sich heute abend im Théâtre-Français zusammengefunden, um in letzter Instanz das Urteil über die Künstlerin zu sprechen.
Die Faustin ging in ihre Garderobe hinauf und begann ihre Rolle durchzuproben, doch in solcher Unruhe, daß ihr Blick jede Minute die Uhr auf dem Toilettentisch suchte und ihr Ohr auf das ferne Gesumm im Zuschauerraum hinunterlauschte, das anschwoll und zu ihr drang wie das Wogenrauschen der steigenden Flut bei einer Überschwemmung.
Entgegen ihrer Gewohnheit war die Schauspielerin schon auf der Bühne, bevor die drei üblichen Schläge den Beginn der Vorstellung anzeigten – und spähte durch das Loch im Vorhang. Gleichgültig glitt ihr Auge durch den Saal voll berühmter Leute, über die strengen Kunstrichter im Parkett, das lärmende, von ihr schon im voraus zu Fieberglut erhitzte Publikum; in diesem ganzen Saale suchte ihr gieriger Blick beharrlich nur nach der einen Silhouette im Dunkel, hinter dem Gitternetz einer Loge. Während der letzten Minuten vor der Aufführung, indes sie lange und starr auf das schwarze viereckige Gelaß schaute, gewiß, daß nun jemand darinnen war, befiel sie etwas wie eine zärtliche physische Kraftlosigkeit, eine süße Ohnmacht, und dem Umsinken nahe, klammerte sie sich einen Augenblick mit dem kleinen Finger an das Vorhangloch.
Als dann die Darstellerin bei ihrem Auftritt die Verse zu sprechen hatte:
"Laß uns nicht weitergehn. Laß mich hier Ruhe finden. Die Knie wanken mir, und meine Kräfte schwinden",
da flüsterte die Faustin diese Worte mit all der Verlorenheit des Wesens, das in Liebessehnen erlöschen will, und in jenen hinschmelzenden Tönen, bei denen die Liebenden im Theatersaal einander mit den Augen suchen. Und ihr Mund sprach Racines Dichtung nicht zu einem namenlosen Publikum, ihm von der Liebe Phädras, der Gemahlin des Theseus, zu erzählen; nein, sie erzählte William von Juliettes Liebe, und mit dem Dunkel griechischer Haine beschwor sie vor ihm das Dunkel der Wälder Schottlands, und alles, was sie in überschwenglicher Leidenschaft sagte, war so offenbar nach der kleinen dämmerigen Loge hin gesagt, daß sich ohne Unterlaß Köpfe aus den Parkettreihen umwandten oder vom Balkon niederbeugten und eifersüchtig den Schattenwinkel durchforschten, in dem ein Unbekannter sich verborgen hielt, ein Mann, dessen Züge man kaum unterscheiden konnte.
William suchte die Künstlerin nach dem ersten Akt in ihrer Garderobe auf, um sie zu beglückwünschen; sie schickte ihn fort: "Kommen Sie nicht wieder, ich will Sie nicht hier, nicht inmitten dieser gleichgültigen Leute sehen... Aber warten Sie nach der Vorstellung auf mich, in meinem Wagen."
Im zweiten Akt, bei dem Geständnis ihrer Liebe, versagte der Faustin für einen Augenblick die Stimme im Aufruhr ihrer eigenen Leidenschaft; doch die Menge hörte in dem Pianissimo ihrer Rede nur den Krampf einer im Gefühl vergehenden Seele, und niemals vielleicht haben die berühmten Verse eine so mächtige Wirkung hervorgebracht.
Auch während dieses Aktes, wie in jedem der drei folgenden, war immer noch, immer wieder William der eine, an den sich alle Worte dieser Phädra richteten – Modulationen eines unendlichen Liebesbekenntnisses durch alle Tonarten der Leidenschaft –, der eine, dem jetzt ein Ermatten, jetzt der Aufschwung, der Verzweiflungsschrei eines Herzens galt und auch jeder Triumph der Künstlerin, wenn sie fühlte, die Liebesverzückung ihres ganzen Seins habe einem Vers den überzeugenden, hinreißenden Ton geliehen.
Die Bravorufe, den Beifall, das Toben der im tiefsten durch das innerliche Spiel echter Leidenschaft bewegten Zuschauer – all das hörte, sah, spürte die Schauspielerin nicht. Nur einem einzigen gehörend, kannte sie nicht Parkett noch Rang, nicht Galerie, Amphitheater und Parterre; sie sah nur zwei weißbehandschuhte Hände auf dem halb herabgelassenen Gitter einer Loge.
Für Lord Annandale spielte die Faustin, so wie sie es ihm versprochen hatte, für ihn allein; und sie schenkte ihrem Geliebten die größte Befriedigung männlicher Eitelkeit, die eine Schauspielerin gewähren kann: Die Künstlerin bringt ihm ihre Kunst als Liebesopfer dar, im Angesicht von zweitausend Menschen, die sie verschmäht, für die sie spielt und die doch für sie sind, als wären sie nicht.
Je weiter die Tragödie voranschritt, desto mehr wuchs die Bewunderung aller und zugleich das überraschte Staunen derer, die der ersten Aufführung beigewohnt hatten. Das war nicht mehr die ein wenig naturkindhaft-sinnliche Phädra des vorletzten Tages, die Phädra des Euripides; es war die Phädra Racines, die schmachtende, mit dem Gurren der verwundeten Taube vom gesitteten Hof alter Zivilisationen.
III
"Nach Haus, Ravaud! Fahren Sie langsam", hatte die Faustin ihrem Kutscher zugerufen.
Mit dem seidenen Rascheln, das von dem Kleid einer glücklichen Frau ausgeht, hatte sie sich neben William niedergelassen; und beide schwiegen, versunken in ihr Glück. Sie genossen die träge Wollust, die nachts in der Enge eines Wagens ein liebendes Paar erfüllt, wenn eine sanfte zärtliche Erregung sich von dem einen dem ändern mitteilt, wenn zwischen beiden Körpern, beiden Seelen ein knisterndes magnetisches Fluidum überströmt, und dies in dem schläfrigen In-sich-versponnen-Sein und jenem lässigen Beieinander, wo das Kleid der Frau die Beine des Mannes streift und ihre Wärme sich mit der seinen vermischt. Wie eine körperliche und geistige Vertraulichkeit in gedämpftem Lichte ist es; und der flüchtige Schein der Straßenlaternen, der durchs Wagenfenster fällt, treibt in der Finsternis sein Spiel mit der Frau, löst ihre Wange, ihre Stirn, eine blitzende Jettperle an ihrer Toilette aus dem köstlich beklommenen Dunkel und läßt für einen Moment ihr beschattetes Antlitz sehen und die Augen voll weichem Veilchenblau. Dazu das Schaukeln des Wagens, das Menschen und Gedanken in Schlummer wiegt und bei einem plötzlichen Stoß einen Kopf, der sich gibt, gegen eine Schulter wirft, die sich darbietet. Und ohne ein einziges Liebeswort überließen sich die beiden Liebenden dem leichten Trab des Gefährts; William hielt Juliettes Hand in seinen Händen und fühlte unbewußt ihre kleinen, in seine eigenen verschlungenen Finger, die feine glatte Haut von warmer Feuchte und die daunenweiche Innenhand, von der, wie ihm schien, etwas vom Leben der geliebten Frau in ihn hinüberfloß.
IV
Als sie zur ersten Etage des Hauses in der Rue Godot de Mauroi hinaufgestiegen waren und William innehielt, sagte die Schauspielerin:
"Weiter nach oben, Lieber, wir werden unser Souper diesmal im ›kleinen Stübchen‹ einnehmen." "Und die Herrschaften, die Madame für heut' abend eingeladen hat?" rief die Haushälterin verzweifelt durch die angelehnte Tür des Speisezimmers.
"Ach was, mögen sie ohne mich essen!... Du sagst ihnen, daß ich nach Le Havre gereist bin ... daß ich den Sturm erleben wollte, der für diese Nacht angekündigt ist."
Die Faustin ging ihrem Geliebten voraus bis zum obersten Stockwerk und führte ihn in ein Zimmer, dessen Decke, Fußboden und Wände mit gefirnißtem Tannenholz getäfelt waren; an der Seite stand ein Jungmädchenbett mit weißen Musselinvorhängen.
"Hier ist mein Eckchen, wo man mir Muße gönnt, meine Rollen zu studieren, mich an meine Rollen heranzutasten... und in dem Bett übernachtet mitunter eine Freundin aus der Provinz, wenn sie mich besuchen kommt."
Vor dem hellodernden Holzfeuer im Kamin waren auf einem kleinen Tisch eine Schüssel Krabben, ein kaltes Rebhuhn und ein Körbchen mit Fontainebleau-Trauben und zwei Granatäpfeln bereitgestellt, dazu eine Flasche Champagner: das Souper eines Studenten mit seiner Grisette.
"Über allem anderen", rief William, "habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt, daß Sie heute abend die größte Schauspielerin dieser Erde gewesen sind!"
"Heute wollen wir von nichts als von unserer Liebe sprechen", sagte die Faustin. "Aber warten Sie einen Augenblick." Und sie verschwand in einem Kabinett nebenan.
William setzte sich am Kamin nieder, sein Auge schweifte durch das kleine Zimmer, das nun in der beginnenden Wärme einen kräftigen Harzgeruch ausströmte; und beim Anblick des Bettes mit den weißen Vorhängen, dieses keuschen Bettes, empfand er ein Gefühl von Freude und Erleichterung, sich nicht in dem Zimmer zu befinden, wo die Faustin Zärtlichkeiten mit dem Manne tauschte, der sie aushielt.
Nach wenigen Minuten kehrte Juliette zurück, in Negligé und Spitzentuch, und blitzartig kam Lord Annandale die Erinnerung: dasselbe Negligé, dasselbe Spitzentuch hatte Juliette in Schottland getragen, in den Nächten, da sie beide, auf der Freitreppe des Schlosses sitzend, selbstvergessen die weißen Pfauen im Mondlicht angeschaut.
"Jawohl, ich habe sie aufgehoben!" sagte die Faustin und entzog sich Williams ausgestreckten Armen. Sie setzte hinzu: "Später... seien Sie vernünftig... jetzt lege ich Ihnen vor, Mylord."
Zu zweit an dem winzigen Tischchen und ohne aufwartende Bediente, nahmen die beiden ihr Souper; und mit dem streifenden Begegnen ihrer Hände, wenn sie einander eine Schüssel reichten, mit den unbefangen zärtlichen Torheiten aus jedem und keinem Anlaß, mit der Heiterkeit eines improvisierten Picknicks, mit der prickelnden Erregung des verliebten Beisammenseins in einer Dachstube glich es dem Souper von zwei jungen Menschen in der ersten Blütezeit ihrer Liebe.
Sie aßen, sie tauschten Blicke, sie lächelten einander zu. Dann und wann während dieses leidenschaftlichen Tête-à-tête ließ die Faustin die zum Munde geführte Gabel sinken, eine Minute lang betrachtete sie William andächtig, fast mit der religiösen Ekstase, die man auf Gemälden dargestellt sieht; und schwärmerisch, so wie ein Mann eine Frau bewundert, flüsterte sie in einem tiefen Aushauch aus beengter Brust:
"Sie sind sehr schön, mein schöner Lord!"
Die Faustin sprach wahr: Er war wirklich schön, der junge Lord Annandale; schön war die melancholisch milde Sanftmut seiner blauen Augen, schön das seidige Gelock von Haar und Bart, schön die durchsichtige Helle, die nur der Haut des Engländers eigen ist, schön die schlanke Geschmeidigkeit seines zugleich zarten und kräftigen Wuchses, schön war er in der edlen Haltung adeliger Blondheit.
Und es gewährte einen seltsamen und reizenden Anblick, wie der Mann, befangen, verwirrt, beglückt verlegen, sich von der Frau umwerben ließ – von derselben Frau, der vor kaum einer Stunde die Huldigungen von ganz Paris gegolten hatten.
Und verschlossenen Mundes fand der Engländer nicht Wort noch Sprache, um die liebenswürdige Anmut zu erwidern, die den Ernst dieser bezaubernden Liebe einer Französin bekränzte.
Das Mahl war beendet, und als es William nicht gleich gelang, sich eine Zigarette anzuzünden, nahm Juliette sie ihm aus der Hand, zündete sie an, zog einmal und schob sie zwischen seine Lippen.
"Nun aber, mein schöner Lord, zu Ihren Abenteuern! Erzählen Sie mir alle Ihre Abenteuer, seit wir uns getrennt haben."
Darauf berichtete William, wie sein Vater, in Unruhe über seine Liebe zu Juliette, ihn bestimmt hatte, seine Entlassung aus dem Amt bei der englischen Gesandtschaft in Belgien einzureichen; dafür hatte er ihm die Stelle des Ersten Privatsekretärs beim Vizekönig von Indien erwirkt, und dies innerhalb weniger Wochen und aus der patriarchalischen Autorität, die in den aristokratischen Familien Englands der Vater noch heute über den Sohn besitzt. William hatte an seine Juliette geschrieben, aber der Brief war von einem dem alten Lord blind ergebenen Bedienten aufgefangen worden. Darauf war er in Verzweiflung abgereist und hatte drüben Jahre verbracht, die ihm unendlich erschienen.
"Und der schwarze Tiger?"
"Woher wissen Sie das? ... Oh, die Verletzung war ganz unbedeutend, nur eine derbe Schramme... die Zeitungen haben gewaltig übertrieben."
"Wo war die Wunde? Ich muß sie sehen... zeigen Sie sie her!" – und die Finger der Faustin strichen wie unbewußt an seinem Arm unter dem Hemd entlang.
"Was sind Sie für ein Kind!"
Lord Annandale nahm seinen Bericht wieder auf: "Schließlich, nach drei langen Jahren, erhielt ich eine Depesche mit der Nachricht, daß mein Vater gestorben war.... Ich kehrte heim nach England... ich fand alle Ihre Briefe, ein versiegeltes Paket, das mir zu gegebener Zeit zugestellt werden sollte... es war gerade damals, als die Zeitungen Ihr Debüt an der Comédie-Francaise ankündigten.... Aber Erbschaftsangelegenheiten, die Fragen der Nachfolge hielten mich in England zurück... so konnte ich erst am Tage nach Ihrem ersten Auftreten in Paris sein...."
Da ließ sich Juliette auf den Teppich zu seinen Füßen gleiten, und neben ihm hockend und die verschränkten Arme auf seine Schenkel gestützt, fragte sie, während sie seine Augen mit den ihren festhielt:
"Und die Frauen da unten? ... ich will, daß Sie mir auch von denen erzählen!"
"Oh, die Bajaderen!" sagte Lord Annandale im Ton ironischer Bewunderung, "sehr niedliche kleine Dinger sind sie, mit ihren verschlagenen Kleinmädchengesichtern, den durchsichtigen Schleiern aus bunter Gaze, den engen Seidenhosen! Sie stampfen mit den nackten Füßen, ihre Hände tragen schwer an all den Ringen und Spiegelchen ... und obendrein die vergoldete Stirn, und die Nase, an der es von Schmuck klirrt!"
"Ja, ja, aber trotz dieser Nasen, mein schöner Lord, haben Sie dort unten sicherlich sehr viel geliebt."
"Dort lieben? ... Nein, Juliette", sagte der Engländer schlicht, "Ihr Bildnis habe ich geliebt... wenn ich auch glaubte, daß Sie mich vergessen hätten!"
Mit einem jähen Schwung der Hüften schnellte Juliette vom Teppich auf; sie warf sich rückwärts auf Williams beide Knie, zog die Lippen des Geliebten auf ihren Mund herab, und mit einem wilden Kuß sagte sie: "Komm."
Und in einer Sekunde hatte sie die Kleider abgeworfen, daß sie das Zimmer übersäten, und war auch schon im Bett. Da ruhte sie, in der reizenden Haltung einer Frau, die, den Kopf auf einen Ellbogen gelehnt, den Freuden der Nacht entgegenlächelt, und ihr halbgeöffneter Mund gleicht einer Rosenblüte voll feuchter Dunkelheit an ihrem Grunde.
Die Dirne Elisa
Wird sie zum Tod verurteilt werden?
Der Tag ging zur Neige, als im gelblichen Dämmerlicht eines Dezemberabends, im unheimlichen Dunkel des Gerichtssaales, während eine Uhr, die man nicht sah, eine gleichgültige Stunde schlug, umgeben von den Assisen, deren Gesichter durch das Rot der Roben wie verlöscht schienen, der Präsident den zahnlosen Mund öffnete, aus dem wie aus einem schwarzen Loch das Resümee kam.
Der Gerichtshof hatte sich zurückgezogen, die Geschwornen befanden sich im Beratungszimmer und das Publikum überflutete das Parkett. Hinter den von Riemenzeug überkreuzten Rücken zweier Gerichtssoldaten drängte man sich an den Tisch heran, auf dem die Corpora delicti lagen, betastete die rote Soldatenhose, entfaltete das blutbefleckte Hemd und versuchte das Messer durch das Loch der steif gewordenen Leinwand zu stecken.
Das Auditorium bot ein buntes Bild. Die Kleider der Frauen hoben sich in leuchtenden Farben von den düsteren Gruppen der Gerichtsbeamten ab. Im Hintergrunde promenierte die rote Silhouette des Staatsanwalts Arm in Arm mit der schwarzen Silhouette des Verteidigers der Angeklagten. Ein Polizist saß auf dem Sessel des Gerichtsschreibers. Aber dieses durcheinanderwogende Menschengewühl machte keinen Lärm, die Worte schienen sozusagen erstorben und eine seltsame und unheimliche Stille lag während dieses Zwischenakts über dem Saale.
Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach: die Frauen mit gesenkten Augenlidern und verschleiertem Blick, die Vorstadtburschen auf der Galerie, deren sonst gestikulierende Hände jetzt wie paralysiert auf der Holzbrüstung lagen. In einer Ecke saß ein Munizipalgardist, der seinen Tschako vor sich auf die Brüstung gelegt hatte und seine nachdenkliche Stirn gegen den harten Kappenschirm rieb. Plötzlich hielten die leise Plaudernden im halben Satz inne ... Jeder versuchte in seinen wirren Gedanken dieses dunkle Drama zu erklären, diesen Mord an dem Infanteristen, den dieses Weib umgebracht hatte, und jeder wiederholte sich die Frage:
Wird sie zum Tod verurteilt werden?
###
Tiefer wurde das Schweigen, die Dunkelheit immer undurchdringlicher und in jedem einzelnen steigerte sich, mit grausamer Neugierde gemischt, die Spannung, die der Gedanke an die Todesstrafe auslöst, die über einen Menschen verhängt werden soll.
Die Stunden verrannen und die Unruhe wuchs immer mehr.
So oft irgendwo im Justizpalast eine Tür zugeschlagen wurde, ging eine Bewegung durch die Menge. Alles blickte nach der kleinen Tür, durch welche die Angeklagte kommen mußte; einen Augenblick lang blieben die Blicke an ihrem Hut haften, den man dort drüben an den verblichenen Bändern aufgehängt hatte.
Dann versanken all diese Männer und Frauen wieder in stumpfe Unbeweglichkeit. Die lange Dauer der Beratung und die bedeutungsvolle Verzögerung der Urteilsfällung ließ in der Phantasie der Wartenden die roten Balken der Guillotine, den Henker, den ganzen gräßlichen Apparat einer Hinrichtung erstehen, samt dem bluttriefenden Haupt dieses jungen Weibes, das dort hinter der Scheidewand saß.
Lange, unendlich lange dauerte die Beratung der Geschwornen.
Der Saal wurde nur noch durch das blasse Blau einer frostigen Nacht erhellt, das durch die Fensterscheiben fiel.
Ein krummbeiniger Gerichtsdiener kam gespenstig wie ein Teufel durch die Dunkelheit angehumpelt, und verpackte und versiegelte die mit bräunlichen Flecken besudelten Wäschestücke.
Aus dem geheimnisvollen Dunkel traten Einzelheiten hervor. Die Tribünen des Saales, die Wandverschalung, die eben erst erneuert worden war und noch kein Todesurteil vernommen hatte. Das frische Holz trug noch die Spuren schnöder Arbeit und krachte verdächtig in den Fugen, wie von einem geheimnisvollen Leben bewegt, von einer Nervosität gleichsam, ob zu seiner Einweihung ein Hals abgeschnitten werden sollte.
Plötzlich schrillte eine Glocke durch den Saal. Und im selben Augenblick erschien ein Gendarmeriehauptmann in der kleinen Tür, durch die die Angeklagte eintreten mußte – blieb stehen, die Klinke der verschlossenen Tür in der Hand. Jetzt nahmen die Richter ihre Sitze ein. Jetzt kamen die Geschwornen die Treppe herab, die vom Beratungszimmer in den Saal führte.
Verhängte Lampen werden hereingebracht Sie werfen ein rötliches Licht auf den Gerichtstisch, auf die Aktenstücke, auf das Gesetzbuch.
In andächtiger Sammlung hält die Menge den Atem an.
Die Geschwornen haben ihre Plätze eingenommen. Ihre Mienen sind ernst, streng und nachdenklich, als fühlten sie die Majestät ihres hohen Richteramts auf sich lasten.
Da erhebt sich der Vorsitzende, ein weißbärtiger Greis, entfaltet ein Dokument und spricht mit einer Stimme, die von dem, was sie zu sagen hat, plötzlich heiser geworden ist, in schmerzlichem Tone diese Worte:
"Im Namen Gottes und der Gerechtigkeit verkünde ich, daß die Herren Geschwornen alle Schuldfragen mit überwiegender Stimmenmehrheit ohne Zubilligung mildernder Gründe bejaht haben."
Zum Tod! Zum Tod! Zum Tod! läuft es leise von Mund zu Mund, und anwachsend, gleich einem unaufhörlichen Echo, wiederholt sich noch lange bis in die äußersten Winkel des Saales das Schreckkensgemurmel Zum Tod! Zum Tod! Zum Tod!
Beim Gedanken an die Bedeutung dieses tödlichen "Ja", dieses gefürchteten und doch unerwarteten "Ja!" läuft ein eisiger Schauer über das Auditorium, von dem selbst die gefühllosen Rechtsvollstrecker ergriffen werden.
###
Für einen Augenblick stockt – im Verlauf dieser Tragödie – die Erregung der Menschen, und während dieses Augenblicks sieht man, beim Schein der Luster, die angezündet werden, gedankenlose, ziellose Gesten, Hände, die, ohne darauf zu achten, den Rock über dem pochenden Herzen zuknöpfen.
###
Und dann wird der Befehl gegeben, die Angeklagte vorzuführen. Um besser zu sehen, wie die Urteilverkündung ihr schmerzvolles Gesicht entstellen wird, sind einige auf die Bänke gestiegen.
Mit einem Satz erscheint die Dirne Elisa in der kleinen Tür, und forscht mit gierig-fragendem Blick in den Augen des Publikums nach ihrem Schicksal.
Aber die Augen senken sich, wenden sich ab, verweigern die Antwort. Viele von denen, die auf die Bänke gestiegen sind, steigen wieder herunter.
Die Angeklagte hat sich gesetzt, ihr Oberkörper pendelt beständig hin und her, ihr Kopf ist gesenkt und ihre Hände sind hinter dem Rücken gekreuzt, als wäre sie schon gefesselt.
Der Gerichtsschreiber liest der Angeklagten das Urteil vor.
Der Vorsitzende erteilt dem Staatsanwalt das Wort, der die Anwendung des Gesetzes verlangt.
Mit einer Stimme, die nichts mehr von dem scharfen, ironischen Tonfall des alten Richters hat, fragt der Vorsitzende die Verurteilte, ob sie hinsichtlich ihrer Strafe etwas zu bemerken hätte.
Die Verurteilte hat sich wieder gesetzt. Ihre Zunge sucht in dem ausgetrockneten Mund nach Speichel, und ein unterdrücktes Schluchzen läßt ihre Nasenflügel zittern. Ihr Körper pendelt noch immer hin und her, ihre Hände sind noch immer auf dem Rücken, und sie scheint die Worte des Vorsitzenden nicht recht zu verstehen.
Da erhebt sich der Gerichtshof, die Richter stecken die Köpfe zusammen, und während einiger Sekunden werden unter dem Zunicken der blassen Stirnen leise Worte gewechselt. Dann öffnet der Vorsitzende das vor ihm liegende Gesetzbuch und liest mit dumpfer Stimme:
"Der Vollzug der Todesstrafe erfolgt durch Enthauptung."
Bei diesem Wort springt die Verurteilte im Taumel ihrer Erregung vor, aus ihrem verzerrten Mund drängen sich irre Worte, zwischen ihren zuckenden Fingern wird ihr Hut zu einem unförmlichen Fetzen – plötzlich nimmt sie ihn vors Gesicht – schneutzt sich in das formlose Ding – fällt ohne ein Wort zu sagen auf die Bank zurück und schlingt ihre beiden Hände um den Nacken, den sie mechanisch festhält, als schauderte sie vor dem Beil der Guillotine.
Erstes Buch
I.
Das Weib, die Prostituierte, die man zu Tod verurteilt hatte, war die Tochter einer Hebamme aus La Chapelle. In ihrer Kindheit vollzogen sich alle sexuellen Intimitäten, wie sie der Beruf ihrer Mutter mit sich brachte, vor ihren Augen. Während sie in ihrer dunklen Kammer krank lag, hörte sie aus dem benachbarten Empfangszimmer die ganzen Geständnisse der Patientinnen. Alles, was unter Tränen gebeichtet, oder in zynischen Worten geschildert wurde, drang an ihre jungen Ohren. Sie erfuhr von den Geheimnissen der Zeugung, von den intimsten Schamlosigkeiten des sexuellen Verkehres in den Pariser Lasterhöhlen, da sie noch in ihrem Kinderbettchen, ja fast noch in der Wiege lag. In einem Lebensalter, da andere Kinder noch an den Storch glauben, von dem ihnen die Mutter erzählt, wurde ihr Kinderglaube durch schamlose Worte zerstört und ihre Unwissenheit durch erotische Details besudelt. In der Stille der Nacht hörte das vertraute, unschuldige Kind in seinem Bettchen die Schilderungen schändlicher Abenteuer, heimlicher Liebesdramen, widernatürlicher Laster und Ratschläge zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten; die ekelerregendsten Geheimnisse der sogenannten Liebe und der Prostitution drangen an ihre Ohren.
II.
Wahrhaftig grauenvoll war das Leben der kleinen Elisa im Hause ihrer Mutter. Die Anstrengungen ihres Berufes, das ewige Treppauf-Treppab, die Visiten bei Tag und Nacht und bei jedem Wetter, das Gott werden ließ, die Nachtwachen, die schlaflosen Nächte, der Aufenthalt in ungeheizten Wohnungen, die Plagen und ewigen Hetzjagden, die oft über ihre Kräfte gingen, das alles versetzte die Hebamme beständig in schlechte Laune und gereizte, brummige Stimmung, wie es gewöhnlich bei Leuten ist, die unter dem Joch harter Arbeit leben. Um bei Kräften zu bleiben, nahm sie reichliche Nahrung zu sich und trank oft über den Durst, und dann setzte es gewöhnlich Ohrfeigen. Manchmal auch entlud sich in einem solchen Klaps ihre Wut und ihr Mitleid über das Elend, das sie so oft zu sehen bekam, jenes furchtbare, erbärmliche Elend, wie es nur die Großstädte in sich bergen. Dann kam sie nach Hause, fegte daher wie der Sturmwind und schrie: "Ja! Kinderchen! Ein paar windschiefe Bretter, das sind die Wände, gestampfter Lehm als Fußboden darauf, für Mann und Frau ein Haufen Sägespäne und darum – grad' so wie um einen Sarg – vier Bretter, damit die Kinder nichts sehen. – Nicht weniger als sieben solche Bälge auf zwei gottverfluchten Strohsäcken, drei liegen oben und drei unten und sie können nicht einmal recht ihre kleinen Beine ausstrecken, weil der Korb mit dem Jüngsten ihnen im Weg steht, und sonst nichts in der ganzen Bude. Ein Kamm, eine Flasche und auf einem wackligen Tisch eine Brotrinde, von der alle Augenblicke eine Ratte, groß wie eine Katze, einen Brocken abbeißt. Mir graut noch jetzt davor. Das sind die Baracken von St. Lazare, wißt ihr, dort draußen, wo die vielen alten Häuser standen, die man jetzt niedergerissen hat. Und zu allem Überfluß wohnt daneben ein kleiner Savoyarde mit seinem Affen; und dieses verfluchte Luder fängt an zu winseln und zu stöhnen und mit allen Höllenkünsten dieser tierischen Hanswurste die Schmerzensrufe der Gebärenden nachzuahmen. Und zu guter Letzt pißt er noch durch eine Spalte in der Bretterwand auf die süßen Knirpse – Als Windel, wenn man das Windel nennen kann, mußt' ich mein eigenes Taschentuch verwenden, und als es hieß, das Neugeborene zu waschen, war zum Wärmen des Wassers nichts anderes da als ein Büschel Stroh aus der Matratze."
Gewöhnlich aber hatten die Wutausbrüche der Mutter Elisas einen anderen Grund. Die Entbindungen im Wöchnerinnenheim zu acht Franken, die Entbindungen zu Hause zu fünfzig Franken, die neuntägige Verpflegung inbegriffen, deckten nicht immer die eigenen Selbstkosten. Fast jeden Monat kam es vor, daß der Gerichtsvollzieher mit gewöhnlich schon prolongierten Wechseln ins Haus kam, daß der Fleischhauer, der Gemüsehändler und der Kohlenhändler den Kredit verweigerten. In solchen Zeiten der ärgsten Kalamität konnte der Hausmeister dann und wann ein junges Mädchen bleich und mit schwankenden Schritten die Treppe herabsteigen sehen, das ein paar Stunden früher zur Hebamme hinaufgegangen war, und mit diesen Besuchen fingen auch für die unglückliche Frau die Tage der Angst und der Sorge an, die Tage, wo sie vor dem Verbrechen zitterte, wo sie in jedem Blick, der sie streifte, einen Argwohn zu sehen glaubte; wo sie, wenn beim Vorübergehen von ihr die Rede war, eine Denunziation fürchtete, wo ihr bei einem Brief, den man ihr brachte, die Hände zitterten, wie bei der Todesnachricht einer von ihr "Behandelten", Tage, wo sie jedesmal, so oft die Glocke schrillte, den Polizeikommissär eintreten zu sehen fürchtete. Um diese quälenden Gedanken, die sie unausgesetzt beunruhigten, wenigstens für ein paar Stunden los zu werden, trank sie und wenn sie dann sinnlos betrunken war, so bedeutete das für die kleine Elisa jedesmal eine Tracht Prügel.
Aber Elisa hatte vor diesen Prügeln weniger Angst als vor den Nächten, die sie mit ihrer Mutter zubringen mußte! Wenn nämlich in der ganzen armseligen Wohnung alle Räume und sogar ihr eigenes Bett mit Wöchnerinnen belegt waren, schlief sie im Bett ihrer Tochter. Das Alpdrücken, das sie plagte, das Auffahren aus entsetzlichen Träumen, die Schreckensrufe, die sie ausstieß, der unruhige Schlaf des bösen Gewissens ließen dann das junge Mädchen die ganze Nacht nicht zur Ruhe kommen und an ihre erschreckten Ohren drangen grauenvolle Einzelheiten von Todeskämpfen sterbender junger Frauen, die die Schlafende ausstieß. Nach solchen Nächten erhob sich Elisa halb erstickt durch den fettleibigen Körper ihrer Mutter, der sich an ihren schlanken Leib anklammerte, als fürchtete die Hebamme, von der unsichtbaren Hand der Gerechtigkeit aus dem Bett gezerrt zu werden, und ein furchtbares Grauen vor der eigenen Mutter blieb in dem Herzen des Kindes zurück.
III.
Im Laufe von kaum sechs Jahren, zwischen ihrem siebenten und dreizehnten Lebensjahr, hatte Elisa zweimal den Typhus. Es war ein wahres Wunder, daß sie am Leben blieb! Längst betrachteten die Nachbarn voll Mitleid ihr schmales Gesichtchen, wie man junge Mädchen ansieht die einem frühen Tod geweiht schienen. Dennoch erholte sie sich wieder, aber die heimtückische Krankheit, die die Ärzte aus dem geheilten Körper nicht ganz zu bannen vermögen und die nach der Genesung dem einen die Zähne raubt, dem andern die Haare und beim dritten eine gewisse Stumpfheit des Geistes zurückläßt, sie verlief auch bei Elisa nicht spurlos. Sie nahm zwar keinen Körperschaden, aber ihre seelische Erregung bekam etwas von einer trotzigen Heftigkeit, einem störrischen Eigensinn, einer reizbaren Nervosität, so daß die Mutter von ihrer Tochter sagte, sie sei ein bißchen "verrückt". Mit diesem Ausdruck meinte die Hebamme ihre phantastischen Launen, die den normalen Menschen, wie sie einer war, in Staunen setzen mußten, Ausbrüche von fast unerklärlichem Zorn, deren Wildheit ihr manchmal beinahe Angst einjagte. Als kleines Kind verbiß sie sich einmal, wie ein junger Bulldogg, derart in die Hand ihrer Mutter, die sie prügelte, daß man Mühe hatte, ihre Zähne auseinanderzubringen. Später, als sie schon halb erwachsen war, mußte sie sich mit aller Mühe zurückhalten, um der Mutter nicht Schlag für Schlag zurückzugeben, und geriet dabei in eine solche verhaltene Wut, daß sie gegen die Wand schlug, als wollte sie sich den Schädel einrennen; aber diese Zornausbrüche waren nichts gegen ihren Starrsinn, ihren stumpfen Eigensinn und ihre ironische Widerspenstigkeit, die ihre Mutter nicht zu brechen vermochte und die mit keinem Mittel zu unterwerfen waren. Die Hebamme, die von ihrer Tochter wußte, daß sie eine richtige Vorstadtpflanze sei, bei jedem Tanz dabei, eine Bummlerin, die allen jungen Burschen der Straße schöne Augen machte und der man der Reihe nach die Liebhaber nachzählte, sie sagte ihr immer wieder, sie solle sich ja nicht unterstehen, mit einem Kinde nach Hause zu kommen. "Ich weiß schon", antwortete das Mädchen geringschätzig und mit so herausforderndem Ton, daß die Mutter Lust gehabt hätte, sie zu erwürgen.
Sie besaß einen unlenkbaren Charakter, ein zügelloses Wesen, mit dem nichts anzufangen war, bei dem nichts verfing. Dabei war sie unerhört launenhaft und veränderlich, so daß sie plötzlich, trotz des Abscheus, den sie vor ihrer Mutter empfand, in zärtliche Schmeichelei verfiel und ihre Mutter, die immer noch eine schöne Frau zu nennen war, zu küssen begann, wie jene kleinen Mädchen, die den Busen ihrer zum Ball geschmückten Mutter mit Küssen bedecken. – Diese plötzliche Zuneigung veränderte sich aber im Handumdrehen in gehässiges und freches Benehmen, das sich dann in Worten Luft machte, wie sie sie auf den Tanzböden auffing, Worte, die verrieten, daß die Zusammenkünfte mit ihren Tänzern oft in Zank und Streit ausarteten und daß ihre Liebeshändel mit Ohrfeigen und Prügel gewürzt waren. Der Wechsel in Elisas Launen schien mit den Schwankungen ihrer physischen Kräfte in irgend einem Zusammenhang zu sein. Einmal überkam sie die Arbeitswut, dann wusch, rieb und fegte sie, daß die ganze Wohnung widerhallte. Dann wieder befiel sie eine wochenlange Schlappheit, Müdigkeit und Faulheit, aus der sie keine Macht der Welt herauszurütteln vermochte.
Unter den zahlreichen Auseinandersetzungen, bei denen die Hebamme und ihre Tochter sich in die Haare gerieten, war besonders eines, das täglich Auftritte herbeiführte und in deren Verlauf die stumme und ironische Widersetzlichkeit der Tochter, wie die Mutter zu sagen pflegte, einen Heiligen zur Tobsucht gebracht hätte. Trotz aller Mühen und aller beständigen Aufregungen war die Mutter nämlich in gewissem Sinn stolz auf ihren Beruf.
Sie war stolz, ihren Namen im Bezirksamt in die Geburtsanzeigen eingetragen zu sehen. Sie war stolz auf den Ehrenplatz, den man ihr, wie es im armen Volk üblich ist, beim Taufschmaus einräumte, sie war stolz auf ihre Popularität der Straße, wo die Kaufmannsfrauen, die sie entbunden, und die Töchter jener Kaufmannsfrauen, die sie in die Welt beförderte und denen sie dann bei ihrer eigenen Niederkunft beigestanden hatte, wo die Kinder, die Mütter und die Großmütter, wo drei Generationen ihr vertraulich und ehrerbietig "Guten Tag, Frau Alexander!" zuriefen. Ihr Traum war, ihre Tochter als ihre Nachfolgerin, ihre Stellvertreterin, ihre Erbin zu sehen, aber ihre Tochter sagte, wenn sie sich überhaupt die Mühe nahm zu antworten, ihr Kopf sei nicht für blödsinnige Bücher geschaffen. Auch fand sie es durchaus nicht lustig, Tag für Tag die in die Kissen verkrampften Finger der Wöchnerinnen, die sich in Geburtswehen wanden, vor sich zu sehen.
Kurz, Elisa betonte jedesmal ihren festen Entschluß, sich lieber erschlagen zu lassen, als den Beruf ihrer Mutter zu ergreifen.
IV.
So wurde also Elisa in alles, was mit der Liebe zusammenhängt und was man vor den Kindern sonst verbirgt, in ihrer frühesten Kindheit, man kann fast sagen schon in der Wiege, eingeweiht. Später verbrachte sie drei Jahre in der Klosterschule von Saint-Quen und wenn sie von dort an Ferialtagen nach Hause kam, geschah es oft, daß sie ihr Jäckchen am Fußende des mütterlichen Bettes unter den Hosen des Kantors von La Chapelle hervorsuchen mußte, der ein alter Verehrer der Hebamme war. Und in den folgenden Jahren hatte sie Tag und Nacht das schlechte Beispiel vor Augen durch den beständigen Umgang mit all diesen unverheirateten Gebärerinnen und Abortierenden, denen sie als Krankenpflegerin und Kindermädchen zur Seite stand.
V.
Jedes Jahr kam im Frühling eine Frau zu Madame Alexander, um sich zur Ader zu lassen, "auf daß es ihr gut ginge und damit sie das ganze Jahr schön bliebe". Vielleicht war das eine alte medizinische Überlieferung der Hebammen vom Lande, vielleicht auch eine Art Aberglauben: die Frau kam regelmäßig am 14. Februar, dem St. Valentintag, zum Aderlaß. Diese Frau war eine Prostituierte aus einer Provinzstadt, die seinerzeit, als sie noch Dienstmädchen in Paris gewesen war, heimlich bei der Hebamme entbunden hatte. So oft sie nun nach Paris kam, um die Aufträge und Geschäfte des Hauses zu erledigen, blieb sie acht Tage bei Madame Alexander, wo sie wie in einem Hotel logierte. Die robuste Provinzlerin, die am Tag nach dem Aderlaß gleich wieder auf den Beinen war, und sich langweilte, wenn sie nichts zu tun hatte, half Elisa während der ganzen Zeit, in der sie zu Hause war, bei der Arbeit, und scheute sich nicht, auch bei den gröbsten häuslichen Verrichtungen Hand anzulegen. Abends nahm sie Elisa mit ins Theater. Sie lachte gern und viel und ihre weiche, ein wenig schleppende Art zu sprechen, flößte Vertrauen ein und gewann ihr im Handumdrehen die Sympathie aller Leute. Sie reiste niemals ab, ohne Elisa, die sie ins Herz geschlossen hatte, ein kleines Geschenk zu machen, und so kam es, daß das junge Mädchen alljährlich dem St. Valentintag mit einer gewissen Freude entgegensah.
Eines Abends nun nach einem solchen Aderlaß, setzte sich Elisa nach einem fürchterlichen Auftritt mit der Mutter an das Bett ihrer Freundin und gestand ihr in kurzen, abgerissenen Worten den geheimen, aber unerschütterlichen Entschluß, mit welchem sie sich seit Monaten trug.
Sie hätte das Leben mit ihrer Mutter satt – als Verkäuferin wolle sie sich nicht abrackern – Hebamme wolle sie schon gar nicht werden – sie hätte seit Wochen ihre Ankunft mit Sehnsucht erwartet – komme was da wolle – sie sei entschlossen durchzubrennen und mit ihrer Freundin zu fahren – und wenn sie sie nicht mitnähme, würde sie in ein Pariser Haus eintreten – ins erstbeste – denn mit der Mutter auszukommen sei einfach ein Ding der Unmöglichkeit, da sei es leichter, einen Toten wachzukitzeln – es sei um aus der Haut zu fahren. Sie kenne wohl einen Burschen, der eine Neigung für sie habe – aber sie habe beobachtet, daß ihre Freundinnen, die mit einem Mann zusammenleben, zu sehr unter die Sklavenfuchtel gekommen seien – da sei ihr schon lieber, in so ein Haus zu gehen – das Leben in der Provinz stelle sie sich sehr nett vor – und zumindest könne sie sich dort ausschlafen.
"Ei! Ei!" meinte die Freundin ein wenig erstaunt, im Grunde aber höchst erfreut über diesen Vorschlag. Es war zwar nicht ihre Gewohnheit, solche Rekrutinnen anzuwerben, aber nachdem sie sich überzeugt hatte, daß Elisa das sechzehnte Jahr überschritten hatte, willigte sie mit Freuden ein und gab nur ihrer Befürchtung Ausdruck, daß ihre Mutter bei der Polizei Krawall schlagen könnte.
"Haben Sie keine Angst, die Mutter hat nicht gern mit der Polizei zu tun, aus guten Gründen. – Sie wird glauben, ich sei zu einem meiner Tänzer von der ›Boule-Noire‹ gezogen. Das wird alles sein ..."
Dann setzte ihr Elisa auseinander, wie man es einrichten müsse, damit ihre Mutter nicht den leisesten Verdacht auf sie haben könne. Elisa würde sich einen Tag vor ihrer Abreise aus dem Staube machen. Sie solle sich von ihrer Mutter zum Mühlhauser Zug begleiten lassen und würde ihre Reisegefährtin erst in der nächsten Station treffen.
Die beiden Freundinnen verabredeten den Tag der Abreise und schon am nächsten Tag verschwand Elisa aus der mütterlichen Wohnung.
VI.
Als Elisa und ihre Gefährtin am Bestimmungsort den Zug verließen, nahmen sie den Omnibus und fuhren an düsteren Häusern vorbei durch endlose Straßen. Nachdem alle anderen Fahrgäste bereits ausgestiegen waren, bog der Omnibus in ein kleines, krummes Gäßchen, das ganz wie ein alter Stadtwall mit einer schneebedeckten Brustwehr umgeben war.
Mühselig rollte der schwere Kasten durch den Schneesturm – für einen Augenblick sah Elisa durch das Fenster die matten Umrisse eines Gekreuzigten mit den blutenden Wunden, der vom Wind gepeitscht im Unwetter ächzte.
Eine Minute später gewahrte sie in unbestimmter Entfernung ein einzeln stehendes Haus mit einem roten Licht. Als der Wagen näher kam, sah sie deutlich die große rote Laterne, die zu ihrem Erstaunen mit einem Schutzgitter wie mit einem Käfig umgeben war, um sie vor den Steinwürfen der Vorübergehenden zu schützen.
Der Wagen hielt vor dem Hause mit der roten Laterne, diesem etwas verfallenen Steinkasten, der wie eine alte Feste aussah, mit seiner verschlossenen und verriegelten Türe, durch deren Guckfenster ein bleiches Licht auf den schneebedeckten Weg fiel.
Ohne abzusteigen reichte der Kutscher den beiden Frauen ihre Koffer herunter. Dann schnalzte der große "Lolo", den man den "Schürzenjäger" nannte, lustig mit seiner Peitsche und lachte den beiden mit breitem Grinsen freundschaftlich zu.
VII.
Am zweiten Tag nach ihrer Ankunft wurde Elisa bei Morgengrauen durch Pferdegetrampel unter ihrem Fenster geweckt.
Sie stand auf und trat ein wenig ängstlich im Hemd ans Fenster, um durch den Vorhangspalt hinunter zu gucken, was im Hofe los sei.
Im weißen Morgennebel spannte ein stämmiger Bursche in einer blauen Bluse über dem Anzug das Pferd eines Bauernwagens aus und plauderte dabei mit Madame wie mit einer alten Bekannten.
"Der Braune hat tüchtig angezogen," sagte er und fuhr mit der Hand über die Kruppe seines Pferdes, "schau'n Sie, er dampft wie ein Waschkessel."
Und als die alte Frau sich anschickte, das Pferd am Zug zu nehmen: "Lassen Sie nur, er braucht Sie nicht, er kennt schon den Weg in den Stall. – Na, Mama, es ist was Neues im Haus, wie?"
###
Elisa hatte sich dem ersten, der da kam, hingegeben, und sich so fast ohne jede Gewissensregung zur Prostituierten gemacht. Von Jugend auf hatte sie sich daran gewöhnt, in der Prostitution den selbstverständlichen Beruf ihres Geschlechtes zu sehen. Ihre Mutter machte so wenig Unterschied zwischen dieser Sorte von Frauen und den anderen – den anständigen Frauen. Während der langen Jahre, in denen sie als Krankenpflegerin mit solchen Weibern zu tun hatte, hörte sie diese mit so tiefer Überzeugung das Wort "arbeiten" aussprechen, um die Ausübung ihres Gewerbes zu bezeichnen, daß sie sich allmählich daran gewöhnt hatte, den Verkauf der Liebe als ein Gewerbe wie jedes andere anzusehen, ein Gewerbe, das ein bißchen weniger mühselig sein mochte als die anderen, in dem es aber wenigstens keine tote Saison gibt.
Die Prügel zu Hause und die fürchterlichen, im gemeinsamen Bett mit der Mutter verbrachten Nächte mochten Elisas Flucht aus La Chapelle und ihren Eintritt in das Haus zu Boulemont mit veranlaßt haben, aber der ausschlaggebende Grund dafür lag sicherlich in ihrer Faulheit, einzig und allein in ihrer Faulheit. Elisa hatte genug gehabt von der anstrengenden Hauswirtschaft, dem Aufbetten, dem Feuermachen, dem Kochen und Umschlägeauflegen in allen vier Zimmern, die fast ständig mit Patientinnen vollgepfropft waren. Und an Tagen, da sie unter dieser Zwangsarbeit zusammenbrach, fühlte sie sich gleichermaßen unfähig, stundenlang beim Nähen oder Sticken zu sitzen. Vielleicht lag der Grund für die Faulheit auch ein wenig in einer gewissen körperlichen Schlaffheit, wie man sie oft in den Übergangsjahren des jungen Mädchens zum Weibe beobachten kann und die jeder alle Kräfte lähmt, was besonders dann schlimm genug ist, wenn es sich um Mädchen handelt, die in Armut leben. Diese Faulheit und die Befriedigung einer ziemlich schwer zu erklärenden Charaktereigentümlichkeit, die man besonders oft bei trotzigen Naturen findet, diesen Stolz nämlich, sich über die öffentliche Meinung hinwegzusetzen, das waren die beiden einzigen Gründe, die Elisa so plötzlich der Prostitution in die Arme getrieben hatten.
Es wäre falsch zu glauben, daß Elisa sich zu diesem "Berufe" aus sinnlicher Veranlagung oder Sucht nach Ausschweifungen und erotischen Reizen entschlossen habe. Die schlimmen Befürchtungen ihrer Mutter, daß Elisa durch den ständigen Besuch der Tanzlokale verdorben werden könne, die diese aus einem wahrhaft teuflischen Widerspruchsgeist und aus Angst vor der öden Wirklichkeit beständig nährte, waren ganz unbegründet gewesen. Elisa war noch Jungfrau! Freilich eine durch das verderbliche Treiben im Hause ihrer Mutter und durch den Besuch der schmutzigen Vorstadtbälle schon stark angefaulte Unschuld. – Aber schließlich – wenn sich die Gelegenheit für den "Fehltritt", wie man im Volksmund sagt, durch Zufall nie geboten hatte, Elisa hatte auch nichts getan, sie herbeizuführen – und so war ihr Körper unberührt geblieben.
Das Groteske war, daß die Unberührtheit, die Jungfräulichkeit ihres Körpers Elisa sechsunddreißig Stunden lang die schwersten Sorgen machte, zu einem ängstlich gehüteten Geheimnis wurde, das sie wie ein übles Verbrechen verbarg, und sie zitterte, sich zu verraten und fürchtete, daß das Bekanntwerden ihrer Jungfräulichkeit ihrer Aufnahme in das Haus hinderlich sein könnte. Und so kam es, daß diese jungfräuliche Dirne aus Angst, zu ihrer Mutter zurückgeschickt zu werden, ihrem ersten Klienten eine Komödie der Schamlosigkeit vorspielte, um ihn glauben zu machen, daß er keine Novize, sondern eine ausgelernte Dirne vor sich habe.
VIII.
Elisa sah sich von ihrer Mutter befreit. Ihr tägliches Brot war gesichert. Die Sorge um das "Morgen", unter der die Arbeiterin bangt, war für sie ohne Bedeutung. Die Männer, die das Haus besuchten, wären durchaus nicht brutal, mit den "Kolleginnen" vertrug sie sich ganz gut, Monsieur und Madame schienen honette Leute zu sein. Das Essen war recht famos. Den verfaulenzten Tagen folgten stille, ruhige Abende, die etwa so verliefen.
Draußen tiefe Stille, der Friede eines abgelegenen Stadtviertels, das Schweigen einer Straße, die nach Einbruch der Nacht nicht mehr begangen wird. In der Stube die laue Luft eines überheizten Ofens, wo die warme Feuchtigkeit der Wäsche, die auf den Möbeln trocknete, sich mit dem faden Geruch der Kastanien mischte, die in gezuckertem Wein kochten. Auf dem abgetretenen Teppich eine große Katze, ein unbeweglicher schwarzer Fleck. Die Frauen lehnen halb schlafend in den Ecken der beiden Kanapees. Monsieur, mit seinem dichten grauen Knebelbart, in seiner Ärmelweste, eine kleine Schirmmütze bis über die Ohren, gezogen, die Hände mit dem Daumen nach außen in die Hosentaschen vergraben, läßt seine Blicke seelenvergnügt über die Illustrationen eines Bandes der "Berühmten Verbrecher" gleiten, ein Buch, das der Sohn des Hauses, ein hübscher, blasser, junger Mensch in Pantoffeln, mit einer gestickten Herzneun darauf, der so blaß ist, daß Papa und Mama ihn Punkt neun schlafen schicken, mit Vorliebe zu lesen pflegt. Und als Hintergrund dieses Genrebildes, in einem schwarz und rot karierten Männerschlafrock, "Madame", kugelrund, dick wie ein Faß, Madame, die ihre liebe Mühe hat, ihre schlappen Fettmassen zusammenzuhalten und weiterzuschleppen, Madame, die den ganzen Abend ihre fetten Hüften massiert, während sie sich an die Stuhllehne klammert, Madame, die von Zeit zu Zeit Stoßseufzer ausstößt, "Jesus Maria!" klagend, wie ein heller Ton aus einer alten Harmonika, während hin und wieder einer ihrer Holzschuhe am Boden aufklappt und die Stille dieser schläfrigen und satten Stunden unterbricht.
IX.
Der Ort selbst, die weit hinausgeschobene Vorstadt und das alte wacklige Haus verloren für Elisa ihre Schrecken; sie sah es jetzt nicht mehr mit so angstvollen Augen wie am Tage ihrer Ankunft. Die knospenden Sträucher, die grünen Sprossen der Gemüsebeete, die beim Eintritt der wärmeren Jahreszeit unter dem Schnee zum Vorschein kamen, gaben dieser Vorstadt eine gewisse Lieblichkeit. Sie glich jetzt einem großen Garten mit zerstreuten Behausungen, die dort und da zwischen den Bäumen hervorlugten. Ja das Haus selbst bot, trotz seines festungsartigen Charakters, seinen Bewohnern mancherlei Reiz, Abwechslung und Eigenart. Vogelgezwitscher und Fliederrauschen umgaben es den ganzen Tag. Das Haus war die ehemalige Salzkammer der Stadt. Die Mauern waren durch die Jahrhunderte von Salz durchsetzt, schwitzten beständig Salz aus. Hunderte von Vögel schwirrten um den alten Kasten, rieben ihre Schnäbel an dem salzigen Gemäuer und stiegen hoch zum Himmel auf, bis sie dem Auge entschwanden, hoch oben einen Augenblick schweben blieben und dann wieder herabschossen, das schwarze Gemäuer mit ihrem frohen Flügelschlag umkreisend. Vom frühen Morgen bis zur Dämmerung ging das Geschwirr der zwitschernden Vogelschar. Das Haus wurde beim ersten Sonnenstrahl durch dieses Gezwitscher aufgeweckt und der letzte Strahl der scheidenden Sonne wurde auf gleiche Weise von den munteren Schwalben gegrüßt. Wenn Regen fiel, dieser laue, sanfte Sommerregen, dann widerhallte der Hausflur von dem Rauschen der Flügel, die an den Wänden streiften, ein anheimelndes Geräusch, das von dem leisen Hämmen der gierigen, jungen Schnäbel unterbrochen wurde, die hastig die salzige Feuchtigkeit von der Mauer aufpickten.
X.
Die Frauen, die sich mit Elisa im Haus befanden, waren größtenteils Landmägde, die verführt und von ihrem Herrn davongejagt worden waren. Könnt ihr sie euch vorstellen, diese vierschrötigen Weiber, deren Haut trotz allen Parfüms noch nach dem Schweiß der Feldarbeit riecht, deren Hände noch die Schwielen der Männerarbeit an sich tragen, deren harte Brustwarzen zwei