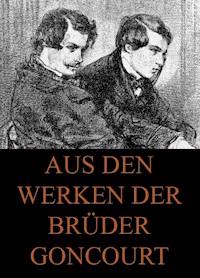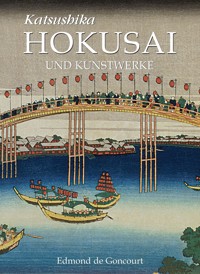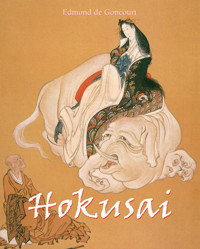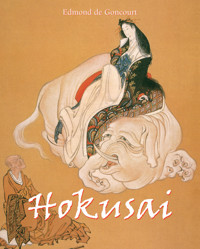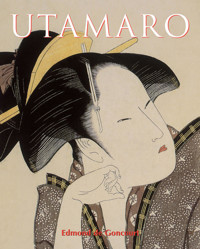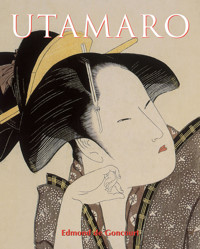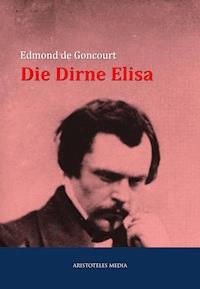19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine brillante Auswahl aus dem berühmt-berüchtigten Tagebuch der Brüder Goncourt, »Erste-Sahne-Klatsch« (Gerd Haffmans) vom Feinsten. »Ein Gehirn, das mit vier Händen schrieb«, nannte Alain Claude Sulzer einmal die beiden Brüder Goncourt – sie lebten ihr gesamtes Leben lang unter demselben Dach, sie trafen zusammen die Pariser Bohème, sie teilten selbst die Geliebte. Vor allem aber schrieben sie zusammen ihr gefürchtetes Tagebuch. Dort notierten sie alles, was sie sahen, was gesagt wurde, was geschah; auch jeden Fauxpas, jede Peinlichkeit, jedes Gerücht und jede Intimität. Denn: Sie wollten die ungeschminkte Wahrheit. Manche Zeitgenossen mieden die Brüder, weil sie nicht in diesem Tagebuch landen wollten. Daraus veröffentlichte Auszüge sorgten für Skandale. Und erst 1956 konnte es erstmals unzensiert erscheinen. Sicherheitshalber in Monaco, außerhalb der französischen Gesetzgebung. Die von Anita Albus großartig übersetzte und zusammengestellte Auswahl verspricht gehörigen Lesespaß. Wir begegnen allen (Geistes-)Größen des gesellschaftlichen Lebens Frankreichs: Baudelaire (»Der Kopf eines Verrückten, die Stimme wie eine Klinge«), Sarah Bernhardt (»die Wohnungseinrichtung in plump orientalischem Geschmack«), Flaubert (»von de Sade besessen. Glücklich, wenn er einen Kloakenfeger sieht, der Kot frisst … im Grunde provinziell und ein Effekthascher«), Hugo (»von heftigem Priapismus befallen«), Napoleon III. (»automatenhaft, somnambul, mit dem Auge einer Echse, die zu schlafen scheint, aber nicht schläft«), George Sand (»ganz entschieden eine geniale Null«), Fürst Metternich (»dieser missratene Affe«) und und und. Ein eminent lesenswerter Blick auf die Pariser Szene!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Edmond de Goncourt / Jules de Goncourt
Blitzlichter
Aus den Tagebüchern der Brüder Goncourt
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Edmond de Goncourt / Jules de Goncourt
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Edmond de Goncourt / Jules de Goncourt
Jules de Goncourt (1830–1870) und Edmond de Goncourt (1822–1896) lebten ein gemeinsames Leben in Paris, veröffentlichten mehrere Romane, vor allem aber schrieben sie gemeinsam seit dem 2. Dezember 1851 ihr berühmt-berüchtigtes Tagebuch. Als Jules stirbt, setzt Edmond es bis zu seinem Tode allein fort.
Anita Albus hatte 1989 für Hans Magnus Enzensbergers ANDERE BIBLIOTHEK aus den 7000 Seiten der Tagebücher eine brillante Auswahl getroffen und die Texte übersetzt, dies ist ein unveränderter Nachdruck. Anita Albus lebt als vielfach preisgekrönte Malerin und Schriftstellerin in München. Zuletzt von ihr erschienen: Affentheater (2022).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Eine brillante Auswahl aus dem berühmt-berüchtigten Tagebuch der Brüder Goncourt, »Erste-Sahne-Klatsch« (Gerd Haffmans) vom Feinsten.
»Ein Gehirn, das mit vier Händen schrieb«, nannte Alain Claude Sulzer einmal die beiden Brüder Goncourt – sie lebten ihr gesamtes Leben lang unter demselben Dach, sie trafen zusammen die Pariser Bohème, sie teilten selbst die Geliebte. Vor allem aber schrieben sie zusammen ihr gefürchtetes Tagebuch. Dort notierten sie alles, was sie sahen, was gesagt wurde, was geschah; auch jeden Fauxpas, jede Peinlichkeit, jedes Gerücht und jede Intimität. Denn: Sie wollten die ungeschminkte Wahrheit. Manche Zeitgenossen mieden die Brüder, weil sie nicht in diesem Tagebuch landen wollten. Daraus veröffentlichte Auszüge sorgten für Skandale. Und erst 1956 konnte es erstmals unzensiert erscheinen. Sicherheitshalber in Monaco, außerhalb der französischen Gesetzgebung.
Die von Anita Albus großartig übersetzte und zusammengestellte Auswahl verspricht gehörigen Lesespaß. Wir begegnen allen (Geistes-)Größen des gesellschaftlichen Lebens Frankreichs: Baudelaire (»Der Kopf eines Verrückten, die Stimme wie eine Klinge«), Sarah Bernhardt (»die Wohnungseinrichtung in plump orientalischem Geschmack«), Flaubert (»von de Sade besessen. Glücklich, wenn er einen Kloakenfeger sieht, der Kot frisst … im Grunde provinziell und ein Effekthascher«), Hugo (»von heftigem Priapismus befallen«), Napoleon III. (»automatenhaft, somnambul, mit dem Auge einer Echse, die zu schlafen scheint, aber nicht schläft«), George Sand (»ganz entschieden eine geniale Null«), Fürst Metternich (»dieser missratene Affe«) und und und. Ein eminent lesenswerter Blick auf die Pariser Szene!
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
All rights reserved
Ausgewählt und aus dem Französischen übertragen von Anita Albus
Verlag Galiani Berlin
© 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Lisa Neuhalfen, Berlin
Covermotiv: © Gemälde von Jean Béraud (1849–1936); © Universal Images Group North America LLC/Alamy Stock Foto
Das Buch erschien erstmals 1989 in der ANDEREN BIBLIOTHEK
Betreuung der Neuausgabe: Wolfgang Hörner
ISBN978-3-462-31167-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Edmond und Jules de Goncourt
Die feine Gesellschaft
ALIZARD, Adolphe-Joseph-Louis
BAUDELAIRE, Charles
BARBEY D’AUREVILLY, Jules
BERNHARDT, Sarah
BERTHELOT, Marcelin
CHARCOT, Jean-Martin
CLADEL, Madame
CONSTANT, Abbé Alphonse-Louis
COPPÉE, François
COROT, Camille
COURMONT, Cornélie Le Bas de
COUTURIER
DAUDET, Alphonse
DEGAS, Edgar
DESLIONS, Anna
DENIS, Pélagie
DEMIDOFF, Anatole
DENNERY, Gisette
DIDOT, Ambroise-Firmin
DUMAS fils, Alexandre
DUMOLARD, Raymond-Martin
DUSE, Eleonora
EUGÉNIE, Kaiserin
FLAUBERT, Gustave
FÉLIX, Dinah
FRANCE, Anatole
GAUTIER, Judith
GAUTIER, Théophile
GAVARNI (Guillaume-Sulpice Chevalier)
GREFFULHE, Gräfin
GUILBERT, Yvette
GUYS, Constantin
HERZEN, Alexander
HOPPE
HUGO, Victor
HUYSMANS, Joris-Karl
JACQUEMIN, Jeanne
KANN, Madame, geb. Marie Warchawska
LABICHE, Eugène
LAGIER, Suzanne
LEBLANC, Léonide
LEMAIRE, Madeleine
LOTI, Pierre
MALINGRE, Rosalie
MARIA
MARIE
MATHILDE, Prinzessin
MAUPASSANT, Guy de
MERYON, Charles
METTERNICH, Pauline
MICHELET, Jules
MONTESQUIOU-FEZENSAC, Robert de
MUNKÁCSY, Michael Lieb, genannt Mihály
NADAR (Félix Tournachon)
NAPOLÉON III.
NIEUWERKERKE, Graf
OSMOY, Charles Le Bœuf, Graf von
PAÏVA, Marquise de, geb. Thérèse Lachman
PASSY, Blanche
PINGAT
RENAN, Ernest
RENARD, Jules
RIMBAUD, Arthur
ROCHEFORT, Henri (Marquis de Rochefort-Lupy)
RODIN, Auguste
ROPS, Félicien
SABATIER, Apollonie-Aglaé, genannt die Präsidentin
SAND, George (Amantine-Aurore-Lucile Baronne de Dudevant, geb. Dupin)
SAINT-VICTOR, Paul de
STRAUS, Geneviève, geb. Halévy
SWINBURNE, Algernon Charles
TAINE, Hippolyte
TURGENJEW, Iwan Sergejewitsch
VERLAINE, Paul
VILLEDEUIL, Pierre-Charles Laurens, Comte de
VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, Auguste, Comte de
ZELLER, Pauline
ZOLA, Émile
Gesellschaft der Fünf
Dossier
Lebensdaten
Literaturhinweise
Namenregister
Prolog
Die feine Gesellschaft
Beim Rennen im Bois de Bologne. Die allerfeinste Gesellschaft, die schöne Welt, wie häßlich sie ist! Eine Sippschaft uneleganter, fast provinzieller Menschen, ermattet ohne die Vornehmheit eines ermatteten Geschlechts. Häßlich die Weibsbilder: die Häßlichkeit der Frau von Welt kennt nur wenige Ausnahmen. Die Kleidung, die Schminke und die Ungeniertheit der Dirnen, aber ohne den unübertrefflichen, der Prostitution eigenen Chic.
Unter den Männern sehe ich Pereire: einen aus Batavia eingeführten schrumpeligen und leicht schimmeligen Affen; Lord Hertford, einen Mann mit einem Einkommen von achtzehn Millionen, mit einem Nachtschal als Krawatte um den Hals und Härte im kalten Porzellangesicht; Haussmann, der wie ein Disziplinarinspektor aus Versailles aussieht; Gramont-Caderousse, mit seinem à l’anglaise umgehängten Fernglas und seinen Rokoko-Posen, hält Madame de Persigny umschlungen und wirkt wie ein englischer Groom: halb glühender Gentleman, halb Komiker vom Palais Royal; Metternich sieht aus wie der Lakai eines vornehmen englischen Hauses.
Die Weibsbilder? Kinderlose Frauen ohne Sanftmut, ohne mütterliche Ausstrahlung, ohne Becken, die Dürre der Unfruchtbarkeit vom Scheitel bis zur Sohle … Da ist die Fürstin Metternich, mit einer Trompetennase, die Lippen wie ein Nachttopfrand gestülpt, sehr bleich, ganz wie eine venezianische Maske in den Gemälden von Longhi; eine semmelblonde Madame de Pourtalès, die zufällig nicht sonderlich häßlich ist; die blonde grimassierende Fürstin Poniatowska sieht aus wie eine Katze, die Milch schleckt; die Fürstin de Sagan, ein Flittchen der großen Welt mit schiefer Habichtsnase, schaut drein wie eine große Ziege; Madame de Solms, jetzt Madame de Ratazzi, mit einem Haarkranz auf dem Kopf, Augen von verschossenem Blau und dem Lächeln einer tauben Tänzerin, am Arm ihres Mannes, dessen schäbige Haltung und Miene an einen Advokaten erinnern; Pommereux, der ehemals seine Frau ausgehalten hat, macht ihm Komplimente über seine elegante Aufmachung und sagt ihm, daß man ihn in Turin nicht wiedererkennen würde; Mademoiselle Haussmann, ein üppiges, ziemlich hübsches Mädchen mit den Augen eines Ochsen … So sieht sie aus, die Welt, die schöne Welt, die große Welt! All das ist dirnenhaft! Keine Spur von Vornehmheit oder von dem Charme einer anständigen Frau. Aufmachungen und Manieren, die beweisen, daß es keine feine Gesellschaft mehr gibt.
Auf dem Rückweg begegnen mir schneidige Equipagen, Pferde mit Rosen hinter den Ohren, sämtliche Schnepfen, der ganze gehobene Schnepfenstrich von Paris. Maßgeblicher und triumphierender denn je, füllen sie diese Promenade der Reichen aus, besetzen und verstopfen den Bois de Bologne wie einst ihre Mütter den Palais Royal. Niemals hat man sich mehr zur Schau gestellt, mehr geprahlt, und nie hat es mehr skandalöse Vorfälle gegeben. Dem achtzehnten Jahrhundert sagt man es nach, aber damals gab es vielleicht zehn berühmte Huren. Heute ist es ein ganzes Volk, eine Welt, die die andere Welt der Frauen verschlingen wird und sie bereits schluckt.
Alizard: massig, kurz, gedrungen, schnaubend wie ein Titan, gebaut wie ein Lastträger, ein ausgezeichneter Musiker und herrlicher Bass in Der Tod und das Mädchen von Schubert; ein wenig hypochondrisch, unglücklich, leidet unter seiner Häßlichkeit und seinem fürs Theater entsetzlich kleinen Wuchs. Eine unglückliche Jugend, hart erzogen von der Mutter, einer Pensionatsvorsteherin, die mit einem Priester lebte. Gräßliches Elend. Hatte man den Familienhorror begriffen und fragte ihn: »Wie geht es dir?«, – »Gut.« – »Und deiner Familie?« – »Sie ist verreckt!«, antwortete er in seinem tiefsten Bass. Das verwunderte Belgiojoso. Darauf, sich umwendend: »Ach, bei Ihnen ist das anders! Ihr Herr Vater hat Sie mit allem versehen. Er hat Sie reich, schön, groß und geistvoll gemacht. Aus mir hingegen hat man einen Wasserträger gemacht … Ohne einen Sou … Ich nehme an, daß Monsieur seinem Vater, wenn er stirbt, ein Mausoleum errichten läßt, ich kann das durchaus verstehen!« – Eines Tages blieb Barilhet aus, der in einer Oper erst im zweiten Akt singen sollte; Alizard wird im Opernhaus zum verzweifelten Direktor gerufen: »Aber ich bin doch kein Bariton! Aber ich kann die Rolle gar nicht!« – »Sie können sie während des ersten Akts einüben, das bringt fünfhundert Mäuse!« Und er spielt es … Kenntnisreich, eine Leidenschaft für Bücher, für alte Uhren, für Geigen. Das Elend geht so weit, daß er das Bett samt Strohsack verkauft hat – schläft auf zwei Guarneri-Geigen als Bettrolle, die pro Stück fünfhundert Franc kosten.
Boucher, ehemaliger Seminarschüler, ein ganz ausgezeichneter Latinist und Hellenist, der immer um italienische Ausstrahlung bemüht ist und tu u u u m’emmerdes, m’emmeerdes sagt und in affektiertem Ton Aaaeee.
Dazu der irre Wartel, ein baumlanger Kerl, mit schrecklichen Meilenstiefeln, ein Spaßvogel, der niemals lacht, der die vorbeigehenden frati umarmt usw.
Sie gehen gemeinsam mit Mario Uchard zum Comersee. Alizard will den Monte Bisbino erklimmen. Während des Aufstiegs entledigt er sich vollständig seiner Kleider, die er Stück für Stück auf dem Weg Boucher übergibt. Im Dorf angelangt, empfängt sie der Pfarrer. Sie bezaubern ihn beim Dessert mit Musik, gehen in die Kirche, stellen sich ans Pult, Mario spielt die Orgel, und so beglücken sie das ganze Dorf mit gregorianischem Gesang. Ein Dorfbewohner bietet ihnen Quartier an. Alizard verdrückt sich im Garten, und man findet ihn, als er gerade die Frau vergewaltigen will, die im siebten Monat schwanger ist. In der Nacht werden sie von Wanzen gepeinigt. Am Morgen hört man plötzlich Schreie wie Donnerhall. Der äußerst reinliche Alizard war noch vor Anbruch des Tages am Seil in den Brunnen hinabgestiegen und kam nicht wieder hoch … Letzte Episode der Reise: Alizard, der außer mena mi l’ucello fast kein Italienisch konnte, warf ein Auge auf ein kleines Mädchen, das mit einem Korb und Kränzen von Immortellen zum Friedhof ging; zum Zupfen seines Vogels wanderte der Korb auf den Arm und ein Kranz von Immortellen auf den Kopf.
Im Café Riche.
Baudelaire soupiert nebenan, ohne Krawatte, ohne Kragen, mit rasiertem Schädel, ganz wie ein zum Tode Verurteilter. Seine einzige Zier: die reinlichen, gepflegten, gebleichten kleinen Hände. Der Kopf eines Verrückten, die Stimme glatt wie eine Klinge. Eine gestelzte Ausdrucksweise, zielt auf Saint-Just und trifft ihn auch. – Verteidigt sich ziemlich hartnäckig und mit einer gewissen harschen Leidenschaft gegen den Vorwurf, er habe in seinen Versen die Sitten verletzt.
Im Magny.
Dann kam die Rede auf gewisse Anhänger in der Nachfolge der Lykanthropen von 1830, die zynischen Bluffer, auf Baudelaire und den schärfsten Spruch, den er eines Tages, als er zu spät bei einer Gesellschaft erschien, von sich gab: »Verzeihung, ich habe mich verspätet, da ich soeben meine Mutter godemichierte.«
Man hat uns dieser Tage erzählt, daß Baudelaire, dieser Gaukler, ein kleines Hotel in der Nähe einer Eisenbahnlinie zum Wohnsitz genommen habe und ein Zimmer wählte, das auf einen Korridor führt, der ständig von Reisenden wimmelt, der reinste Bahnhof. Bei weit geöffneter Tür gibt er allen das Schauspiel seiner selbst bei der Arbeit, der Anspannung des Genies, während seine Hände durch die langen weißen Haare in seinen Gedanken wühlen.
Zum Porträt von Baudelaire erzählte mir Stevens, daß er Zeuge seiner ersten Amnesie wurde. Er begegnete ihm auf dem Rückweg von einem Händler, bei dem er etwas gekauft hatte und dem er im ersten Augenblick den eigenen Namen nicht nennen konnte. Und er fügte noch hinzu, wie weh es ihm tat, den Jammer des armen Teufels mitanzusehen.
Asselineau erzählt, Baudelaire habe ihn verblüffen wollen, indem er sich im Hotel Pimodan zum Schlafen unter das Bett gelegt habe.
Heute abend erzählte mir Madame Sichel von Madame Aupick, der Mutter Baudelaires, mit der sie in Honfleur verkehrte.
Sie schilderte diese Frau als ein kleines, zartes, niedliches bucklicht Weiblein, mit großen, knorrigen, ungeschickten Händen, die sechs Dominosteine auf einmal faßten. Darüber hinaus war sie so blind, daß sie beim Nähen gezwungen war, ihrer Nase entlang zu stechen.
Dann beschrieb sie das Haus auf der Felsklippe, unterhalb der Côte de Grace, eine Stelle, die der General, der einst Botschafter von Konstantinopel gewesen war, ausgewählt hatte, weil sie ihn an die Pforte des Goldenen Horns erinnerte, ein Haus, in dem das Zimmer des Generals wie ein Zelt mit Segeltuch bespannt war und die anderen Zimmer mit bedrucktem Stoff aus Jouy; im Stall waren zwei Prunkkarossen untergebracht, das dazugehörige Pferdegespann hatte die Besitzerin verkaufen müssen, als sie sich auf ihre Witwenpension beschränkt sah. Jeden Samstag wurden die Karossen von den Mägden aus dem Stall geholt und eine Stunde lang auf dem Pflaster im Hof spazierengeführt.
Dem jungen Mädchen, das Madame Sichel damals war, schien es, als habe die alte Frau eine hohe Meinung vom Intellekt ihres Sohnes, wage jedoch unter dem Einfluß von Monsieur Hémon nicht, offen darüber zu sprechen. Dieser sah in ihrem Sohn nichts als einen Strolch, der immer davon spricht, seine Mutter zu besuchen, aber nie kommt und ihr nur schreibt, wenn er Geld braucht.
Diese Plauderei enthüllte etwas Seltsames: die Mutter Baudelaires starb nach ihrem Sohn und starb als Aphasikerin an der gleichen Krankheit. Damit wird die Legende hinfällig, die Baudelaires Krankheit seinem chaotischen Leben zuschrieb, wo sie doch in seinem Fall nur erbbedingt war.
In ihrer schwärmerischen Weise sagte die alte Frau mehrmals zu Madame Sichel, die Laura heißt: »Wie bedaure ich, daß mein Sohn so gar nicht heiraten mag, es wäre mein innigster Wunsch, daß er Ihr Petrarca würde.«
Welch sonderbare Straße, welch originelles Viertel in einem Winkel von Paris dieser Barbey d’Aurevilly bewohnt!
Die Rue Rousselet, die sich fernab in der Rue de Sèvres verliert, hat den Vorortcharakter einer Kleinstadt, der die Nachbarschaft der Militärschule etwas Soldatisches gibt. Portiers mit türkischen Käppchen fegen vor den Türen. In den Bilderbogen-Geschäften sind auf Blättern mit einheitlichem Grund sämtliche Uniformen der Armee ausgestellt. Der primitive Schuppen eines Barbiers – sein Beruf steht mit Tinte auf den Mauerputz geschrieben – appelliert an die Kinnbacken der Herren Soldaten. Die Häuser dort haben Eingänge wie auf dem Dorf, und die hohen Mauern überragt das schattige dichte Laub öffentlicher Gärten.
In einem Quartier, das wie ein Kuhstall aussieht – ein vom Oberst Chabert des Balzacschen Romans bewohnter Kuhstall –, wende ich mich an eine Art Bäuerin, die Portiersfrau von Barbey. Erst behauptet sie, er sei ausgegangen. Ich erkenne die Weisung. Ich kämpfe. Schließlich entscheidet sie sich, meine Karte hinauf zu bringen, und als sie wieder herunterkommt, wirft sie mir hin: »Im ersten Stock die Nummer 4 im Korridor.«
Eine kleine Treppe, ein kleiner Korridor und eine noch kleinere, ockerfarben gestrichene Tür, in der der Schlüssel steckt. Ich trete ein und werde in einem Wirrwarr und Durcheinander, in dem man nichts erkennen kann, von Barbey d’Aurevilly empfangen; er steht in Hemdsärmeln und perlgrauer Hose, die ein schwarzer Seitenstreifen ziert, vor einem dieser altmodischen Toilettentische mit großem runden Schaukelspiegel. Er entschuldigt sich, mich so zu empfangen, er sei gerade dabei, sich anzukleiden, um zur Messe zu gehen.
Ich finde ihn unverändert, seit ich seiner bei der Beerdigung von Roger de Beauviro gewahr wurde, er hat den gleichen geräucherten Teint, seine lange Haarsträhne, die ihm das Gesicht schrammt, der elegante Mischmasch seiner halbfertigen Aufmachung; aber man muß trotz alledem zugeben, daß er über die Höflichkeit eines Edelmannes und die Anmut eines Herren aus gutem Hause verfügt, wenn es auch einen Widerspruch zu diesem Schweinestall bildet, in dem sich überall seine Siebensachen und Klamotten mit Büchern, Zeitschriften und Tageszeitungen vermengen, verheddern und vermischen.
Ich nehme aus dieser Unterkunft in der Rue Rousselet so etwas wie die Erinnerung an die unheimliche Höhle eines abgebrannten Gebildeten aus guter Familie mit.
Abendessen bei Daudet mit Barbey d’Aurevilly, dem ich heute zum ersten Mal etwas zwangloser begegne.
Er hat einen Überzieher mit Rockschoß an, der ihm Hüften verleiht, als trage er eine Krinoline, und dazu trägt er eine weiße Wollhose, die aussieht wie eine Unterhose aus Molton mit Stegen. In diesem lächerlichen und päderastischen Kostüm steckt ein Mensch mit exzellenten Manieren, der über die Flötentöne eines Mannes verfügt, der gewohnt ist, mit Frauen zu sprechen, und dessen gutturale Intonation – die von seinen fehlenden Zähnen herrührt – wie die Moll-Version von Frédérick Lernaltre klingt.
Diner mit Sarah Bernhardt bei Bauër.
Eine Wohnung im sechsten Stock, von einem berühmten Dekorateur im plump orientalisch-japanischen Geschmack eingerichtet, aber licht- und sonnendurchflutet.
Herein tritt Sarah in einer perlgrauen Robe mit goldenen Litzen, einer hängenden Robe ohne Taille in der Art einer Tunika. An Diamanten einzig eine Lorgnette, deren Stiel damit übersät ist. Auf dem Kopf ein Putz aus schwarzer Spitze, der sich wie ein Nachtfalter ausnimmt, darunter bäumt sich eine Frisur wie ein loderndes Gebüsch auf, und Augen von durchsichtigem Blau leuchten im Halbschatten schwarzer Wimpern auf.
Als man sich an den Tisch setzt, beklagt sie sich, daß sie so klein sei, und dabei sind ihre Beine so lang wie die der Renaissance-Frauen; und die ganze Zeit über sitzt sie schräg auf einer Ecke ihres Stuhls, ganz wie ein kleines Mädchen, das man an die große Tafel gesetzt hat.
Sogleich gibt sie uns mit einer Lebhaftigkeit, einem Schwung, einem sprühenden Wortwitz sondergleichen die Geschichte ihrer Tourneen rund um den Erdball preis und gibt uns das folgende seltsame Detail wieder: Die Ankündigung künftiger Vorstellungen in den Vereinigten Staaten – eine Ankündigung, die immer ein Jahr im voraus gemacht wird – hatte zur Folge, daß eine Ladung Französischlehrer angefordert wurde, damit sie dafür sorgten, daß die jungen Leute und Fräuleins verständen und den Stücken, die sie spielen soll, folgen könnten. Dann die Geschichte ihres Raubüberfalls in Buenos Aires: Die acht Männer, die ihre Leibwächter abgaben, waren so gut eingeschläfert worden, daß sie nichts hörten; sie selbst mußte man vom Bett auf den Boden werfen, um sie zu wecken, und ihr Hund hat volle drei Tage durchgeschlafen.
Ich sitze gleich neben ihr; diese Frau, die an die fünfzig sein könnte, die ganz ungeschminkt ist, ohne einen Hauch von Reispuder, hat die Gesichtsfarbe eines jungen Mädchens, eine blutjunge rosige Farbe auf einer Haut von seltener Feinheit, Zartheit und Durchsichtigkeit an den von einem Netz feiner blauer Äderchen durchzogenen Schläfen. Bauër sagte mir, daß dieser Teint das Resultat einer zweiten Jugend sei, die ihr durch die Wechseljahre zuteil geworden sei.
Diner bei Sarah.
Die kleine Halle oder vielmehr das Atelier, in dem die Tragödin empfängt, hat etwas von einem Theaterdekor. An den Wänden sind zwei oder drei Reihen Bilder aufs Parkett gestellt, die, weil sie nicht gehängt sind, wirken, als bereite ein Experte eine Auktion vor; diese Bilder werden von einem Gemälde über dem Kamin beherrscht, ihrem großen Porträt in ganzer Figur von Clairin, auf dem sie ohne Stirn dargestellt ist, unter einer persianerschwarzen Frisur, in einer Art weißem Schlangenschmelz. Vor den Bildern Möbel aller Art, mittelalterliche Truhen, eingelegte Schubladenschränke und eine Unmenge exotischen Kunstplunders, Figurinen aus Chile, Musikinstrumente von Wilden, große Blumenkörbe, deren Blüten und Blätter aus Vogelfedern bestehen. Nur eines zeugt in alldem von persönlichem Geschmack: große weiße Bärenfelle, die der Ecke, in der die Dame sich aufhält, ein leuchtendes Weiß geben.
Mittendrin ein Käfig, ein Käfig, in dem ein Papagei und ein Affe en famille leben, ein Papagei mit einem riesigen Schnabel, den der kleine Affe martert, peinigt, rupft, der immer in Bewegung ist, ständig um ihn herum seine Saltos schlägt, und den der Papagei mit seinem fabelhaften Schnabel ohne weiteres zweiteilen könnte – er begnügt sich jedoch damit, herzzerreißende Schreie auszustoßen. Da mir das gräßliche Leben dieses Papageis ans Herz ging, wurde mir versichert, daß man sie einmal für eine Weile getrennt habe; der Papagei sei infolge dieser Trennung um ein Haar aus Kummer gestorben, so daß man ihn unbedingt wieder zu seinem Peiniger stecken mußte.
Im Magny.
Großes Palaver über die Abstraktion von Raum und Zeit, das uns in Narreteien und Halluzinationen und Hypothesen stürzt, bis ich schließlich die Worte Berthelots vernehme:
»Jeder Körper, jede Bewegung löst eine chemische Aktion in den organischen Körpern aus, mit denen er auch nur eine Sekunde in Berührung gekommen ist; vielleicht wurde alles, seit die Welt besteht, photographisch konserviert. Das ist vielleicht die einzige Spur unseres Durchgangs durch diese Ewigkeit. Warum sollte die Wissenschaft mit ihren Fortschritten, mit ihrer Hexerei, nicht eines Tages das Porträt von Alexander dem Großen auf einem Felsen finden, den sein Schatten streifte?«
Berthelot sagte uns im Magny, daß Frankreich nicht nur das Land sei, in dem es zur Zeit am wenigsten Kinder gebe, es sei darüber hinaus das Land, in dem die meisten Greise lebten, eine Anzahl, die bei 400 zu 58 im Verhältnis zu Preußen liege. Dem verdanke sich auch die derzeitige Verblödung.
Wir gehen mit Charles Edmond Berthelot besuchen, seinen Nachbarn, und so schneien wir dem Chemiker ins Haus: ein von Wäldern umgebenes Häuschen in der Gegend von Sèvres. Ein Garten voller Kinder, ein Salon voller Frauen.
Seine Frau ist eine beachtliche, einzigartige, unvergeßliche Schönheit; eine intelligente, tiefe, magnetische Schönheit; eine Schönheit der Seele und der Gedanken, jenen außerirdischen Schöpfungen Poes vergleichbar. Sie sieht aus wie eine Statue und wie ein verkörpertes Gewissen. Ihr Haar, das gescheitelt in breiten, glatten Strähnen fast gelöst herabfällt, wirkt wie ein Heiligenschein; eine hohe, ruhige und gewölbte Stirn; große Augen, schimmernd im Schatten ihrer Höhlen; und die Frau mit ihrem ganz flachen Leib und in der Robe eines mageren Seraphim. Dazu die Stimme eines jungen Knaben und bei aller Höflichkeit und Liebenswürdigkeit die Herablassung des gehobenen Bürgertums.
Ein hübsches Pariser Detail. In einer Arme-Leute-Straße legt man zusammen, um einem alten Mann dieser Straße – einem Alten, den alle lieben – eine Konsultation bei Charcot zu ermöglichen; sie bringen hundert Franc zusammen, die der am besten Gekleidete dem berühmten Arzt überbringt.
Es wurde behauptet, daß sich Charcot die Schläfen rasiere, um sich eine Denkerstirn zuzulegen.
Heute abend wurde über die Härte geredet, mit der Charcot seinen Kranken begegnete, über die inhumane Weise, in der er mit ihnen über ihren Tod sprach, eine bestimmte Zeit von sechs Monaten oder einem Jahr angab, als sei der Tod ein Gast, den er ohne Furcht erwarte; und man erzählte von der Sinnesverwirrung dieses Verächters des Todes der anderen, als er einmal an Silvester zuviel Blutwurst gegessen hatte. Es war äußerst belustigend, wie uns Leon seine Aufregung, sein weibisches Gejammer, seine schändliche Angst vormachte. Er schilderte, wie Charcot ihm nicht einmal die Zeit ließ, den Hut aufzusetzen, um zu Potain zu laufen, da er glaubte, sein letztes Stündlein habe geschlagen; Potain sagte ihm in seiner einfältigen Art, der an diesem Tag eine leichte Ironie beigemischt war: »Es handelt sich nur um eine Verdauungsstörung, werter Kollege!«, und verordnete ihm Brechwurz.
Ein seltsamer Fall von Tollheit. Die Mutter von Cladel, eine alte Bäuerin, wird plötzlich aus ihrer Hütte und von ihrem Feld in den Salon der Rue Saron versetzt, mitten in Wortgefechte über Diphthonge; ganz wirr im Kopf und verloren durch die Unverständlichkeit der fremden Worte, die sie den ganzen Tag vernommen hat, fängt sie plötzlich an, im Salon zu tanzen.
Abbé Constant wird von einem jungen Mädchen von vierzehn Jahren geliebt. Das junge Mädchen, ein resolutes Wesen, bringt es fertig, daß er das Priestergewand ablegt und heiratet. Ein kleiner, sehr glücklicher Haushalt; eine vier oder fünf Jahre währende vollkommene Liebe; ganz seiner Frau gewidmet. Clubbesuche im Februar. Dann wird die Frau Bildhauerin und neidet dem Gatten die Intelligenz. – Constant widmet sich ganz der Magie, entdeckt, daß das Tarotspiel – Inbegriff der höchsten Magierkunst, das niemand bisher erklären konnte – inzwischen dazu dient, den Portiersfrauen die Karten zu legen. Frau Constant stellt im Salon von 1853 einen Bacchus aus Marmor aus, setzt ihren Mann vor die Tür; der geht nach London, um dort sein Glück zu suchen.
Ein kleines Gesicht mit olivfarbenem Teint, Miniatur eines Bonaparte nach der Rückkehr aus Ägypten. Wiewohl freundlich, vornehm, feminin, ist er doch leider keine Persönlichkeit. Man hört Banville, wenn er spricht – Banville, dem er sich nicht nur geistig anverwandelt hat, er hat sich auch seine scharfe und geziert schleppende Redeweise angeeignet.
Coppée ist der Geliebte der Doche. Die Liebschaft des jungen Mannes zu dieser alten Frau hat für mich etwas fantastisch Makabres. Eines Abends erhaschte ich den Anblick des Gerippes der Schauspielerin im Hausrock, und wann immer ich mit Coppée plaudere, überkommt mich eine gewisse Unruhe vor dem erdigen Schwarz seiner Nasenhöhlen und Mundwinkel – kurzum, vor der ganzen morbiden Senilität seines kindlichen Gesichts; die Vereinigung dieser beiden Wesen will meiner Phantasie wie die Vereinigung eines Skeletts mit einem verrotteten Foetus erscheinen.
Das Leben dieser verschwiegenen Liebe, die unter dem gemeinsamen Dach kaum jemand anderen empfängt als Barbey d’Aurevilly, drängt mir den Gedanken an das schreckliche Trio der Mageren auf, das diese Frau, dieser junge Mann und der alte Erotiker bilden und das mich – runzlig, geräuchert und ausgedörrt, wie es ist – an die vertrocknete Rute eines Tambour-Majors gemahnt, wie sie im Museum Dantan ausgestellt sein könnte.
Corot ist wirklich der gutmütigste aller gutmütigen Kerle. Die Tochter von einem der Brüder Leleux zerbricht das Bein eines kleinen Puppentischchens und sagt zu Corot: »Schau mal, ich kann nichts mehr damit anfangen, du solltest mir etwas druntermachen.« Corot nimmt das Tischchen mit und macht ein schönes Bild daraus. Sagt die Mutter: »Ah, Monsieur Corot, das behalte ich für mich!« Darauf antwortet Corot so mir nichts, dir nichts: »Es würde ihrer Tochter Spaß machen … Warum lassen sie es ihr nicht?«
Corot ist der glückliche Mensch par excellence. Glücklich zu malen, wenn er malt; glücklich, sich auszuruhen, wenn er nicht malt. Glücklich über sein spärliches Vermögen, als er noch nicht geerbt hat; glücklich über seine Erbschaft, als er erbt. Glücklich über seine Ruhmlosigkeit, als er noch unbekannt war; indessen glücklich über seine Erfolge – und jeden Monat schiebt er seine Nummer mit irgendeinem schmuddligen Modell, das ihn besuchen kommt.
»Ja, Corot hat nie Grün verwendet … Sein Grün war das Ergebnis einer Mischung aus Gelb und Preußischblau, Mineralblau … und ich werde Ihnen den schlagenden Beweis dafür bringen.«
Das ist der alte Maler Decan, ein Freund von Corot, der in Gavarnis Haus wohnt; wenige Augenblicke später kommt er mit der Bluse, die Corot beim Malen trug, wieder herunter; diese Bluse ist aus zwei Küchenschürzen von verblichenem Blau zusammengestückelt und hat hinten ein neues Teil von lebhaftem Blau, ein Stück Stoff, das die untere Hälfte der Bluse, die am Ofen verbrannte, ersetzen soll … Und wirklich ist die Bluse ganz mit einem Regen zarter Flecken bedeckt, bei denen das Grün fehlt.
Decan hat zusammen mit der Bluse eine Skizze gebracht, auf der er den alten Corot dargestellt hat, wie er in ebendieser Bluse auf dem Lande malt: eine Skizze, auf der er mit seinem widerspenstigen weißen Haar auf dem unbedeckten Schädel, dem Teint eines Menschen, der sich viel im Freien aufhält, seiner Wurzelholzpfeife, die ihm aus dem Mund hängt, ganz wie ein alter normannischer Bauer aussieht.
Und Decan verrät uns das Rezept des alten Corot zur Herstellung von Meisterwerken in der Natur:
»Man wähle seinen Platz an guter Stelle« – so hatte Meister Bertin es ihn gelehrt – »lege sein Bild in groben Zügen an, suche seine Valeurs und«, indem er abwechselnd den Kopf und die Herzgegend berührt, »setze auf die Leinwand, was man hier und hier hat.«
Decan fügt hinzu: »Er war ein Maler des Morgens, nicht des Nachmittags; bei strahlender Sonne malte er nicht. ›Ich bin kein Kolorist‹, sagte er, ›ich bin Harmonist.‹«
»Stellen Sie sich vor«, fährt Decan fort, »Corot hat bis zu seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr wie ein kleines Kind bei seinem Vater gelebt, der nicht im mindesten an sein Talent glaubte. Einmal, als François, der bei Vater Corot zu Abend gegessen hatte, gerade das Haus verlassen wollte, sagte der Vater, daß er ihn begleiten möchte; als sein Sohn sich anschickte, ihm zu folgen, bedeutete er ihm zu bleiben. Schließlich auf der Straße: ›Monsieur Français, sollte mein Sohn wirklich Talent haben?‹ – ›Und ob‹, antwortete Français, ›er ist doch mein Lehrer!‹«
Zwei Besuche bleiben noch zu machen. Die Zweige der Familie sind so gut wie abgestorben. Ein sehr reicher Onkel und eine alte Cousine, die in einem Arbeiterquartier in der Zugluft zwischen Tür und Fenster hockt.
Und dabei ist sie die Enkelin einer Frau, die über drei Millionen verfügte, über das große und das kleine Palais Charolais, über das Schloß von Clichy-Bondy, über Silberplatten für den Wildpretbraten, die zwei Domestiken nur mit Mühe tragen konnten: aus alldem wurden Staatspapiere, und jene Elisabeth Lenoir, diese Goldmarie, wie man sie damals nannte, die Monsieur de Courmont wegen ihres Vermögens geheiratet hatte, starb in einer Dachstube an der Seite ihres alten Hundes und wurde in einem Massengrab beigesetzt. Meine Cousine: nichts als eine kleine Rente auf Lebzeiten und ein Platz auf dem Friedhof von Montmartre, im voraus bezahlt und ganz ihr eigen.
Neujahr ist für uns der Tag der Toten. Es fröstelt das Herz, und man zählt die Abwesenden.
Wir steigen in den fünften Stock zu unserer alten Cousine hinauf in ihre armselige kleine Stube. Sie muß uns wieder fortschicken, so viele Damen, Schulkameraden, Familienangehörige kommen sie besuchen. Sie hat nicht genügend Sitzgelegenheiten noch überhaupt Platz, wo wir uns hinsetzen könnten. Es gehört zu den schönen Seiten des Adels, daß man die Armut nicht flieht. Man rückt gegen sie zusammen. In den bürgerlichen Familien hört die Verwandtschaft unterhalb bestimmter Vermögensverhältnisse, will sagen oberhalb des vierten Stockwerks eines Hauses, auf.
Alphonse[1] geht zu meiner Cousine Cornelie, die im Sterben liegt. Sie erkennt die Leute nicht mehr und hält ihn für einen belanglosen Tropf aus ihrer Familie, gegen den sie einen Groll hegte: »Ach du bist’s, Hornochse.« Alphonse nimmt ihre Hand und klopft sie zwischen seinen Händen, ihr Dienstmädchen schreit ihr dreimal den Namen Alphonse zu. Sie betrachtet ihn lange, wirft dann den Kopf zurück, und ihre Gedanken scheinen zu ganz anderen Dingen abzuschweifen. Dann wendet sie sich ihm wieder zu, und mit dankbarem Blick und sich aufhellender Miene führt sie ihre Hand an ihren Mund und schickt ihm sacht drei Küsse.
Als wir heute abend bei Lia dinierten, war da auch ein gewisser Couturier, den Saint-Victor eingeladen hatte, zweifellos wegen eines möglichen Vorteils beim Bilderhandel. Er ist ein gerissener Schacherer von Kunstgegenständen, der sich gewöhnlich in Madrid aufhält, ein Mann aus Burgund mit gegerbtem Teint, dessen bleifarbenes Gesicht von allen möglichen Berufen geprägt scheint. Dieser Händler von Ölschinken hat ich weiß nicht was von einem Menschenhändler: er sieht aus wie ein Sklavenhändler für Kunstgegenstände.
Dieser zweifelhafte Mensch mit dunklen Quellen, mit der Haut eines Arabers und dem Auge eines Juden, erzählt folgendes:
Als er in Toledo wohnte, ging er jeden Monat zu einer alten Dame, um ihr seine zwölf Piaster Miete zu bezahlen. Diese Dame – eine alte Hoheit – lebte mit einer zwei- oder dreiunddreißig Jahre alten Tochter zusammen, einer ehemaligen Komturin von Sankt Jakob, aus dem durch die spanische Revolution aufgelösten Kloster, dessen Tracht sie jedoch weiterhin trug, eine Tracht, reich an historischer Größe: die Kapuze, das große weiße Gewand mit einer zwei Meter langen Schleppe und das gewaltige rote Kreuz, so hoch wie sie selbst. Außerdem wohnte in dem Hause der letzte männliche Erbe des Geschlechts, ein Enkel der alten Dame, ein etwa zehnjähriges Kind.
Couturier war gerade dabei, die alte Dame zu bezahlen – die Komturin las in der Haltung einer Statue in einer Ecke ihr Brevier –, als das Kind plötzlich mit der gellenden Stimme heftiger kindlicher Begierden ausrief: »Ich möchte die Möse meiner Tante sehen!« Die Großmutter glaubt, nicht richtig gehört zu haben, die Komturin verzieht keine Miene. Couturier wird es allmählich peinlich. Das Kind wiederholt in noch schrillerem Ton: »Ich möchte die Möse meiner Tante sehen!« – »Oh, mein Gott! Was ist denn das?« ruft wieder die Großmutter und ringt die Hände, weil sie es nicht fassen kann. Couturier ist vergessen.
Plötzlich fällt das Kind wie ein Stein zu Boden, keucht und schreit: »Die Möse, die Möse meiner Tante«, als ob es den Geist aufgäbe. Es brüllt, haucht, röchelt es heraus, stampft mit den Füßen und bleibt hingestreckt liegen. Der erschrockene Couturier sagt zu der Alten: »Aber irgend etwas muß man doch tun … es schwebt in Gefahr …« Da ruft die alte Mutter mit einer schrecklichen, feierlichen und tragischen Stimme ihrer Tochter zu: »Madame, der letzte Marquis ist des Todes!«
Die Tochter erhebt sich, nimmt das Kind, trägt es zur Tür und sagt: »Gott wird es mir verzeihen.« Couturier bleibt niedergeschmettert stehen. Nach einer Weile kommt das Kind verschämt, enttäuscht und greinend zurück: »E negro!« – »Sie ist schwarz!«
Heute abend, während des Essens bei Flaubert, erzählte uns Daudet von seiner Kindheit, einer frühreifen und verstörten Kindheit. Er verbrachte sie in der Atmosphäre eines mittellosen Hauses, mit einem Vater, der täglich den Beruf und das Gewerbe wechselte, in diesem ewigen Nebel der Stadt Lyon, den das junge sonnenselige Wesen bereits verabscheute. Damals – er war gerade zwölf Jahre alt – las er unendlich viel, las Dichter, Bücher von lebhafter Einbildungskraft, die ihm zu Kopf stiegen: eine von der Trunkenheit stibitzter Liköre noch zusätzlich aufgeputschte Lektüre; ganze Tage schweifte er lesend auf den Booten umher, die er vom Kai losmachte. Und in der verzehrenden Spiegelung dieser beiden Ströme, trunken von Lektüre und Alkohol und kurzsichtig, wie es war, gelang es dem Kind, in einer Traum- oder Halluzinationswelt zu leben, in der die Realität der Dinge nicht zu ihm drang.
Daudet ist ein schöner Bursche mit langem Haar und dem Aussehen eines Tenors aus dem Süden. Dieser leicht theatralischen Schönheit mit dem ständigen Zurückwerfen der Haare ist ein Tonfall und das examinatorenhafte Einsetzen des Monokels à la Scholl zu eigen, was mich etwas mißtrauisch macht.
Ich verbringe den Tag bei Alphonse Daudet in Champrosay, der Gegend, für die Delacroix eine Vorliebe hatte. Er wohnt in einem stattlichen Bürgerhaus, das in einem winzigen Park im Geschmack des achtzehnten Jahrhunderts steht.
Ein intelligentes und schönes Kind, auf dessen Gesicht sich die Ähnlichkeit mit dem Vater und der Mutter in einer hübschen Mischung wiederfindet, bringt Leben ins Haus. Und dann ist da diese bezaubernde Frau, eine sehr belesene Frau, die bescheiden und selbstlos im Hintergrund bleibt.
Es ist, als sei hier alles zusammengekommen, um in diesen vier Mauern der Bürger glückselige unverfälschte Zufriedenheit zu bergen; und dennoch ist dieser Ort so melancholisch wie nur irgendeine Werkstatt des Geistes, in der kaum etwas anderes als eine erkünstelte Heiterkeit auftaucht, eine von Champagner aufgeschäumte Heiterkeit, und die zu Kopf gestiegenen Paradoxien beim Dessert.
Kommt noch hinzu, daß mir diese liebenswürdigen Leute, wie auch ihr Heim, in diesem melancholischen Licht fremdartig oder komisch vorkommen – das macht die Abwesenheit jeglicher Bemühung um geschmackvolle und künstlerische Dinge. Es ist eine Unterkunft von der heillosesten Spießbürgerlichkeit, in der nicht ein Gemälde, nicht ein Stich, nicht ein Kinkerlitzchen auszumachen ist, ja nicht einmal ein etwas exotischer Strohhut. Nichts gibt es da, absolut gar nichts, kein einziges Ding, das nicht so gewöhnlich, so banal wäre wie das von jedermann. Bei Leuten, die einen freien Beruf ausüben, kann ich mich einfach nicht damit abfinden; und diese Umgebungen, die sich mit einem künstlerischen Beruf nicht vertragen, machen mich auf die Dauer todtraurig – so blöde das klingen mag, aber so ist es nun mal.
Daudet, dem der Porter beim Essen etwas zu Kopf gestiegen ist, kommt auf Chien Verl[2] zu sprechen, auf seine Liebschaft mit diesem verrückten, tollen, übergeschnappten Weibchen, das er von Nadar geerbt hat. Eine irre, Absinth-verschwitzte Liebschaft, die von Zeit zu Zeit durch Messerstiche dramatisiert wurde, deren Male er uns auf einer Hand vorweist. Böse witzelnd schildert er uns das traurige Leben mit dieser Frau, von der sich zu lösen er nicht den Mut fand, die er ein wenig bemitleidete wegen ihrer verschwundenen Schönheit und dem Schneidezahn, den sie sich am Gerstenzucker zerbrochen hatte, und Mitleid bindet. Als er heiratete und mit ihr brechen mußte, brachte er sie unter dem Vorwand eines Abendessens aufs Land, mitten in den Wald von Meudon – in einem Haus, an einem bewohnten Ort hätte er ihre Heftigkeit gefürchtet. Als er ihr dort inmitten der entlaubten Bäume sagte, daß es zu Ende sei, wälzte sich die Frau in Schlamm und Schnee zu seinen Füßen mit dem Brüllen eines jungen Stiers, in das sich die Worte mischten: »Ich werde auch nicht mehr böse sein, ich will deine Dienerin sein …« Später, beim Souper, aß sie wie ein Fuhrknecht, in einer Art stupider Verstörtheit. Diese Erzählung wird von einer anderen Liebesgeschichte unterbrochen, einer Episode mit einem jungen bezaubernden Geschöpf namens Rosa; er gibt uns eine leidenschaftliche Nacht in einer Mannschaftsstube in Orsay wieder, inmitten von sieben oder acht Kumpanen, die am Morgen der Leidenschaftlichkeit und Poesie ihrer Liebe etwas Abbruch taten, indem jeder von ihnen ausgiebig in seinen Nachttopf pißte, begleitet von einem dicken Furz …
Gestern verbrachte ich den Tag in dem Atelier eines wunderlichen Malers namens Degas. Nach vielen Anläufen, Versuchen, entschlossenen Vorstößen in verschiedener Richtung, hat er sich ins Moderne verliebt und innerhalb des Modernen sein Auge auf die Wäscherinnen und Tänzerinnen geworfen. Im Grunde ist das gar keine so schlechte Wahl. Es ist das Weiß und das Rosa, die weibliche Haut in Leinen und Gaze, der reizendste Vorwand für zarte blonde Tönungen.
Der Maler führt seine Bilder vor; von Zeit zu Zeit erläutert er seine Deutung mimisch, indem er einen choreographischen Verlauf nachahmt, eine Arabeske, wie es die Tänzerinnen nennen. Und es ist wirklich sehr amüsant, ihm zuzusehen, wie er auf den Zehenspitzen steht, mit abgerundeten Armen, die Ästhetik des Tanzlehrers mit der des Malers verbindet und von dem zarten Schmutzton der Bilder von Velázquez spricht oder von den silhouettenhaften Bildern Mantegnas.
Ein origineller Kerl ist dieser Degas, kränklich und neurotisch, vor allem, was die Augen anbelangt, so daß er fürchtet zu erblinden; aber dadurch ist er eben auch ein höchst empfindungsfähiger Mensch, der den Widerhall des Wesens der Dinge auffängt.
Degas klagte heute abend, als er von einer Einladung kam, daß es in der Gesellschaft keine Hängeschultern mehr gebe. Und er hat recht, es ist ein Zeichen physischen Adels, das bei den neuen Schichten der Frauen verschwindet.
Rose hat bei der Portiersfrau das Nachtgewand oder meinetwegen auch das Morgengewand gesehen, das die Deslions durch ihr Dienstmädchen einem der Männer schickt, dem sie eine Nacht gewährt. Es scheint, daß sie für jeden ihrer Liebhaber ein solches Gewand in seiner jeweiligen Lieblingsfarbe besitzt. Dies war ein Morgenrock aus weißem Satin, wattiert und abgesteppt, dazu goldbestickte Pantoffeln in der gleichen Farbe – ein Morgenrock zu zwölf- bis fünfzehnhundert Franc –, ein mit Valenciennes-Spitzen verziertes Batisthemd mit bestickten Einsätzen zu dreihundert Franc, ein Unterrock mit drei Spitzenvolants zu drei- oder vierhundert Franc. Das macht insgesamt eintausendzweihundert Franc und wird in jedes Domizil getragen, in dem man es bezahlen kann.
Die Deslions, dieser Trampel auf unserem Treppenflur, wird von dem Börsen-Millionär und ehemaligen Seidenweber Bianchi und von Lauriston mit Gold überhäuft: »Ihr Spülstein in der Küche ist schwarz«, erzählte uns Rose, schwarz von ihren Walnußblatt-Spülungen.
Anna Deslions, Bianchis Ex-Mätresse und der Ruin von Lauriston: eine wunderbar üppige schwarze Haarflut; Samtaugen, die wie eine heiße Liebkosung sind, wenn man ihrem Blick begegnet; eine starke, aber fein gezeichnete Nase; schmale Lippen, ein volles Gesicht: ein prächtiger italienischer Jünglingskopf mit goldenen Lichtern wie von Rembrandt.
Heute morgen brachte uns der Bademeister ein Bad. Als er von Rose hört, daß Anna Deslions die Mätresse des Prinzen Plonplon ist, sagt er zu ihr: »Er ist wahrhaftig nicht zimperlich, sie ließ Partikel ihres Körpers im Bad.«
Wir gehen in die Avenue des Champs-Élysées nahe beim Arc de Triomphe zur Besichtigung der zum Verkauf stehenden Möbel der Wohnung von Anna Deslions, der berühmten Mätresse zweier Zelebritäten: Prinz Napoléon und Lambert-Thiboust, jener Dirne, die so lange unsere Nachbarin war und die aus dem vierten Arrondissement unseres Hauses zu diesem Prunk, zu Reichtum und blendendem Ansehen aufgestiegen ist!
Alles in allem sind mir diese Dirnen gar nicht so unangenehm. Sie heben sich ab von der Eintönigkeit, der Rechtschaffenheit, der gesellschaftlichen Ordnung, der Vernünftigkeit und Regel. Sie bringen ein bißchen Tollheit in die Welt. Sie teilen Ohrfeigen mit Banknoten aus. Sie sind die losgelassene nackte, ausschweifende und siegreiche Laune inmitten einer Welt freudloser Notare und Sachwalter.
In ihrem Heim zeugt alles vom großen Prunk einer Unkeuschen: das geträumte und von einem Dekorateur realisierte Paradies, mehr nicht. Ein weißgoldener Salon, ein Schlafzimmer in rotem Satin, Boudoirs in gelbem Satin, alles reichlich mit Gold gehöht; entsetzlich überladene goldene Spiegel; eine ziemlich hübsche Toiletten-Garnitur, riesige Wasserschüsseln und Krüge aus graviertem gelben böhmischen Kristall. Bemühter Reichtum im Schlafzimmer: mit Chenillegarn bestickte kleine Sofas aus weißem Satin.
Als Kunstgegenstände gibt es Bilder … o Ironie! Inmitten all der Seide an der Wand: ein Bonvin, der einen Mann bei Tisch in einem Kabarett vorstellt. Es scheint so, als sei das ein Familienporträt, eine Spur der Herkunft, der Vater der Dirne, der den Kopf aus ihrem Reichtum herausstreckt!
Dann, an einer anderen Wand: ährenlesende und heuwendende Feldarbeiterinnen von Breton, gebeugt in der Mühsal und mit schwitzender Stirn, geben sie inmitten des Goldes in diesem Huren-Interieur ein Bild der Arbeit, der sonnengebräunten Landbevölkerung, die ihr Brot einer kargen Erde abringt.
In der Bibliothek – sie hatte nämlich eine Bibliothek! – sah ich neben den Brevieren des Gewerbes – Faublas, Manon Lescaut, les Mémoires de Mogador usw. – die Fragen meiner Zeit von Émile Girardin. Man stelle sich die Triangulation der Gemalten als Opfergabe für Venus Pandemos vor!
Bei den Juwelen, die eine ganze Vitrine füllen, handelte es sich um das Schmuckkästchen einer Faustine, blitzende dreihunderttausend Franc, die sie auf ihrer Ambrahaut spielen ließ. Während ich mich darüberbeugte und sie betrachtete, sah ich in ihrem Schimmer – wie in einem Aufleuchten der Vergangenheit – die Deslions wieder, wie sie einmal, als wir ein Abendessen gaben, unser Dienstmädchen bat, in unserer Abwesenheit um den gedeckten Tisch herumgehen zu dürfen, um ihre Augen mit ein wenig Luxus zu beglücken …
Sie verkauft übrigens weder Kleider noch Kaschmirschals: ihr Werkzeug behält sie für sich.
Im Theater.
Ich sitze Seite an Seite neben der allzeit schönen Anna Deslions; sie hat einen bernsteinfarbenen Teint und ist gelassen und prachtvoll in der Art einer Io. Sie ist in tiefer Trauer wegen ihrer Mutter. In diesem Jahr ist unter den Müttern der Huren eine richtige Epidemie ausgebrochen: Gisette, Lagier, Anna. Denn diese Frauen haben wie andere Frauen Mütter, die sterben. Es gibt in der Tat Schmerzen, die dazu angetan sind, zur Prostitution zu verleiten.
Wir plaudern. Sie ist sehr liebenswürdig, sagt, wie sie es bedauert, daß wir sie nicht kannten, als sie unsere Nachbarin war, denn als Schriftsteller, die wir sind, hätten wir Dinge bei ihr sehen können, die für uns durchaus kurios gewesen wären. Dann kommen wir auf ihren Verkauf. Ich finde ihren Waschraum zu schlicht, zu ärmlich. Sagt, daß sie ein herrschaftliches Haus bräuchte, daß sie gern ein Schwimmbecken aus Marmor hätte, in dem sie ihre Empfänge abhalten würde. Dann sagt sie mir, daß sie es immer vorhergesagt habe, wie sich nun ihr Traum von einem Mansardendach erfüllte; sie werde in Neuilly wohnen und ihre Zeit mit dem Weben von Tapisserien unter den Weiden verbringen: »Sie müssen nämlich wissen, daß ich alldem wahrhaftig nicht entgegengekommen bin. Es ist mir von selbst zugefallen. Ich war nicht darauf aus, reich zu sein. Als es mir zufiel, habe ich davon profitiert.«
Und das stimmt. Diese Frau hat die echte und eingefleischte Eigenschaft der Dirne: die Passivität. Unbewußt und unbekümmert, fügt sie sich in den Lauf ihres Lebens. Sie hat sich vom Glück anreden lassen wie von einem Passanten: wie etwas, das kommt, das man akzeptiert, das wieder weggeht und das man vergißt.
Dieser Prinz Napoléon ist ganz entschieden der letzte der Geizhälse! Feydeau erzählte uns, daß er zur Zeit seines Bruchs mit Anna Deslions einen Domestiken zu ihr geschickt habe, der die Blaufuchsdecke wieder an sich nehmen sollte, die er ihr geschenkt hatte. Feydeau war anwesend. Er sagte zu Anna, daß er sie verachten würde, wenn sie sie zurückgäbe. Der Prinz gab sich nicht geschlagen: durch den Polizeipräfekten Boitelle wollte er Anna schon dazu bringen, sie auszuspucken.
Der Brand gibt Paris ein Licht wie bei einer Sonnenfinsternis.
Die Beschießung setzt einen Augenblick aus. Ich nutze das, um Burty zu verlassen und zur Rue de l’Arcade zu gelangen. Dort finde ich Pélagie, die so tollkühn gewesen ist, gestern, mit einem großen Rosenstrauch von meinem Gloire de Dijon-Strauch im Arm, quer durch die ganze Schlacht zu dringen. Offiziere, die diese Frau bewunderten, die ohne Furcht mit ihren Blumen mitten durch Gewehrfeuer und Kugelregen schritt, gewährten ihr Schutz und Hilfe, indem sie sie in der Umgebung der Chapelle Expiatoire durch Gänge passieren ließen, die vom Pionierkorps gestochen worden sind.
Während wir das Haus inspizierten und als Pélagie mir das Essen servierte, erzählte sie mir, daß mein Nachbar César, der keinen Gewölbekeller hat, in einem der meinen untergebracht wurde, während sie mit dem Dienstmädchen des besagten César den anderen Keller in Besitz nahm, und da sie nichts weiter zu tun hatten, verbrachten sie die Tage mit Kartenspielen – ihre Augen hatten sich bald daran gewöhnt, in der Dunkelheit zu sehen.