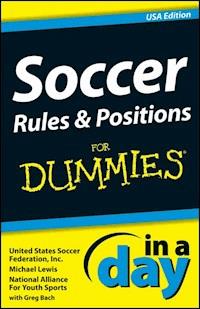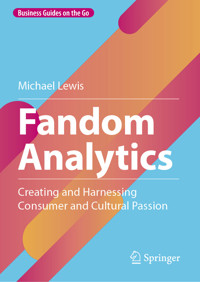Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
New York Times Bestseller Wie gelangen wir zu unseren Entscheidungen, und warum liegen wir so oft daneben? Daniel Kahneman war sich immer sicher, dass er sich irrte. Amos Tversky war sich immer sicher, dass er recht hatte. Der eine nimmt alles ernst, für den anderen ist das Leben ein Spaß. Die beiden weltberühmten Psychologen und Begründer der Verhaltensökonomie haben mit ihrer gemeinsamen Forschung unsere Annahmen über Entscheidungsprozesse völlig auf den Kopf gestellt. Michael Lewis entspinnt entlang zweier filmreifer Figuren eine fesselnde Geschichte über menschliches Denken in unkalkulierbaren Situationen und die Macht der Algorithmen. In seiner genialen Erzählung führt uns Lewis an die Grenzen unserer Entscheidungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MICHAEL LEWIS
AUS DER WELT
Grenzen der Entscheidung oder Eine Freundschaft, die unser Denken verändert hat
Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer und Sebastian Vogel
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Irren ist menschlich, sagen wir, und lassen uns immer wieder von unserem Bauchgefühl leiten. Michael Lewis geht dem Phänomen intuitiver Entscheidungsprozesse jetzt auf den Grund. Sujet seines neuen Buches ist nicht mehr die Wall Street, sondern die faszinierende Freundschaft der weltbekannten Psychologen und Begründer
der Verhaltensökonomie Daniel Kahneman und Amos Tversky. Beide haben unsere Annahmen über Entscheidungsprozesse völlig auf den Kopf gestellt. Jetzt liefern sie als Protagonisten den filmreifen Stoff, aus dem Lewis seine unverwechselbar spannende Geschichte macht. Dieses Buch zu lesen, ist eine kluge Entscheidung.
Vita
Michael Lewis ist New-York-Times-Nr.-1-Bestsellerautor. In seinem ersten Buch Liar‘s Poker verarbeitete er seine Erfahrungen als Investmentbanker. 2003 erschien sein Bestseller Moneyball, der 2011 mit Brad Pitt in der Hauptrolle verfilmt wurde, ein Buch über ein Baseballteam, das seine Spieler nach mathematischen Regeln beurteilt. Es folgten bei Campus unter anderem The Big Short, das auch als Kinofilm Furore machte, und zuletzt Flash Boys, das ebenfalls in Hollywood verfilmt wird. Lewis lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Berkeley, Kalifornien.
Für Dacher Keltner, meinen Führer durch den Dschungel
Inhalt
Einleitung — EINE NAGENDE FRAGE
Kapitel 1Männertitten
Kapitel 2Der Außenseiter
Kapitel 3Der Liebling
Kapitel 4Der Denkfehler
Kapitel 5Der Zusammenprall
Kapitel 6Die Gesetze des Denkens
Kapitel 7Die Regeln der Prognose
Kapitel 8Virale Erfolge
Kapitel 9Die Geburt des Kampfpsychologen
Kapitel 10Der Isolationseffekt
Kapitel 11Aus der Welt
Kapitel 12Die Wolke der Möglichkeiten
Coda — BORA-BORA
Ein Hinweis zur Literatur
Einleitung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Nachwort
Dank
Zweifel ist keine angenehme Voraussetzung, aber Gewissheit ist eine absurde.
Voltaire
Einleitung
EINE NAGENDE FRAGE
In meinem Buch Moneyball, das im Jahr 2003 erschien, schilderte ich die Baseballmannschaft der Oakland Athletics und ihre Suche nach neuen Methoden zur Bewertung von Spielern und Strategien. Da die Oakland Athletics weniger Geld für Spielereinkäufe zur Verfügung hatten als andere Clubs, entwickelten die Manager einen ganz anderen Ansatz. In alten und neuen Baseballstatistiken spürten sie frische Erkenntnisse auf, mit deren Hilfe es ihnen gelang, besser zu werden als viele der anderen Teams. Sie fanden einen Platz für Spieler, die von anderen Mannschaften ausgemustert oder übergangen worden waren, und stellten fest, dass sich viele der geschätzten Baseballweisheiten als reiner Unsinn entpuppten. Als das Buch erschien, wurde es von einigen Experten – erfahrenen Managern, Talentsuchern und Journalisten – verrissen, aber viele Leser waren von der Geschichte genauso fasziniert wie ich. Viele erkannten im Ansatz der Oakland Athletics eine Lektion, die weit über den Sport hinausging: Wenn die in aller Öffentlichkeit agierenden Vertreter einer traditionsreichen Branche derart falsch eingeschätzt wurden, wer wurde dann nicht falsch eingeschätzt? Wenn der Markt für Baseballspieler ineffizient war, welcher Markt war es dann nicht? Wenn ein neuer analytischer Ansatz im Baseball neue Erkenntnisse hervorbrachte, ließen sich dann nicht auch in anderen Branchen ähnliche Ergebnisse erzielen?
In den vergangenen gut zehn Jahren haben sich viele Menschen die Oakland Athletics zum Vorbild genommen und nach Möglichkeiten gesucht, sich mithilfe besserer Statistiken die Schwächen des Marktes zunutze zu machen. In der Folge wurden Artikel über Moneyball für Schulen, Filmstudios, Krankenversicherungen, Golf, Landwirtschaft, Buchverlage, Präsidentschaftswahlen, Banker und so weiter veröffentlicht. »Plötzlich werden Außenstürmer nach Moneyball-Kriterien beurteilt«, klagte ein Footballtrainer der New York Jets. Und als der Satiriker John Oliver sah, mit welch diabolischen und datengestützten Methoden das Parlament von North Carolina afroamerikanische Wähler von den Urnen ferngehalten wollte, sprach er von »Moneyball-Rassismus«.
Doch die Statistikbegeisterung hielt nicht lange vor. Wenn der statistische Entscheidungsansatz nicht sofort zum Erfolg führte, wurde er auf eine Weise niedergemacht, wie klassische Experten niemals kritisiert wurden. Nachdem die Boston Red Sox die Einkaufsstrategie der Oakland Athletics kopiert hatten, gewannen sie 2004 zum ersten Mal seit fast einem Jahrhundert die Meisterschaft. In den Jahren 2007 und 2013 wiederholten sie den Erfolg mit derselben Methode. Aber nach drei enttäuschenden Jahren nahmen sie 2016 wieder Abstand von dem datengestützten Ansatz und erklärten, dass sie sich fortan wieder auf Baseballexperten verlassen wollten. Ein anderes Beispiel ist der Meinungsforscher Nate Silver, der in der New York Times jahrelang mit erstaunlicher Präzision Wahlergebnisse vorausgesagt und dazu einen Ansatz verwendet hatte, den er als Baseball-Journalist entwickelt hatte. Erstmals schien die New York Times einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu haben. Aber als Silver die New York Times verließ und den Aufstieg Donald Trumps nicht vorhersagte, wurde sein Ansatz kritisiert – ausgerechnet von der New York Times! »Es geht nichts über den klassischen Journalismus, denn Politik ist eine zutiefst menschliche Angelegenheit und widersetzt sich der Prognose und der Vernunft«, schrieb ein Kolumnist im Frühjahr 2016. (Dabei übersah er geflissentlich, dass so gut wie kein klassischer Journalist den Aufstieg Trumps vorhergesehen hatte und dass Silver später einräumte, er habe sich bei seinen Vorhersagen ungewöhnlich stark von seiner subjektiven Meinung leiten lassen, weil Trump ein derartiger Ausreißer war.)
Die Kritik an Leuten, die von sich behaupten, mithilfe von Statistiken neue Erkenntnisse zu gewinnen und die Schwächen ihrer Branchen auszunutzen, mag hin und wieder berechtigt sein. Aber die Sehnsucht nach Experten, die Sicherheit bieten, wo es gar keine gibt, scheint tief in der menschlichen Psyche verwurzelt zu sein. Sie ist wie ein Filmmonster, das wir eigentlich schon tot geglaubt haben, das sich aber immer irgendwie noch einmal hochrappelt.
Nachdem sich der Staub um Moneyball gelegt hatte, blieb mir daher vor allem eine Reaktion auf mein Buch im Gedächtnis haften: die Besprechung des Wirtschaftswissenschaftlers Richard Thaler und des Juristen Cass Sunstein, die damals an der University of Chicago lehrten. Der Rezension, die am 31. August 2003 in der Zeitschrift New Republic erschien, gelang das Kunststück, großzügig und vernichtend zugleich zu sein. Die beiden Wissenschaftler waren genauso fasziniert wie ich, wie ein Markt für Profisportler derart verkorkst sein konnte, dass ein armer Club wie die Oakland Athletics plötzlich einen Gutteil der wohlhabenden Vereine besiegen konnte, indem er sich die Schwächen dieses Marktes zunutze machte. Doch der Autor von Moneyball scheine den Grund dafür nicht zu kennen, so die beiden Rezensenten: Der sei tief in den Mechanismen des menschlichen Denkens verwurzelt. Die Gründe für die Fehleinschätzungen von Baseballexperten und die Denkfehler aller Experten seien schon vor Jahren von zwei israelischen Psychologen namens Daniel Kahneman und Amos Tversky beschrieben worden. Mein Buch sei nichts Neues. Es handele sich lediglich um ein Beispiel für eine jahrzehntealte Erkenntnis, die von der Öffentlichkeit – meine Wenigkeit eingeschlossen – offenbar noch nicht ausreichend zur Kenntnis genommen worden sei.
Das war eine freundliche Untertreibung. Die Namen Kahneman und Tversky hörte ich zum ersten Mal, und das, obwohl ersterer im Jahr zuvor den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hatte. Und über die psychologischen Aspekte der Moneyball-Geschichte hatte ich mir kaum Gedanken gemacht. Warum der Markt für Baseballspieler ineffizient war? Das Management der Oakland Athletics hatte von »Verzerrungen« gesprochen: Zum Beispiel wurde die Geschwindigkeit der Spieler überschätzt, weil sie einfach zu messen war; dagegen wurde die Fähigkeit eines Spielers, auch ohne Schlag zu punkten, oft unterschätzt, weil er ja im Grunde gar nichts tat. Kleine, rundliche Spieler wurden unterbewertet, während attraktive, fit wirkende Spieler tendenziell überbewertet wurden. Ich fand diese Verzerrungen interessant, von denen die Manager sprachen, aber ich hatte nie nachgehakt und mich gefragt, wo sie wohl herkommen oder warum die Scouts und Spielerkäufer sich von ihnen beeinflussen lassen. In meinem Buch ging es darum, wie Märkte Spieler bewerten, und warum sie sich so oft irren. Irgendwo verschüttet war da noch eine andere Geschichte, die ich nicht erzählte, und in der ging es darum, wie wir zu unseren Urteilen und Entscheidungen kommen und warum wir so oft danebenliegen. Wie gelangen wir zu unseren Entscheidungen, wenn wir mit Unwägbarkeiten konfrontiert sind? Wie gehen wir mit Informationen aus Sportereignissen, Quartalsberichten, Gerichtsverfahren, medizinischen Untersuchungen oder zwischenmenschlichen Begegnungen um? Was geschieht in unserem Gehirn (und selbst im Gehirn von vermuteten Experten), dass es Fehlurteile fabriziert, die anderen Vorteile verschaffen, wenn sie statt Experten Statistiken heranziehen?
Und wie kam es, dass zwei israelische Psychologen so viel über dieses Thema zu sagen hatten, dass sie im Grunde ein Buch über Baseball vorweggenommen hatten, das erst Jahrzehnte später geschrieben werden sollte? Was brachte zwei Wissenschaftler aus dem Nahen Osten dazu, sich Gedanken darüber zu machen, was in einem Gehirn vorgeht, wenn es Baseballspieler, Anlagemöglichkeiten oder Präsidentschaftskandidaten beurteilen soll? Und wieso konnte ein Psychologe einen Wirtschaftsnobelpreis gewinnen? In der Antwort auf diese Fragen steckte eine ganz neue Geschichte.
Kapitel 1Männertitten
Als Clubmanager wissen Sie nie, was ein angehender Basketballprofi in einem Vorstellungsgespräch sagen wird, um Sie aus Ihrem Schlummer hochfahren zu lassen. Aber wenn Sie erst einmal hellwach sind, dann messen Sie dem, was Sie da hören, schnell viel größeres Gewicht bei, als es verdient: Die denkwürdigsten Momente in den Vorstellungsgesprächen lassen sich nur schwer in die richtige Gehirnschublade packen. Manche Spieler scheinen es regelrecht darauf anzulegen, Ihr Urteil zu verwirren. Als zum Beispiel ein Manager der Houston Rockets einen Nachwuchsspieler fragte, ob er einen Dopingtest bestehen würde, riss dieser die Augen auf, klammerte sich an die Tischkante und rief: »Heute!!!???« Ein anderer war als Student wegen häuslicher Gewalt verhaftet worden, doch die Anklage wurde später fallengelassen. Sein Agent behauptete, es habe sich um ein Missverständnis gehandelt, doch als der junge Mann darauf angesprochen wurde, erklärte er: »Meine Freundin hat mich so genervt mit ihrem Gezicke, da hab ich ihr die Hand um den Hals gelegt und zugedrückt. Damit sie endlich die Klappe hält.« Dann war da noch Kenneth Faried, Offensivspieler der Morehead State University. Als er beim Vorstellungsgespräch gefragt wurde, ob er lieber Kenneth oder Kenny genannt werden wollte, antwortete er: »Nennt mich einfach Manimal«1. Wie reagieren Sie auf so etwas? Etwa drei Viertel aller schwarzen Spieler, die bei den Houston Rockets zum Vorstellungsgespräch erscheinen, kennen ihren Vater bestenfalls vom Sehen. »Wenn man diese Jungs nach ihrer wichtigsten männlichen Bezugsperson fragt, dann antworten viele ›meine Mutter‹«, berichtet Sportdirektor Jimmy Paulins. »Einer hat ›Obama‹ gesagt.«
Dann war da noch Sean Williams. Am Boston College war der 2,08 Meter große Spieler ein Star gewesen, jedoch in den ersten beiden seiner drei Jahre suspendiert worden, weil er mit Marihuana verhaftet worden war (wobei es nie zu einer Anklage kam). In seinem zweiten Jahr war er nur auf fünfzehn Einsätze gekommen, hatte aber insgesamt 75 Würfe geblockt. Sean Williams sah aus wie ein kommender Star, und man ging davon aus, dass er in der ersten Runde gewählt würde, weil man annahm, dass er seinen Drogenkonsum in den Griff bekommen hatte.2 Vor dem Auswahlverfahren des Jahres 2007 flog er auf Bitten seines Agenten nach Houston, um sich auf die Gespräche vorzubereiten. Der Agent machte den Rockets ein Angebot: Williams würde ausschließlich mit den Rockets sprechen, und die Rockets würden dem Agenten Tipps geben, wie Williams im Vorstellungsgespräch überzeugender auftreten könnte. Es lief gut, bis das Thema Marihuana zur Sprache kam. »Sie sind im ersten und zweiten Jahr mit Marihuana erwischt worden«, sagte der Sportdirektor. »Wie ist es im dritten Jahr gelaufen?« Williams schüttelte nur den Kopf und antwortete: »Sie haben mich nicht mehr getestet. Und wenn sie mich nicht testen, dann rauche ich!«
Danach hielt es der Agent für ratsam, Williams nicht zu weiteren Gesprächen zu schicken. Er wurde trotzdem in der ersten Runde von den New Jersey Nets verpflichtet und wechselte nach 137 Kurzeinsätzen in der NBA in die Türkei.
Es ging um Millionenbeträge, denn Basketballspieler sind die im Durchschnitt bestbezahlten Mannschaftssportler der Welt. Die sportliche Zukunft der Houston Rockets stand auf dem Spiel. Die jungen Männer warfen den Managern Informationen an den Kopf, anhand derer sie beurteilen sollten, ob sie sie verpflichteten oder nicht. Aber was sollten die Manager damit anfangen?
Sportdirektor: Was wissen Sie von den Houston Rockets?
Spieler: Ich weiß, dass sie in Houston sind.
Sportdirektor: Welcher Fuß war verletzt?
Spieler: Ich habe immer gesagt, dass es der rechte war.
Spieler: Der Trainer und ich, wir waren nicht immer auf einer Wellenlänge.
Sportdirektor: In welchem Punkt?
Spieler: Spielzeit.
Sportdirektor: Was noch?
Spieler: Er war kleiner.
Daryl Morey, Sportdirektor der Houston Rockets, führt seit inzwischen zehn Jahren Vorstellungsgespräche mit extrem großen jungen Männern und hält es für besser, sich vor persönlichen Eindrücken zu hüten. Vorstellungsgespräche sind immer Theater. Er musste seine subjektiven Eindrücke im Zaum halten, vor allem dann, wenn er und alle anderen Teilnehmer von der Ausstrahlung eines Spielers wie gebannt waren. Und große Menschen haben nun mal eine besondere Ausstrahlung. »Es gibt viele charmante Riesen«, meint Morey. Das Problem war nicht die Ausstrahlung, sondern das, was sich möglicherweise dahinter verbarg: Sucht, Persönlichkeitsstörungen, Verletzungen, Trainingsfaulheit. Riesen konnten einen schier zu Tränen rühren mit ihren Geschichten über ihre Liebe zum Basketball und die Hindernisse, die sie überwinden mussten, um spielen zu können. »Jeder hat seine Story«, sagt Morey. »Ich könnte Ihnen über jeden eine Geschichte erzählen.« Und wenn diese Erzählung von jemandem handelte, der sich von Schwierigkeiten nicht aufhalten ließ – und davon handelten viele –, dann war es ganz schwer, ihnen zu widerstehen. Vor allem war es schwer, diese Geschichte nicht weiterzuspinnen und sich den künftigen Aufstieg des Basketballprofis in buntesten Farben auszumalen.
Deshalb glaubt Daryl Morey an Bewertungsverfahren, die auf Statistiken basierten. Für ihn gibt es keine wichtigere Entscheidung als die, welche Spieler er für seine Mannschaft unter Vertrag nimmt. »Sie müssen sich konstant vor dem ganzen Mist in Acht nehmen, der Sie in die Irre führen will«, sagt er. »Wir versuchen dauernd herauszufinden, was falsch ist und was echt. Sehen wir eine Fata Morgana? Ist das eine Illusion?« Die Vorstellungsgespräche stehen ganz oben auf der Liste von irreführendem Mist. »Es gibt nur einen Grund, warum ich mich in jedes Auswahlgespräch setze«, bekennt Morey. »Wenn der Spieler ein Problem hat und der Clubeigentümer nachher fragt: ›Was hat er denn im Auswahlgespräch auf diese und jene Frage geantwortet?‹, und ich ihm sagen muss: ›Mit dem habe ich zum ersten Mal gesprochen, als ich ihm den Scheck über fünf Millionen Dollar in die Hand gedrückt habe‹, dann bin ich meinen Job los.«
Nur deshalb saß Morey im Winter 2015 zusammen mit fünf Mitarbeitern in einem Konferenzraum in Houston und wartete auf einen weiteren Riesen. In dem Raum gab es nichts Erwähnenswertes zu sehen – ein Tisch, ein paar Stühle, mit Jalousien verdunkelte Fenster. Auf dem Tisch eine einsame Kaffeetasse, die irgendjemand vergessen hatte. Der Riese war … tja, das wussten die Anwesenden auch nicht so genau. Sie wussten nur, dass er erst neunzehn Jahre alt war und selbst für einen Basketballer riesig. Ein Talentsucher hatte ihn fünf Jahre zuvor in einem Dorf im indischen Punjab aufgespürt – so hieß es zumindest. Damals war er vierzehn Jahre alt, 2,13 Meter groß und barfuß, oder er trug Schuhe, die so zerrissen waren, dass seine Füße herausstanden.
Dieses Detail beschäftigte die Manager. War die Familie so arm, dass sie dem Jungen keine Schuhe kaufen konnten? Oder hatten sie es aufgegeben, Schuhe für derart rasant wachsende Füße zu kaufen? Oder war das Ganze nur das Märchen eines Agenten? So oder so blieb das Bild eines 2,13 Meter großen Jungen haften, der barfuß durch die Straßen von Indien lief. Sie hatten keine Ahnung, wie dieser Junge aus seinem indischen Dorf herausgekommen war. Wahrscheinlich hatte ein Talentsucher ihn in die Vereinigten Staaten gebracht, wo er Englisch und Basketball lernen sollte.
In der NBA kannte ihn niemand. Es gab nicht einmal ein Video, das den Jungen bei einer Basketballpartie zeigte. Die Rockets-Manager mussten annehmen, dass er nie gespielt hatte. Er hatte nicht einmal am offiziellen Auswahlverfahren der NBA für Amateure teilgenommen. Erst vor wenigen Stunden hatten die Rockets ihn wiegen und messen dürfen. Er hatte Schuhgröße 58, und seine Hände maßen von der Fingerspitze bis zum Handgelenk fast 30 Zentimeter – so große Hände hatten die Manager noch nie gesehen. Ohne Schuhe maß er 2,18 Meter und wog 136 Kilogramm, und sein Agent behauptete, er wachse sogar noch. In den letzten fünf Jahren hatte er in Südflorida gelebt und dort Basketball gelernt, zuletzt an der Sportakademie IMG, die Amateure zu Profis machen sollte. Niemand hatte ihn je spielen gesehen, doch die wenigen Menschen, die ihn zu Gesicht bekommen hatten, sprachen noch immer von ihm. Zum Beispiel Robert Upshaw, ein kräftiger Verteidiger von 2,13 Meter, der an der Washington University aus der Mannschaft geflogen war und sich nun um einen Platz in der NBA bemühte. Vor einigen Tagen war er dem indischen Riesen im Trainingsraum der Dallas Mavericks begegnet. Als er von Scouts hörte, dass die Rockets ihn eingeladen hatten, machte er große Augen und rief strahlend: »Der Typ ist der größte Mensch, den ich je gesehen habe. Und er kann Dreier werfen! Irre.«
Als Daryl Morey 2006 von den Rockets angestellt worden war, um Spieler einzukaufen, war er der erste seiner Art: der König der Basketballstreber. Seine Aufgabe bestand darin, das intuitive Expertenurteil durch ein statistisches Entscheidungsverfahren zu ersetzen. Dorey hatte keine nennenswerte Spielerfahrung und wollte gar nicht erst so tun, als sei er ein Experte oder Insider. Er war einfach jemand, der sich mit Zahlen wohler fühlte als mit Emotionen. Als Kind hatte er ein Interesse dafür entwickelt, mit Daten Prognosen anzustellen, und irgendwann hatte er einen regelrechten Zahlenfanatismus entwickelt. »Es gab für mich nichts Cooleres«, erzählt er. »Wie kann man mithilfe von Zahlen Ereignisse vorhersagen? Das war eine coole Art, den anderen voraus zu sein. Und es hat mir gefallen, den anderen voraus zu sein.« Er bastelte Prognosemodelle wie andere Kinder Modellflugzeuge. »Ich habe mich vor allem auf Sportergebnisse konzentriert. Ich hätte nicht gewusst, worauf ich das sonst anwenden sollte – auf meine Noten?«
Sein Interesse an Sport und Prognose führte ihn im Alter von sechzehn Jahren zu einem Buch von Bill James, der damals das statistische Denken in den Baseballsport einführen wollte. Auch dank der Oakland Athletics löste sein Ansatz eine Baseballrevolution aus und beförderte die Streber in die Führungsetagen fast sämtlicher Proficlubs. Als Morey 1988 über das Buch stolperte, konnte er nicht ahnen, dass eines Tages in professionellen Sportvereinen und allen anderen Unternehmen, die kostspielige Entscheidungen zu treffen hatten, Menschen mit einem Händchen für Zahlen das Sagen haben würden – oder dass der Basketball auf ihn warten würde. Er hegte einfach den Verdacht, dass die klassischen Experten bei Weitem nicht so viel wussten, wie alle Welt glaubte.
Diese Ahnung hatte ihn schon ein Jahr zuvor beschlichen, als die Sportzeitschrift Sports Illustrated seine Lieblingsmannschaft, die Cleveland Indians, aufs Cover gebracht und verkündet hatte, sie würde in diesem Jahr die Baseballmeisterschaft gewinnen. »Ich war begeistert. Endlich! Die Indians haben Jahre lang beschissen gespielt. Aber jetzt werden sie Meister!« Am Ende schnitten die Indians so schlecht ab wie noch nie. Wie konnte das passieren? »In dem Moment habe ich mir gedacht, vielleicht wissen die Experten einfach nicht, wovon sie reden.«
Nachdem er Bill James entdeckt hatte, kam er auf den Gedanken, dass er mithilfe von Statistiken bessere Prognosen abgeben könnte als die Experten. Wenn er die künftige Leistung von Sportlern vorhersagen konnte, dann konnte er erfolgreiche Mannschaften zusammenstellen, und wenn er erfolgreiche Mannschaften zusammenstellen konnte, dann … Und damit hatte Daryl Morey ein Ziel. Er wollte erfolgreiche Mannschaften zusammenstellen. Die Frage war nur: Wer würde ihm die Chance dazu geben? Während seines Studiums verschickte er Dutzende Briefe an Proficlubs, in der Hoffnung, irgendwo einen Aushilfsjob zu ergattern. Er erhielt nicht eine Antwort. »Damals bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich reich werden muss. Wenn ich reich bin, kann ich mir einfach eine Mannschaft kaufen und damit machen, was ich will.«
Morey stammt aus einer Mittelschichtfamilie im Mittleren Westen. Er war in seinem ganzen Leben keinem einzigen reichen Menschen begegnet. Als Student war er ausgesprochen faul. Trotzdem gab er den Gedanken nicht auf, genug Geld zu verdienen, um einen Club zu kaufen und die Mannschaft zusammenzustellen. »Jede Woche hat er ein Blatt Papier genommen und oben ›Meine Ziele‹ draufgeschrieben«, erinnert sich Ellen, seine damalige Freundin und heutige Frau. »Sein größtes Lebensziel war es, irgendwann einen Proficlub zu besitzen.« Und Morey erzählt weiter: »Ich habe Betriebswirtschaft studiert, weil ich mir gedacht habe, dass man so reich wird.« Nach Abschluss seines Studiums suchte er eine Stelle bei einer Unternehmensberatung, die ihre Mitarbeiter mit den Anteilen der Unternehmen bezahlte, die sie beriet. Die Kunden waren Internet-Start-ups. Das klang damals so, als könne man schnell reich werden. Dann platzte die Blase, und die Aktien waren keinen Cent mehr wert. »Es war die schlechteste Entscheidung meines Lebens«, gesteht Morey.
Doch aus dem Ausflug ins Beratergeschäft nahm Morey eine wichtige Lektion mit. Als Berater schien es zu seinen Aufgaben zu gehören, so zu tun, als verfüge er über hundertprozentige Gewissheit in Fragen, über die man gar nichts wissen konnte. In einem Vorstellungsgespräch bei McKinsey sagte man ihm, er vertrete seine Meinungen nicht mit der nötigen Überzeugung. »Ich habe gesagt, das liegt daran, dass ich nicht hundertprozentig sicher bin. Und dann haben die mir gesagt: ›Wir berechnen unseren Kunden eine halbe Millionen Dollar im Jahr, und deswegen müssen Sie sich sicher sein.‹« Auch das Beratungsunternehmen, das ihn schließlich nahm, verlangte unentwegt sichere Aussagen von ihm, obwohl diese Sicherheit in seinen Augen reine Täuschung war. Zum Beispiel sollte er die Ölpreisentwicklung prognostizieren. »Also sind wir zu unseren Kunden gegangen und haben den Ölpreis prognostiziert. Niemand kann den Ölpreis vorhersagen. Es war vollkommener Schwachsinn.«
Morey wurde klar, wie verlogen die meisten Experten und ihre »Prognosen« waren: Sie taten nur so, als wüssten sie etwas, aber in Wirklichkeit waren sie ahnungslos. Auf eine Menge faszinierender Fragen gab es nur eine einzige ehrliche Antwort: »Das kann man nicht vorhersagen.« Eine dieser Fragen war: »Wo steht der Ölpreis in zehn Jahren?« Das bedeutete nicht, dass man aufhörte, nach Antworten zu suchen. Es bedeutete nur, dass man die Antworten in Form von Wahrscheinlichkeiten angab.
Als er später Talentsucher einstellte, erwartete er von ihnen ein Bewusstsein dafür, dass sie es mit Fragen zu tun hatten, auf die es keine sicheren Antworten gab – dass sie also nicht unfehlbar waren. »Ich frage sie immer: Wen habt ihr übersehen?« Welchen künftigen Star haben sie abgeschrieben, in welchen Flop haben sie sich verliebt? »Wenn sie das nicht beantworten können, dann tschüss.«
Es war ein Glücksfall, dass Moreys Unternehmensberatung für einen Konzern arbeitete, der die Boston Red Sox erwerben wollte. Als der Kauf der Baseballmannschaft scheiterte, übernahm der Konzern kurzerhand eine Basketballmannschaft, die Boston Celtics. Dort konnte Morey 2001 anfangen und bekam gleich »die kniffligsten Aufgaben«. Er half bei der Zusammenstellung des neuen Managements, der Preisgestaltung der Eintrittskarten, und irgendwann wurde er auch bei den Spielerkäufen hinzugezogen. Die Frage »Wie wird sich dieser Neunzehnjährige in der Profiliga schlagen?« war ungefähr so wie die Frage »Wo steht der Ölpreis in zehn Jahren?«. Das konnte niemand exakt vorhersagen, aber mithilfe von Statistiken konnte man bessere Antworten finden, als wenn man einfach ins Blaue riet.
Morey besaß bereits ein simples statistisches Modell zur Bewertung von Amateuren. Er hatte es selbst entwickelt, nur zum Spaß. Im Jahr 2003 gaben ihm die Celtics die Chance, gegen Ende des Auswahlverfahrens einen Spieler zu wählen – an 56. Stelle, wenn man kaum noch etwas erwarten kann. So wurde Brandon Hunter, ein unbekannter Stürmer der Ohio University, der erste Spieler, der von einem Algorithmus ausgewählt wurde.3 Zwei Jahre später erhielt Morey einen Anruf von einer Headhunterin, die ihm sagte, die Houstons Rockets seien auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor. »Sie meinte, sie suchten einen Moneyball-Typen«, erinnert sich Morey.
Rockets-Eigentümer Leslie Alexander war enttäuscht vom Bauchgefühl der Basketballexperten. »Das Entscheidungsverfahren war nicht sonderlich gut«, meint er. »Es war nicht präzise. Heutzutage haben wir für alles Daten. Und wir haben Computer, die diese Daten auswerten. Ich wollte, dass wir diese Daten besser nutzen. Ich habe Daryl eingestellt, weil ich jemanden haben wollte, der sich die Spieler nicht nur auf die übliche Art und Weise anschaut. Ich war nicht einmal sicher, ob wir das Spiel richtig spielen.« Je höher die Gehälter der Spieler, umso teurer kamen ihn schlechte Entscheidungen zu stehen. Er hoffte, dass Morey ihm mit seinem analytischen Ansatz auf dem teuren Talentmarkt einen Vorsprung verschaffen würde. Und weil es ihm egal war, was die Öffentlichkeit dachte, wollte er es ausprobieren. In seinem eigenen Vorstellungsgespräch fühlte sich Morey durch Alexanders Einstellung bestätigt. »Er hat mich gefragt: ›Welcher Religion gehörst du an?‹ Ich habe mir gedacht, das gehört eigentlich nicht in ein Vorstellungsgespräch. Ich habe ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet und gesagt, meine Familie sei lutherisch. Da unterbricht er mich: ›Sag doch einfach, dass du an diesen ganzen Quatsch nicht glaubst.‹«
Dass sich Alexander nicht um die öffentliche Meinung scherte, war ein Vorteil. Als Fans und Insider erfuhren, dass ein dreiunddreißigjähriger Streber Sportdirektor bei den Houston Rockets geworden war, reagierten sie im besten Fall verwundert und im schlimmsten feindselig. Die Radiosprecher aus Houston verpassten ihm den Spitznamen Deep Blue. »Die Fans haben das Gefühl, dass ich keiner von ihnen bin«, meint Morey. »Wenn wir Erfolg haben, schweigen sie, aber wenn sie irgendwo eine Schwäche spüren, dann rühren sie sich.« In seinem Jahrzehnt an der Spitze des Vereins gehören die Rockets zu den Top 3 der dreißig NBA-Mannschaften, hinter den San Antonio Spurs und den Dallas Mavericks. Nur vier andere Teams schafften es häufiger in die Play-offs. Nicht eine einzige Saison war ein Reinfall. Den Leuten, die sich über Morey aufregten, blieb also nichts anderes übrig, als in Erfolgszeiten über ihn herzuziehen. Als die Rockets im Frühjahr 2015 im Halbfinale gegen die Golden State Warriors antraten, ließ der einstige Starspieler und Fernsehkommentator Charles Barkley in der Halbzeitpause eine vierminütige Hasstirade gegen Morey vom Stapel: »Ich habe keine Angst vor Morey. Das ist einer von diesen Idioten, die an Statistiken glauben. Ich habe schon immer gewusst, dass Statistiken Quatsch sind … Diesen Morey würde ich nicht mal erkennen, wenn der jetzt hier zur Tür reinkäme … Im Basketball geht es um Talent. Diese Typen, die diese Organisation anführen und über Statistiken quatschen, die haben eins gemeinsam: Das sind Leute, die nie auf dem Feld gestanden haben und in der Schule keine Mädels abbekommen haben. Die wollen sich einfach nur in dieses Spiel reindrängen.«
Das war nicht die einzige Attacke. Leute, die Daryl Morey nicht kannten, nannten ihn einen Klugscheißer, weil er Analyse in den Sport gebracht hatte. In Wirklichkeit ist er das genaue Gegenteil. Er hat etwas Bescheidenes an sich, weil er weiß, wie schwierig es ist, etwas mit Sicherheit vorzusagen. Nur was seinen eigenen Entscheidungsprozess angeht, ist er einigermaßen sicher: Seinem ersten Urteil traut er nie. Er schlug eine neue Definition für das Wort Streber vor: jemand, der sein Denken gut genug kennt, um ihm zu misstrauen.
Gleich nach seiner Ankunft in Houston führte Morey sein statistisches Modell zur Vorhersage der künftigen Entwicklung von Basketballspielern ein. Das Modell war außerdem ein Instrument, um Wissen zu sammeln. »Wissen ist buchstäblich Prognose«, meint Morey. »Wissen ist alles, womit wir unsere Prognosen verbessern können. In allem, was wir tun, wollen wir das Richtige vorhersehen. Die meisten Menschen machen das unbewusst.« Mit einem Modell konnte man Eigenschaften identifizieren, die einen Nachwuchsspieler im Profigeschäft erfolgreich machten, und die richtige Gewichtung dieser Eigenschaften ermitteln. Wenn man erst einmal eine Datenbank mit Tausenden aktiven und ehemaligen Spielern hat, konnte man allgemeine Beziehungen zwischen ihrer Leistungen in Universitätsmannschaften und ihrer Profilaufbahn herstellen. Die Zahlen sagten etwas über einen Spieler aus. Aber welche Zahlen? Viele glaubten, dass die Anzahl der erzielten Körbe den Ausschlag gab. Diese Annahme ließ sich nun überprüfen: Sagte die Trefferzahl an der Universität etwas über die spätere Leistung in einer Profimannschaft aus? Die Antwort lautete Nein. Aus ersten Versionen seines Modells wusste Morey, dass herkömmliche Statistiken – von Körben, Rebounds, Vorlagen – reichlich irreführend sein konnten. Es war möglich, dass ein Spieler, der viele Körbe warf, seiner Mannschaft schadete und dass ein Spieler, der kaum traf, ein Plus für sein Team war. »Wenn man nur das Modell hat und keine menschliche Meinung, ist man gezwungen, die richtigen Fragen zu stellen«, sagt Morey. »Warum schätzen die Talentsucher jemanden so hoch ein, der im Modell so schlecht abschneidet? Und warum schätzen sie jemanden so schlecht ein, der im Modell so gut bewertet wird?«
Er glaubte nicht, dass das Modell die richtige Antwort hatte – aber es hatte eine bessere Antwort. Er war auch nicht so naiv zu glauben, dass das Modell die Spieler von allein aussuchen könnte. Das Modell musste ständig überprüft und korrigiert werden – vor allem weil es Informationen gab, die das Modell nicht hatte. Wenn sich ein Spieler am Tag vor dem Auswahlverfahren den Hals brach, dann wäre es natürlich gut, das zu wissen. Aber wenn Daryl Morey die Wahl zwischen seinem Modell und einem Team von Talentsuchern gehabt hätte, dann hätte er sich für sein Modell entschieden.
Damit stand er damals, im Jahr 2006, allein da. Außer ihm schien niemand mit einem Modell zu arbeiten, und niemand hatte sich die Mühe gemacht, die Daten zu sammeln, die ein Modell benötigte. Um an Statistiken heranzukommen, musste er Leute zum Büro der universitären Sportvereine in Indianapolis schicken, Ergebnisse aller Spiele der vergangenen zwanzig Jahre zusammenstellen und die Daten von Hand in sein System eingeben. Mit seiner Datenbank konnte er dann Nachwuchsspieler mit ähnlichen Spielern der Vergangenheit vergleichen und sehen, ob sich daraus allgemeine Regeln ableiten ließen.
Heute ist die Methode der Houston Rockets nichts Neues mehr. Ihre Algorithmen unterschieden sich nicht wesentlich von denen, die Börsenhändler, Wahlkampfmanager und Unternehmen für ihre Prognosen und Kaufentscheidungen verwenden. Im Jahr 2006 war das jedoch Neuland. Moreys Modell benötigte viele Informationen, die nicht verfügbar waren. Die Rockets begannen damit, ihre eigenen Daten zu sammeln, indem sie Dinge maßen, die noch nie gemessen worden waren. Sie zählten zum Beispiel nicht nur die Abstauber, sondern auch die Zahl der Abstauber-Chancen eines Spielers. Sie beobachteten, wie viele Punkte ein Team erzielte, wenn ein bestimmter Spieler auf dem Feld war, und wie viele, wenn er auf der Bank saß. Punkte und Abstauber pro Spiel waren wenig aussagekräftig, Punkte und Abstauber pro Minute hingegen schon. Wenn ein Spieler 15 Punkte erzielte, dann musste man wissen, ob er während der gesamten Spielzeit auf dem Feld gestanden hatte oder nur eine Halbzeit lang. Außerdem ermittelten sie die Geschwindigkeit eines Teams, also wie oft es das Spielfeld hinauf und hinunter lief. Durch die Justierung der Statistiken eines Spielers erhielt man neue Informationen. Eine bestimmte Anzahl von Würfen und Abstaubern bedeutete eine Sache, wenn die Mannschaft 150 Angriffe durchführte, und eine ganz andere, wenn sie nur 75-mal unter dem gegnerischen Korb stand.
Die Rockets sammelten Daten über Spieler, die noch nie jemand erhoben hatte. Und nicht nur Basketballdaten. Sie sammelten auch Informationen aus dem privaten Umfeld der Spieler und suchten nach Mustern. War ein Spieler besser, wenn er mit beiden Elternteilen aufwuchs? Waren Linkshänder im Vorteil? Waren Spieler, die an der Universität unter erfolgreichen Trainern gespielt hatten, in der Profiliga besser? Was bedeutete es, wenn ein Spieler einen früheren Profi in der Familie hatte? Wenn seine Universitätsmannschaft Raumdeckung spielte? Wenn er in der Universität auf mehreren Positionen gespielt hatte? Wie viele Liegestütze er schaffte? »Die meisten Daten haben gar nichts ausgesagt«, gesteht Morey. Aber einige waren interessant. Die Zahl der Abstauber pro Minute zum Beispiel. Außerdem stellte er fest, dass Körpergröße allein weniger aussagte als die Größe mit ausgestreckten Armen, die Reichweite also.
Im Jahr 2007 kam das Modell erstmals zum Einsatz. Nun war die Chance gekommen, einen leidenschaftslosen, unsentimentalen und evidenzbasierten Ansatz gegen die gefühlte Erfahrung einer ganzen Branche antreten zu lassen. In diesem Jahr wählten die Rockets an 26. und 31. Stelle. Nach Moreys Modell betrug die Wahrscheinlichkeit, an diesen Positionen einen ordentlichen Profispieler zu erwischen, 8 beziehungsweise 5 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, einen Spieler zu bekommen, der von Anfang an in der ersten Mannschaft spielen würde, betrug gerade einmal 1 Prozent. Er wählte Aaron Brooks und bekam durch einen Tausch Carl Landry, die beide sofort einen Platz in der Mannschaft bekamen. Es war ein unglaublicher Fischzug.4 »Das hat uns eingelullt«, meint Morey. Ihm war klar, dass sein Modell bestenfalls ein bisschen weniger fehlerbehaftet war als die Menschen, die seit jeher Bewerber beurteilen. Und er wusste, dass er bei Weitem nicht über genug aussagekräftige Daten verfügte. »Wir hatten Informationen, aber die stammten oft nur von einer Universitätssaison. Und auch diese Informationen sind problematisch. Das Spiel ist anders, die Trainer sind andere, der Wettbewerb ist anders – und die Spieler sind zwanzig Jahre alt. Die wissen ja nicht mal selbst, wer sie sind. Woher sollen wir das dann wissen?« Das alles war ihm klar, und trotzdem dachte er, dass er eine Spur hatte. Dann kam das Jahr 2008.
In diesem Jahr standen die Rockets bei der Auswahl an 25. Stelle und tauschten ihre eigentliche Wahl mit den Portland Trail Blazers; sie bekamen einen Nachwuchsspieler namens Joey Dorsey von der University of Memphis. Im Vorstellungsgespräch war Dorsey witzig und liebenswürdig – er hatte gesagt, er überlege, nach seiner Basketballlaufbahn eine Karriere als Pornostar einzuschlagen. Nachdem die Rockets ihn verpflichtet hatten, schickten sie ihn nach Santa Cruz, um an einem Trainingsspiel mit anderen Neuverpflichtungen teilzunehmen. Morey sah sich die Partie an. »Das erste Spiel war furchtbar«, erinnert er sich. »Ich war entsetzt!« Joey Dorsey war so schlecht, dass Morey zweifelte, ob das wirklich der Junge war, den er ausgewählt hatte. Vielleicht nahm er das Spiel ja nicht sonderlich ernst, dachte er sich. »Ich habe ihn zum Essen eingeladen, und wir haben uns zwei Stunden lang unterhalten.« Morey erklärte ihm, wie wichtig es war, dass er Einsatz zeigte, einen guten Eindruck machte und so weiter. »Ich habe erwartet, dass er beim nächsten Spiel mit brennenden Haaren aufs Feld läuft. Aber er hat genauso beschissen gespielt.« Morey musste schnell einsehen, dass er ein größeres Problem hatte als Joey Dorsey. »Für das Modell war Joey Dorsey der Inbegriff eines Superstars. Die Werte waren unglaublich.«
Im gleichen Jahr hatte das Modell einen Spieler namens DeAndre Jordan von der Texas A&M University als untauglich eingestuft. Gut, auch für die Scouts der anderen Mannschaften war er nicht die erste Wahl, und er erhielt erst relativ spät im Auswahlverfahren einen Vertrag von den Los Angeles Clippers. Aber während sich Joey Dorsey als Flop erwies, wurde DeAndre Jordan einer der besten Center-Spieler der Liga und zweitbester Spieler seines Auswahljahrgangs.5
Irgendeine Mannschaft hatte immer Pech, und meistens zogen alle eine Niete. Jedes Jahr übersahen die Talentsucher große Stars, und jedes Jahr erwiesen sich umworbene Spieler als Flops. Morey hatte nie angenommen, dass sein Modell perfekt war, aber er hatte auch nicht vermutet, dass es so danebenliegen konnte. Wissen war Prognose: Aber wenn man offensichtliche Entwicklungen wie das Versagen von Joey Dorsey oder den Erfolg von DeAndre Jordan nicht vorhersagen konnte, was konnte man dann überhaupt wissen? Sein Leben lang hatte er einen verlockenden Gedanken verfolgt: Mit Zahlen konnte man bessere Prognosen treffen. Das schien nun fraglich. »Ich hatte etwas übersehen«, gesteht Morey. »Und das waren die Grenzen des Modells.«
Sein erster Fehler war, dass er Joey Dorseys Alter vernachlässigt hatte. »Er war uralt«, sagt Morey. »Er war vierundzwanzig, als wir ihn verpflichtet haben.« An der Universität hatte Dorsey auch deshalb so gut gespielt, weil er viel älter war als seine Gegner. Er hatte die Kleinen verhauen. Als Morey in seinem Modell das Alter stärker gewichtete, stufte es Dorsey als schwachen Profikandidaten ein und schärfte die Bewertung fast aller Spieler der Datenbank. Morey stellte fest, dass es an den Universitäten eine ganze Gruppe von Spielern gab, die gegen schwache Gegner besser waren als gegen starke – Basketballrüpel. Auch die konnte das Modell identifizieren, indem es die Spiele gegen starke Gegner stärker gewichtete. Eine weitere Verbesserung des Modells.
Morey glaubte zu verstehen, wie sich das Modell von Joey Dorsey hatte täuschen lassen. Dass es den Wert von DeAndre Jordan nicht erkannt hatte, bereitete ihm größeres Kopfzerbrechen. Der Junge hatte an der Universität nur eine Saison lang gespielt, und das nicht sonderlich gut. In der Schule war er sensationell gewesen, aber an der Universität hatte er seinen Trainer gehasst, und eigentlich wollte er auch gar nicht studieren. Wie sollte das Modell einen Spieler erkennen, der sich absichtlich nicht hervorgetan hatte? Aus den Statistiken der Universitätsmannschaften ließ sich Jordans Zukunft unmöglich herauslesen, und damals gab es noch keine brauchbaren Statistiken über Schulbasketball. Wenn das Modell nur Spielstatistiken zugrunde legte, würde es jemanden wie DeAndre Jordan nie entdecken. Es sah so aus, als könnte das nur ein klassischer Talentsucher. Zufällig war Jordan in Houston aufgewachsen, direkt unter den Augen der Rockets, und einer der Talentsucher hatte ihn vorgeschlagen, weil er sein unschlagbares Talent bemerkt hatte. Einer seiner Scouts hatte etwas erkannt, das sein Modell übersehen hatte!
Weil Morey Morey war, hatte er natürlich überprüft, ob sich aus den Empfehlungen seiner Talentsucher ein Muster ergab. Die meisten von ihnen hatte er selbst eingestellt und war von ihren Fähigkeiten überzeugt, aber es gab keinen Hinweis, dass einer bessere Einschätzungen abgab als seine Kollegen oder als der Markt. Wenn es so etwas gab wie einen Experten, der künftige Stars erkennen konnte, dann war er ihm noch nicht untergekommen. Er glaubte aber auch nicht, dass es so jemanden gab. »Es kam mir nicht in den Kopf, meine Intuition stärker zu gewichten«, sagt er. »Ich habe kein Vertrauen in meinen Bauch. Ich glaube, es gibt genug Beweise, dass man auf Instinkte nicht viel geben sollte.«
Schließlich kam er zu dem Schluss, dass die Rockets Eigenschaften erfassen und analysieren mussten, die bislang keine Rolle gespielt hatten: die Physis der Spieler. Sie mussten nicht nur messen, wie hoch ein Spieler sprang, sondern auch, wie schnell er absprang. Sie mussten nicht nur die Geschwindigkeit der Spieler ermitteln, sondern den Antritt. Das heißt, sie mussten noch streberhafter werden, als sie es ohnehin schon waren. »Wenn etwas schiefläuft, dann greifen die meisten Leute auf Bewährtes zurück«, meint Morey. »Ich wollte zu den Grundprinzipien zurück. Wenn die Physis wichtig ist, dann müssen wir sie noch besser messen als je zuvor. Wir mussten die Leistung in der Uni-Mannschaft schwächer gewichten und die körperlichen Eigenschaften stärker.«
Aber auch diese Daten haben ihre Grenzen, wenn es darum geht, die Leistung eines Spielers in einer Profimannschaft vorherzusehen. Offenbar brauchte man Experten, die sich die Leistung auf dem Spielfeld ansahen und einschätzen konnten, wie dieser Spieler in einem anderen Spiel gegen stärkere Gegner auftreten würde. Talentsucher mussten die Fähigkeiten beurteilen, auf die es im Spiel ankam: Pässe, Würfe, Sprungwürfe, Durchsetzung unterm Ring, Abstauber und so weiter. Man brauchte Experten. Modelle hatten ihre Grenzen, und damit war das menschliche Urteil wieder Teil des Entscheidungsverfahrens, egal ob es hilfreich war oder nicht.
Und so geschah es, dass Morey alles tat, um das subjektive menschliche Urteil in sein Modell zu integrieren. Es kam nicht nur darauf an, ein besseres Modell zu entwickeln. Es kam vielmehr darauf an, auf sein Modell und seine Talentsucher gleichzeitig zu hören. »Man muss herausfinden, was das Modell kann und was nicht und was Menschen können und was nicht«, erklärt Morey. Menschen haben manchmal Zugang zu Informationen, die das Modell nicht hat. Modelle können beispielsweise nicht wissen, dass DeAndre Jordan in seiner Universitätsmannschaft so schlecht spielte, weil er keine Lust hatte. Und was Menschen nicht konnten … nun, das war eine Frage, mit der sich Morey näher beschäftigen musste.
Als er begann, sich mit dem menschlichen Denken auseinanderzusetzen, musste er feststellen, welch sonderbare Wege es geht. Wenn es Informationen aufnahm, die bei der Beurteilung von Amateurspielern nützlich waren, dann öffnete es auch Tür und Tor für die Illusionen, die das Modell so nützlich machten. Im Jahr 2007 stand beispielsweise ein Spieler zur Auswahl, der dem Modell besonders gut gefiel. Marc Gasol war damals 22 Jahre alt, 2,16 Meter groß und spielte in Europa. Die Talentsucher hatten ein Foto von ihm entdeckt, auf dem er oben ohne zu besichtigen war. Er hatte dicke Bäckchen, ein Kindergesicht und eine ausgeprägte Brustmuskulatur. Prompt verpassten ihm die Mitarbeiter der Rockets den Spitznamen »Männertitten«. »Es war mein erstes Jahr, und ich habe mich zurückgehalten«, erinnert sich Morey. Deshalb ließ er es zu, dass der Spott das Urteil seines Modells übertönte, und musste zusehen, wie die Memphis Grizzlies Gasol unter Vertrag nahmen. Gasol wurde zweimal unter die All-Stars gewählt. Der Spitzname, den ihm die Talentsucher verpasst hatten, hatte sich in ihrer Beurteilung niedergeschlagen. »Danach habe ich eine Regel aufgestellt: Keine Spitznamen mehr.«
Plötzlich steckte er mitten in dem Sumpf, aus dem er sich mit seinem Modell eigentlich hatte befreien wollen. Wenn Daryl Morey schon nicht in der Lage war, das menschliche Denken aus dem Entscheidungsprozess herauszuhalten, dann musste er zumindest seine Schwächen kennen. Und nun sah er diese Schwächen überall. Zum Beispiel luden die Rockets Kandidaten zu einem Trainingsspiel ein. Wer wollte sich die Chance entgehen lassen, sie spielen zu sehen? Aber so interessant es für seine Talentsucher war, einen Spieler in Aktion zu sehen, so riskant war es auch, wie Morey bald feststellte. Ein guter Offensivspieler konnte einen schlechten Tag erwischen, ein guter Abstauber konnte herumgeschubst werden. Wenn alle zusehen durften, dann musste er seine Scouts dazu bringen, der Vorführung nicht allzu viel Gewicht beizumessen. (Aber warum sollten sie dann überhaupt zusehen?) Wenn zum Beispiel ein Spieler an der Universität eine Freiwurfquote von 90 Prozent hat, spielt es keine Rolle, wenn er in einem Trainingsspiel sechsmal hintereinander verwirft.
Money hielt seine Mitarbeiter an, das Trainingsspiel aufmerksam zu verfolgen, aber sich nicht davon beeinflussen zu lassen. Trotzdem hatten viele ihre Schwierigkeiten, das zu ignorieren, was sie mit eigenen Augen gesehen hatten. Einigen fiel es so schwer, als müssten sie an den Mast gefesselt dem Sirenengesang lauschen. Eines Tages kam ein Talentsucher zu Morey und meinte: »Ich habe das jetzt lange genug mitgemacht. Ich finde, wir sollten die Demonstrationsspiele einstellen. Bitte, hör auf damit.« Morey bat ihn, dem Gesehenen einfach nicht allzu viel Bedeutung beizumessen. »Da hat er zu mir gesagt: ›Das kann ich nicht.‹ Das ist wie eine Sucht. Die Droge schadet schon, wenn sie nur in der Nähe ist.«
Bald machte Morey eine weitere Beobachtung: Die Talentsucher bildeten sich fast auf den ersten Blick eine Meinung von einem Spieler, und dieser Meinung ordneten sie alle weiteren Informationen unter. Er hatte gehört, dass man das »Bestätigungsfehler« nannte. Das menschliche Gehirn hat kein besonderes Talent dafür, Unerwartetes zu erkennen, doch es hat auf der anderen Seite eine Gabe dafür, seine Erwartungen zu bestätigen. »Der Bestätigungsfehler ist besonders heimtückisch, weil man ihn einfach nicht bemerkt«, führt er aus. Ein Talentsucher bildete sich eine Meinung über einen Spieler, und benutzte alle weiteren Informationen, um diese Meinung zu untermauern. »Das ist der Klassiker. Wenn ein Talentsucher einen Spieler nicht mag, dann sagt er, er hat keine Position. Und wenn er ihn mag, dann sagt er, er ist vielseitig. Wen man mag, den vergleicht man mit einem Star, und wen man nicht mag, mit einem Versager.« Vorurteile blieben erhalten, selbst wenn sie eher schadeten, denn die Talentsucher suchten vor allem nach Möglichkeiten, diese Vorurteile zu bestätigen. Das Problem wurde noch größer, weil Talentsucher – Morey eingeschlossen – Spieler bevorzugten, die sie an ihre eigene Spielweise erinnerten. »Meine Spielerlaufbahn ist wirklich nicht der Rede wert«, sagt Morey. »Aber ich habe immer noch eine Vorliebe für Raufbolde. Weil ich so gespielt habe.« Wenn man jemanden sah, der so spielte wie man selbst früher, dann suchte man nach Gründen, ihn zu mögen.
Es half auch nicht, wenn ein Nachwuchsspieler eine gewisse Ähnlichkeit mit einem aktuellen Star hatte. Vor gut zehn Jahren wäre ein hellhäutiger 1,88 Meter großer Spieler, der als Schüler von den großen Mannschaften übergangen worden war, an einer kleinen Universität spielte und dessen hauptsächliches Talent Dreier waren, nicht weiter aufgefallen. Typen wie ihn gab es damals in der Profiliga nicht, oder zumindest waren sie keine Stars. Dann kam Stephen Curry in die NBA, führte die Golden State Warriors zur Meisterschaft und wurde als wertvollster Spieler gehandelt. Als plötzlich in den Auswahlgesprächen kleine, hellhäutige Spieler auftauchten und behaupteten, sie spielten wie Stephen Curry, wurden sie allein aufgrund ihrer Ähnlichkeit eher genommen.6 »Nachdem wir Aaron Brooks verpflichtet hatten, haben sich fünf Jahre lang in den Auswahlgesprächen viele Jungs mit ihm verglichen. Als ob es so viele kleine Abwehrspieler gäbe.« Also verbot Morey alle Vergleiche mit Spielern gleicher Hautfarbe. »Wenn sich jemand mit einem anderen Spieler vergleicht, dann muss der eine andere Hautfarbe haben.« Das hatte eine merkwürdige Folge: Die Vergleiche hörten auf. »Man sieht die Ähnlichkeiten nicht mehr«, sagt Morey.
Unser Gehirn hat ein ganz besonderes Talent dafür, uns ein Gefühl der Gewissheit in Fragen zu vermitteln, die an sich ungewiss sind. Wieder und wieder erlebt man es in Auswahlverfahren, dass Basketballexperten eine glasklare Meinung von einem Spieler haben, die sich später als Fata Morgana herausstellt. Zum Beispiel im Fall von Jeremy Lin. Der heute weltberühmte chinesisch-stämmige Abwehrspieler ging 2010 von Harvard ab und nahm am Auswahlverfahren teil. »Unser Modell schlug Purzelbäume«, erinnert sich Morey. Die Daten passten allerdings nicht zu dem Eindruck, den die Experten hatten, wenn sie ihn auf dem Feld sahen: Hier wirkte er nicht sonderlich athletisch. Weil Morey seinem Modell nicht hundertprozentig traute, drückte er sich und entschied sich gegen Lin. Ein Jahr später begannen die Rockets, den Antritt der Nachwuchsspieler zu messen: Jeremy Lin hatte den schnellsten Antritt aller je gemessenen Spieler. Er explodierte regelrecht und wechselte die Richtung schneller als jeder andere Profispieler. »Er ist unglaublich athletisch«, meint Morey. »Aber alle Welt, mich eingeschlossen, hat ihn für eine lahme Ente gehalten. Das kann nur daran gelegen haben, dass er Chinese ist.«
Wenn wir andere Menschen beurteilen, sehen wir offenbar nur das, was wir erwarten, und nicht das, was wir noch nie gesehen haben. Aber wie gravierend ist dieses Problem? Jeremy Lin saß lange bei den New York Knicks auf der Bank; als er schließlich einmal eingewechselt wurde (weil alle anderen verletzt waren), brannte er ein Feuerwerk ab. Die Knicks hatten ihn eigentlich schon verkaufen wollen, und Lin hatte beschlossen, in diesem Fall die Basketballschuhe an den Nagel zu hängen. So gravierend war das also: Ein ausgezeichneter Profispieler hätte nie eine Chance bekommen, nur weil er nach Ansicht von Experten kein Basketballgesicht hatte. Wie viele Jeremy Lins gibt es denn noch?
Wenig später schloss die NBA zeitweilig ihre Tore. Eine Auseinandersetzung zwischen Spielern und Eigentümern führte zu einem Streik, die Spiele wurden ausgesetzt. Morey nutzte die Zeit, um an der Harvard Business School einen Kurs in Verhaltensökonomik zu belegen. Er hatte von dem Fach gehört, sich aber nie näher damit beschäftigt. Zu Beginn der ersten Veranstaltung forderte die Professorin ihn und die anderen auf, die ersten beiden Ziffern ihrer Handynummer auf ein Blatt Papier zu schreiben. Dann bat sie die Teilnehmer zu schätzen, wie viele afrikanische Staaten Mitglied der Vereinten Nationen sind, und diese Zahl daneben zu schreiben. Sie sammelte die Zettel ein und demonstrierte ihnen, dass die Teilnehmer mit einer höheren Telefonnummer die Zahl der Länder durchweg höher eingeschätzt hatten. Dann führte sie ein zweites Experiment durch und sagte: »Wir machen das Spiel jetzt noch einmal. Ich gebe Ihnen einen Anker. Hier. Schauen wir mal, ob Ihr Denken nicht verkorkst ist.« Die Teilnehmer waren gewarnt, aber das änderte nichts. Um einen Denkfehler zu überwinden, reichte es offenbar nicht, zu wissen, dass man ihn machte. Dieser Gedanke beunruhigte Daryl Morey.
Als die Liga die Spiele wieder aufnahm, machte er eine weitere beunruhigende Beobachtung. Die Toronto Raptors boten den Houston Rockets an, ihnen ihre gute Position im Draft-Pick abzutreten, wenn sie ihnen einen Auswechselspieler namens Kyle Lowry überließen. Morey besprach sich mit seinen Mitarbeitern und wollte das Geschäft schon ausschlagen, als einer der Trainer sagte: »Also wenn uns jemand anbieten würde, eine gute Position im Draft-Pick gegen Lowry zu tauschen, dann würden wir nicht im Traum daran denken.« Also analysierten sie die Situation genauer. Der erwartete Wert der Position im Auswahlverfahren lag deutlich über dem Wert des Spielers, den sie dafür eintauschen sollten. Die Tatsache, dass Kyle Lowry zu ihrer Mannschaft gehörte, schien ihr Urteil über ihn verzerrt zu haben.7 Im Rückblick auf die vorangegangenen fünf Jahre stellten sie fest, dass sie ihre eigenen Spieler systematisch überbewertet hatten, wenn ein anderes Team einen Tausch angeboten hatte. Vor allem schlugen sie attraktive Angebote aus, Profis gegen gute Positionen im Draft-Pick zu tauschen. Warum? Das war nicht bewusst passiert.
So lernte Morey etwas kennen, das Verhaltensökonomen als Endowment- oder Besitztumseffekt bezeichnen. Um diesen auszuschalten, zwang er seine Talentsucher und sein Modell, vor dem Auswahlverfahren den Wert der eigenen Spieler zu ermitteln.
Im Jahr darauf trat Morey vor seine Mitarbeiter und schrieb sämtliche Denkfehler, die ihr Urteil verzerren konnten, an eine Tafel: Besitztumseffekt, Bestätigungsfehler und viele andere. Eine dieser Verzerrungen war zum Beispiel der »present bias«, also die Tendenz, bei einer Entscheidung der Gegenwart größeren Wert beizumessen als der Zukunft. Ein anderer war der Rückschaufehler: die Neigung, ein Ergebnis zu sehen und zu glauben, es sei von Anfang an absehbar gewesen. Das Modell war ein Gegengift gegen die Irrungen des menschlichen Urteils, aber spätestens ab 2012 schien es den Rockets keinen Informationsvorsprung mehr zu verschaffen. »Jedes Jahr sprechen wir darüber, was wir rein- und rausnehmen wollen«, sagt Morey. »Und jedes Jahr wird es ein bisschen deprimierender.«
Die Zusammenstellung von Basketballmannschaften sah ganz anders aus, als er sich in seiner Kindheit ausgemalt hatte. Es war so, als sollte er einen teuflisch komplizierten Wecker auseinandernehmen und reparieren, nur um dann herauszufinden, dass sich ein entscheidendes Rädchen des Weckers in seinem eigenen Kopf befand.
Morey und seine Mitarbeiter hatten schon einige große Männer gesehen. Aber selbst ihnen verschlug es beim Anblick des Inders, der im Winter 2015 ihren Konferenzraum betrat, den Atem. Er trug nur eine Trainingshose und ein grünes T-Shirt, und um seinen Hals baumelten ein paar Hundemarken. Aber dieser Hals war – genau wie seine Hände, seine Füße, sein Kopf und sogar seine Ohren – so riesig, dass der Blick unwillkürlich von einem Körperteil zum anderen sprang und man sich fragte, ob es vielleicht für das Guinness-Buch taugte. Die Rockets hatten einmal einen 2,29 Meter großen Chinesen namens Yao Ming im Kader gehabt, der mit seinen Ausmaßen die sonderbarsten Reaktionen provozierte. Menschen, die ihn sahen, liefen davon, lachten oder brachen in Tränen aus. Vom Scheitel bis zur Sohle maß der Inder ein paar Zentimeter weniger als Yao Ming, doch in jeder anderen Hinsicht war er größer. Nachdem Morey seine Körpermaße gesehen und sich gefragt hatte, wie jemand nur so groß werden kann, bat er seine Mitarbeiter, die Geburtsurkunde des Riesen aufzutreiben. Dessen Agent behauptete, in seinem Heimatdorf gebe es keine Geburtsurkunden. Darauf erinnerte sich Morey an eine Warnung von Dikembe Mutombo, dem kongolesischen Verteidiger der Rockets: »Wenn ein ausländischer Riese auftaucht und behauptet, er sei viel jünger, als er aussieht, dann schneidet ihm das Bein auf und zählt die Jahresringe.«
Der indische Hüne hieß Satnam Singh. Wenn man einmal von seiner Größe absah, wirkte er jung. In Gegenwart anderer zeigte er die Unsicherheit eines pubertierenden Jugendlichen, der weit von zu Hause entfernt ist. Er lächelte nervös und ließ sich in einen Stuhl am Kopfende des Tischs hinab.
»Alles okay?«, fragte der Gesprächsleiter.
»Ja, alles okay, alles okay.« Das war keine Stimme, sondern ein Nebelhorn, und so kehlig, dass man eine Weile überlegen musste, was er gesagt hatte.
»Wir würden dich gern ein bisschen besser kennenlernen«, begann der Gesprächsleiter. »Erzähl uns ein bisschen von deinem Agenten, und warum du ihn ausgewählt hast.«
Satnam Singh stammelte nervös einige Minuten lang vor sich hin. Es war nicht klar, ob irgendeiner der Anwesenden ihm folgen konnte. Es schien darauf hinauszulaufen, dass er seit seinem vierzehnten Lebensjahr von Leuten betreut wurde, die ihm eine große Zukunft im Basketball vorhersagten.
»Woher kommst du und wer ist deine Familie?«, wollte der Gesprächsleiter wissen.
Sein Vater arbeitete auf einem Bauernhof, seine Mutter war Köchin. »Ich komme hierher, ich spreche kein Englisch«, sagte er. »Ich kann mit niemandem sprechen. Es war schwer. Nichts. Null.« Während er die unglaubliche Geschichte seiner Reise von einem indischen Achthundert-Seelen-Dorf ins Büro der Rockets erzählte, suchten seine Augen die Zustimmung seiner Zuhörer. Die Manager hatten ihr Pokergesicht aufgesetzt. Sie waren nicht unfreundlich, aber sie wollten sich auch auf nichts festlegen lassen.
»Was würdest du als deine Stärken bezeichnen?«, fragte der Gesprächsleiter. »Was kannst du besonders gut?«
Der Gesprächsleiter folgte einem Drehbuch. Singhs Antworten wurden in die Datenbank eingespeist, mit den Aussagen Tausender anderer Spieler verglichen und auf Muster durchsucht. Sie hatten die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie eines Tages den Charakter messen konnten oder zumindest ein Gefühl dafür bekamen, wie sich so ein armer Knabe verhalten würde, nachdem er ein paar Millionen Dollar und einen Platz auf der Bank bekommen hatte. Würde er weiter hart trainieren? Würde er auf die Trainer hören?
Morey hatte noch niemanden kennengelernt, der ihm diese Fragen beantworten konnte, auch wenn zahllose Psychologen das von sich behaupteten. Die Rockets hatten selbst einige davon beschäftigt. »Es ist schrecklich«, meint Morey. »Eine schlimme Erfahrung. Jedes Jahr denke ich, da muss doch etwas sein. Jedes Jahr finden wir jemanden mit einem neuen Ansatz. Jedes Jahr ist es völlig sinnlos. Aber jedes Jahr spielen wir dasselbe Spiel. Ich habe langsam den Eindruck, die Psychologen sind alle Scharlatane.« Der letzte Psychologe, der von sich behauptet hatte, das Verhalten der Nachwuchsspieler vorhersagen zu können, hatte eine Variante des Myers-Briggs-Persönlichkeitstests verwendet und versucht, Morey im Nachhinein zu überzeugen, dass er damit alle möglichen unsichtbaren Gefahren abgewendet habe. Daryl Morey erinnerte das Ganze an einen Witz, den er einmal gehört hatte. »Läuft ein Typ mit einer Banane im Ohr durch die Gegend. Die Leute fragen ihn: Warum hast du eine Banane im Ohr? Und er antwortet: Um die Krokodile fernzuhalten. Seht ihr, nirgends Krokodile! Es funktioniert!«
Der indische Riese erklärte, seine Stärken seien Stellungsspiel und Würfe aus der mittleren Distanz.
»Hast du bei IMG Mannschaftsregeln gebrochen?«, fragte der Gesprächsleiter.
Singh war verwirrt. Er verstand die Frage nicht.
»Keine Probleme mit der Polizei?«, erklärte Morey.
»Keine Schlägereien?«, ergänzte der Gesprächsleiter.
Singhs Miene hellte sich auf. »Nie!« rief er aus. »Nie im Leben. Ich habe es nie probiert. Wenn ich es probiere, dann stirbt jemand.«
Die Manager hatten Singhs Körper in Augenschein genommen. Einer konnte schließlich nicht mehr an sich halten. »Warst du immer schon so groß?«, fragte er und verließ das Drehbuch. »Oder wann hast du angefangen, schneller zu wachsen?«
Singh erklärte, mit acht sei er 1,75 Meter groß gewesen und mit fünfzehn 2,16 Meter. Es liege in der Familie. Seine Oma messe 2,05 Meter …
Unruhig rutschte Morey auf seinem Stuhl hin und her. Er wollte wieder zu den Fragen zurückkommen, die ihm bei seiner Prognose weiterhalfen. Er fragte: »Wo hast du dich am meisten verbessert? Was kannst du heute gut, was du vor zwei Jahren noch nicht so gut gekonnt hast?«
»Ich glaube vor allem im Denken. Im Kopf.«
»Entschuldigung. Ich meine im Basketball. Auf dem Spielfeld.«
»Stellungsspiel«, erwiderte er und murmelte noch ein paar unverständliche Sachen.
»Mit welchem Basketballprofi würdest du dich am ehesten vergleichen? Von der Spielweise her?«, fragte Morey.
»Jowman und Schkinoonee«, antwortete Singh wie aus der Pistole geschossen.
Schweigen. Dann dämmerte es Morey. »Ach so, Yao Ming.« Er machte eine Pause. »Und der andere?«
»Schkinoonee.«
Jemand riet. »Shaq?«
»Shaq, ja«, sagte Singh erleichtert.
»Ach so, Shaquille O’Neal!« Nun hatte es Morey auch kapiert.
»Ja, gleicher Körper, gleiches Stellungsspiel«, erklärte Singh. Die meisten Spieler verglichen sich mit Profis, denen sie ähnlich sahen. Andererseits gab es keinen amerikanischen Profi, der so aussah wie Satnam Singh. Wenn er es schaffen sollte, wäre er der erste Inder der Liga.
»Was hast du da um den Hals?«, fragte Morey.
Singh schnappte seine Hundemarken und starrte hinunter auf seine Brust. »Das ist mein Name«, antwortete er und nahm eine in die Hand. Dann nahm er die zweite und las vor: »Ich vermisse meinen Trainer. Ich liebe Basketball. Basketball ist mein Leben.«
Dass er eine Hundemarke brauchte, um sich das ins Gedächtnis zu rufen, war vielleicht nicht das allerbeste Zeichen. Viele dieser großen Jungs spielten nur, weil sie groß waren. Vor langer Zeit waren sie von einem Trainer oder Vater aufs Spielfeld gezerrt worden und aus sozialem Druck dort geblieben. Sie arbeiteten in der Regel weniger an sich als die kleineren Spieler und schienen eher bereit, das Geld der Clubs einzustecken und dann nichts mehr zu tun. Sie waren keine Betrüger. Sie gehörten nur zu der Sorte von großen Kindern, die ihr Leben lang Basketball gespielt hatten, um jemand anderen zufrieden zu stellen, und hatten so viel Übung darin, anderen nach dem Mund zu reden, dass sie nicht wussten, was sie selbst wollten.
Irgendwann ging Singh. »Haben wir Beweise gefunden, dass er irgendwo in einer Mannschaft gespielt hat?«, fragte Morey, sobald er draußen war. Das Bauchgefühl konnte man nach einem Vorstellungsgespräch nicht abstellen, aber man konnte es mithilfe der Daten in den Griff bekommen. (Oder doch nicht?)
»Er hat angeblich bei der IMG Academy in Florida gespielt.«
»Ich hasse diese Glücksspiele«, seufzte Morey. Er hatte dreißig Minuten von Singhs Probetraining gesehen, aber er hatte seine Entscheidung gefällt. Es gab keine Daten über Singh, und ohne Daten gab es nichts, was man hätte auswerten können. Der Inder war ein weiterer DeAndre Jordan. Wie die meisten Fragen, die sich einem im Leben stellten, war er ein Rätsel – ein Puzzle, dem einige Teile fehlten. Die Houston Rockets entschieden sich, ihn nicht zu verpflichten, und staunten, dass die Dallas Mavericks ihn unter Vertrag nahmen. Aber man weiß ja nie.8
Aber genau das war ja das Problem: Man wusste es nie. In den zehn Jahren, in denen Morey nach seinem statistischen Modell die Mannschaft der Houstons Rockets einkaufte, hatten sich seine Spieler besser entwickelt als drei Viertel der Spieler der anderen Mannschaften. Sein Ansatz war immerhin so gut, dass andere Clubs ihn übernommen hatten. Er konnte sogar den Moment benennen, als er zum ersten Mal bemerkte, dass man ihn kopiert hatte. Das war beim Draft 2012, als die Spieler fast in derselben Reihenfolge ausgewählt wurden, in der die Rockets sie platziert hatten. »Die sind einfach unsere Liste durchgegangen. Die ganze Liga hat die Sache genauso gesehen wie wir.«
Trotzdem konnte Leslie Alexander, der 2006 als einziger Eigentümer den Schneid gehabt hatte, jemanden wie Morey einzustellen, an den Wahrscheinlichkeitsrechnungen verzweifeln. »Er verlangt Gewissheit von mir, und ich muss ihm sagen, dass ich ihm die nicht geben kann.« Er hatte der Croupier am Blackjack-Tisch des Kasinos sein wollen, der die Karten verteilt, aber er konnte diesem Vergleich nur bis zu einem bestimmten Punkt gerecht werden. Wie der Croupier spielte er ein Glücksspiel, und wie dieser hatte er die Wahrscheinlichkeiten ein wenig zu seinen Gunsten verschoben. Aber anders als der Croupier hatte er nur sehr wenige Runden zu spielen. Pro Jahr verpflichtet er nur eine Handvoll Spieler; bei einer derart kleinen Probe konnte alles passieren, selbst wenn er einen kleinen Vorteil besaß.
Manchmal dachte Morey darüber nach, wie es möglich gewesen war, dass jemand ihm, einem völligen Außenseiter, der seinem Arbeitgeber einen kleinen Vorteil versprechen konnte, eine professionelle Basketballmannschaft anvertraut hatte. Er hatte nicht selbst reich werden müssen, um sich eine eigene Mannschaft zu kaufen. Er hatte sich nicht einmal verändern müssen. Die Welt hatte sich verändert, um Platz für ihn zu machen. Natürlich wurde die Welt auch deshalb gegenüber Moreys Ansatz aufgeschlossener, weil immer leistungsstärkere Computer zur Verfügung standen. Gleichzeitig war eine neue Klasse von Mannschaftseigentümern herangewachsen: »Die Eigentümer verdienen ihr Geld oft, indem sie Branchen aufknacken, in denen die traditionellen Methoden nicht mehr funktioniert«, erklärt Morey. Diese Leute sind sich bewusst, wie wichtig selbst ein winziger Informationsvorsprung sein kann, und sie sind bereit, sich diesen Vorsprung mit Statistiken zu verschaffen. Das warf jedoch die nächste Frage auf: Warum waren die herkömmlichen Methoden oft so schlecht? Und zwar nicht nur im Sport, sondern überall? Warum warteten so viele Branchen geradezu darauf, aufgeknackt zu werden? Warum gab es so viel, was umzukrempeln war?
Es war sonderbar, dass ein derart hart umkämpfter Markt wie der für hochdotierte Athleten so ineffizient sein sollte. Es war unerklärlich, dass Experten zwar schon lange Basketballstatistiken aufstellten, dass sie aber so lange schlicht die falschen Daten erhoben hatten. Und es war geradezu grotesk, dass ein Außenseiter mit einem ganz neuen System an die Bewertung von Spielern herangehen konnte und plötzlich von der gesamten Branche imitiert wurde.