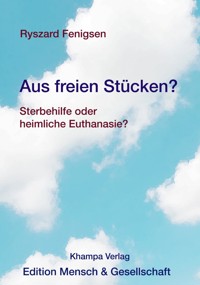
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch beschreibt Ryszard Fenigsen, ein äußerst erfahrener Kliniker, der die letzten 20 Jahre in den Niederlanden als Arzt und Forscher in leitenden Stellungen verbracht und dort sehr sorgfältig die Euthanasiebewegung in ihren verschiedensten Ausprägungen beobachtet hat, die Auswirkungen einer Legalisierung des Tötens durch Ärzte: Auswirkungen auf die ärztliche Praxis, Auswirkungen auf den einzelnen Arzt, aber auch den einzelnen Patienten selbst und auf die vulnerablen Gruppen der Patienten. Schlussendlich aber auch Auswirkungen auf die Gesellschaft als ganze, auf ihre ethische Verfasstheit. Aus all diesen sehr sorgfältig durchgeführten Reflexionen ergibt sich sein Credo für das Leben, für die umfassende medizinische Unterstützung der Leidenden, für palliative Fürsorge, und gegen die Tendenz, problematische oder schwer zu ertragende Lebenssituationen durch Beseitigung des leidenden Subjekts selbst lösen zu wollen – es sich einfach, oder einfach 'billig' machen zu wollen. Dieses Buch besitzt auch in den weiterhin immer wieder in verschiedensten Varianten geführten Debatten über Gesetzesinitiativen in Deutschland Aktualität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ryszard Fenigsen
Aus freien Stücken?
Sterbehilfe oder heimliche Euthanasie?
aus dem Polnischen: Dr. Robert Jaroslawski
Ryszard Fenigsen
Zeichnung von Alicja Fenigsen
Impressum
Autor: Ryszard Fenigsen
Titel der polnischen Originalausgabe: Eutanazja: Śmierć z wyboru?,
erschienen 1997 bei Wydawnictwo W drodze, Poznań
Übersetzung aus dem Polnischen:
Dr. Robert Jaroslawski
Einzig vom Verfasser autorisierte Übersetzung
Alle Rechte Vorbehalten
Zweite, durchgesehene Auflage
Khampa Verlag • Edition Mensch & Gesellschaft
Freiburg und Eckernförde 2023
© der polnischen Ausgabe von 2001 Ryszard Fenigsen Estate
© der deutschen Erstausgabe
Khampa Verlag 2001/2023
1. Auflage 2001
Druck: Pirwitz Druck & Design, Kiel Kronshagen
ISBN 3-9805251-4-7 (1.Auflage)
Lektorat: Dr. Karin Jaroslawski und Anna Müller-Nilsson
2. durchgesehene Auflage 2023
Umschlag: Robert Jaroslawski
Umschlagbild: Royalty Free Picture von Klaus P. , Pixabay®
Fotobearbeitung: Robert Jaroslawski
Edition Mensch & Gesellschaft
Khampa Verlag Eckernförde-Freiburg
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Einleitende Worte zur deutschen Ausgabe
Geleitwort des Übersetzers
Vorwort des Übersetzers zur 2. deutschen Auflage
Vorwort des Autors zur deutschen Ausgabe
Vorwort des Autors zur polnischen Ausgabe
Der Sozialdarwinismus und die Hügel von Taygetos
Die Einstellung der Sozialdarwinisten
Ärztliche Hilfe ist etwas ganz anderes
Wir müssen alle einmal sterben
Ärztliche Behandlung hilft ohnehin nicht
Ärztliches Wirken ist an sich weder gut noch schlecht
‚Außergewöhnliche‘ bzw. ‚heroische‘ Behandlungsmethoden
Das Leben darf nicht mit künstlichen Mitteln verlängert werden
Die Lebensqualität
Die weltweite zwischenmenschliche Solidarität
Verweigerung von Hilfe
Das Zivilrecht
Das Strafrecht
Die Ethik des ärztlichen Berufes
Ethische Normen
Judeo-christliche Ethik
Kant’sche Ethik
Allgemeine Normen des guten Verhaltens
Das Gleichheitsprinzip
Das Recht auf Verteidigung
Redliches Handeln
Das Handeln im Namen anderer ohne Mandat
Vertrauenswürdiges Handeln
Sozialdarwinistische Medizin und der ärztliche Beruf
Sozialdarwinismus und die Rechte des Patienten
Die Hauptströmung unserer Zivilisation
Was empfindet ein sozialdarwinistischer Arzt?
In Verteidigung der Kranken und Behinderten
Die sozialdarwinistische Mentalität: eine Zusammenfassung
Heimliche Euthanasie – Krypthanasie
Warum betreiben Ärzte unfreiwillige Euthanasie?
Sogar Neugeborene unterliegen der Euthanasie
Die Euthanasie auf Bitte des Kranken
Legalisierung als logische Schlussfolgerung
Ein kritischer Kommentar
Die Abschaffung aller Tabus
Alters- und Pflegeheime
Kranke werden mittels moderner Technik künstlich am Leben erhalten
Menschenunwürdiger Tod
Sinnloses Leiden
Unerträgliche Leiden
Einen Menschen am Leben lassen als Entscheidung
Der Gewissensnotstand: Euthanasie als zwingendes Handeln
Das ‚Selbstbestimmungsrecht‘
Die eigene Bitte des Patienten
Die eigene Bitte des Patienten II
Die Familie des Kranken sollte an der Entscheidung beteiligt werden
Das Handeln des Arztes sollte durch Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt
gekennzeichnet sein
Konsultationen und Vereinbarungen
Nicht reanimieren
Eine abstrakte Diskussion über eine konkrete Sache
Ein Porträt des Euthanasten
Sacrum, Profanum und die Euthanasie
Die Euthanasie und die Medizin
Der Arzt-Euthanast als Beobachtender
Der Arzt-Euthanast als Behandelnder
Euthanasie und die Beziehung zwischen Patient und Arzt
Verachtung
Was wir verlieren werden
Die Euthanasiegesellschaft
Schlussbemerkungen
Anhang
I. Der Bericht der Holländischen Regierungskommission zu
Fragen der Euthanasie
Wie viele Euthanasiefälle gibt es jährlich?
Die unfreiwillige Euthanasie in der Statistik
Andere wichtige Daten
Schlussfolgerungen
II. Ökonomie und Euthanasie
Hat die Ökonomie einen Einfluss auf die Euthanasie in den Niederlanden?
III. Euthanasie bei Kindern
IV. Warum gerade Holland?
V. Wird es die Euthanasie auch in den USA geben?
Anhang zur zweiten polnischen Ausgabe
I. Nicht Euthanasie, sondern ärztliche Beihilfe zum Selbstmord
II. Sachverständigengutachten in der Sache Gary Lee und andere gegen den Staat Oregon und andere, vor dem Bundesgericht des Staates Oregon unter Eid abgelegt
Anhang zur 2. deutschen Auflage – Biografisches über Ryszard Fenigsen
Bibliografie
Einleitende Worte zur deutschen Ausgabe
Inhaltsverzeichnis
von Prof. Dr. med. Klaus Jork
In den letzten Jahren beobachte ich immer häufiger, vor allem in Großstädten, Diskussionsgruppen über passive und aktive Sterbehilfe sowie Euthanasie. Sozialinstitute, Hospizgruppen, Vertreter ärztlicher und nicht-ärztlicher Berufe scheinen verunsichert in ihrer Einschätzung und Stellungnahme: Soll eine freiwillige Sterbehilfe erlaubt sein? Und wenn ja: Welches sind ihre Regeln und Grenzen?
Zwei Gefahren stellen die „alte Ethik“ der Achtung vor dem Leben in Frage. Zum einen ist es die praktische Gefahr durch die Fortschritte der Medizin, die auf Fragen Antworten geben muss, wie: Wann gilt ein Mensch als tot? Und: Müssen schwerstbehinderte Säuglinge wirklich weiterleben? Die andere Gefahr besteht darin, dass der moderne Mensch die Fragen nach der religiösen und philosophischen Begründung der „alten Ethik“ neu beantworten muss: Sind biblische Sätze noch gültig, wenn wir statt an eine göttliche Schöpfung eher an darwinistische Ursprünge von uns glauben?
Als Moderator und Referent, sowohl als Arzt seit mehr als 30 Jahren in eigener Hausarztpraxis als auch als Dozent am Universitätsklinikum in Frankfurt tätig, ist mir die Thematik aus unterschiedlichen Gesichtspunkten vertraut. Deswegen schätze ich die Redlichkeit und die Genauigkeit, mit welcher der Autor des vorliegenden Buches das Material gesammelt und die Aufarbeitung nach logischen, philosophischen, juristischen und religiös-ethischen Kriterien durchgeführt hat. Er weckt Nachdenklichkeit und liefert Argumente zur Beantwortung der Frage: Wie würde ich mich selbst verhalten, wenn an mich die Frage der aktiven Beendigung von Leben gestellt würde, bei einem Familienangehörigen, einem Freund oder Patienten?
Letzten Endes ist jeder Leser, jeder, der sich mit dieser Thematik beschäftigt, auch ein potentiell Betroffener, denn niemand hat Gewissheit über den Fortgang und das Ende seines derzeitigen Daseins. Diese Überlegungen bilden auch für mich den Hintergrund bei den verschiedensten Gesprächen im Für und Wider, um Lebensqualität und vermeidbares Leiden, passive Sterbehilfe und unterlassene Hilfeleistung. Im Lauf dieser Diskussionen orientiere ich mein eigenes Entscheiden und Handeln zunehmend an folgenden Thesen:
Jedes Leben ist achtenswert, auch wenn es noch so unscheinbar wirken mag.
Der Hippokratische Eid, nicht selten zum Klischee geworden oder als weltfremd abgetan, wurde für mich zu Beginn des Studiums an der Humboldt-Universität in Berlin die Grundlage einer traditionsbezogenen Orientierung für ärztliches Handeln in einer damals diktatorischen und menschenverachtenden Gesellschaftsform.
Als junger Arzt besuchte ich eine 82-jährige, aber sonst noch rüstige Bäuerin, die an einer Pneumonie erkrankt war. Ich verordnete ihr Antibiotika. Schon am nächsten Tag ging es ihr wesentlich besser. In den Gesichtern der umstehenden Verwandten sah ich aber Unzufriedenheit und Enttäuschung. Dann erklärte mir jemand, dass man erwartet habe, dass die Bäuerin jetzt stirbt – man hatte das Erbe schon unter sich aufgeteilt. Noch wenig mit der Alltagswirklichkeit vertraut, erfüllte mich das Erlebnis damals mit Entsetzen.
Leben kann Sinn haben, auch wenn sich dieser im Leiden nicht unmittelbar erkennen lässt.
Zweifeln lässt mich manchmal eine inzwischen 82-jährige Patientin in einem Pflegeheim. Seit Jahren an einem Leiden des Nervensystems gelähmt und von Kontrakturen gepeinigt, kann sie weder lesen noch schreiben oder sich selbständig fortbewegen. „Geben Sie mir doch die Spritz’“ ist wiederholt ihre stereotype Aufforderung an mich. Schon manches Gespräch ließ den Zweifel bei ihr selbst deutlich werden. Anlässlich einer Pneumonie stellt sie die Frage: „Muss ich jetzt sterben?“
Ein älterer Kollege, der mir als junger Arzt in verschiedenen Situationen Vorbild war, erlitt einen Schlaganfall. Anlässlich einer Ehrung traf ich ihn nach längerer Zeit wieder. Er sagte: „Als ich gesund war, wollte ich nach einem Schlaganfall lieber sterben. Heute hänge ich am Leben, obwohl ich allein kaum noch laufen kann.“ Dieses Erlebnis ließ mich über die Relativität des Begriffs „Lebensqualität“ und selbst getroffene Entscheidungen nachdenken: Was ich heute für mich als gültig akzeptiere, kann unter anderen Umständen zu einem völlig anderen Urteil oder einer anderen Einstellung führen. Oder: Lebensqualität kann für den Augenblick nur der beurteilen, der selbst betroffen ist.
Nächstenliebe und Mitgefühl können Leiden lindern.
Ein 56-jähriger Angestellter, der mit einem Bronchial-Karzinom über Monate chemotherapeutisch und mit Bestrahlungen behandelt wird und trotzdem die ständige Verschlechterung seines Gesundheitszustandes unter Schmerzen erlebt, erbittet von mir ein Rezept über eine tödliche Dosis von Barbituraten. Ob er mit seiner Frau über diese Absicht gesprochen habe? Nein, natürlich nicht – die darf nichts davon wissen. Er hat nur den ersten Schritt seines geplanten Handelns bedacht, aber nicht die Folgen. Verärgert wegen der verweigerten „Hilfe“ bricht er den Kontakt zu mir ab. Er kann nicht einsehen: Er möchte die Freiheit haben zu gehen und beschneidet damit die Freiheit anderer.
Begleiten statt töten stellt die Bezugspersonen vor die Aufgabe, die Belastung der Pflege von Schwerkranken und Sterbenden anzunehmen.
Ein 84-jährige halbseitig gelähmte, übergewichtige Patientin, die nach einem Schlaganfall nicht mehr sprechen und schlucken kann, bekommt im Krankenhaus eine Ernährungssonde gelegt. Sie ist voll pflegebedürftig, kann nicht sitzen oder kommunizieren und muss laufend umgelagert werden, um einen Dekubitus zu vermeiden.
Das Pflegepersonal im Altenheim nimmt sich dieser Aufgabe mit Hingabe und Zuwendung an. Nicht selten diskutieren wir über die Kranke, deren Pflege monatlich mehr als DM 5.000,– kostet. Wo könnten diese Mittel überall eingesetzt werden? Wie möchte ich selbst behandelt werden, wenn ich mich in einem ähnlichen Zustand befinde?
Die Patientenbeispiele mögen widersprüchlich erscheinen zu den formulierten Thesen. Sie sollen verdeutlichen, dass ethisches Verhalten rational „sinnlos“ erscheinen mag und dass wir in einem Spannungsfeld leben. Gefühl ohne Verstand ist Chaos, aber Vernunft ohne Gefühl ist Diktatur.
Wirklichkeit und Wahrheit hängen immer ab vom Gesichtspunkt des Betrachters und von den Kriterien, an denen er sich orientiert. Beim Nachdenken über Euthanasie, aktive und passive Sterbehilfe wird dies besonders deutlich. Eine allgemeine, objektive Lösung dazu kann es nicht geben, wo individuelle Betroffenheit herrscht.
Die wenigen Fälle sind eine Bestätigung der möglichen Vielzahl von Situationen in der Frage um Leben und Sterben. Wir Ärzte werden zum Helfen, zum Handeln aus- und weitergebildet. Wir lernen nicht, die Spannung des Nicht-Handelns auszuhalten und mit ihr umzugehen. Wir lernen auch nicht, den natürlichen Vorgang des Ab-Lebens zu erkennen, ihn anzunehmen und den Patienten in diesem Abschnitt zu begleiten. Dazu wäre die Einsicht nötig, dass wir Ärzte für solche Situationen keine nur rationalen Lösungen haben. Wir müssten bereit sein, Partnerschaft zu erlernen und zu üben, diese wird aber in der klinischen Ausbildung und der gebietsbezogenen Weiterbildung nicht gelehrt. Stattdessen erlernen wir immer neue Techniken, wie man dem Tod ausweichen kann. Wenn er dann eines Tages doch unvermeidlich vor der Tür steht, empfinden wir Ärzte diese Situation nicht selten als ein persönliches Versagen.
Peter Singer fordert als Orientierungshilfe bei medizinischen Entscheidungen die Einführung einer „social policy“, die in offener Diskussion auch den fadenscheinigen Unterschied zwischen Tun und Unterlassen offenlegt, im medizinischen Alltag aber Schuldgefühle mindert. Sicherlich ist es notwendig, den Hirntod als medizinische und naturwissenschaftliche Tatsache zu akzeptieren, entschieden werden aber muss ethisch. Denn Teste geben keinen Aufschluss über alle Hirnfunktionen, andererseits aber könnten Herztransplantationen sonst nicht durchgeführt werden. Singer fordert die Bildung von Gremien, denn die Entscheidung eines Landes könne nicht unmittelbar auf ein anderes übertragen werden.
Dies hat Ryszard Fenigsen in aller Eindrücklichkeit für Holland dargestellt.
Auch wenn man dem Patienten Wahlmöglichkeiten unter verschiedenen Voraussetzungen lässt, dann entscheidet er aus seiner momentanen Sicht in der augenblicklichen Situation. Die Dynamik des Lebens und der zu einem anderen Zeitpunkt veränderten Sichtweisen werden nicht berücksichtigt. Doch gerade das von mir erlebte Patientenbeispiel des älteren Kollegen belegt die Bedenklichkeit eines solchen Vorgehens: Freiwillige Euthanasie ist in sich widersprüchlich.
Handlungsorientierung bleiben deswegen für mich die oben zitierten Thesen. In einer Diskussion formulierte der Ethiker Albrecht Ritschl: „Wenn es also so wäre, wenn wir in diesem Jahrhundert gelernt hätten, dass Zärtlichkeit besser als Beherrschung, Liebe besser als Zerstörung, Kommunikation besser als Schweigen ist, so hätten wir die ersten Fixpunkte für ethische Theorien erfasst.“
Das vorliegende Werk von Ryszard Fenigsen ist geprägt von humanistischem Engagement und dem Unbehagen, differenzierte Zusammenhänge des Lebens und seines Endes durch Gesetze zu regeln, welche die Umgehung ethischer Orientierung ermöglichen. Die verschiedenen individuellen, ärztlichen und sozialen Aspekte der Euthanasie und Krypthanasie sind durch Beispiele und Literatur umfassend belegt. Jedem Informationssuchenden und Zweifler zu Fragen über eine aktive Beendigung des Lebens kann der vorliegende Band eine wichtige und wertvolle Entscheidungshilfe sein.
Prof. Dr. med. Klaus Jork, Frankfurt, Neujahr 2001
Geleitwort des Übersetzers
Inhaltsverzeichnis
Vor vielen Jahren hatte sich der Autor dieses Buches viel Zeit genommen, um mit mir die verschiedensten Argumente zugunsten der freiwilligen Euthanasie1 – oft als Sterbehilfe bezeichnet – durchzugehen und ihre Fragwürdigkeit offenzulegen. Ich bin ihm zu großem Dank verpflichtet, denn er half mir, mit vielen leichtfertigen und nur halb durchdachten Vorstellungen über Leiden und dessen Beendigung aufzuräumen und größeren Respekt vor allen Lebensformen zu entwickeln – auch solchen, die bei oberflächlicher Betrachtung nicht die erwünschte „Lebensqualität“ bieten, wie sie heutzutage oft für unerlässlich betrachtet wird, damit das Leben lebenswert erscheint.
Ich hoffe, dem Autor durch meine Arbeit an dieser Übersetzung wenigstens etwas zurückgeben zu können, und natürlich auch, dass dieses Buch anderen helfen wird, so manche unhinterfragten Annahmen über Leiden und Hilfe aus einer neuen Perspektive anzuschauen.
Zu dem Buch als solchem gibt es meinerseits nicht viel hinzuzufügen, denn es spricht für sich; dennoch will ich darauf hinweisen, dass es aus meiner Sicht eine einzigartige Position in dem Spektrum der Literatur zur Euthanasie einnimmt – was sicherlich dem Mut des Autors zuzuschreiben ist, in dem Zeitalter der Polarität von sachlichen, von ‚Wissenschaftlichkeit‘ (oder was man dafür hält) getragenen Debatten auf der einen und von Irrationalität auf der anderen Seite ein Buch zu schreiben, das zwar sicherlich auch als sehr sachlich und wissenschaftlich gut begründet bezeichnet werden kann, das zugleich aber auch ein von tiefer Menschlichkeit getragenes Manifest für das Leben ist.
Robert Jaroslawski, Sölden, d. 02. September 2023
Vorwort des Übersetzers zur 2. deutschen Auflage
Inhaltsverzeichnis
Vor mehr als 35 Jahren hat mir Ryszard Fenigsen, der Autor des vorliegenden Buches, in einem langen persönlichen Gespräch seine Haltung zur sog. Sterbehilfe detailliert dargelegt. Ich habe ihm mit einem offenen Geist zugehört und konnte nicht umhin, viele meiner naiven Vorstellung und Fantasien zu diesem Thema zu revidieren. Vielleicht wird es auch Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, so gehen?
Es sind seit dem Erscheinen der Erstauflage der deutschen Übersetzung dieses wichtigen Buches mehr als 20 Jahre vergangen. Hätten Sie sich, wie in einem Science-Fiction-Film, in einen Kryoschlaf versetzen und heute wieder aufwecken lassen – Sie würden die Welt nicht wieder erkennen. Nicht nur tobt im Herzen Europas ein brutaler Krieg, der alle Fragen der Weiterentwicklung der Medizin als kleine Probleme erscheinen lässt; ein Krieg , der mit der unterschwelligen Drohung verbunden ist, auf weitere Länder überzuspringen und zu eskalieren (etwas, das sich die Generation meiner Eltern, die den Irrsinn des 2. Weltkrieges am eigenen Leib erlebt hatte, nicht im Entferntesten hatte vorstellen können). Auch das Thema des Tötens von Kranken wird wieder auf eine Weise diskutiert, die für jene, die den Tötungswahn der Nationalsozialisten noch aus eigener Erfahrung kannten, so frei und von ethischen Bedenken unbelastet nicht geführt werden konnte.
Diese heutige Unbefangenheit hat durchaus praktische Konsequenzen, hier und im Ausland. Neben den Niederlanden hat auch Belgien inzwischen, ein Jahr nach dem Erscheinen des vorliegenden Buches, ein Gesetz zur Sterbehilfe verabschiedet (Wet betreffende de euthanasie; Loi relative à l’euthanasie). Das Belgische Gesetz scheint sogar noch weiterzugehen als das in den Niederlanden. In Oregon ist der assistierte Suizid2, der seinerzeit unter aktiver Mitwirkung des Verfassers zu Fall gebracht wurde (davon ist einiges im Buch zu lesen) nun doch legalisiert worden. Und auch in Deutschland werden, inspiriert durch die Entwicklung bei unseren europäischen Nachbarn, die Forderungen nach gesetzlichen Regelungen der ‚Sterbehilfe‘ lauter und die ethischen Bedenken bei nicht unbeträchtlich großen Gruppen in der Bevölkerung geringer.
Um so wichtiger ist es, diesen ganzen Fragenkomplex mit einem klar formulierten ethischen Kompass, jedoch ohne polarisierende Polemik von allen Seiten auszuleuchten. Der Verlag hofft, mit der Neuauflage dieses Buches einen Beitrag dazu zu leisten – eines exzellenten Buches aus der Feder eines Kenners der Problematik, des zeitlebens leidenschaftlich für seine Patienten eintretenden Arztes, Ryszard Fenigsen.3
Eine zweite Auflage ist nicht zuletzt auch deswegen notwendig geworden, weil der Übersetzer den Titel der ersten Auflage direkt aus dem Polnischen übernommen hatte – in Verkennung der Missverstehbarkeit, und damit der abschreckenden Wirkung auf gerade jene Leserinnen und Leser, die mit dem Inhalt vermutlich ganz und gar einverstanden gewesen wären. Dies gibt mir als Übersetzer andererseits auch die Gelegenheit, den Text noch einmal durchzusehen und eventuelle Korrekturen anzubringen.
Wie steht es aber um die Aktualität des Buches? Würde der Autor noch leben, hätte er sicherlich selbst über die inzwischen eingetretenen Veränderungen der gesetzlichen Sachlage und in der tatsächlichen Praxis der verschiedenen Länder aktualisierte Informationen. So, wie die Dinge aber stehen, muss dies ein Projekt für jüngere engagierte Forscher und Autoren bleiben.
In seinem Kern bleibt das Buch jedoch so aktuell, wie es am ersten Tage nach seiner Veröffentlichung war. An den ethischen Grundfragen hat sich nichts geändert, und die Antworten, die der Verfasser auf diese Grundfragen gibt, verlieren auch durch die Veränderungen in der heutigen Situation nichts an Aktualität.
Es ist mir auch wichtig zu betonen, dass der Autor nicht mit abstrakten Maximen über die individuell erfahrene Not der Betroffenen hinweggeht. Er setzt sich vielmehr mit den Folgen auseinander, – für den einzelnen Menschen und für die Gesellschaft als ganze –, die eintreten können und eintreten werden, wenn wir versuchen, pauschale Lösungen zu installieren. Die tiefe menschliche Haltung des Verfassers und seine fachliche Kompetenz kann heute wie gestern als Kompass für unsere eigenen Reflexionen zu diesem Themenkreis dienen.
Robert Jaroslawski, der Übersetzer, Sölden 17. September 2023
Vorwort des Autors zur deutschen Ausgabe
Inhaltsverzeichnis
Der Streit um die Euthanasie wird in Nordamerika, Australien, Südafrika und im ganzen nordwestlichen Europa geführt. Der Gegenstand der Diskussion ist nicht nur die Euthanasie auf Bitte des Kranken oder die Frage der Zulässigkeit von Beihilfe zur Selbsttötung, gestritten wird auch um die Euthanasie ohne Einverständnis des Kranken, die bei Neugeborenen, bei körperlich oder geistig behinderten Kindern, bei Menschen im Koma und bei psychiatrischen Patienten angewandt wird. Es geht hier also um einen Streit über die Zukunft unserer Zivilisation!
Ich bin dem Übersetzer Herrn Dr. Robert Jaroslawski und dem Khampa-Verlag dankbar dafür, dass sie es ermöglichen, dieses Büchlein den Lesern des deutschen Sprachraumes zugänglich zu machen, Menschen, die für die künftigen Geschicke Europas von so großer Bedeutung sind.
Während der Jahre, die seit der letzten (polnischen) Ausgabe verflossen sind, haben einige beachtenswerte Ereignisse stattgefunden:
Das Gesetz, das die Euthanasie zuließ und das mit fünfzehn gegen zehn Stimmen durch die gesetzgebende Versammlung des Nördlichen Territoriums beschlossen wurde, wurde im März 1997 vom Parlament der Australischen Föderation für nichtig erklärt. In der kurzen Zeit, in der das Gesetz gültig war, tötete der dortige Verfechter der Euthanasie, Dr. Nitschke, vier Menschen.
Am 28. November 2000 verabschiedete das Unterhaus des Holländischen Parlaments (Tweede Kamer) mit hundertvier gegen vierzig Stimmen ein Gesetz über die Euthanasie. Gegen das Gesetz stimmte die Fraktion der Christdemokraten (CDA) und die Abgeordneten kleiner protestantischer Parteien. Im April 2001 wurde dieses Gesetz durch das Oberhaus bestätigt.
Das Gesetz bestätigt die „Regeln sorgfältigen Handelns“, die zuvor von den Gerichten, der Königlichen Medizinischen Gesellschaft (KNMG) und durch einen Parlamentsbeschluss von 1994 festgelegt worden waren. Demnach darf die Euthanasie nur ausgeführt werden auf die eigene, entschiedene Bitte des Kranken, der angemessen informiert worden sein muss, die eigenen Leiden nicht ertragen und keine Hoffnung auf Besserung hegen kann. Der Arzt soll einen anderen Kollegen konsultieren, ein schriftliches Protokoll anfertigen und nach der Ausführung der Euthanasie einen Bericht erstatten, der von einem Ethiker, einem Arzt und einem Juristen zu überprüfen sein soll. Gelangt die Kommission dann zur Auffassung, der Arzt habe sich Verfehlungen in Bezug auf die Regeln zuschulden kommen lassen, kann die Sache dem Staatsanwalt übergeben werden.
Die „Regeln sorgfältigen Handelns“ garantieren die Sicherheit des Kranken jedoch nicht, und das nicht nur deswegen, weil sie häufig nicht befolgt werden, sondern weil sie infolge grundlegender Fehler in der Konstruktion dieser Vorschriften mangelhaft sind.
Die Einschätzung der Tat und die Überwachung ihrer Durchführung sind dem Ausführenden selbst überlassen. Es ist der gleiche Arzt, der die Diagnose und die Prognose stellt und den Kranken so informiert, wie er es für richtig hält; er selbst wählt seinen Konsultanten aus, fertigt das Protokoll an und bewahrt es auf, und er selbst verfasst schließlich den Bericht nach eigenem Gutdünken – oder beschließt, die Behörden nicht zu verständigen. Die Verheimlichung der Euthanasie kann nicht strafbar sein, denn nach geltendem Recht hat niemand die Pflicht zur Selbstanklage.
Wenn es also um die Euthanasie geht, erweist die holländische Rechtsprechung – und gegenwärtig auch die Gesetzgebung – dem ärztlichen Stand großes Vertrauen. Ärzte sind jedoch Menschen, und unter ihnen befinden sich – wie in jedem anderen Beruf auch – einzelne, die emotional labil sind oder auf einem unterdurchschnittlichen intellektuellen Niveau stehen. So wurde in Holland eine große Zahl an tragischen Fällen veröffentlicht, an Diagnosefehlern, an unter Druck ausgeführten Euthanasien, an Kranken, die starben, weil der Arzt die Geduld verloren hatte oder das Leben des Kranken beendet hatte, um der Familie eine Erleichterung zu verschaffen. Die holländische Gesellschaft zahlt für das „Recht auf freie Wahl“ und das „Recht auf einen würdigen Tod“ einen hohen Preis. Die letzte Bezeichnung ist übrigens wahrheitswidrig. Der Tod aus der Hand eines bezahlten Experten für das Töten ist ein der Würde im ganz besonderen Maße beraubter Tod.
Der Gesetzesentwurf enthielt auch einen Artikel, der die Euthanasie an Kindern über 12 – auch gegen den Willen der Eltern – zulassen sollte. Dieser Artikel löste eine stürmische Diskussion aus und wurde noch vor der Beratung des Parlaments aus dem Gesetzesentwurf gestrichen. Das aber ändert nichts an der Tatsache, dass, wie die Untersuchungen von H. W. H. Hilhorst und die Aussagen des Onkologen Prof. Voute zeigen, manchmal Euthanasie an Kindern ohne Zustimmung der Eltern vorgenommen wird.
Mir begegnet die Auffassung, dass, weil das neue Gesetz nur die bestehende Praxis festschreibe, es sich dabei um einen Rechtsakt von geringer Bedeutung handele. Doch wird dieses Gesetz die Situation in Holland und den weiteren Lauf der Ereignisse beeinflussen. Für die Verfechter und insbesondere die Praktiker der Euthanasie stellt es eine moralische und rechtliche Unterstützung dar, die sie dringend brauchen (viele von ihnen haben öffentlich bekannt, von Zweifeln und Skrupeln geplagt zu werden). Schwerkranke und Schwerbehinderte, die für ihre Familien oder das Pflegepersonal eine Last darstellen, können unter einen größeren Druck geraten als bisher. Die Position des Arztes, der die Euthanasie verweigert, wird erschüttert: Er wird sich gegenwärtig nicht mehr auf ein Rechtsverbot berufen können. Die Ärzte, die die Euthanasie ablehnen, befinden sich jetzt schon bei der Ausübung ihres Berufes in Schwierigkeiten: Sie werden ungerne in Gemeinschaftspraxen zugelassen, man verweigert ihnen manchmal die Einstellung auf Weiterbildungstellen in Krankenhäusern oder die Teilnahme an Fortbildungskursen nach dem Diplom. Dieser Druck der Mehrheit, welche jede Opposition als Bedrohung empfindet, wird, durch das neue Gesetz getragen, stärker werden. Ich fürchte, dass in einigen Jahren ein junger niederländischer Arzt, der die Euthanasie ablehnt, keine Approbation, kein Recht zu praktizieren erhalten wird. Muss er doch den Eid ablegen, „den Beruf des Arztes, Chirurgen oder Geburtshelfers dem geltenden Recht gemäß auszuüben“.
In dem US-amerikanischen Bundesstaat Oregon beschlossen im Jahre 1994 die Wähler mit einer Mehrheit von 51 % ein Gesetz, das den Ärzten die Erlaubnis erteilte, Mittel zur Durchführung von Selbsttötung zu verschreiben. Anfangs wurde dieses Gesetz durch das Bundesgericht als verfassungswidrig eingestuft; dies ist der Gegenstand des vorletzten Anhangs dieses Buches. In einem erneuten Referendum im Jahre 1997 bestätigten jedoch die Wähler von Oregon das Gesetz, diesmal mit einer Mehrheit von 60 %. Im Jahre 1998 verschrieben Ärzte in Oregon 23 Personen tödliche Arzneimitteldosen und 15 Menschen nahmen sich auf diese Weise das Leben. Oregon ist der einzige US-amerikanische Bundesstaat, der den „ärztlich begleiteten Selbstmord“ („physician-assisted suicide“) erlaubt.
Das Gesetz in Oregon steht im Widerspruch zum Bundesrecht, welches bestimmt, dass Medikamente, die einer besonderen Kontrolle unterliegen („federally controlled substances“) ausschließlich zu medizinisch indizierten Zwecken verwendet werden dürfen. Im US-Kongress wurde der Versuch unternommen, diesen gesetzlichen Konflikt zu lösen; die Ergebnisse dieser Initiative sind noch unsicher. Es steht jedoch zu erwarten, dass der neue Bundesminister für Justiz (Attorney General), Sen. Ashcroft, sofern seine Kandidatur bestätigt wird, die Ärzte in Oregon dem Bundesrecht unterstellen wird. Die Unterstützung der Selbsttötung durch Ärzte wäre dann auch in Oregon (rechtlich) nicht mehr möglich.
Im Bundesstaat Michigan hat Dr. Jack Kevorkian, der in neun Jahren bei 130 Personen aktive Beihilfe zur Selbsttötung geleistet hatte, im Herbst des Jahres 1998 einen Schwerkranken getötet, indem er ihm ein herz- und atemlähmendes Mittel einspritzte, ferner diese Tat gefilmt und landesweit im Fernsehen zeigen lassen. Kevorkian, der bislang straffrei ausging, wurde im April 1999 wegen Mordes zu 10-25 Jahren Haft verurteilt.
Dies stellt ein wichtiges Urteil dar, einen Schritt zur Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit. Mehr noch: Kevorkians Verurteilung und die Nichtigkeitserklärung des nordaustralischen Euthanasiegesetzes sind Schritte zur Wiederherstellung natürlicher Prinzipien des menschlichen Zusammenlebens.
Wir müssen eine solche menschliche Gemeinschaft, eine solche Gesellschaft verteidigen und wiederherstellen, die das Leben aller Menschen hoch schätzt und schützt – das Leben der Kranken, Schwachen, Versehrten oder Behinderten so wie das der Starken und Gesunden.
Es bleibt mir nur noch die Gelegenheit zu nutzen, den deutschsprachigen Lesern meine herzlichen Grüße zu übermitteln.
Ryszard Fenigsen, Cambridge, Massachusetts, im Januar 2001
Vorwort des Autors zur polnischen Ausgabe
Inhaltsverzeichnis
Anfang des Jahres 1973 verurteilte ein Gericht in Leeuwarden in den Niederlanden eine Ärztin, die ihre kranke Mutter getötet hatte, zu einer Woche Haft mit Bewährung. „Niemand in diesem Saal zweifelt an der Rechtschaffenheit des Charakters der Angeklagten“, erklärte der Richter. Viele Menschen erklärten ihre Unterstützung für die angeklagte Ärztin, und während der Kampagne zu ihrer Verteidigung entstanden zwei Vereinigungen zur Unterstützung der Euthanasie.
Der Prozess in Leeuwarden beschleunigte jene Veränderungen, in deren Ergebnis Holland zu einem Land wurde, in welchem die Euthanasie offen praktiziert und durch die Gesellschaft bejaht wird.
Als ein Land an der Wegkreuzung aller wichtigen Handelsrouten im Herzen der EG – durch Handel, Tradition und Auswanderer mit einigen Kontinenten verbunden – ist Holland offen für den Austausch von Dienstleistungen, Gütern, Information und Ideen mit der ganzen Welt. Zugleich ist es ein Land, das eifersüchtig und entschlossen über seine Selbstständigkeit und Souveränität wacht. Beschließen die Holländer erst einmal bei sich und für sich etwas, so wird dies auch so getan, mag es dem Rest der Welt nicht gefallen.
Die Welt ist aber keinesfalls generell gegen die Beschlüsse, die Holland in Bezug auf die Frage der Euthanasie gefasst hat; allenfalls ist sie geteilter Meinung. Der Streit um die Euthanasie wird im gesamten Nordwesten Europas, in Nordamerika und in Australien geführt. Beide Seiten in dieser Diskussion berufen sich dabei auf das Beispiel Holland. Die Befürworter der Euthanasie verweisen auf Holland als ein Land, in welchem das Mitgefühl mit menschlichem Leiden Vorrang vor allen veralteten Gesetzen und vor jeglichem Tabu habe; ein Land, in welchem das Recht zu wählen, das Recht des Menschen auf freie Verfügung über das eigene Leben und auf freie Entscheidung über den eigenen Tod endlich anerkannt worden sei. In Holland – so die Anhänger der Euthanasie – werde seit zwanzig Jahren die geregelte, verantwortungsbewusste, humanitäre und wohltätige Euthanasie [1, 2, 3, 4, 5, 6]4 betrieben.
Unterdessen verweisen die Gegner auf Holland als das abschreckende Beispiel, indem sie behaupten, die Euthanasie sei jeder Kontrolle entglitten [7] und werde in enormem Maßstab betrieben, häufiger ohne Einverständnis und Wissen des Patienten als freiwillig [8]; dass ferner die „Regeln sorgfältigen Handelns“ missachtet würden [9), dass von jeder Verantwortung entbundene Ärzte nach „eigenem Gutdünken“ [10] oder aufgrund von Zorn und Ungeduld [11] und überhaupt unter Einfluss von momentanen Stimmungen Patienten töteten. Sie machen geltend, dass die von diesem Bild berauschte und von der Rhetorik der Euthanasiebefürworter trunkene Öffentlichkeit allen Entwicklungen Beifall zollten, während die bedrohten Minderheiten um ihr Leben zitterten: alte Menschen [12], Behinderte [13], Schwerkranke und alle, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Nicht einmal die Familie sei, was sie einmal war, denn die Kranken müssten heute die ihnen am nächsten Stehenden fürchten [14].
Welches Bild ist nun wahr? Genaue Untersuchungen, die im Jahre 1990 im Auftrag der niederländischen Regierung durchgeführt wurden [8], haben diese Frage autoritativ und abschließend entschieden5, aber nur bezüglich der Feststellung von Tatsachen. Der Streit um die Prinzipien wird weiter gehen.
Diese kleine Abhandlung über die Euthanasie schrieb ich in den Jahren 1984-1985, und sie erschien 1987 im Verlag Van Loghum Slaterus unter dem Titel „Euthanasie: een weldaad?“ („Euthanasie: eine Wohltat?“). Dr. Isaac van der Sluis, Dr. Chris J. C. Rutenfrans und Prof. G. A. Lindenboom haben mir viel bei der endgültigen Fassung des Textes geholfen. Noch im Manuskriptstadium erstellte ich eine polnische Fassung der Arbeit, um sie Leszek Kołakowski zur Durchsicht vorlegen zu können; mich beunruhigte nämlich die Frage, ob ich bei meinen philosophischen Betrachtungen auch keine Dummheiten begangen hatte. Leszek Kołakowski bin ich vom Herzen zu Dank verpflichtet für die ermutigenden Worte, die ich damals so dringend brauchte, sowie für alles, was er – zusammen mit Prof. Leon Kass von der Universität von Chicago – für die Erleichterung der Herausgabe meiner Arbeiten in den Vereinigten Staaten tat. In Polen wurde der inzwischen schon verstorbene Roman Zimand auf diese Arbeiten aufmerksam und begriff auf der Stelle, um was der Streit eigentlich geht: „Nicht so sehr darum, wie manche von uns sterben werden, wie vielmehr darum, wie wir alle leben werden“ [15]. Dem freundlichen Interesse der Padres Jacek Salij und Maciej Zięba (Direktor des Verlags „W drodze“ – Auf dem Weg) verdanke ich die Möglichkeit, diese Arbeit auch in polnischer Sprache zu veröffentlichen.
Der polnische Leser wird sicherlich bemerken, dass manche in dieser Arbeit beschriebenen Erscheinungen spezifisch für Holland sind, oder für die westliche Kultur, und dass sie in Polen nicht auftreten. Andere mögen auch in Polen jetzt oder in naher Zukunft anzutreffen sein.
Da seit der Veröffentlichung dieser Arbeit in den Niederlanden fünf Jahre vergangen sind, habe ich kurze Ergänzungen durchgeführt, die den Leser über die Veränderungen informieren sollen, die in den letzten Jahren zum Tragen kamen. Aus dem gleichen Grund fügte ich im Anhang einige meiner in den Jahren 1989-1991 veröffentlichten Publikationen über Euthanasie hinzu.
Ryszard Fenigsen
Kapitel I
Der Sozialdarwinismus und die Hügel von Taygetos6
Inhaltsverzeichnis
Die Diskussion über die Euthanasie hat Unklarheiten hinterlassen, die ich im vorliegenden Buch besprechen werde. Vor allem möchte ich aber die Frage der Euthanasie in einen anderen Zusammenhang stellen als dies bisher geschah. Die bisherige Diskussion befasste sich mit der freiwilligen Euthanasie, überging aber eine damit recht eng verflochtene Erscheinung: die Krypthanasie, d. h. die heimliche Tötung Kranker ohne ihr Einverständnis und Wissen, aber auch den Sozialdarwinismus, jene Weltanschauung, der zufolge die Gesellschaft von ‚schwachen‘ und ‚nutzlosen‘ Individuen befreit werden sollte. Indem man diese zwei Erscheinungen überging, riss man die Euthanasie aus ihrem wahren Hintergrund und Kontext. Die Analyse blieb unvollständig und musste zwangsläufig zu unvollständigen, damit aber auch zu unzutreffenden Vorhersagen führen. Die Notwendigkeit, diese Lücken zu schließen, bewegte mich dazu, die vorliegende Arbeit zu verfassen.
Als die hier zu betrachtende Weltanschauung mit dem Begriff ‚Sozialdarwinismus‘ beschrieben wurde, so geschah dies, wie ich meine, mit Unrecht gegen Darwin, aber auch gegen die eigentlichen Sozialdarwinisten. Darwin beschrieb die natürliche Zuchtwahl und das Überleben der am besten angepassten Individuen als natürliche Prozesse, als die Wirkungsweise der blinden Natur [17]; nirgendwo schlug er vor, die menschliche Gesellschaft solle ihre Angelegenheiten bewusst auf die gleiche Weise regeln. Die Sozialdarwinisten postulierten zwar tatsächlich das ‚survival of the fittest‘ als ein Prinzip, nach welchem die Gesellschaft eingerichtet sein sollte, aber ausschließlich auf der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ebene. Das Postulat der biologischen Auslöschung, Exterminierung von ‚schwachen‘ und ‚nutzlosen‘ Personen stammt von späteren, insbesondere von deutschen Verfassern wie Ernst Haeckel und vor allem Karl Binding und Alfred Hoche [18].
Mit diesem klaren Vorbehalt werde ich hier den Begriff ‚Sozialdarwinismus‘ abwechselnd mit dem Begriff ‚taygeteische Weltanschauung‘ verwenden, wobei der letztere einfach an geschichtliche Assoziationen anknüpft. Die Geschichte dieser Erscheinung zeichnete unlängst I. van der Sluis in seiner hervorragenden Skizze nach [19]; ich werde mich daher darauf beschränken, die gegenwärtigen Erscheinungsformen des Sozialdarwinismus und die von mir selbst beobachteten Tatsachen zu beschreiben:
Eine junge Ärztin widersetzte sich der Implantation eines Herzschrittmachers bei einem älteren Patienten mit Herzblock (‚kompletter Herzblock‘) und erklärte hierzu, dass sie grundsätzlich dagegen sei, bei Patienten nach dem 75. Lebensjahr Herzschrittmacher einzusetzen, da es ihrer Meinung nach nicht gestattet sei, der Gesellschaft die Last aufzubürden, alte Menschen am Leben zu erhalten.
Das Anästhesiologenteam einer Universitätsklinik beschloss, bei mongoloiden Kindern die Narkose zu verweigern und damit die operative Behandlung von angeborenen Herzfehlern unmöglich zu machen.
Der Küchenchef eines Krankenhauses litt unter einer Harnvergiftung (einer fortschreitender Niereninsuffizienz). Der Internist dieses Krankenhauses verweigerte die Durchführung der Nierendialyse und ließ es zu, dass der Kranke ohne Behandlung starb, mit der Begründung, er sei alleinstehend und habe keine näheren Angehörigen.
Bei der Überweisung eines Kranken mit Herzinfarkt und Lungenödem an mich ersuchte mich mein internistischer Kollege, diesen Menschen „nicht allzu energisch zu retten, da es sich um einen einsamen Witwer handelt“.
Ein Hausarzt überwies nacheinander zwei Patientinnen mit Lungenödem (Wasseransammlung in der Lunge aufgrund von Herzinsuffizienz; dabei handelt es sich um einen plötzlich auftretenden lebensbedrohlichen Zustand, der sich jedoch gewöhnlicherweise schnell beheben lässt) in unser Krankenhaus und verlangte in beiden Fällen telefonisch von uns, diesen – seiner Meinung nach – zu alten Frauen die Hilfe zu verweigern (im zweiten Fall sogar die Aufnahme in das Krankenhaus).
Ein anderer Hausarzt erklärte mir, dass er „als Hausarzt“ mit Nachdruck gegen die Implantation eines Herzschrittmachers bei einer seiner Patientinnen protestiere, da die Kranke bereits 86 Jahre alt sei. Die Kranke war schon einmal aufgrund eines Herzblocks bewusstlos geworden, hatte sich beim Fallen den Kopf am Küchenherd aufgeschlagen und wurde in einer Blutlache auf dem Boden liegend gefunden.
Um sich ein Bild davon zu machen, wie weit eine solche Einstellung verbreitet ist und wie häufig in den Niederlanden7 die Entscheidung gefällt wird, kranken Menschen die (medizinische) Hilfe zu verweigern, muss man die Beobachtungen eines einzelnen Spezialisten zigtausendfach multiplizieren.
In den hier beschriebenen Fällen wurde bestimmten Personenkreisen die lebensrettende Hilfe verweigert oder der Versuch einer Verweigerung unternommen: nämlich älteren Menschen; mongoloiden Kindern, die geringfügig ‚geistig behindert‘8 sind, vor allem aber wegen ihres andersartigen Aussehens auf Ablehnung stoßen; schließlich alleinstehenden Personen ohne nähere Angehörige.
Bevor ich den Versuch unternehme, dieses Handeln zu bewerten, wird es nützlich sein, sich die folgende Frage zu beantworten: Passen solche Handlungen zum ärztlichen Wirken, gehören sie zu den Aufgaben des Arztes?
Folgt man der allgemein angenommenen Definition des ärztlichen Berufes, ist dies nicht der Fall („learned calling concerned with the treatment and prevention of disease“ [20]; „akademischer Beruf, der mit der Behandlung und Prävention von Krankheit befasst ist“). Solche Handlungen wurden auch durch den Weltärztebund (World Medical Association, WMA) bewusst außerhalb der Definition der ärztlichen Wirkungssphäre belassen [21]. Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass wir es hierbei also nicht mit ärztlichem Wirken zu tun haben, sondern mit Handlungen, die durch die persönliche Weltanschauung des Arztes diktiert wurden. Der taygeteische Arzt kann uns zwar in eine Diskussion verwickeln und erklären, dass er die Beschlüsse des Weltärztebundes ablehne. Er kann auch behaupten, dass er mit der weiter oben zitierten Definition der Medizin nicht einverstanden sei und eine weiter gefasste Begriffsbestimmung anwende, welche nicht nur „die Behandlung und die Prävention von Krankheiten“ umfasse, sondern ebenso Entscheidungen und Handlungen, die darauf abzielten, einige Personengruppen aussterben zu lassen. Er kann jedoch nicht leugnen, dass eine solche Ausweitung der vom ärztlichen Beruf implizierten Aufgaben seiner eigenen Weltanschauung entspringt, und diese Feststellung genügt für meine weiteren Betrachtungen.
Die Einstellung der Sozialdarwinisten
Inhaltsverzeichnis
Das Begriffs- und Argumentationssystem, dessen sich die taygeteischen Ärzte zur Begründung ihrer Handlungsweisen bedienen, verschweigt seine wesentlich sozialdarwinistische Motivation, und ist daher seinem Charakter nach nicht authentisch. Dennoch will ich die dabei benutzten Argumente hier untersuchen.





























